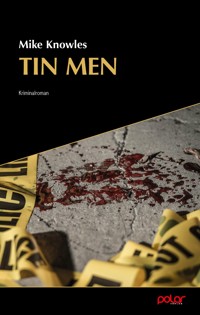
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Drei kriminelle Bullen jagen einen Mörder. Woody war gerade dabei high zu werden, als das Telefon klingelte. Dennis hatte ein Date - es war ein Date, für das er bezahlt hatte, aber dennoch ein Date. Os hatte Blut an den Händen von einer kleinen außerplanmäßigen Strafvollstreckung. Detective Julie Owen wurde brutal in ihrem eigenen Bett getötet und das ungeborene Kind, das sie trug, ist nirgends zu finden. Woody, Dennis und Os haben eine Verbindung zu Julie. Jeder auf seine Weise. Die jedoch tiefer ging als das Blau ihrer Uniformen. Jeder hat seine eigenen Gründe die Person zu finden, die für den Mord an Julie verantwortlich ist. Os, besser bekannt als der "Tin Man", der nur Schild und ohne Herz ist; sein Partner Charlie Woodward, besser bekannt als Woody, der mit seinen eigenen Verlusten fertig wird, indem er zwischen Heroin und Adderall hin und her springt und Dennis Hamlet, besser bekannt als ein Typ, der Fälle abschließt, auch wenn Woody und Os nichts mit ihm zu tun haben wollen, vielleicht weil er viel weniger klug ist als er meint. Ein denkwürdig kaltherziger Fall der reichlich Beweise für die düstere Behauptung liefert, dass "nicht jeder Polizist schmutzig ist, aber die Guten".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DARK PLACES
Mike Knowles
Tin Men
Aus dem kanadischen Englisch von Karen WitthuhnHerausgegeben von Jürgen Ruckh
Förderung durch Canadian Council of the Artsund Ontario Book Publisher Organization
Originaltitel: TIN MEN by Mike KnowlesCopyright: Mike Knowles, 2018
First published ECW Press Ltd, 2018
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2020
Aus dem kanadischen Englisch von Karen Witthuhn
Mit einem Nachwort von Marcus Müntefering
© 2020 Polar Verlag e. K., Stuttgart
www.polar-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Tobias Schumacher-Hernández, Nadine HelmsUmschlaggestaltung: Britta KuhlmannCoverfoto: © Nicholas/Adobe StockAutorenfoto: © Mike KnowlesSatz/Layout: Martina Stolzmann
ISBN 978-3-948392-14-7eISBN 978-3-948392-15-4
Für Andrea.Es könnte für niemand anderen sein.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Nicht jeder Cop ist dreckig, aber die guten schon
1
Os war auf dem Weg zu Sully’s Tavern, später als geplant, denn das Dreckstück im Kabuff hatte einfach nicht das Maul aufmachen wollen. Os hatte dem Typen gegenübergesessen und das Reden seinem Partner Woody überlassen. Wie immer hatte Woody den Kerl eingewickelt, hatte ihm verklickert, was sie bereits sicher wussten und was sie in ein, zwei Tagen würden beweisen können. Woody knackte fast jeden Fall; wenn er den Vernehmungsraum betrat, hatte er immer alle Trümpfe in der Hand. Meistens knickte der Verdächtige unter der Beweislast schnell ein, und alle konnten pünktlich Feierabend machen. Heute Abend war es anders gelaufen. Der kleine Wichser war auf frischer Tat ertappt worden. Woody hatte ihm die Aufnahmen der Kamera im Minimart auf der gegenüberliegenden Straßenseite gezeigt. Grobkörnige Bilder zwar, die aber erkennen ließen, wie er die alte Frau überfallen hatte, und Woody hatte sie ihm als Nägel zu seinem Sarg verkauft. Os hatte den Vergewaltiger beobachtet, der stocksteif dagesessen und die Wand hinter den beiden Cops angestiert hatte. Er hatte nicht nach einem Anwalt verlangt, und Woody hatte ihm in aller Deutlichkeit klargemacht, dass er nur durch ein Geständnis noch auf irgendeinen Deal hoffen konnte.
Aber der Typ war stumm geblieben, hatte zugehört und sie nicht angesehen. So war das über Stunden gegangen, dann hatte der Drecksack zum ersten Mal den Mund aufgemacht: »Anwalt.«
Os war gerade rechtzeitig wieder reingekommen, um dieses einzige Wort mitzuerleben. Die sechs Buchstaben fegten die sorgfältig eingefädelte Vernehmung vom Tisch wie eine Hand die Figuren eines Schachspiels zwei Züge vor Schachmatt. Woody hatte resigniert die Hände gehoben, gesagt »Wie du willst«, und war, die beiden Kaffeebecher in den Händen, an Os vorbei aus dem Raum gegangen. Er hatte nicht aufgegeben, er musste pinkeln. Im Laufe der Vernehmung hatte er mindestens sechs Tassen Kaffee runtergekippt und Nachschub verlangt, wann immer Os seinen Stuhl nach hinten geschoben hatte, um aufzustehen. Os sah seinem dürren Partner nach. Der Vergewaltiger starrte stur geradeaus.
»Du hättest reden sollen«, sagte Os.
Der Typ lächelte leicht.
Os spürte, wie sich seine Nackenhaare aufstellten. Am liebsten hätte er den Typen mit der Fresse zuerst in die Betonwand gedonnert, hart genug, um Zähne rauszuschlagen und Knochen zu brechen, aber das ging hier drin nicht. Im Nebenzimmer stand ein Monitor, auf dem andere Detectives das Verhör verfolgten. Os hatte mehr Stunden auf diesen kleinen Bildschirm gestarrt als auf seinen eigenen Fernseher zu Hause. Er kannte den Kamerawinkel und das ziemlich unscharfe Bild genau und hatte sich absichtlich den linken Stuhl ausgesucht. So saß er mit dem Rücken zur Kamera.
Die Kamera war nach Durchschnittsmaßen ausgerichtet. Os war mindestens einen Kopf größer und fünfzig Pfund schwerer als alles, was einem Durchschnittsmenschen ähnelte. Seine Übergröße bedeutete, dass die Kamera ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht wurde, wenn sich Os auf den linken Stuhl im Vernehmungsraum setzte. Os war eins achtundneunzig groß, und wenn er sein Jackett über die Stuhllehne legte, hing es auf dem Boden. Dadurch waren seine Füße nicht zu sehen. Woody hatte vor Jahren einen Witz über Os’ XXL-Jackett gerissen: Er würde darin aussehen wie Onkel Fester von der Addams Family. Ein paar Kollegen hatten gelacht, und ein neuer Spitzname war geboren. Der Name überlebte keine Woche, aber Os hatte nie vergessen, was die Kamera sah – und was nicht.
Er stellte die beiden Kaffeebecher in die Mitte des Tisches, zog sein Jackett aus und setzte sich. »Das Gespräch war ein bisschen einseitig.«
Der Vergewaltiger beäugte den Kaffee. Nachdem er mit angesehen hatte, wie sein anderer Vernehmer Tasse um Tasse schlürfte, hatte er jetzt natürlich Durst.
Os sah die Becher an, dann den Mann. Er zuckte die Achseln. »Nur zu.«
Der Vergewaltiger streckte die mit Handschellen gefesselten Arme aus und hob langsam den Plastikbecher an den Mund. Der Kaffee war besonders schlecht und besonders heiß, wie der Mistkerl zu Os’ großer Freude schnell herausfand. Beim ersten vorsichtigen Schluck verbrannte er sich die Zunge, zuckte zusammen und wollte den Becher wieder abstellen. Als er noch etwa drei Zentimeter über der Tischplatte schwebte, streckte Os das Bein aus und schob den Stuhl des Typen ein Stück nach hinten. Die Bewegung war schnell und behände und an Os’ Oberkörper nicht abzulesen. Der Vergewaltiger hatte seine Aufmerksamkeit auf den Kaffeebecher gerichtet und kapierte einen Sekundenbruchteil zu spät. Die abgerundete Tischkante bot weniger Halt als eine alleinerziehende Alkoholikerin, und schon landete der Becher im Schoß des Vergewaltigers.
Ein Schrei, dann kippte der Stuhl um, als der Mann aufsprang und an die Wand zurückwich, wobei er krampfhaft versuchte, sich den Stoff seiner Hose vom Körper zu ziehen. Os erhob sich ebenfalls und zog umständlich Papierservietten aus der Tasche. Er hatte oft genug Kaffee auf seinen Anzug verschüttet und immer einen dicken Packen der dünnen Dinger dabei. Da der jammernde Typ keine Anstalten machte, sie zu nehmen, drückte Os sie ihm gegen die Brust und hielt sie dort fest.
»Du musst besser aufpassen. Die Becher sind echt heiß«, sagte er gerade laut genug fürs Mikrofon.
Denn Os wusste nicht nur, was die Kamera im Vernehmungsraum sah, sondern auch, was das Mikrofon hörte. Über die Jahre hatte er herausgefunden, dass es im Kabuff eine tote Zone gab, in der nichts aufgezeichnet wurde, was unter normaler Gesprächslautstärke lag. Os drückte dem erstarrten Mann die Servietten an die Brust, ließ sie dann mit einer kaum wahrnehmbaren Bewegung los und bohrte ihm einen Daumen in den Brustkorb. Eine von inzwischen abgekühltem Kaffee noch feuchte Hand landete auf seiner und versuchte, den eingedrungenen Daumen wegzuziehen. Os wandte das Gesicht von der Kamera ab und sagte: »Hoff mal lieber auf einen miserablen Anwalt. Vergewaltiger leben draußen gefährlich. Da können einem schlimme Dinge passieren.« Dabei senkte er seinen schweren rechten Stiefel auf den leichten Nike-Trainer des Vergewaltigers herab und erhöhte den Druck, ohne dass mehr zu erkennen gewesen wäre als ein plötzliches Aufkeuchen, zu leise für das schlechte Mikrofon. »Und jetzt entschuldige dich dafür, dass du den Kaffee verschüttet hast.«
»T-tut mir leid.«
Os hob die Stimme, damit das Mikrofon ihn hörte. »Kann ja mal passieren.«
Er nahm den Fuß weg, gab dem Vergewaltiger einen Klaps auf den Rücken und wandte sich um, um sein Jackett von der Stuhllehne zu ziehen.
»Setz dich«, sagte Os. »Ich versuch dir jetzt mal einen Anwalt zu besorgen.«
Als er endlich Feierabend hatte, war es spät geworden. Er hatte gehofft, noch rechtzeitig zum Kampf im Sully’s zu sein. Dort war es nie sehr voll, und auf Os’ Bitte hin schaltete der Barmann immer bereitwillig auf ESPN2 Classic Boxing um. Heute lief Cassius Clay gegen Sonny Liston. Os mochte Liston. Vor seiner Profikarriere war der ehemalige Schwergewichtschampion Knochenbrecher für die Mafia gewesen. Harte Muskeln und ein schwarzes Herz. Und er kämpfte, als hätte er eine Riesenwut auf die Welt. Jeder Schlag sollte wehtun – sogar seine Führhand war aus Dynamit. Clay hatte ihn geschlagen, aber Liston hatte dafür gesorgt, dass er sich den Sieg schwer erkämpfen musste; als Clay aus dem Ring stieg, wusste er, was er hinter sich hatte.
Os schaute beim Fahren immer wieder nach allen Seiten. Nach Jahren im Streifenwagen und noch mehr Jahren bei der Armee reichte ihm der Blick geradeaus auf die Straße nicht. Er fuhr zu schnell und kam trotzdem nicht weiter, weil irgendein Arschloch bei der Stadt die Ampeln so geschaltet hatte, dass niemand mehr als zwei Grünphasen hintereinander schaffte. Er drehte das Lenkrad seines Jeeps hin und her und verfluchte die Uhr. 23:14. Wahrscheinlich war der Kampf schon zu Ende. Er würde gerade noch mitbekommen, wie Liston das Handtuch warf, und dann seinen Drink zu koreanischem Pingpong leeren müssen. Durch den Vergewaltiger und den verpassten Kampf waren Os’ Nerven angespannt, und als er einen Typen gegen eine Hauswand pissen sah, rissen sie.
Drei weitere Männer hingen auf der winzigen Rasenfläche vor dem Haus rum und warteten, bis der vierte sein nasses Geschäft verrichtet hatte. In seiner Zeit in Uniform hatte Os die Tür dieses Hauses nach Beschwerden über das darin hausende Pack zweimal eingetreten. Die Tür war immer noch zugenagelt, die vier Typen waren also schlau genug, den Hintereingang zu benutzen. Os parkte drei Häuser weiter und stieg aus.
Mit gesenktem Kopf ging er die Straße entlang. Er schlug den Kragen seines Wollmantels hoch und stopfte die Hände in die Taschen. Die Temperatur war heute nicht über minus fünf gestiegen, die Nacht schien den Nachmittag als Ansporn zu nehmen und das Thermometer noch mal um zehn Grad zu drücken, nur um auf dicke Hose zu machen. Os’ Klamotten verkündeten nicht Cop, ebenso wenig wie seine Hautfarbe. Die meisten würden einen Schwarzen nicht für einen Polizisten halten. Os war scheißegal, wofür die meisten ihn hielten. Oft nutzte er den allgemeinen Rassismus zu seinem Vorteil; Vorurteile halfen ihm, viel näher an die Arschlöcher ranzukommen. Wenn die zu blöd waren, ihn für einen Cop zu halten – ihr Pech.
Die vier unterbrachen ihr lautstarkes Gegröle erst, als Os den Gehweg verließ und den schneebedeckten Vorgarten betrat. Der bräunliche Schnee hatte nichts mit dem weißen Zeug auf einer Weihnachtskarte gemeinsam. Die Stadt schüttete Unmengen von Sand und Salz auf die Straßen, und die Schneepflüge schmissen den Brei auf die Grundstücke der Anwohner. Das Gras unter dem Schneematsch überlebte nur, wenn jemand wirklich viel Zeit und tonnenweise Wasser einsetzte. Os vermutete, dass keiner von diesen Junkies irgendwas zum Wachsen bringen konnte.
»Was willste?« Die Frage kam von einem Weißen, der sich auf der Haustreppe niedergelassen hatte. Ein anderer aus der Gruppe stand auf, ein schwarzer Typ mit dem Gesicht voller Narben und zwei Zahnlücken.
Os überlegte, was die vier genommen haben mochten. Meth war allerorten, aber wie die Medien berichteten, hatte sich in letzter Zeit auch Fentanyl verbreitet. Die Notfallärzte konnten sich schon mal für die Mischung aus beiden Drogen bereit machen. Dirty hieß das. Os musterte die vier verdreckten Junkies und fragte sich, ob sie auf Ironie standen. In den vier Augenpaaren, die ihn anstarrten, war kein Fentanyl zu erkennen. Jeder der Männer hatte irgendeinen Tick, ein wippendes Knie oder schnelles Blinzeln, was nicht für ein Opiat sprach – es waren Methheads.
Os verteilte im Kopf Nummern. Der Laberer war Nummer eins, der, der aufgestanden war, seine Nummer zwei. Der dritte Typ und der Pinkelnde waren Mitläufer, die er ignorieren konnte. Alles hing von Nummer eins und zwei ab.
Os hielt seine Dienstmarke hoch. »Aufstehen.«
»Ein Scheißbulle? Scheiße, wir ham nichts gemacht. Was willst du von uns, ey? Das is’ Scheißprofiling, Mann«, sagte der Weiße.
Das gefiel Os – als schwarzer Cop für Profiling beschimpft zu werden. »Aufstehen«, wiederholte er. Er öffnete seinen Mantel, damit die vier seine Waffe sahen und kapierten, dass er es ernst meinte. Die anderen beiden, ein kleiner Latino und der Pisser, ein blasses Pummelchen, kamen jetzt auf die Verandatreppe zu. Nummer eins blieb auf seinem Arsch sitzen. Da Os nicht im Vorgarten aktiv werden wollte, hielt er ihm eine Karotte hin.
»Hände an die Seitenwand. Los jetzt.«
Os beobachtete, wie der drogenverranzte Verstand von Nummer eins diese Information verarbeitete. Es dauerte ein bisschen, bis er kapiert hatte – vier gegen einen, von der Straße nicht sichtbar. Sein Lächeln entblößte die wenigen verbliebenen braunen Zahnstummel. Was sich anscheinend nie jemand klarmachte: Wenn Meth etwas so Hartes wie einen Zahn kleinkriegte, hatten die Organe im Körper keine Chance.
»Okay, Officer«, sagte Nummer eins. »Machen wir.«
Nummer zwei lächelte und folgte Nummer eins um die Hausecke. Die anderen beiden Junkies schwangen hinterher wie ein wackelnder Arsch. Os beäugte die vor ihm trabende Meute. Meute war das passende Wort. Die Typen sahen aus wie dürre, klapprige Hunde – Kojoten. Hunde sind Aasfresser und jagen im Rudel. Sie isolieren ein schwächeres Opfer und reißen es nieder, aber immer gibt es ein Alphatier, das die Beute auswählt. Dass die vier Männer sich so spät am Abend draußen rumtrieben, bedeutete, dass sie nichts mehr zu rauchen hatten – die Meute brauchte Futter.
Jäger machen sich meistens nichts aus Kojoten – sie sind auf größeres Wild aus –, aber da entgeht ihnen was. Ein paar Wildhunde in die Ecke getrieben, das gibt einen echten Kampf. Danach interessiert einen kein Hirsch mehr.
Der schmale Durchgang neben dem Haus war auf der einen Seite von der Ziegelsteinwand, auf der anderen von einem Holzzaun begrenzt, der zum Nachbarhaus gehörte. Os konnte Nummer eins nicht sehen, als der rief: »Sollen wir die Hände hochheben, Officer?«
Os fühlte das Adrenalin losrauschen. »An die Hauswand.«
Und dann kam es.
»Zwing uns doch.«
Nummer drei und vier waren die Mitläufer, loyal, aber auch high auf etwas, das irgendein Küchenchemiker gemischt hatte. Sie brauchten eine Weile, um die Bedeutung der Worte ihrer Alphas zu verarbeiten und zu kapieren, dass das Wörtchen »uns« bedeutete, dass sie diejenigen waren, die sich als Erste bewegen sollten.
Os wartete nicht, bis die elektrischen Impulse in den Matschbirnen von Nummer drei und vier übergesprungen waren. Bevor der kleine Latino sich auch nur gerührt hatte, trat Os ihm das Rückgrat ein. Der Latino war höchstens eins fünfundsechzig und spindeldürr. Os wählte sein Ziel so, dass der kleine Mann nicht bloß von seinem Fuß abprallte, sondern der Rücken sich durchbog, und dann gab es irgendwo in seinem Inneren ein lautes »Plopp«, und der Latino fiel gegen seinen Kumpel, der daraufhin das Gleichgewicht verlor und schwankte. Os trat über den Latino hinweg und schlug dem Pisser dreimal hart auf den Hinterkopf. Er krachte mit dem Gesicht gegen die Hauswand und klappte zusammen.
Nummer eins und zwei verzogen sich in den Hinterhof. Sie hatten mehr Verstand als die anderen beiden; als Os um die Ecke kam, hatten sie bereits die Hände oben.
»Komm doch, Bulle.« Aus dem Narbengesicht klangen die Worte noch hässlicher. Nummer eins und zwei rückten ein Stück auseinander, damit Os in zwei Richtungen gleichzeitig kämpfen musste.
»Für die Marke und die Knarre gibt’s ’ne Menge Kohle«, sagte Nummer eins. »’Ne Menge.«
Os blieb an der Hausecke stehen, sodass der Seitendurchgang hinter ihm lag. Die Junkies rechneten mit ihm auf dem offenen Hinterhof, einen Plan B hatten sie nicht. Als sie kapierten, dass er nicht tat, was sie wollten, versuchten sie, ihn mit Beschimpfungen wie »Pussy« und »Feigling« aus der Deckung zu locken, aber Os rührte sich nicht vom Fleck. Er öffnete nur seinen Mantel und zeigte ihnen die Dienstmarke. Schließlich wurde Nummer zwei gierig, ließ den Plan fallen und sprang mit einem hohen Kick auf Os zu. Damit hatte er nicht gerechnet. Für einen Junkie war Nummer zwei ganz schön fix, und der Kick zielte darauf ab, Os seitlich am Kopf zu treffen. Der Methhead ließ dabei sogar ein »Hijah« hören.
Os’ Reflexe waren besser als gut, außerdem hatte er den Vorteil, dass sein Hirn nicht von Meth vernebelt war. Er bewegte sich vorwärts und flirtete zunächst mit dem Kick, um dann plötzlich die Richtung zu ändern und sich so tief zu bücken, dass der Angriff ins Leere lief. Os ließ den Tritt seinen Zenit erreichen und änderte wieder die Richtung. Der Sekundenbruchteil zwischen Höhepunkt und Rückzug reichte ihm. Explosionsartig schoss er aus der gebückten Haltung nach oben und stieß mit beiden Händen hammerartig gegen das dürre Bein, das immer noch auf Augenhöhe in der Luft hing. Nummer zwei wurde von seinem Fuß gerissen, und an der Art, wie er sein Bein festhielt, als er rücklings auf dem Boden lag, wusste Os, dass irgendwas darin gerissen war. Nummer eins holte jetzt ein Teppichmesser aus der Tasche und schob mit dem Daumen die Klinge hoch. Os hätte seine Glock ziehen können, aber er war nicht auf eine Verhaftung aus, und eine Schießerei wäre zu laut gewesen. Der Junkie kam auf ihn zu und säbelte mit großen Messerschwüngen die Luft klein. Das sollte geschickt und gefährlich wirken, sah aber bloß schludrig aus.
Dann setzte Nummer eins einen vertikalen Schwung von unten an, mit dem Ziel, Os die Messerspitze in den Bauch zu rammen und hochzureißen bis zum Hals. Os warf sich diagonal dagegen und wich der Klinge um wenige Zentimeter aus. Nummer eins hatte viel Kraft in den Angriff gelegt, und als er sein Ziel verfehlte, stolperte er nach vorne, Opfer seines eigenen Schwungs, auf einen Ellbogen zu, der direkt vor seiner Nase hing. Os erreichte mit einer Hüftbewegung maximale Drehkraft, und Nummer eins fiel um wie vom Blitz getroffen. Die harte Schneedecke brach unter seinem Gewicht und hüllte ihn ein. Im Dämmerlicht der wenigen Straßenlaternen hinter dem Haus sah Os, dass das Gesicht des Junkies ziemlich platt war.
Os hob einen Fuß und versank dabei mit dem anderen tiefer im Schnee. Die dicke Gummisohle seines Stiefels hing wie eine dichte schwarze Regenwolke über dem Gesicht des Junkies. Er wollte gerade zutreten, als sein Handy klingelte. Erst wollte er den Anruf ignorieren, aber das war nicht sein Stil – die Pflicht rief. Os setzte den Fuß wieder im Schnee ab und fischte sein Handy aus der Tasche.
»Yeah?«
»Os, ich brauch dich hier an der 110 Ferguson Avenue South«, sagte Jerry Morgan, Detective Sergeant der Mordkommission von Division 1.
Die Adresse klang vage vertraut. »Was ist los, Jerry? Ich hab gerade Feierabend gemacht.«
Jerry seufzte, und Os sah vor sich, wie der rundliche Sergeant in seinem Schreibtisch nach seinem schier unerschöpflichen Süßigkeitenvorrat kramte.
»Wir haben einen Polizistenmord. Sie war nicht im Dienst. Es ist bei ihr zu Hause passiert. Sie war auf Bandenkriminalität angesetzt. Julie Owen. Kennst du sie?«
»Nein«, sagte Os.
»Sieht schlimm aus, Os. Ich brauch dich da.«
Der Wunsch, dem Methhead die Fresse einzutreten, verschwand wie eine Münze in der Hand eines Zauberers.
Os stieg über den schlapp daliegenden Junkie hinweg und ging zur Straße. »Ich bin in zehn Minuten da.«
2
»Findest du mich fett, Jennifer?«
Das Stöhnen vor der Antwort fiel zu kurz aus, um als genussvoll durchgehen zu können. »Baby, ich heiße Jenny. Hab ich dir doch gesagt.«
Einen Moment lang vergaß Dennis seinen Bauch und lachte etwas zu laut für den Raum. »Du bist alles andere als eine brave Jenny.«
Jennifer holte scharf Luft und zog den Kopf zurück. Ihre Lippen waren gekräuselt, als hätte sie einen sehr schlechten Geschmack im Mund. »Niemand nennt mich Jennifer.«
Dennis grinste. »Ich schon.«
Jennifer erkannte die Gemeinheit in dem Grinsen und wusste, dass eine Diskussion sinnlos war. »Du klingst wie mein Vater.« Das Gemeine wurde fast boshaft.
»Echt?«
Jennifer lächelte, während sie sich langsam vorbeugte. Wenn sie etwas konnte, dann den Moment nutzen. »Ja – Daddy.«
Dennis seufzte auf, als sich Jennifer wieder daran machte, ihren Fünfziger zu verdienen. Sie war gut, und alles war auf einem guten Weg gewesen, bis Dennis zufällig sein Spiegelbild in der Balkontür erblickt hatte. Er konnte sich nicht davon abhalten, wieder hinzugucken.
»Im Ernst, findest du mich fett?«
Jennifer stand seufzend auf und ging zum Sofa. »Willst du jetzt lieber einen Personal Trainer oder machen wir hier weiter? Weil, für beides haben wir keine Zeit.«
Dennis ignorierte die Frage und strich mit den Fingern über seinen Bauch. Er beobachtete die Geste im Fenster. Das Spiegelbild bestätigte, was seine Hände ihm sagten – er war fett. Er hob seinen Bauch an und musterte jeden einzelnen der dunkelrosa Schwangerschaftsstreifen, die sich über die blasse Haut zogen. Sie waren sogar in der drei Meter entfernten Scheibe noch zu erkennen.
»Ich bin fett«, sagte Dennis, mehr zu sich selbst als zu Jennifer.
»Du bist nicht fett, Baby. Du siehst männlich aus. Wie ein Mann, der hart arbeitet. Ich kann deine Muskeln sehen, das macht mich ganz heiß.«
Dennis löste den Blick von seinem Spiegelbild und wandte sich Jennifer zu. Sie hatte die Knie unter sich gezogen. Der von der Sonne ausgeblichene Sofabezug war einst ein farbenfrohes Muster aus verschiedenen Vögeln auf beigem Hintergrund gewesen. Das kleine Schwarze, straff gestreckt und eine von Jennifers Schultern entblößend, hob sich von den ausgeblichenen Vögeln ab. Jennifers High Heels lagen umgekippt auf dem Boden.
Dennis schüttelte den Kopf und nickte mit dem Kopf in Richtung der von dem hochgerutschten Kleid entblößten Haut. »Du lügst. Ich bin zu fett für dich.«
Jennifer rutschte auf den Fußboden hinunter und krauchte langsam auf Dennis zu, wie eine Katze auf der Jagd.
»Du bist nicht fett, du bist mächtig. Und das macht mich heiß. Das kann man nicht sehen – das spürt man. Ich zeige es dir.«
Dennis vergaß die Fensterscheibe. Er vergaß alles außer Jennifers Mund, bis sein Handy zu klingeln begann, das auf dem Couchtisch lag und durch die Vibration langsam über die Glasplatte rutschte. Dennis versuchte, sich auf das Schnurrgeräusch zu konzentrieren, das Jennifer von sich gab, aber das Telefon war stärker – das Telefon war immer stärker. Er schob Jennifer weg und ging zum Couchtisch. Dabei erhaschte er in dem Spiegel neben der Wohnungstür einen Blick auf seinen Kopf und die Schultern und dachte einen Moment lang, Jennifer könnte recht haben – er sah eigentlich ganz mächtig aus. Er wischte über das Display des Smartphones und trat dichter an den Spiegel heran. Als er die Schwangerschaftsstreifen aus der Nähe sah, wandte er sich ab.
»Hamlet.«
»Dennis, Jerry hier. Ich brauch dich an der 110 Ferguson Avenue South.«
»Jerry, heute ist mein freier Tag. Ich weiß, dass der Tag praktisch um ist, aber auch die Nacht gehört mir. Komm schon, Mann, ich hab ein Mädchen da.«
Jennifer warf sich das Haar über die Schultern und ihm einen Luftkuss zu.
»Eine von uns hat’s erwischt. Julie Owen, Detective bei der GANG-Einheit. Mir egal, ob heute Weihnachten ist, du bist dran.«
»Bin sofort da.«
Dennis drückte den Anruf weg, ging zum Sofa und hob seine Unterhose auf.
»Verschwinde«, sagte er.
»Aber wir hatten doch gerade Spaß, Daddy.«
Dennis zog seine Hose an und kramte drei Zwanziger aus der Tasche. »Nimm das und geh, Benjamin.«
Jennifer stand auf und zog das Kleid zurecht. »Wer –«
»Ich kenn deine Akte – wo du gewesen bist, was du gemacht hast. Ich weiß, wie dein Vater dich genannt hat, Benjamin.«
Dennis wedelte mit den Geldscheinen, bis Jennifer sie ihm aus der Hand zog. Kaum war die Transaktion vollbracht, packte er Jennifer am Arm und schob sie zur Haustür. »Warte, meine Schuhe.«
Er stellte Jennifer an der Haustür ab. »Bleib hier«, sagte er, ging zurück ins Wohnzimmer, sammelte die High Heels vom Teppich auf und warf einen Schuh nach dem anderen in Richtung Tür. Jennifer schützte ihren Kopf mit den Händen und ließ die Schuhe gegen die Wand prallen.
»Du fängst schlechter als ein Mädchen«, sagte Dennis.
»Dafür mache ich eine Menge anderer Dinge besser als die meisten Mädchen. Leider wirst du das heute nicht rausfinden. Vielleicht morgen?«
Dennis öffnete die Tür und schob Jennifer nach draußen. Er wollte die Tür wieder schließen, hielt jedoch inne, als sie noch einen Spalt offen stand. »Vielleicht morgen«, sagte er.
»Wir haben ein Date, Daddy.«
Dennis schloss die Tür und machte sich fertig.
3
»Wo ist das verdammte Pizzastück?«
Woody bekam keine Antwort, er redete mit sich selbst. Eine schlechte Angewohnheit, die sich im letzten Jahr festgesetzt hatte wie Hautausschlag. Woody kramte durch Stapel alter Pizzaschachteln, als wären es Akten, er suchte nach den Resten der Pizza von gestern. Die Schachteln sahen alle gleich aus, und Woody versuchte, sich zu erinnern, welche Seite der Küchentheke der Anfang und welche das Ende war. Da lagen um die vierzig Schachteln, und er hatte das dumpfe Gefühl, am falschen Ende angefangen zu haben. Er stand neben dem Kühlschrank. Obwohl er gerade eine Zwölf-Stunden-Schicht und drei Bier hinter sich hatte, funktionierte seine Coplogik noch.
»Die Schachteln am Kühlschrank müssten die älteren sein, weil, da würde ich stehen und essen, wenn die Küche leer wäre. Ich würde zum Essen was trinken wollen und die Schachtel abstellen, um mir ein Bier zu holen.«
Um seine Hypothese zu überprüfen, hob Woody den Deckel der untersten Schachtel neben dem Kühlschrank an und fasste hinein. Er fand kein Pizzastück, dafür etwas, das er erst mal vom Boden der Schachtel abpulen musste. Er stieß den Fingernagel hinein, dann zog er die Hand aus der Schachtel und hielt sie sich vors Gesicht. Um Licht zu haben, musste er sich umdrehen. Die 40-Watt-Funzel, mit der er die alte Birne in der Küche ersetzt hatte, war zu schwach. Aber er hatte keine andere im Haus gehabt, und um Ersatz hatte er sich nie gekümmert. Das Dämmerlicht enthüllte, dass es sich bei dem gefundenen Klumpen ehemals um eine grüne Olive gehandelt hatte. Obendrauf spross Schimmel, aber der verschrumpelte Teil, der an der Pappschachtel festgeklebt hatte, war noch immer grünlich.
Woody nickte und umrundete die Kücheninsel, deren Granitoberfläche mit Werbewurfsendungen und alten Essensschachteln vom Chinesen übersät war. Die Kücheninsel endete am Mülleimer. Woody konnte den Abfall selbst bei geschlossenem Deckel riechen und versuchte, sich zu erinnern, wann er zuletzt den Müll rausgebracht hatte. Kein gutes Zeichen, dass er nicht wusste, an welchem Tag die Müllabfuhr kam. Das Grummeln in seinem Magen ließ ihn den Müll vergessen; er hielt direkt auf die oberste Schachtel des letzten Stapels zu und förderte ein Pizzastück von gestern mit Schinken und Ananas zutage.
»Elementar, mein lieber Watson«, sagte er laut.
Die Pizza war kalt und ziemlich fade, die Ananas aber noch ein bisschen feucht. Woody hatte sich nie was aus Ananas gemacht – das war ihr Lieblingsbelag gewesen. Woody war sicher, dass sie Ananas nur bestellt hatte, damit er ihre Pizzahälfte nicht aß. Aber ein Jahr täglichen Pizzakonsums hatte Woodys Geschmack verändert. Nach sechs Monaten war ihm schon bei dem Gedanken an Peperoni und Salami, seiner Standardbestellung, übel geworden. Also musste er entweder etwas anderes bestellen oder kochen lernen. Woody hatte begonnen, sich andere Beilagen auszusuchen, und festgestellt, dass er Pizza weiterhin essen konnte. Ananas vermied er noch ein paar Monate, aber irgendwann war er eingeknickt und hatte das Obst bestellt. Eine Zeit lang aß er wegen der Ananas dann weniger. Er starrte so lange die Pizza an, bis er weinen musste. Aber eines Abends hatte er nur noch die Ananashälfte im Haus gehabt und sie schließlich gegessen. Es war nicht so schlimm gewesen wie erwartet. Fast hatte er das Gefühl, sie wäre noch da. Die Frucht passte nicht zur Pizza, aber der Gedanke, dass sie durch die Tür kommen könnte, um ihre Hälfte zu essen, machte die Pizza genießbar.
Woody stopfte sich die letzten beiden Stücke in den Mund und kaute gerade ausreichend, um sie runterschlucken zu können. Was noch in der Kehle steckte, rutschte mit einem Schluck aus dem vierten Bier runter. Eigentlich hatte Woody keinen Appetit, sein Heißhunger galt etwas anderem. Die kalte Pizza und das Bier waren nur das Vorspiel. Er fand noch eine übrig gebliebene Kruste in der Schachtel. Die Kruste war schneller gealtert als der Rest, Woody musste kleine Stücke abbrechen und sie im Mund aufweichen, bevor er den harten Teig runterwürgen konnte. Während er an dem letzten Stück nagte, starrte er die Schublade an. Er wollte eigentlich überhaupt keine Pizza.
»Scheiß drauf«, sagte er laut.
Er warf die Kruste in Richtung Spülbecken und hörte sie gegen ein Glas klirren, das ganz oben auf dem dreckigen Geschirrstapel stand. Das Abwaschen hatte er schon vor Monaten aufgegeben, irgendwann waren ihm saubere Teller, Gläser, Besteck und Schüsseln ausgegangen. Was nicht aus einer Schachtel gegessen oder einer Flasche getrunken werden konnte, wurde in seinem Haus einfach nicht mehr verzehrt. Woody zog die Schublade auf und griff hinein. Sie war fast leer. Die Messer und Kochutensilien, die einst darin gelegen hatten, waren jetzt im Spülbecken oder unter den Müllhaufen auf der Arbeitsfläche begraben. Übrig geblieben waren nur noch ein Flaschenöffner und eine kleine Schminktasche, die ihr gehört hatte. Als Woody die Tasche zum ersten Mal in die Hand nahm, hatte sie nach ihrem Parfüm geduftet. Stundenlang hatte er daran gerochen, bis sie nur noch nach seinem schalen Atem stank. Auch jetzt verströmte sie einen furchtbaren Geruch, der ihm aber den Puls in die Höhe trieb. Es war ihm peinlich, dass der Gestank ihn mehr erregte als früher ihr Duft. Er nahm die Tasche, hielt kurz inne und zählte im Kopf nach, wann er sie zuletzt in der Hand gehabt hatte – erst vor zwei Tagen. Einen Moment lang überlegte er, sie wieder wegzulegen. Aber er war in letzter Zeit kränklich gewesen und so müde. Er arbeitete zu viel und bekam nicht genug Schlaf, war erschöpft und nervös und brauchte dringend Entspannung. Das war alles. Er griff schneller wieder zu der Tasche, als ihm lieb war und am Wochenende hatte er frei und konnte Schlaf nachholen. Mit ein bisschen Schlaf wäre bald alles wieder normal. Woody überwand seine Gewissensbisse und nahm die Tasche mit ins Wohnzimmer.
Der Fußboden war mit alten Zeitungen und noch älteren Pizzaschachteln übersät. Jedes Sofa und jeder Sessel waren von ordentlich aufgestellten Ringen leerer Flaschen umzäunt, um den La-Z-Boy-Sessel herum gleich dreireihig, hier saß er am liebsten. Woody legte die Tasche auf den Tisch neben dem Sessel und setzte sich vorsichtig hinein, um keine der Flaschen umzustoßen. Das abgenutzte braune Leder ächzte, als er sich in die Kissen lehnte. Er ließ seine Knöchel knacken und zog den Reißverschluss der Schminktasche auf. Sie enthielt eine Glaspfeife, ein Feuerzeug und einen kleinen Ball aus Alufolie. Woody zog die Folie auseinander und betrachtete die auf der zerknitterten Oberfläche liegenden Reste. Nur noch drei kleine Heroin-Rocks – weniger, als er gedacht hatte.
»Billigscheiße hält nie lange«, sagte er. Was immer Joanne ihm dieses Mal verkauft hatte, musste mit irgendwas verschnitten worden sein. Augen auf beim Drogenkauf. Egal, für heute Nacht würde es reichen. Er würde schlafen können und dann eine Weile nichts mehr brauchen. Es sei denn, die Erkältung verschlimmerte sich. Dann würde er ein bisschen Medizin brauchen, aber wahrscheinlich würde es dazu nicht kommen. Woody wurde kaum jemals ernsthaft krank.
Er hielt das Feuerzeug unter die Folie. Die Flamme erweckte das Heroin zum Leben, es zischte wie eine beschworene Schlange. Die Rocks verwandelten sich von fest zu Rauch, der sich wie eine Kobra in die Luft erhob, bevor Woody ihn mit der Pfeife in seine Lungen sog. Dort hielt er ihn, bis sein Kopf leicht wurde, dann blies er ihn aus. Den nächsten, rasch folgenden Zug hielt er noch länger. Beim Ausatmen hustete er. Nach dem dritten Zug sah er Sterne. Es dauerte kaum eine Minute, dann war alles in der Folie weggeatmet. Woody nutzte die geschwärzte Folie als Untersetzer für die Pfeife und das Feuerzeug. Mit den freien Händen suchte er auf beiden Seiten seines Hinterteils nach der Fernbedienung für die Stereoanlage, fand sie unter der rechten Arschbacke und drückte zu. Sekunden später erklangen die Anfangstöne von »Gimme Shelter« aus den Lautsprechern. Woody zog am Hebel des La-Z-Boys und lehnte sich so weit wie möglich zurück. Er war nicht high, bloß entspannt und gedankenverloren. Sein Hirn war im Leerlauf, er dachte an nichts.
So trieb er, bis ein neuer Klang im Lied, ein atonales Quietschen, ihn aus seinem Schweben im Nichts riss. Irgendwann verarbeitete sein Hirn den Ton und ordnete ihn seinem Handy zu. Woody stand auf, schlurfte in die Küche, nahm seine Jacke von dem Poststapel auf der Kücheninsel und kramte sein Telefon heraus.
»Yeah?«
»Scheiße, was ist los, Woody? Ich wollte gerade auflegen.«
»Nur die Gegenwart zählt, Jerry.«
»Witzig. Ich brauche dich an der 110 Ferguson Avenue South.«
»Ich komm gerade vom Dienst, Jerry. Jetzt ist wer anders dran. Ruf den an.«
»Würde ich gerne, aber ich hab hier einen toten Cop und bestelle dich ein.«
»Wer?«
»Julie Owen. Sie war bei der GANG-Einheit. Echt schlimme Horrorscheiße, Woody. Ich brauch dich.«
»Hast du Os angerufen?«
»Ja, er ist auf dem Weg.«
»Ich bin in zehn Minuten da.«
Als Woody auflegte, sang Mick Jagger gerade »Love in Vain«. Woody ging langsam ins Badezimmer im ersten Stock. Während das Waschbecken sich mit kaltem Wasser füllte, starrte er in den Spiegel. Er sah müde aus. Bestimmt wurde er doch richtig krank. Als das Waschbecken voll war, tauchte er sein Gesicht in das kalte Wasser. So blieb er, bis der Schock nachließ. Als er den Kopf rauszog, stellte er fest, dass er überall Wasser verteilt hatte. Er griff zu dem Händehandtuch, das er nie wusch, und trocknete sich Gesicht und Haare ab. Er ließ das Wasser ablaufen, der Rest konnte von allein trocknen. Als er seine Jacke anzog und zur Tür hinausging, fühlte er sich wach und munter.
4
Es gab keine einzige Parklücke – jeder Zentimeter der Ferguson Avenue in Sichtweite des Gebäudes war mit Einsatz- und Zivilwagen zugeparkt.
Os stellte sich auf einen Behindertenparkplatz hinter dem Gebäude und stieg aus seinem Jeep. Er trat ein paar Schritte zurück und betrachtete die heruntergekommene Fassade – das Haus war alt, niemand schien auch nur ansatzweise für seine Instandhaltung zu sorgen. Er ging um die Ecke und traf am Eingang auf die erste blaue Welle: Uniformierte Cops schwirrten dort herum, ein paar schienen sich halbherzig um das Absperren des Hauses zu kümmern, die meisten standen rum und quatschten. Noch waren keine Reporter vor Ort, und die meisten Menschen nahmen beim Anblick einer Massenansammlung von Cops Reißaus. Das Absperren war eher Formsache.
Os fiel auf, dass das Blumenbeet vor dem Haus an mehreren Stellen zertrampelt war. Sofort war er sauer, dass das Beet nicht gesichert worden war, damit die Kriminaltechniker Fotos machen konnten. Er wollte sich gerade einen der herumstehenden Uniformierten schnappen, als etwas seine Aufmerksamkeit erregte. Er stellte sich auf die betonierte Blumenbeetbegrenzung, und sein Blick folgte den heruntergetrampelten Pflanzen bis zu einer Kotzelache. Die Lache bestand aus weitgehend unverdautem Essen, und wie Os sah, hatte der, der da gekotzt hatte, vor nicht allzu langer Zeit eine Pizza verspeist. Eineinhalb Meter weiter war noch eine Lache, älter als die erste und vornehmlich aus Schaum und Gallenflüssigkeit bestehend. Ernüchtert entdeckte Os ein Stück weiter noch eine dritte Pfütze. Das Blumenbeet war kein Beweismittel, hier war kein Täter durchgerannt. Die Ersteinsatzkräfte hatten nach der Begutachtung des Tatorts ihr Abendessen erbrochen. Os starrte die drei Lachen an und fragte sich, was drei Cops dazu gebracht haben konnte. Cops hatten stärkere Mägen als die meisten Möwen. Os hatte Tote gesehen und war dann Chickenwings essen gegangen. Er hatte Burger verspeist, nachdem er verkohlte Leichen aus einem Autowrack gezogen hatte. Der Job hatte ihm noch nie den Appetit verdorben. Dafür hatte die Armee gesorgt, dort hatte er monatelang nichts essen können, bis er gegen jede erdenkliche Art menschlicher Grausamkeit abgehärtet war. Os hatte oft erlebt, dass sich Anfänger beim Anblick einer frischen Leiche die Seele aus dem Leib kotzten, aber so heftig hatte er noch nie drei Cops auf einen Tatort reagieren sehen. Er wandte sich ab und drängte sich durch den Copschwarm zum Eingang durch. Dabei fing er die Blicke von mehreren der herumstehenden Uniformierten auf, die schnell den Kopf senkten und den Boden anstarrten. Die Stimmen waren gedämpft – noch ein schlechtes Omen. Polizisten waren die Meister der schlechten Witze. Os konnte sich bei jedem Cop, dem er je begegnet war, an einen Witz erinnern. Meistens kamen sie nicht von ihm, manchmal schon. Schweigende Cops waren nicht gut.
Keiner der Uniformierten hielt Os auf, als er Julies Wohnhaus betrat. Die Tür wurde mit einem Keil offen gehalten, damit nicht jeder klingeln musste. In der Lobby standen Detectives in Zivilkleidung. Es war seltsam, wie sich die Polizei an einem Tatort immer in hierarchischen Grüppchen zusammenfand. Höherrangige sammelten sich im Gebäude an, die Uniformierten hielten sich draußen auf dem Gehweg auf. Viele der Gesichter waren Os bekannt. Als er Paul Daniels erblickte, hielt er inne.
»Paul«, sagte er.
Paul hob den Blick vom Fußboden und nickte Os zu.
»Bist du gerade gekommen?«, fragte Paul.
»Der Anruf kam vor zehn Minuten. Und du?«
»Hab’s auf Funk gehört und bin hergefahren, als es hieß, es sei eine von uns.«
»Julie«, sagte Os. Bei ihrem Namen brach ihm leicht die Stimme. Um es zu verbergen, räusperte er sich.
»Ja«, sagte Paul. »Julie.« Er sprach es ohne ein Räuspern aus. »Sieht schlimm aus da oben, Os. Echt schlimm. Da willst du nicht hoch.«
»Jerry hat mich herbestellt. Wo ist er?«
»Oben.«
»Dann bleibt mir wohl keine Wahl«, sagte Os.
Paul zuckte die Achseln, und Os drängte sich durch die dicht an dicht stehenden Männer zum Aufzug durch. Es roch nach Schweiß und Rasierwasser. Die Menge brach so plötzlich ab, als stünden die Detectives am Rande einer Klippe. Niemand wollte in der Nähe der Aufzüge stehen. Os trat in die Lücke und drückte den Knopf nach oben. Er spürte die Blicke der anderen Cops im Rücken, wandte sich aber nicht um. Er dachte an Julie und das, was ihn oben erwartete. Die Fahrstuhltür ging auf, Os trat ein und drückte die Neun.
Der Aufzug war schnell. Ein altes Modell, Komfort hatte keine Rolle gespielt. Os spürte die Geschwindigkeit im Magen, während er durch den Schacht nach oben sauste, und als der Aufzug im neunten Stock abrupt stoppte, knickten ihm kurz die Knie weg. Die Türen gingen auf, und Os erblickte die oberen Sprossen der Hierarchieleiter: Im Flur standen ein Inspector, zwei Superintendents und der Deputy Chief. Alle vier sahen ihn an, als würden sie eine Erklärung erwarten, was er hier oben unter Männern zu suchen hatte, die weitaus mehr verdienten als er.
»Jerry McLean hat mich herbestellt«, sagte Os und stieg aus.
Der Deputy Chief, ein blasser Mann Ende fünfzig mit Hasenzähnen und Ohren, die wie Satellitenschüsseln vom Kopf abstanden, nickte und sagte: »Jerry.« Er sprach so leise, dass Os ihn kaum hörte. Normalerweise wimmelte es an einem Tatort von Cops, die überall herumliefen und ermittelten, aber hier im neunten Stockwerk von 110 Ferguson Avenue South sprach der Deputy Chief gerade so laut, dass Jerry wie ein bei Fuß gerufener Hund aus der Tür kam.
Jerry sah Os, machte eine jähe Kopfbewegung in die Richtung, aus der er gerade gekommen war, und ging wieder in die Wohnung. Os folgte ihm, die vier Männer beobachteten jeden seiner Schritte, als müssten sie Punkte vergeben. Os nahm die Blicke kaum wahr, er hatte nur Augen für die Tür.
Vom Flur aus sah er rechts das Wohnzimmer und geradeaus die Küche. Das Wohnzimmer war genauso ordentlich, wie Os es in Erinnerung hatte. Auf jeder glatten Oberfläche stand irgendein Dekoartikel: Duftkerzen, Blumenvasen und Bilderrahmen, alle sorgfältig arrangiert. Die Blumen in den Vasen waren unecht, und die Bilder sahen aus, als hätte man sie aus einem uralten Fotoalbum befreit. Os ging geradeaus und war nach zwei Schritten in der Küche. Der Boden war sauber und das Spülbecken fleckenlos. Julie hatte die Angewohnheit, alle Stahloberflächen so abzuwischen, dass sie wie neu aussahen. Hinter der Küche lag das Esszimmer. Den Raum zwischen Küche und Wohnzimmer als Esszimmer zu bezeichnen, wäre vermessen gewesen, er bot kaum genug Platz für den Tisch und den Stuhl, die dort standen. Os drängte sich am Tisch vorbei ins Wohnzimmer und sah, dass Jerry auf ihn gewartet hatte und sich jetzt umdrehte, um durch den kurzen Flur ins Schlafzimmer zu gehen. Er bekam nicht mit, wie langsam Jerry sich bewegte, bis er fast in ihn hineinrannte. Der dicke Detective Sergeant holte tief Luft und betrat das letzte Zimmer. Os holte ebenfalls Luft und folgte ihm. Er sah das Bett, war eine Sekunde später wieder im Flur und stürmte zum Badezimmer.





























