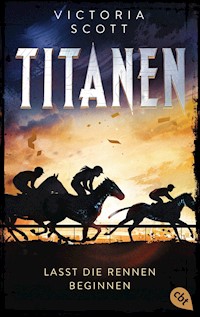
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein Mädchen riskiert auf der Rennbahn alles, um ihre Familie vor dem Ruin zu retten
Seitdem die »Titanen« in Astrid Sullivans Nachbarschaft aufgetaucht sind, dreht sich ihr gesamtes Leben um die faszinierenden Rennpferde aus Stahl. Astrid verbringt Stunden damit, den Jockeys und ihren Pferden beim Training zuzuschauen, obwohl ihr Vater das gesamte Geld der Familie beim Wetten verspielt hat. Als Astrid die Gelegenheit erhält, selbst einen Titanen zu reiten, greift sie daher sofort zu. Denn ein Sieg würde alle, die sie liebt, vor dem finanziellen Ruin bewahren. Doch nicht jeder überlebt die Rennen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
VICTORIA SCOTT
LASST DIE RENNEN BEGINNEN
Aus dem Englischen von Michaela Link
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2022 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2016 by Victoria Scott. All rights reserved.
Published by arrangement withSCHOLASTICINC., 557 Broadway, New York,NY10012USA
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Titans« bei Scholastic Press, an imprint of Scholastic Inc., New York
Aus dem Englischen von Michaela Link
Covergestaltung und Artwork: © Isabelle Hirtz, Inkcraft unter Verwendung mehrerer Bilder von
© Shutterstock (NiklsN / Tithi Luadthong /Aliyev Alexei Sergeevich)
sh · Herstellung:MC
ISBN978-3-641-19960-9V002
www.cbj-verlag.de
Für meine Tochter –
Was du dir in dieser großen blauen Welt auch vornimmst, deine Mama setzt auf Sieg.
Ich liebe dich.
TITANENDERBY AUF DER ZYKLONENBAHN
Endergebnisse der vergangenen Saison
Bahnbezeichnung: Erdbeben
Streckenlänge: 6,5 km
Pferdetyp: Titan 3.0
Treibstoff: Diesel
Strecke: Erde
Titan
Jockey
Trainer
Sponsor
Zeit/ Rang
Der Mann
M. Franklin
O. Richey
Richey Enterprises
10,50
1/4
Fuzzy
Constellation
A. Gaston
C. Norman
B&B Öl
und Benzin
11,03
2/4
Herr der Gezeiten
S. Barrins
B. Lovato
Gestüt Stanley
13,60
3/4
Sylvester
H. Wells
V. Pletcher
Ned und Carol Wells
----
4/4
TEIL 1
ZERBRECHLICHE DINGE
Kapitel 1
Heute Nacht ist das Titanenrennen.
Von meinem hart erkämpften Zaunplatz aus sehe ich ihre rot glühenden Augen. Erwachsene Männer, denen das Bier aus den Gläsern schwappt, rempeln mich von beiden Seiten an und brüllen durcheinander, um in letzter Minute noch Wetten zu platzieren. Der Mond steht tief am Himmel, hervorgelockt von gebrummten Flüchen, Faustkämpfen und Zigaretten, die zwischen schmutzigen Fingerspitzen klemmen.
Meine Eltern wissen nicht, dass ich hier bin. Eine Stunde vor Mitternacht, eine Stunde vor Beginn des Rennens, bin ich heimlich mit Magnolia aus meinem Fenster gestiegen. Letztes Jahr habe ich mir das Rennen der Maschinen auf einem lokalen Sportsender angesehen – einem der wenigen Sender, die meine Familie sich leisten konnte. Die Gambini-Brüder hätten begeistert sein sollen. Erst ein Jahr dabei, und schon hatten sie überall in Detroit Kameramänner und einen festen Platz in den Wohnzimmern.
Doch diesmal werde ich nicht an meine Mutter gekuschelt zusehen, während sie mit meinem Haar spielt. Ich atme den durchdringenden Geruch von Schweiß und Urin ein und dränge mich näher an den Zaun. Magnolia steht neben mir, den Blick auf die Rennbahn gerichtet. Sie nimmt meine Hand und drückt sie fest. Ich erwidere den Druck und schaue angestrengt zu den Titanen in den Startboxen hinüber.
Die Stahlpferde stampfen auf die trockene Erde und werfen die Köpfe hoch. Ich erkenne die bunten Trikots der Jockeys, deren Finger nervös über die Bedienfelder ihrer Titanen gleiten. Im Internet habe ich gelesen, dass sie per Hand Anweisungen an die Kontrollzentren der Pferde schicken, Geschwindigkeiten einstellen, den Muskelanteil ausrechnen und bestimmen, wie weit sie ihre Pferde in den roten Bereich bringen werden.
Die Pferde sind eine Mischung aus Tieren und Rennwagen. Das ist der Grund, warum ich mich mit beidem beschäftigt habe. In den Vororten von Detroit kann man nicht viel machen, vor allem dann nicht, wenn man in einem Vorort wohnt, der mehr einem Slum gleicht. Die Pferde sind etwa zu der Zeit in den Wald an unserem Haus gebracht worden, als die Arbeitsbedingungen in der Fabrik meines Vaters schlechter wurden und meine Eltern sich zu streiten begannen. Ein glitzerndes Versprechen auf Hoffnung in Form von Eisenbolzen und glattem Stahl.
Die Startampel über der Bahn geht an und wirft einen roten Schein auf den Boden. Wenn die Titanen dieses spezielle Kirschrot sehen, ist es mit ihrer sonst so liebenswerten Art schlagartig vorbei. Sie mögen zwar keinen echten Geist haben, keine echten Gedanken, aber wie jeder andere Computer besitzen sie das Potenzial zur Wiedererkennung und Reaktion. Die Jockeys schieben die Füße in die Steigbügel, beugen sich auf den schwarzen Ledersitzen vor und packen die Griffe, während die Pferde kurz vorm Durchdrehen stehen.
Ich beobachte das alles durch die Gitterstäbe der Startmaschine.
Dann wechselt die Startampel die Farbe.
Sie blinkt gelb – an und aus, an und aus.
Gelb.
Die Menge drängt nach vorn, Leiber drücken sich von hinten gegen mich, bis mir die Nase durch den Maschendrahtzaun gestoßen wird.
Gelb.
Mir schlägt das Herz bis zum Hals. Magnolia umklammert meine Hand fester.
Gelb.
Schließlich verstummen die Zuschauer. Die Abwesenheit von Geräuschen ist verstörend. Es ist das Lauteste, was ich je gehört habe – all diese schnell atmenden Männer, die mit aufgerissenen Augen ihre Wettscheine gepackt halten.
Grün!
Die Boxen fliegen auf. Ein Schuss fällt.
Und die Titanen rennen los.
Sie rennen, und der Boden unter meinen Füßen bebt. Dampfwölkchen steigen aus ihren Nüstern auf, ihre Augen ziehen eine rote Lichtspur und ihre Leiber prallen gegeneinander, Stahl auf Stahl. Als die Titanen vorbeidonnern, gleitet ein Lächeln über meine Züge. Sie zu beobachten ist so, als küsse man einen rasenden Zug, als tanze man mit einem Hurrikan. Die Pferde sind Furcht einflößend und schön zugleich. Sie sind vernunftlose Wesen, aber wenn sie im Stadionlicht wie Geister über die Bahn jagen, sind sie herrlich.
An dem Tag, an dem ich das erste Rennen der Titanen erlebe, bin ich dreizehn Jahre alt.
Und sehe, wie ein erwachsener Mann stirbt.
Kapitel 2
Vier Jahre später
Es ist der erste Montag des Sommers. Keine Ms Finchella mit Kreidefingern und Geschichtsaufsätzen. Keine Styroporschalen mit panierten Steakstreifen und fragwürdiger Soße. Und definitiv kein Sportkurs, in dem die Schüler nach Volleyballknieschonern getrennt werden: strahlend weiß für diejenigen, die aus einer reichen Familie kommen, und schmutzig grau für jene, die sich ein Paar gebrauchte vom Stapel nehmen.
Wer braucht all das, wenn es endlich Sommer ist? Wenn der Himmel über unserem Viertel von einem so dunklen Blau ist, dass man es durch einen Strohhalm schlürfen könnte. Ich vergrabe die Hände in den Taschen, lege den Kopf in den Nacken und öffne den Mund, als würde ein Teil dieses Blaus wie eine Schneeflocke herabschweben. Den Blick nach oben gerichtet, zähle ich die flauschigen Wolken, sortiere sie nach Form und Größe in Kategorien, sehe mathematische Berechnungen über ihre weißen Bäuche tanzen.
Natürlich sehe ich überall Zahlen – im Laub der Bäume, im Wuchs des Grases, selbst in den Linien, die meine Handflächen durchziehen.
Meine Füße tragen mich zwischen zwei holzverkleideten Häusern hindurch, während mein Gehirn weiter Muster sortiert, bis ein lautes Klopfen mich ablenkt. Es ist Magnolia, die an ihrem Fenster steht und winkt. Als sie es öffnet, dringt Musik in die warme Luft hinaus, als wäre sie erleichtert, aus ihrem Zimmer zu entkommen.
»Was willst du, Astrid?«, fragt sie grinsend.
»Nichts«, antworte ich. »Falsches Haus, falsches Fenster.«
Sie lacht. »Trotzdem ist heute dein Glückstag, denn ich bin für ein kleines Abenteuer zu haben.« Sie steigt aus dem Fenster und bleibt mit ihren knubbeligen Knien am Rahmen hängen. Meine beste Freundin trägt schwarze Shorts und ein schwarzes Tanktop. Sie hat sogar schwarze Sandalen an. Man sollte meinen, sie wäre allergisch gegen Farbe, aber weit gefehlt.
»Gefällt dir mein neues Accessoire?«, fragt sie, als sie sich aufrichtet.
Ich bewundere das orangefarbene Band in ihrem langen blonden Haar. Ein orangefarbener Schleier hängt davon herab und scheint nur auf einen Windstoß zu warten, damit er nach vorn wehen und ihr herzförmiges Gesicht bedecken kann. Jetzt ergibt das Schwarz einen Sinn. Magnolia findet, die Leute sollten sich passend zu ihren Accessoires kleiden, nicht andersherum. Und Magnolia trägt Accessoires am liebsten auf dem Kopf.
»Ich habe es heute Morgen gemacht.« Sie schiebt das Band zurück. »Ich muss unten noch eine Reihe Pailletten annähen.«
»Nein, keine Pailletten.«
»Nicht?«
»Nein.«
Sie verzieht das Gesicht. »Was weißt du schon?«
Ich lächele. »Gar nichts. Es macht mir nur Spaß, dich zu provozieren.«
Magnolias weiße Zähne blitzen hinter rotem Lippenstift auf. Die Farbe beißt sich mit dem orangefarbenen Haarband, aber das werde ich ihr nicht sagen. Das Einzige, was Magnolia lieber mag als ihren selbst gemachten Kopfschmuck, ist ihr roter Revlon-Lippenstift Nr. 22. »Was hast du vor?«
Ich zucke die Achseln. »Einen Spaziergang machen?«
»Ja?« Sie geht bereits zur Straße und nimmt denselben Weg, den wir schon zahllose Male gegangen sind. »Meinst du, so früh sind schon welche draußen?«
»Kann sein.«
Wir brauchen den Ort nicht beim Namen zu nennen. Er ist der Grund, warum wir einen so großen Teil des Sommers im Wald hinter dem Candlewick Park verbringen – um bei Tageslicht einen Blick auf sie zu erhaschen, obwohl die meisten erst nach Einbruch der Nacht auftauchen. Allein der Gedanke an die Titanen, die auf der Zyklonenbahn laufen, lässt mein Herz schneller klopfen.
»Wie ist das Vorstellungsgespräch deines Dads gelaufen?«, fragt Magnolia.
Ich winde mich bei dieser Frage. Unsere Väter haben vor zwei Monaten ihre Jobs im Kraftwerk verloren. »Strategische Restrukturierung« nannte die Zeitung die Entlassungen, was meinen Vater nur umso wütender gemacht hat. In Wirklichkeit hat die Firma die Menschen durch in Taiwan hergestellte Maschinen ersetzt. Das weiß ich, weil Dad in den Wochen nach seiner »Restrukturierung« durchs Haus gelaufen ist und nach allem gesucht hat, was aus Taiwan stammt. Zwei Stofftiere meiner kleinen Schwester, unsere Mikrowelle und eine der Lieblingsschaufeln meiner Mutter waren unter den Schuldigen. Er hat sie alle weggeworfen, bis auf die Mikrowelle. »Es ist heute«, teile ich ihr mit.
»Oh, ich dachte, es wäre letzten Freitag gewesen.«
Ich verlasse den Gehweg und trete auf trockenes Laub. »Der Termin ist verschoben worden.«
Magnolia nickt, als hätte sie damit gerechnet. »Dad meint, er wird sich vielleicht auch da bewerben, wenn deinem Dad die Stelle und der Affe gefallen, der das Gespräch mit ihm führt.«
»Dann wäre es sinnlos, es vorher zu tun«, antworte ich. Aber wir wissen beide, dass Magnolias Dad sich wahrscheinlich längst beworben hat. Die beiden alten Freunde haben jeden Betrieb und jede Fabrik in Detroit abgeklappert. Magnolias Dad hat sogar einen Kurs in der Bibliothek besucht, wie man einen Lebenslauf verfasst. Man hätte meinen können, er hätte einen neuen Planeten entdeckt, als er von diesem Stück Papier schwärmte.
Es hat ihm nichts gebracht.
Magnolia muss den abwesenden Ausdruck auf meinem Gesicht bemerkt haben, denn sie reibt mir den Rücken. Ich ziehe einen Mundwinkel hoch und erwidere den Gefallen. Es ist unser Ritual, unser Wir-werden-es-durchstehen-Tanz. Irgendwie ist es schön zu wissen, dass ich nicht allein in dieser Situation bin, dass wir beide auf eine Implosion bei uns zu Hause warten. Aber es ist auch doppelt so beängstigend, denn es gibt da etwas ganz Bestimmtes, was Fabrikarbeiter aus Detroit tun, wenn sie ihre Möglichkeiten ausgeschöpft haben.
Mein Magen krampft sich zusammen, als ich mir vorstelle, wie meine Familie ihre Sachen packt, um in eine andere Stadt, ein anderes Haus zu ziehen. Das stehe ich nicht noch mal durch. Die Nächte in schmuddeligen Motels oder, schlimmer noch, die Tage, die wir uns im Auto zusammenkauern, während Dad woanders nach Jobs sucht, werde ich nicht überleben.
Als wir das letzte Mal unser Haus verloren haben, ist meine Familie fast daran zerbrochen. Aber diesmal wäre es noch schlimmer, weil es bedeuten würde, Magnolia zu verlassen. Natürlich könnte auch sie die Erste sein, die geht.
Meine Gedanken wirbeln durcheinander, während ich von einer möglichen Lösung zur anderen springe. Das tue ich jeden Tag, seit Dad arbeitslos geworden ist: Ich denke über Wege nach, wie ich meiner Familie helfen könnte. Klar, mein Dad braucht einen neuen Job. Aber im Moment brauchen wir einfach nur Geld. Genug Geld, dass wir, wenn er wieder die Arbeit verliert, keine Worst-Case-Szenarien durchspielen müssen. Wenn ich einen Job mit Mindestlohn bekäme, könnte das helfen, aber als Mom das letzte Mal von einer Bewerbung in einem Bastelladen nach Hause gekommen ist, hat Dad geschrien, dass es eine Frage des Respekts sei und die Verantwortung des Mannes, seine Familie zu ernähren. Meine Schwestern und ich haben die Ader an seinem Hals pochen sehen und uns am Tisch ganz klein gemacht.
Kapitel 3
Es muss fast Mittag sein, als wir den ganzen Stolz der Gambini-Brüder erreichen. Junge Mädchen und Frauen sind bei den Mitternachtsrennen nicht die Norm, aber tagsüber verscheucht uns niemand. Also lungern wir am Waldrand herum, ein gutes Stück vom Maschendrahtzaun entfernt, und halten Ausschau nach Lebenszeichen. Es ist mitten in der Saison, und Jockeys, Manager und Sponsoren pendeln zwischen den Ställen und der Rennbahn hin und her. Aber es ist immer noch Zeit, bevor es richtig losgeht, und die meisten Jockeys trainieren lieber auf den privaten Bahnen der Leute, die sie bezahlen.
Magnolia setzt sich auf den Boden und zieht ein Kartenspiel hervor. Ich setze mich neben sie, und sie mischt geschickt und verteilt die Karten, fünf für jede. Sie wirft einen Blick zu der leeren Rennbahn und sagt: »Lass uns mit Lowball anfangen, Ass ist die niedrigste Karte.«
Low-Poker schlägt sie meinetwegen vor, denn ich erwische ständig ein Scheiß-Blatt. Das macht aber nichts, Magnolia wird mich eh schlagen. Ihr Vater hat ihr Poker beigebracht, aber inzwischen spielt sie viel besser als er. Zugegeben, das will nicht viel heißen. Magnolias Dad hat beim Kartenspiel den Familienwagen schon öfter verloren und zurückgekauft, als ich zählen kann. Wenn man den Mann fragt, geht es immer bergauf. Aber sagt das mal seinen Kindern, die von den Dollars leben, die heimlich in der Hutschachtel seiner Frau versteckt wurden und immer weniger werden.
Obwohl Magnolia ihren Vater für das, was er ihnen angetan hat, verachtet, spielt sie selbst gern.
Spielen liegt manchen vermutlich einfach im Blut. Ich muss es schließlich wissen. Es war die Sucht meines Großvaters, die uns beim ersten Mal das Zuhause gekostet hat. Das einstöckige Haus im Ranchstil mit den grünen Fensterläden sollte an meinen Vater und uns vererbt werden. Das war der ausdrückliche Wunsch meiner Großmutter. Aber sie starb still und leise eines Nachts, als ich noch sehr jung war, und mein Großvater war kein leiser Mann.
Er verspielte alles, was er auf dem Konto hatte, und dann jedes hart verdiente Bündel Bargeld, das wir in seinem Haus versteckt hatten. Schließlich verspielte er auch noch die Hypothek auf das Haus, und wir standen auf der Straße.
Die Schwäche meines Großvaters für Kartenspiele war schlimmer als eine Sucht. Sie war wild und entzog sich seiner Kontrolle.
Die Sucht meines Vaters ist von einer sanfteren Art. Nachdem sie aufkeimte, wuchs sie langsam, aber stetig. Auch er mochte Karten, und deshalb mochte er Magnolias alten Herrn. Aber es waren die Titanenrennen, die uns das letzte Sicherheitsnetz kosteten, das wir hatten.
Magnolia und ich spielen etwa eine Stunde, während unsere Blicke immer wieder zu der leeren Bahn hinüberhuschen. Schließlich, nachdem meine beste Freundin mich Blatt für Blatt verhöhnt hat, höre ich jemanden kommen.
Der Mann trägt eine orangefarbene Jagdweste über einem karierten Hemd. Behaarte Unterarme ragen aus hochgekrempelten Ärmeln heraus, und er hat das Gesicht zu einer Dauer-Grimasse verzogen, als hätte er sich in seinem ganzen Leben noch nie vor Lachen den Bauch gehalten. Spärliches weißes Haar, eine hohe, dünne Gestalt und Augenbrauen, die so buschig sind, dass sie Respekt gebieten – das ist dieser Mann. Er sieht blass aus. Er scheint auch wegen irgendetwas wütend zu sein, ist aber trotzdem blass. Ich bemerke Schweiß, der ihm übers Gesicht rinnt, und überlege, ihm zu sagen, dass er die Jagdweste ausziehen soll. Es ist schließlich Sommer, Herrgott noch mal.
Der alte Mann kann sich kaum aufrecht halten, und seine Atmung geht schnell. Magnolia bemerkt ihn und seinen Zustand und flüstert, dass wir meine Mom holen gehen sollten. Aber ich habe ein Motto, an das ich mich seit meinem elften Lebensjahr halte, und zwar so fest, wie es eben geht.
Bemühe nie andere mit Dingen, die du selbst tun kannst.
Ich kann diesem Mann genauso gut helfen wie Mom. Also stehe ich auf und gehe auf ihn zu. »Hey, ist alles okay?«
Er brummt etwas.
»Wollen Sie sich zu uns setzen?«, frage ich und fasse ihn sanft am Ellbogen.
Der Mann sieht mich an. Seine Grimasse ist noch grimassenhafter als vorher. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. »Es geht mir gut.«
»Hm. Sie sehen aber nicht gut aus«, meint Magnolia, als sie neben uns tritt.
Er entzieht mir den Arm, gerät dabei ins Stolpern und wäre fast gefallen.
»Sie sind jetzt schon nass geschwitzt, alter Mann«, sage ich. »Wollen Sie auch noch den Mund voll Erde haben?«
Der Mann fletscht sein widerliches Gebiss in meine Richtung. Nicht, dass ich mir sicher bin, dass er ein Gebiss trägt, aber wahrscheinlich ist es schon. »Ich brauche eure Hilfe nicht. Lasst mich in Ruhe.«
»Wenn jemand sagt, dass er keine Hilfe braucht, dann braucht er meistens – na?«
Er funkelt mich an.
Ich packe ihn mit festem Griff am Arm und sehe Magnolia an. »Nimm den anderen Arm. Wir setzen ihn hin.«
Magnolia reckt das Kinn vor. »Ähm …«
»Tu es einfach, Mag«, blaffe ich.
Der Mann stößt eine Reihe von Flüchen aus, die so entzückend sind, dass meine kleine Schwester vor Freude jubeln würde. Wir drücken ihn trotzdem neben unseren Karten zu Boden, denn er leistet kaum Widerstand. Nachdem er sich ins Laub gesetzt hat, verfällt er in finsteres Schweigen.
»Da Sie nicht mehr sprechen, werden wir noch eine Weile hierbleiben müssen, um sicherzugehen, dass Sie nicht ins Gras beißen.« Ich setze mich ein Stück von ihm entfernt auf den Boden, und Magnolia lässt sich mir gegenüber hinplumpsen und sieht mich an, als wolle sie sagen: Können wir nicht einfach von hier verschwinden?
»Ziehen Sie wenigstens diese Jagdweste aus«, fordere ich ihn auf.
Sein Kiefer spannt sich an.
»Ziehen Sie sie aus.«
Er brummt.
»Und hier sind sie, Leute«, ruft Magnolia. »Die zwei größten Sturköpfe, die das Warren County jemals beehrt haben.« Sie lacht nervös, während der Mann und ich uns ein nettes Blickduell liefern.
Schließlich entspannt Magnolia sich genug oder langweilt sich vielleicht ausreichend, um das Thema zu wechseln. »Habt ihr schon Zeugnisse bekommen? Hast du schon deine Noten?«
»Ja, sie haben sie am Sonntag gepostet.«
Magnolia grinst. »Und, wie hat das Mathegenie abgeschnitten?«
Ich kann nicht verhindern, dass ein Lächeln meine Mundwinkel in die Höhe zieht. »Ganz gut.«
»Pffft. Du hast bei Slanders Abschlussklausur bestimmt hundert Punkte bekommen.«
Ich antworte nicht.
»Unmöglich.« Magnolia reißt die Augen auf. »Du hast beim Test von diesem Schleimbolzen hundert Punkte gekriegt? Heißt das nicht, dass er nächstes Jahr deinen Namen in die Abschlussprüfung schreiben wird?«
Mein Lachen verrät mich, und Magnolia schüttelt den Kopf. »Denk nur an all die Schüler, die in Zukunft deinen Namen verfluchen werden, wenn sie sich durch … durch …«
»Gleichheitsaxiome quälen?«, schlage ich vor.
Sie rümpft die Nase. »Ekelhaft. Sprich in meiner Gegenwart nicht von solch abscheulichen Dingen. Ich bin eine Dame.«
Während der nächsten Minuten zeichne ich für Magnolia meine neuesten Theorien darüber ins Gras, mit welchen Bahnlängen und Hindernissen diese Titanensaison aufwarten wird. Ich wünschte, ich hätte Kreide dabei. Und ein leeres Blatt Papier. Und die Teile, die mein Dad früher von der Arbeit mit nach Hause gebracht hat. Als ich merke, dass Magnolia mir nicht mehr zuhört, stehe ich auf und werfe dem Alten einen vielsagenden Blick zu.
»Wir werden jetzt gehen, es sei denn, Sie brauchen uns noch.«
»Wegen mir hättet ihr überhaupt nicht bleiben brauchen«, knurrt er.
»Manieren«, witzle ich.
Aber dann drehen Magnolia und ich den Kopf zur Zyklonenbahn und halten den Atem an. Magnolia sagt nichts. Ich auch nicht. Wir haben beide Angst, dass uns beim kleinsten Laut die Möglichkeit entwischt. Wir haben gehofft, einen Blick auf einen aufstrebenden Jockey zu erhaschen, der sich das Gelände ansieht, oder vielleicht einen der Gambini-Brüder zu erspähen.
Aber das hier ist besser als alles, was wir zu hoffen gewagt hatten.
Kapitel 4
Dort in der Ferne blitzt Stahl in der Sonne auf und Hufschlag ertönt, als ein Pferd zur Bahn geführt wird. Magnolia und ich springen hastig auf, Doppel-Asse vergessen, überlassen den Alten sich selbst.
Das Pferd nähert sich den Startboxen und wirft den Kopf hoch. Ich spähe angestrengt durch die Schatten der Bäume und sehe den Reiter. Zwar kenne ich ihn nicht, aber das ist natürlich keine Überraschung, da Jockeys immer nur einmal an den Rennen teilnehmen dürfen. Das gilt auch für die Titanen. Sobald die Seriennummer eines Titanen in einen Vorlauf eingetragen wurde, darf er nach dieser Saison nie wieder ein Rennen laufen. Das begrenzt die Anzahl und die Art der Menschen, die in Titanen investieren. Es sorgt auch dafür, dass es immer neue Kunden gibt.
Der aufstrebende Jockey trägt Blau, weder Zahl noch Nachname oder Slogan auf dem Rücken. Dann ist er also ein Free Agent, wie so viele im Moment. Ohne einen Sponsor ist er vielleicht nicht in der Lage, die fünfzigtausend Dollar Startgeld aufzubringen. Verdammt, sein Titan könnte womöglich nur geborgt sein.
Langsam verwandeln sich die Augen des Titanen von schwarzen Kugeln in ein rot loderndes Sonnensystem – ein sicheres Zeichen dafür, dass der Rennmotor des Pferdes aufgewärmt und funktionsbereit ist. Der Jockey führt sein Pferd auf die Bahn und macht sich nicht die Mühe, die Startbox zu betreten. Er dreht die beiden joystickartigen Hebel zu beiden Seiten des Bedienfeldes, um das Geschöpf auszurichten.
»Denkst du, er arbeitet an der Startgeschwindigkeit?«, flüstert Magnolia.
Ich nicke, obwohl er in dem Fall in die Startbox gehen sollte. Dann hebe ich eine Hand an die Stirn und sehe mir den Mann genauer an. Er ist schlank und größer als die meisten Jockeys, die ich hier gesehen habe, außerdem trägt er eine Sonnenbrille und ein Taschentuch vor dem Mund.
Wo ist sein Helm?
Der Jockey gibt noch ein paar Befehle ein, und der Titan versteift sich, der Hals starr, die Beine wie angewurzelt.
Dann folgt ein leises Heulen, das immer mehr anschwillt und zeigt, dass das Pferd gleich losgelassen wird. Es klingt wie ein Flugzeug, das eine Startbahn entlangrollt und Fahrt aufnimmt. Aber das Pferd hat sich keinen Zentimeter bewegt. Magnolia sieht mich an und ich sie. Wir lächeln. Das hier ist unser Ort. Ist es immer gewesen. Egal, wie schwierig das Leben wird, und trotz des Geldes, das mein Vater hier verloren hat – diese Liebe verbindet uns.
Das Geräusch wird lauter.
Und lauter.
Der Mann lehnt sich zurück, aber er sollte es besser wissen. Man muss sich vorbeugen. Seine Schultern straffen sich, und er stößt den Atem aus. Ich kann beinahe sehen, wie der Sauerstoff seinen Körper verlässt. Und dann schlägt er auf den glitzernden schwarzen Knopf, und sein Titan erwacht brüllend zum Leben.
Er rennt los und beschleunigt, bis ich das Gefühl habe, vor Aufregung zu platzen. Der Jockey lehnt sich noch weiter zurück und streckt die Beine in den schwarzen Ledersteigbügeln durch. Er hält sich mit der linken Hand am Haltegriff fest und führt die rechte über das Bedienfeld, um das Pferd in den nächsthöheren Gang zu schalten. Doch das ist ein Fehler. Er hätte es früher tun müssen. Die erste Kurve nähert sich schnell, und der enge Radius bedeutet, dass er das Tempo bald drosseln muss. Zwei Sekunden früher wäre am besten gewesen, besser zweieinhalb. Sein Armaturenbrett hat eine Stoppuhr. Warum benutzt er sie nicht?
Und tatsächlich, die erste Kurve kommt, und er verlangsamt seinen Titanen, begreift, dass er die Gerade hätte nutzen sollen. Aber hey, dafür ist das Training ja da. Als er seinen Titanen zum Startpunkt umwendet, lasse ich den Blick über die Bahn gleiten. Die Gambini-Brüder haben sie vor sechs Jahren gebaut, und im folgenden Jahr fand das erste Rennen statt. Mein Dad sagt, der ältere Bruder sei besessen vom Motorsportverband NASCAR, von Pferderennen und von allem, was mit Geschwindigkeit zu tun hat. Aber es war Arvin, der jüngere Bruder, der sich die Titanen ausgedacht hat. Dieses Wiesel ist derjenige, der die Fäden zieht, sagt Dad.
Die Gambini-Brüder haben nur eine lebende Verwandte, ihre Großmutter. Und diese Großmutter hat Taschen, die tiefer sind als die Tiefen der Hölle. Als die Brüder den Titanenparcours ins Leben riefen, ging es ihnen nicht ums Geld, sondern um Aufmerksamkeit. Als die Kameras liefen und die ersten Interviews erschienen, verwandelte sich Arvin in einen Mann, den die Leute beneideten. Schließlich sind viele Menschen wohlhabend. Aber nicht jeder ist berühmt.
Arvin und sein älterer Bruder mögen das Geld zwar nicht brauchen, aber an Renntagen scheffeln sie es ohne Ende. Männer kommen von weit her und stapfen mit schweren Arbeitsschuhen durch den Wald, um Wetten auf ihre Lieblingstitanen abzuschließen. Und die Mehrheit, die innerhalb weniger Minuten alles verliert? Nun, diese Knete fließt auf das Konto der Gambinis. Und dann ist da noch das Startgeld.
Diese fünfzigtausend Dollar, um ein Pferd für das Rennen anzumelden.
Gehen direkt an die Gambinis.
Und die zweihundertfünfzigtausend Dollar, die man braucht, um einen Titanen zu kaufen?
Ein Teil davon geht ebenfalls an die Gambinis, die Aktien von Hanover Steel Incorporated besitzen, der Firma, die sie herstellt.
Natürlich ist es nicht so, als hätten die Brüder keine Ausgaben. Da sind Rennbahn-Designer zu bezahlen, die Buchmacher und die Ingenieure, die immer neue Bahnen bauen, während die Sommerwochen voranschreiten und die Rennen anspruchsvoller werden. Und gefährlicher. Ich habe auch Reklametafeln gesehen und im Radio Ankündigungen für den Titanenparcours gehört. Dafür müssen die Brüder auch bezahlen.
Und dann ist da ihr Gefolge: ein Dutzend Angestellte, die den Brüdern mit frisch gebügelten Anzügen, Make-up und Frisiercreme hinterherdackeln, falls sie ein Interview geben müssen. Diese Menschen lachen über die Witze ihrer Bosse und lächeln nur, wenn Arvin und sein Bruder gut gelaunt sind.
Manchmal frage ich mich, wie es mit der echten Rennbahn in Detroit aussieht, die angeblich kurz vor dem Bankrott steht. Der Niedergang begann, bevor die Gambini-Brüder auf der Bildfläche erschienen sind. Nach der Rezession haben selbst die Reichen ein Auge aufs Geld gehabt und sind nicht mehr hingegangen. Natürlich haben sie sich anschließend gelangweilt. So sehr gelangweilt, dass sie die neue, sichere Investition in eine Technik ins Auge fassten, wie die Gambini-Brüder sie anpriesen und die den gleichen Spaß wie ein Rennen versprach.
Pferde, die wie Rennwagen funktionierten.
Es würde ihre Portfolios streuen, sagten die Brüder. Und wer weiß mehr über Motoren und Getriebe als die Bewohner von Detroit?
Sie stimmten zu und schüttelten sich die Hände. Und kurz darauf wurde den mittleren und unteren Klassen eine neue Chance geboten. Lasst die Champagnerangebote und kalten Stadionsitze zurück, wo ihr nie wirklich hingehören werdet, und kommt auf die Party im Wald. Einen Ort, wo ein Mann ein Bier trinken kann, das er von zu Hause mitgebracht hat. Einen Ort, wo er rauchen und fluchen und seine Freunde mit einer Zehn-Dollar-Wette beeindrucken kann, die er in bar bezahlt hat.
Einen Ort, an dem er sich wohlfühlen kann.
Wo er ein König sein kann.
Am ersten Abend rückte die Polizei mit gezückten Handschellen an der Bahn der Gambini-Brüder an. Aber die Beamten kamen aus der Arbeiterschicht. Nachdem Arvin ihnen die Hände geschüttelt und den Polizeichef des Warren Countys gebeten hatte, den ersten Schuss für das Eröffnungsrennen abzufeuern, um dann noch eine üppige Spende zuzusagen, wurden die Behördenvertreter nur noch selten gesehen. Wenn überhaupt, so sah man sie in den meisten Fällen in Zivil mit einem Wettschein in der Hand. Arvin begrüßte sie mit Namen und sorgte dafür, dass sie vor dem Rennstart einen guten Platz am Zaun bekamen.
Als der Jockey in Blau seinen Titanen zu einem dritten Versuch, den Bogen in Rekordzeit zu nehmen, wendet, schlüpfe ich näher an die Startmaschine heran, genau wie die Polizeibeamten nach Dienstschluss. Magnolia zischt meinen Namen, aber was spielt das für eine Rolle?
Der Jockey startet, und es ist bisher sein schlechtester Ritt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Mitleid mit ihm haben oder innerlich hämisch grinsen soll. Es gibt nichts zu grinsen. Es ist nicht so, als würde ich jemals die Chance bekommen, an einem Rennen teilzunehmen oder einen Titanen auch nur zu berühren.
Stahl knirscht auf Stahl, als das Pferd eine scharfe Kehrtwende macht und auf die Startboxen zudonnert. Es kommt mit voller Geschwindigkeit auf mich zu. Ich springe zurück und hätte es um ein Haar nicht rechtzeitig geschafft. Der Titan kracht gegen die Stelle, wo meine Finger waren, und der Jockey reißt sich das Tuch und die Sonnenbrille vom Gesicht.
»Das Training ist für die Öffentlichkeit gesperrt«, blafft er. Er hat blondes Haar, das er sich zu einem kurzen Pferdeschwanz zurückgebunden hat, und dunkelbraune Augen. Er ist nicht unattraktiv, aber er sieht auch nicht besonders gut aus. Jedenfalls nicht, wenn er so böse guckt.
Ich drehe lässig den Kopf von einer Seite zur anderen. »Ich sehe kein Schild, auf dem das draufsteht.«
Er packt die Joysticks fester, und der Titan zwischen seinen Beinen tänzelt. »Los, verschwinde von hier. Ich mag es nicht, wenn man mir zusieht.«
»Dir habe ich auch gar nicht zugesehen«, erwidere ich und richte den Blick auf sein Pferd.
Magnolia berührt mich am Arm, aber ihre Haltung ist steif. Sie ist bereit, nicht von der Stelle zu weichen, falls ich das will.
Der Typ beugt sich vor und schüttelt den Kopf. »Titanenfans. Zu schade, dass ihr niemals wissen werdet, wie es ist zu reiten. Ihr werdet immer dort sein …« Er nickt mir zu. »Und wir werden immer hier oben sein. Also los, ihr da unten im Dreck, schaut mir nur zu.«
Jemand nähert sich uns von hinten. Ich drehe mich um und sehe, dass der alte Mann den Jockey anstarrt. Wenn Blicke töten könnten, würde Taschentuch-Junge zwei Meter unter der Erde liegen. Er spricht kein Wort, sondern funkelt den Jockey nur mit einer stillen Botschaft an, die ich so deute: Ich mag zwar alt sein, aber das bedeutet, dass ich nicht viel zu verlieren habe, wenn ich dich mit meinen Altmänner-Händen begrabe.
Der Junge wendet seinen Titanen und galoppiert auf die Ställe zu.
»Also, das war unhöflich«, bemerkt Magnolia. Dann reckt sie den Hals und brüllt: »Unhöflich!« Sie sieht mich an. »Dieser Blauton sieht grauenhaft an ihm aus. Das geht gar nicht.«
Ich presse die Lippen aufeinander und schaue ihm nach, wie er davonreitet. Zorn brennt in meinen Adern. Ich bin wütend, weil er recht hat. Verglichen mit mir wird dieser Kerl immer mehr haben. Selbst wenn der Titan nur geliehen ist, bedeutet das, dass seine Familie einflussreiche Freunde hat. Freunde, die Beziehungen spielen lassen und Dinge möglich machen können.
Ich werde nie die Chance haben, am Titanenparcours teilzunehmen, doch ich brauche dieses Preisgeld mehr als jeder andere, der in diesem Jahr reiten wird. Aber so ist das Leben nun mal, nicht? Die Reichen werden reicher, und die Armen werden verbitterter.
»Danke«, sage ich zu dem alten Mann, aber er brummt nur. »Ernsthaft, Sie sollten nach Hause gehen. Trinken Sie etwas Wasser und legen Sie sich hin. Ich wäre in diesem Park auch mal fast ohnmächtig geworden. Das liegt an den Bäumen. Durch den Schatten meint man, es wäre kühler, als es in Wirklichkeit ist.«
Als der alte Mann mit den Zähnen knirscht, hebe ich kapitulierend die Hände. Magnolia und ich machen uns auf den Weg nach Hause, wo Eiersalat-Sandwiches auf uns warten.
»Warum hast du dem Mann überhaupt geholfen?«, fragt Magnolia, sobald er außer Hörweite ist. »Und warum hat er an der Bahn herumgelungert?«
»Aus dem gleichen Grund wie wir? Und weil ich nicht herzlos bin?«
»Warum eigentlich nicht?«, fragt sie. »Herzlosigkeit ist jetzt total in.«
Ich lache, weil ich weiß, dass sie es nicht ernst meint. Aber das Lachen fällt mir schwer. Denn obwohl der Jockey und sein Titan meine Aufmerksamkeit fesseln sollten, bekomme ich diesen starrköpfigen Mann mit den leberfleckigen Händen nicht aus dem Kopf. Er erinnert mich an jemanden, an den ich mich auch ohne Hilfe erinnere. Denn ich denke ständig an ihn, und jedes Mal tut mir das Herz weh. Es fragt, ob ich ihn nicht hätte retten können, ob ich nicht irgendetwas hätte tun können, damit er noch da wäre.
Als Magnolia uns durch dichte Bäume und Sträucher führt, die an meinen nackten Waden kratzen, kann ich nur denken:
Ich vermisse Grandpa.
Kapitel 5
An diesem Abend isst meine Familie am Tisch. Wir haben schon seit Monaten nicht mehr so gegessen, und meine Hände sind völlig verschwitzt, denn ich rechne mit einer Ankündigung. Als ich elf war, ist es auf diese Weise passiert. Meine Mom hatte eine Blase der Behaglichkeit in Form von gefüllten Paprika und Ranchero-Bohnen angeboten und sechs Stühle um einen runden Tisch gestellt.
Dann haben sie diese Blase mit einem Hammerschlag zerstört.
Zara, meine kleine Schwester, sieht mich nervös an. Sie ist erst zehn, zu jung, um sich an die Einzelheiten von damals zu erinnern, als wir unseren Platz im Haus unseres Großvaters verloren haben, aber sie erinnert sich an die Gefühle. Die Tränen, die meine Mutter geweint hat, das Schneckenhaus, in das mein Vater sich verkroch. Sie weiß, dass es eine schlimme Zeit gab, und vielleicht erinnert sie sich sogar, dass diese mit einem gemeinsamen Abendessen begonnen hat.
Dad steht am Herd und löffelt mexikanischen Reis auf die Teller, während Mom Tacos mit Carnitas rollt. Das ist in unserer Familie das Standardgericht, seit ich denken kann. Mom hat es von ihrer Mutter gelernt, und Dad toleriert es. Ich finde darin Trost. Es kann nichts Schlimmes passieren, wenn auf dem Speiseplan das Übliche steht.
Dani, meine große Schwester, sitzt rechts von mir, die Beine weit gespreizt, während ihre Finger hektisch über ihr Handy tanzen. Sie hat es von ihrem neusten Freund, mit dem sie seit über fünf Monaten zusammen ist. Eine absolute Ewigkeit. Er mag es nicht, wenn sie nicht verfügbar ist. Ich bin zwar erst siebzehn, aber das ist alt genug, um zu begreifen, dass Danis Freund ein kontrollsüchtiger Mistkerl ist. Aber Dani liebt ihn, jedenfalls sagt sie das. Und Mom und Dad achten nicht mehr auf so was.
Ich beobachte meinen Dad jetzt, während er unsere Teller füllt, als hänge sein Leben davon ab. Alle müssen eine vollkommen gleiche Portion erhalten. Exakte Maße, das ist sein Talent. Im Kraftwerk haben er und Magnolias Vater die Maschinen überwacht. Wenn irgendetwas schiefging, konnte Dad sie nach Vorgabe reparieren. Und wenn das nicht funktionierte, konnte er sich eine Alternativlösung einfallen lassen und es so hinkriegen, dass alles wieder lief. Dad sagte immer: Maschinen wirken Wunder, aber man braucht trotzdem das menschliche Gehirn, um sie zu überwachen. Ich schätze, das Kraftwerk war anderer Meinung, denn jetzt überwachen dort Maschinen die Maschinen. Ich will ihn nach dem Vorstellungsgespräch heute fragen, aber ich bin klug genug, um zu wissen, dass es ein Fehler wäre. Wenn es gut gelaufen wäre, hätte er einen Brandy mit Eis in einem Green-Bay-Packers-Bierglas in der Hand.
Ich entdecke einen orangefarbenen Umschlag in seiner Gesäßtasche und frage mich, was es ist. Zara folgt meinem Blick.
»Was hast du da in der Tasche, Dad?«, fragt sie.
Statt Zara anzusehen, schaut er zu meiner Mom hinüber. Sie verkrampft sich, und in dem Moment weiß ich ohne den geringsten Zweifel, dass uns schlechte Nachrichten ins Haus stehen. Während Dad unsere Teller verteilt und Platz nimmt, versucht er, den Umschlag tiefer in die Tasche zu schieben, aber er verknickt und hängt halb heraus.
Meine Eltern sind in unserer bescheidenen Küche keine zwei Meter voneinander entfernt, aber zwischen ihnen hätte bequem noch der Grand Canyon Platz. Es gab eine Zeit, in der mein Vater und meine Mutter eine Einheit waren, eine geschlossene Front gegen unseren Schwesternstreit und unser Flehen um ein Gartentrampolin. Sie tranken morgens gemeinsam Kaffee und umarmten sich fest, wenn Dad von der Arbeit nach Hause kam. Meine Mutter flüsterte meinem Vater etwas auf Spanisch ins Ohr, und mein Dad schnurrte förmlich, obwohl er kein Wort verstand. Sie waren echt ekelhaft.
Ich würde morden, um das zurückzubekommen.
Meine Mom setzt sich, und wir sprechen das Tischgebet. Es mag nicht viel geben, wofür wir dankbar sein können, aber Mom stammt aus San Antonio und ihre katholische Erziehung sitzt tief. Dad tut so, als bete er mit uns. Und Dani schaut keine Sekunde lang von ihrem Handy auf.
Nur Zara senkt ernst den Kopf über gefaltete Hände. Sie ist durch und durch die Tochter meiner Mutter. Und ich? Ich mag die Vorstellung vom Gott meiner Mutter. Aber ich verlasse mich lieber auf mich selbst. Ihr Gott war nicht da, als Grandpa starb.
Aber an dem Tag habe ich zu ihm gebetet, oder nicht? Ich habe ganz fest gebetet.
»Dani, leg das Telefon weg«, verlangt Dad.
Meine große Schwester spitzt die Lippen, tippt aber weiter.
»Dani«, fügt meine Mutter leise hinzu.
Als Dani immer noch nicht hört, beschleunigt sich mein Puls. Ich spüre die Veränderung in der Luft – zum Schneiden dick, wie vor einem Donnerschlag. Dad hebt die geschlossene Faust und lässt sie einmal und dann noch einmal auf den Esstisch krachen.
Dani knallt das Telefon hin. »Was hast du für ein Problem?«
»Mein Problem ist, dass deine Mutter und ich eine Mahlzeit zubereitet haben, die du keines Blickes würdigst«, donnert er.
»Ist schon gut, Tony«, murmelt meine Mom und legt ihm eine Hand auf den Arm.
Dad zieht den Arm weg. »Ist es nicht. Sie und dieser Junge sind besessen.«
»Er heißt Jason«, faucht Dani. »Und ich bin nicht besessen von ihm. Ich bin in ihn verliebt.« Sie schaut zwischen unseren Eltern hin und her. »Ich erwarte nicht von euch, dass ihr das versteht.«
Mein Vater nimmt die Gabel in die Hand, und ich habe Angst, dass er damit auf sie einsticht. »Du hast ja keine Ahnung, was Liebe ist. Und du hast kein Recht, über deine Mutter und mich zu urteilen. Nicht, bis du das Gleiche durchgemacht hast wie wir und es überlebst.«
Dani wendet den Blick ab und murmelt: »Jason würde nie zulassen, dass wir so etwas durchmachen.«
Zara greift unter dem Tisch nach meiner Hand, und ich halte die Luft an. Meine Mutter bewegt sich nicht, während Dad Dani anfunkelt. Es herrscht vielleicht drei Herzschläge lang Schweigen. Dann fliegt der Stuhl meines Dads zurück und landet klappernd auf dem Boden. Der orangefarbene Umschlag flattert aus seiner Gesäßtasche. Als meine Mom ihn sieht, presst sie die Augen fest zusammen. Aber nicht, bevor ich die Tränen darin bemerke.
Dad schnappt sich den Umschlag und zerknüllt ihn in der Faust. Dann hält er Dani die Faust dicht vors Gesicht und schüttelt sie, aber ihm fehlen die Worte. Und während Dani seinen Ausbruch ignoriert, stürmt mein Vater aus der Küche und knallt die Schlafzimmertür hinter sich zu.
»Hättest du nicht einfach dein Handy weglegen können?«, fahre ich meine Schwester verärgert an.
Sie schiebt den Stuhl zurück und steht auf. »Leck mich.«
Dann ist auch sie weg.
Meine Mom reibt sich die Hände, und ich betrachte ihre schmutzigen Fingernägel. Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis auch sie den Tisch verlässt. Sie wird sich um ihren Garten kümmern und bei dem Gefühl von Erde zwischen den Fingern ihre Sorgen verdrängen.
Die Antwort: sieben Minuten.
Sieben Minuten isst sie schweigend mit Zara und mir, dann verschwindet sie. Die Vordertür fällt leise ins Schloss, und ich kitzle Zara, erleichtert, dass der größte Teil meiner Familie sich zerstreut hat, obwohl das nicht gut sein kann.
»Los, komm«, sage ich einer kichernden Zara. »Hilf mir beim Abwaschen.«
Sie steht auf, und ich gebe ihr mit einem Geschirrtuch einen sanften Klaps, um ihr meine Dankbarkeit zu zeigen. Am Ende schaut Zara nur zu, während ich schrubbe, nachspüle und abtrockne. Denn eigentlich brauche ich ihre Hilfe nicht. Nicht beim Spülen und auch sonst nicht.
Ich habe sie einfach gern um mich.
Kapitel 6
Zwei Stunden später bin ich in dem Zimmer, das ich mir mit Dani teile. Sie ist im Magnolia-Stil aus dem Fenster geschlüpft, bevor ich reingekommen bin, um sich mit dem unvergleichlichen Jason zu treffen. Ich strecke mich auf meinem Bett aus und spiele mit den mechanischen Teilen, die mein Vater mir im Lauf der Jahre mitgebracht hat. Er hat in einem Kraftwerk gearbeitet, aber ein großer Teil des Erdgeschosses der Werkshalle war an einen Mann vermietet gewesen, der Sonderteile für die Titanen gebaut hat.
Die Titanen 3.0 sind baugleich, aber es besteht eine große Nachfrage nach Produkten zum Nachrüsten, die keinen Einfluss auf die Leistung haben. Teure Sachen wie Ritzelabdeckungen mit den eingravierten Initialen des Besitzers, die niemand bemerken wird. So was hat dieser Mann gemacht. Als Dad darauf aufmerksam wurde, brachte er ihm Gemüse aus Moms Garten mit. Er hat drei Anläufe gebraucht, bevor er die Schwäche des Mannes entdeckte.
Okra. Er mochte Okraschoten.
Dad hat nie etwas gesagt, wenn er die Teile auf mein Bett gelegt hat, aber mir schnürte es jedes Mal die Kehle zu. Ich wünschte, Dad würde Wichtiges laut aussprechen. Ich wünschte, er würde mir sagen, dass das, was mit Grandpa passiert ist, nicht meine Schuld war und dass es uns nie wieder so schlecht gehen wird wie vor unserem Umzug in den Vorort von Detroit. Ich wünschte, er würde mich umarmen und mich trauern lassen. Ich wünschte, er würde sagen, dass er stolz auf mich und immer noch glücklich darüber ist, Vater und Ehemann zu sein.
Aber ich begnüge mich mit den Bauteilen für die Titanen.
Ich lasse eine Radmutter zwischen den Fingern kreisen und betrachte die Diagramme, die ich von den Bahnen des vergangenen Jahres gezeichnet habe. Zyklonenbahn.com führt die wesentlichen Daten des Gewinners der letzten Saison auf – Name, Sponsoreninformation, gelaufene Zeit. Aber ich hatte mehr. Ich habe die Wenderaten des Siegers auf ein Hundertstelgrad genau berechnet. Ich habe seinen Drehradius an einem besonders fiesen Hindernis ausgerechnet und die Sekunden, die er gewonnen hätte, wenn er näher an den roten Bereich gegangen wäre.
Ich lächele, während ich mit dem Bleistift eine neue Zahlengruppe in mein Notizbuch eintrage und eine Antwort, für die ich Wochen gebraucht habe, dick einrahme. Dann kehre ich zu der Radmutter zurück und halte sie in das Mondlicht, das durchs Fenster fällt.
Muss sie so schwer sein?
Als ich höre, dass Dad das Radio angemacht hat, springe ich vom Bett auf. Ich weiß, was er sich anhört. Es ist der einzige Grund, warum er es einschaltet und nicht unseren Röhrenfernseher. Ich schleiche mich aus dem Zimmer und den Flur entlang. Eine weitere Tür öffnet sich, und ich sehe, wie Zara mir zugrinst. Ich winke sie heran und lege einen Finger auf die Lippen.
Am Ende des Flurs spähe ich um die Ecke. Dad sitzt in seinem verschlissenen roten Fernsehsessel, das Radio auf dem Schoß. Ich sehe Mom in der Küche, die Knie dreckverschmiert. Sie beobachtet meinen Dad genau wie wir. Wenn wir zu eifrig sind, wird er uns aus dem Zimmer scheuchen. Aber wenn wir uns wie feindliche Soldaten nähern, einen lautlosen Schritt nach dem anderen, wird er uns nicht beachten.
Dad hat das wenige Geld verloren, das wir nach dem Umzug nach Detroit gespart haben, als er auf einen Titanen gesetzt hat, der nicht die leiseste Chance hatte. Das war vor seiner Kündigung, damals, als er noch dachte, er würde bald befördert werden, und warum sollten nicht zwei bedeutende Dinge gleichzeitig passieren? Seitdem heuchelt er Hass auf die Titanen und die pöbelnden Betrunkenen an der Rennbahn in unserer Nähe. Aber er ist genauso von den Pferden fasziniert wie wir. Und so murmelt er nur missmutig, als wir in den Raum schleichen, uns zu seinen Füßen auf den Boden setzen und zuhören, wie der Jockey die letzten Nachrichten von den Gambini-Brüdern kommentiert.
»Wie alle Fans der Zyklonenbahn wissen, findet dieses Jahr das fünfte Titanenrennen statt. Der Sieger des Rennens und sein Jockey erhalten das übliche Preisgeld von zwei Millionen Dollar und werden die jährliche Thanksgiving-Parade über die Woodward Street anführen. Wie immer müssen alle Jockeys den gesamten Titanenparcours vollenden, beginnend mit …«
Der Mann bricht ab und blättert in Papieren. Binnen Sekunden erklingt eine Frauenstimme.
»Ich habe es hier, Jordan. Alle Jockeys müssen sich zuerst mit ihrem Titanen 3.0 auf Zyklonenbahn.com registrieren. Das muss bis nächsten Freitag um Mitternacht geschehen sein. Und am selben Wochenende werden die Titanen zum ersten Mal rennen.«
»Genau«, wirft der Mann ein. »Das Sponsorenrennen wird auf der Zyklonenbahn stattfinden, wo sich die Firmen und diejenigen, die sich das Startgeld leisten können, vergewissern, dass sie sich mit dem besten Titanen und dem besten Jockey zusammengetan haben. Nach dem Rennen werden die Jockeys und die Trainer am Travestieball teilnehmen, wo sie die Möglichkeit zur zwanglosen Begegnung mit den Sponsoren haben. Sobald das Sponsoring gesichert und die Verträge unterzeichnet sind, wird das Startgeld bezahlt und offiziell verkündet, welcher Jockey in dieser Saison welchen Titanen reiten wird.«
Die Frau lacht leise auf, bevor sie hinzufügt: »Dann müssen da natürlich noch die Vorläufe und die Parcoursrennen absolviert werden, die Werbeverträge müssen erfüllt werden, und ganz zu schweigen von dem Klatsch rund um die Zyklonenbahn, dem die Jockeys kurz danach ausgesetzt sein werden.«
»Den genießen Sie, nicht wahr?«, witzelt der Mann.
»Schuldig!« Sie lacht lauter. »Ich kaufe jede Ausgabe des Titanenmagazins, die ich in die Finger bekommen kann. Übrigens glaube ich immer noch, dass Harding und Flynn letztes Jahr eine Affäre abseits der Rennbahn hatten.«
»Okay, bevor wir uns in dieses leidige Thema verrennen, sollten wir die große Überraschung verkünden, die die Gambini-Brüder organisiert haben.«
»Oh ja!«, kreischt die Frau. »Ich konnte es kaum glauben, als ich es gehört habe.«
Zara rutscht näher heran und holt mich zurück in das überfüllte Wohnzimmer. Wir haben uns jetzt alle hier hineingequetscht: Mom sitzt auf dem Sofa und Zara und ich haben uns unserem Vater so weit genähert, wie es möglich ist, ohne dass er uns ins Bett scheucht.
»Zur Feier des fünfjährigen Bestehens der Zyklonenbahn haben die Gambini-Brüder beschlossen, dem Jockey, der beim Sponsorenrennen als Erster die Ziellinie überquert, das Startgeld zu erlassen.«
Mir klappt die Kinnlade runter. Unmöglich. Eine kostenlose Teilnahme am diesjährigen Rennen? Keine Fünfzigtausend-Dollar-Hürde? Es könnte jeder sein, der diesen Gratisplatz bekommt! Es könnte sogar jemand aus dem Warren County sein. Was, wenn er am Ende das Derby gewinnt? Eine solche Chance konnte hier draußen eine Familie retten. Sie konnte ihr Leben verändern, einen Ausweg aus der Armut bieten.
»Es ist so aufregend«, sagt die Frau. »Natürlich wird der Glückliche, wer immer es sein wird, einen Titanen brauchen, um am Rennen teilzunehmen.«
Mir wird schwer ums Herz, was lächerlich ist. Selbst mein Dad schaltet das Radio aus.
»Glauben die, wir fallen darauf rein?«, murmelt er vor sich hin und ignoriert die Tatsache, dass wir da sind. »Sie erlauben nur einem reichen Geldsack, Kohle zu behalten, die er gar nicht braucht.«
»Jepp«, murmle ich, ohne nachzudenken.
Mein Dad sieht mir in die Augen.
Nicht gut.
»Wieso seid ihr noch auf? Ab ins Bett. Alle beide!«
Ich springe mit Zara auf, und meine Mom geht wieder in die Küche. Auf dem Weg in mein Zimmer verspüre ich dieselbe Verärgerung wie mein Vater. Ich habe mal gehört, dass eine Katze vom Geruch ihres eigenen Katzenklos gleichzeitig angezogen und abgestoßen wird. Vielleicht geht es mir mit den Titanen genauso. Und mit den Promizeitschriften, die ich unter meiner Matratze verstecke. Sie gewähren einen flüchtigen Blick in eine andere Art von Leben, ein Leben voller Aufregung und Sicherheit. Unwillkürlich fühle ich mich davon angezogen.
Ebenso hasse ich sie auch dafür, dass sie mir ein Leben zeigen, das unerreichbar ist.
Kapitel 7
Zwei Tage später steckt Magnolia mitten in einem Haaraccessoire-Projekt, das sie völlig in Anspruch nimmt. Sie fleht mich an, rüberzukommen und auf ihrem Bett zu sitzen, um ihrem Genie bei der Arbeit zuzusehen. Ich hänge schon seit sechs Stunden vor dem Fernseher und brauche eine Pause, bevor mir die Augäpfel aus dem Kopf fallen. Ich verspreche ihr, dass ich nach dem Mittagessen vorbeischaue, und beschließe, einen Spaziergang durch unser Viertel zu machen.
Unsere Wohngegend ist nichts Besonderes – einstöckige Häuser mit verwitterter Verkleidung und Mülleimern, die am Straßenrand vor sich hin stinken. Die Häuser haben keine Fensterläden mehr und die Fliegentüren sind zerrissen. Mr Reynolds hat ein gelbes Sofa auf seiner Veranda stehen, seit ich denken kann, und zwei Häuser weiter parkt ein Auto auf dem Rasen.
Der Vorgarten der meisten Leute hier besteht ohnehin zu hundert Prozent aus Unkraut. Ihr wollt nicht morgens um sieben von einem Rasenmäher geweckt werden? Dann haben wir genau die richtige Wohnung für euch!
Ich lächle bei dem Gedanken an Mom und diese sogenannten Rasenflächen. Nichts auf der Welt bringt meine Mutter mehr in Rage als Menschen, die sich nicht um ihre Beete kümmern. Wenn sie wüssten, was sie nachts mit ihrem Eigentum macht, während sie sich in den Betten wälzen, würden sie wahrscheinlich unser Haus anzünden.
Oder ihr eine Belohnung geben.
Ich gehe fünf oder sechs Häuserblocks, bevor meine Schritte stocken. Da steht ein Mann in seiner offenen Garage und trägt eine Schweißermaske. Er beugt sich über eine Maschine, unter der er langsam, aber stetig etwas entlangschiebt und alle paar Sekunden dreht. Orangefarbene Funken sprühen in alle Richtungen, und ein schrilles Kreischen dringt an meine Ohren.
Der Mann richtet sich auf, greift sich ins Kreuz und reckt sich. Dann klappt er das Visier der Maske hoch und flucht so laut, dass ich ihn von der anderen Straßenseite aus höre. Ich kann sein Gesicht jetzt deutlich sehen, aber ich habe die ganze Zeit über gewusst, wer er ist. Er stemmt die Hände in die Hüften, dreht sich um und schaut in meine Richtung.
»Schöne Weste«, rufe ich.
Er stellt die Maschine ab und kneift die Augen zusammen. »Bist du dieses Mädchen von der Rennbahn?«
»Höchstpersönlich.« Ich gehe über die Straße, angelockt von der Art, wie er dasteht – genau wie mein Grandpa, zu weit nach hinten gelehnt, die Schultern bis zu den Ohren hochgezogen. Ich weiß nicht, wie mir die Tatsache bis jetzt entgehen konnte, dass er so nah bei Magnolia und mir wohnt.
»Was hast du vor?«, fragt er sichtlich gereizt.
»Ich mache mich bereit, Sie aufzufangen, wenn Sie fallen. Heute ist es heißer als am Montag.« Ich werfe einen Blick auf das Material unter seinem großen Elektrowerkzeug. Es ist ein Stahlblech, wie ich es schon einmal gesehen habe, aber dieses hier ist dunkler. Da ist ein feines Wellenmuster, das man nur im Sonnenlicht sieht, und ein funkelnder Glanz unter der Oberfläche. Das sagt mir alles, was ich wissen muss. »Woher haben Sie das?«
»Woher habe ich was?« Der alte Mann legt die Maschine weg und wischt sich die Hände an einem Lappen ab, der ein oder zwei Runden in der Waschmaschine gebrauchen könnte.
»Das ist Titanenstahl.«
Er fängt meinen Blick auf und mustert mich eingehend. »Ist es nicht.«
»Ist es doch. Es hat diese Wellen und den Glanz und …«
»Kind, wenn du wüsstest, wovon du redest, wüsstest du auch, dass das hier viel zu dunkel ist, um Titanenstahl zu sein. Warum hüpfst du nicht zurück über die Straße und machst dich wieder auf den Weg?«
Er klappt die Maske wieder runter, wodurch er aussieht wie ein Serienmörder.
Ich schaue mir den Stahl noch einmal genau an, und meine Begeisterung schwindet. Er hat recht. Der Stahl ist zu dunkel.
Als ich sehe, wie der alte Mann ihn zugeschnitten hat, stelle ich fest, dass er ganze drei Grad danebenliegt. Selbst wenn er die achteckige Form hinkriegt, die er haben möchte, werden die Seiten nicht gleich sein. Ich recke das Kinn in die Luft. »Ich habe mal jemanden wie Sie gekannt, alter Mann. Hinter diesem Grummeln und den finsteren Blicken steckte ein netter Kerl.«
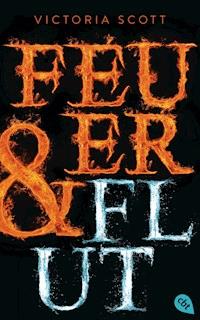
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











