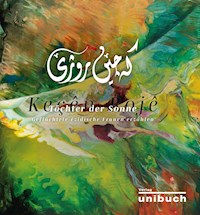
Töchter der Sonne E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNIBUCH
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Sie leben mitten unter uns, aber wir wissen nichts über ihr Leben und ihre Kultur. Authentische Berichte geflüchteter êzîdischer Frauen beschreiben ihre Herkunft und gegenwärtige Situation in Deutschland. Die Lyrik von Sebra Xaltî und die Gemälde des Kunstmalers Ravo Ossman ergeben einen Dreiklang, der einen tiefen Einblick in die êzîdische Kultur ermöglicht. Die Gemälde sind inspiriert vom Leben des Künstlers in der nordirakischen Heimat und vom Einfluss der Gräueltaten des Islamischen Staates von 2014. Die Gedichte, in Deutsch und Kurdisch, spiegeln die Gefühle und Gedanken der Dichterin, die in ihrer zweiten Heimat Deutschland, die Verfolgung ihres Volkes miterlebt. Ein Erkenntnisgewinn, der das Miteinander der Kulturen und das gegenseitige Verständnis füreinander verbessert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bis August 2014 lebten mehr als 500.000 Êziden in Shingal, Irak. Sie lebten von der Landwirtschaft. Es war ein hartes, aber friedliches Leben in Großfamilien, die sich gegenseitig unterstützten. Ab Juli 2014 änderte sich ihr Leben von heute auf morgen. In der Nacht des 03.08.2014 fiel der IS in Shingal ein – tötete tausende Männer und heranwachsende Jungen, verschleppte und versklavte mehr als fünf- bis sechstausend êzidische Frauen, Mädchen und Kinder. Viele wurden vergewaltigt und umgebracht, weil sie sich der Ehe verweigerten – darunter waren auch orientalische Christen.
Im Sommer 2015 sind vier Millionen Menschen auf der Flucht. 2015 konnten 890.000 beim BAMF Anträge auf Asyl stellen. Fünf unter uns lebende Frauen erzählen.
Gedichte in deutscher und kurdischer Sprache der Migrantin Sebra Xaltî, Gemälde des êzîdischen Malers Ravo Ossman und Kurzbiographien êzîdischer geflüchteter Frauen aus dem Irak und Syrien aufgeschrieben in Zusammenarbeit von Sebra Xaltî und Claudia Ruhs.
Die Gedichte sind in Kurdisch verfasst worden. Die deutschen Fassungen sind ein gelungener Versuch, den deutschen LeserInnen die eigene Gedanken- und Gefühlswelt nahe zu bringen. Wo das in Versform nicht möglich war, stehen kurze Inhaltsangaben.
Die Gemälde des êzîdischen Malers Ravo Ossman entstanden zum Teil im Nord-Irak und Italien, zuletzt in Deutschland. Die im Irak gemalten Bilder fielen zu einem großen Teil den Zerstörungen des IS zum Opfer.
Wir widmen dieses Buch den mehr als 2500 Frauen,
von denen bis heute jede Spur fehlt. Sie dürfen
nicht vergessen werden.
Sebra Xaltî
Wut, Trauer und Enttäuschung sind übermächtig nach erlittenen Misshandlungen Nur die Flucht und das Zurücklassen von Hab und Gut können sie davon befreien.
Dank
Bei unseren Gesprächspartnerinnen rief die Rückbesinnung auf ihren Lebensweg viele Erinnerungen wach, die oft sehr schmerzhaft und belastend waren.
Das Erzählen während der Interviews wurde so zu einer schweren Herausforderung und große Anstrengung. Unser besonderer Dank gilt den Frauen, die trotzdem ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben.
Inhaltsverzeichnis
Xatûn
Wenn wir Glück haben, überleben wir. Wenn nicht, sterben wir
Hevi
Der weiße Stoffhase
Xanê und Tochter Sorgul
Im Herzen unglücklich aber der Körper lebendig
Nergiz
Alles ist fremd! – alles ist neu!
Sosin
Egal wo man lebt, wenn man sich in Sicherheit fühlt und seine Kinder und Lieben um sich hat, ist das Leben schön
Ecce homo – siehe, welch ein Mensch!
Sie leben unter uns, wir begegnen ihnen auf der Straße, beim Einkaufen und anderswo. Sie machen Deutschkurse und suchen die Jobcenter auf. Sie sind Flüchtlinge wie viele andere auch, die seit 2015 in größerer Zahl nach Deutschland gekommen sind – die Êzîden (deutsch: Jesiden). Aber es steht fest: Wir wissen nicht viel über sie, über die Gruppe der Êzîden. Mit einzelnen Begriffen wie Irak, Shingal, Kurden, IS oder Peschmerga können wir etwas verbinden. Und doch gilt: Sie sind uns unbekannt. Wir wissen nicht, aus welcher Welt mit völlig anderer kultureller Tradition und völlig anderem Alltag diese Menschen in unsere westliche Welt hinein katapultiert wurden. Sie kannten unsere heutige Lebenswelt nicht, in der jeder als Individuum zu bestehen hat.
Bis zum August 2014 lebten mehr als 500.000 Êzîden im Irak und Syrien. Sie lebten überwiegend von der Landwirtschaft in friedlicher Nachbarschaft mit Muslimen und Christen. Es war ein hartes, aber zufriedenstellendes Leben in Großfamilien, die sich als Gemeinschaft verstanden und sich gegenseitig unterstützten.
Ab August 2014 änderte sich ihr Leben radikal von heute auf morgen. Denn in der Nacht des 03.08.2014 fiel der IS, der »Islamische Staat« in Shingal ein.
Er ist eine ultra-konservative, terroristische Variante des Islam. Er tötete in Shingal tausende Männer und heranwachsende Jungen, er verschleppte und versklavte mehr als fünftausend êzîdische Frauen, Mädchen und Kinder. Viele wurden vergewaltigt und umgebracht, wie jene 19 Mädchen, die bei lebendigem Leib in einem Eisenkäfig verbrannt wurden, weil sie sich der Zwangsehe verweigerten.
Zwar konnten viele Êzîden noch rechtzeitig aus eigener Kraft in das nahe gelegene unwirtliche Sindschar Gebirge fliehen, das bis auf 1400 m aufsteigt, größtenteils trocken, verkarstet und insgesamt eher lebensfeindlich ist, aber auch hier ging es nur um das nackte Überleben.
Von den gefangenen, versklavten Frauen und Mädchen, die eine menschliche Beute des IS waren, so wie es in Kriegen des Altertums üblich war, konnten wenige fliehen oder freigekauft werden. Aber auch Jahre nach diesem Genozid fehlt bis heute immer noch von mehr als 2500 Frauen und Mädchen jede Spur.
Ecce homo – siehe, welch ein Mensch! Das nackte Leben haben die unter uns lebenden Êzîden retten können, aber sie tragen eine schwere, unsichtbare Bürde mit sich, wie dieses Buch zeigt. Es soll sie mit ihrer persönlichen, aber auch allgemeinen Lebensgeschichte sichtbar machen. Es ist ihnen und allen anderen gewidmet. Diese Menschen dürfen nicht vergessen werden.
* In der kurdischen Sprache gibt es bei Namensbezeichnungen sehr häufig verschiedene Schreibweisen, je nachdem, ob es kurmançi, arabisch oder englisch beeinflusst ist, kann es Jesidisch oder Yezidisch geschrieben werden. Wir haben uns für die von den Êzîden verwendete Schreibweise entschieden.
Ich ließ mir von der Liebe
Einen ihrer unerfüllten
Wünsche aufschreiben.
Und später las ich nur noch
Von ihrer unerfüllten Sehnsucht
Nach der Freiheit.
Sebra Xaltî
Min xwest je evîndariyê je min re çend hêviyên xwe yên pêknehatî binivîsîne, le wê tikîtenê nivîsandiyehesrekeşiya xwe yî ji bo azadiyê
Sebra Xaltî
Xatûn
Wenn wir Glück haben, überleben wir – wenn nicht, sterben wir
Am 1.1.1989 wurde ich als jüngstes Kind in eine große êzîdische Landarbeiterfamilie hinein geboren. Dies hat mein Leben bestimmt – bei mir sind das 28 Jahre – bis ich nach Deutschland kam.
Wir hatten ein Lehmhaus in Til Hezir, Shingal. Dort waren wir nur selten. Die ganze große Familie hat meistens auf den Feldern gelebt, in kleinen Lehmhäuschen, und gemeinsam gearbeitet.
Auf den Feldern lebten jeweils ein bis zwei Familien, nicht wie in einem Dorf. Wenn wir von dem Landbesitzer gut bezahlt wurden, blieben wir zwei, drei bis vier Jahre, wenn nicht, zogen wir weiter und haben uns einen anderen Landbesitzer gesucht. Wir sind bestimmt dreißig Mal in der Zeit umgezogen, in der ich bei meiner Mutter wohnte, also noch nicht verheiratet war.
Wenn ich von Deutschland aus schaue, arbeiteten wir auf den Dörfern rund um unser Haus in Til Hezir. Weil wir aber alles zu Fuß bewältigen mussten, waren zehn Kilometer schon zu weit, um täglich zu unserem Haus zurückzukehren. Wir blieben also auf den Feldern. Wären wir zuhause geblieben, wären wir verhungert. Fast alle Êzîden, die ich kannte, haben dort so gelebt. Wir kannten es nicht anders. Heute weiß ich: Wir lebten in der Gegend mit der höchsten Armut und mit der schlechtesten Sicherheitslage.
So hatten wir nie das Gefühl, zuhause zu sein. Wir arbeiteten täglich nur für unser Essen und lebten von den eigenen Feldfrüchten. Uns stand nämlich eine kleine Parzelle zu. Hier bauten wir an, was wir zu unserer täglichen Ernährung benötigten. Wir hatten keine Tiere, dann hätten wir nicht so einfach weiterwandern können. Schafe z.B. kosten auch Futter, dafür war kein Geld übrig.
Die Felder gehörten Arabern, für sie hat unsere ganze Familie gearbeitet. Die Grundbesitzer wussten, dass wir Êzîden sind. Zu Saddam Husseins Zeiten hatten wir nichts auszustehen, aber wir waren für die Araber wie Sklaven. Wir arbeiteten täglich nur für unser Essen, nie konnten wir uns etwas aufbauen. Unser Lohn war ein Anteil von dem Erlös der Ernte. Wenn wir zum Beispiel zwei Körbe Tomaten geerntet hatten, konnten wir einen Korb für uns nutzen und den Rest verkaufen. Ansonsten konnten wir nichts verkaufen, alles Gemüse ging zum Großbauern.
Meine Brüder haben Melonen, Auberginen, Tomaten, Zwiebeln, Paprika, Okra, Gurken und Sonnenblumen gepflanzt, gepflegt und geerntet. Das war schwere Arbeit. Sobald es hell wurde, waren sie auf dem Feld. Die Arbeit war dann nicht so schwer.
Wir waren oft in Rabia und Ser Sib, an der Grenze zu Syrien. Dort haben wir nur Wassermelonen, Honigmelonen und Auberginen gepflanzt. Wir konnten uns nie irgendwo niederlassen, aber immer blieb die ganze Familie zusammen. Wer arbeiten konnte, arbeitete – die anderen waren im Haus.
Als Kind und junges Mädchen musste ich zuhause nichts machen, denn ich war die Jüngste. Als Jüngste wird man bei uns von Eltern und Geschwistern verwöhnt. Ich verinnerlichte früh, dass wir bitter arm waren. Wenn ich sah, was Nachbarskinder vom Einkaufen mitgebracht bekamen, habe ich mir das heimlich auch gewünscht. Nie habe ich das zuhause gesagt, denn ich wusste, wir können uns das nicht leisten. Ich wusste auch genau, dass meine Brüder dann traurig sein würden, weil sie meinen Wunsch nicht erfüllen konnten.
Seit ich mich erinnern kann, haben wir in Armut gelebt – es hat mein Leben geprägt und eingeengt. Meine Brüder hätten mir Schulbildung gegönnt. Ich wollte gerne zur Schule gehen. Aber ich hatte nicht einmal Gelegenheit, in eine Schule hineinzuschauen.
Deshalb bin ich, wenn ich konnte, auch bei Sonnenaufgang mit auf die Felder gegangen. Ich hätte sonst ein schlechtes Gewissen gehabt.
Dann kam die Zeit zu heiraten. Mein Onkel richtete eine Hochzeitsfeier für einen seiner Söhne aus. Da beobachteten er und mein Vater wohl, dass ich den anderen Sohn, Sahid, ganz nett fand. Seine Familie mochte mich auch. Mein Onkel ist aber wiederum mit meiner Cousine verheiratet. Von nun an besuchte meine Cousine uns ziemlich oft. Am Feiertag Car Sema Sor, den wir den roten Mittwoch nennen (ähnlich Ostern), kam dann meine Cousine, zugleich die Mutter von Sahid, zu uns und sagte meiner Mutter, dass sie es gut fände, wenn ich und Sahid heiraten würden. »Da ist sie, frag sie. Wenn sie möchte, habe ich nichts dagegen,« antwortete meine Mutter. Ich sagte ja, denn Sahid ist ein guter Mensch. Es ist besser jemanden aus der Familie zu heiraten, als einen fremden Menschen. So wurde meine Cousine meine Schwiegermutter.
Abb. 1
Die Schwiegermutter fragte, was ich mir zur Hochzeit wünsche. »Was ihr euch leisten könnt«, war meine Antwort. So bekam ich ein Kleid und bei der Hochzeitsfeier fuhren drei Autos vor. Unsere beiden Familien teilten sich die Aussteuer: Bettwäsche und Handtücher. Zwei Wochen vor unserer geplanten Hochzeit starb unser Nachbar. Er war ein »Pir«. Bei ihm holten sich die Dorfbewohner den Segen, er besuchte die Familien bei Todesfällen und an Feiertagen. Aus Respekt vor ihm heirateten wir ohne eine Feier, ohne Musik. Die Verwandtschaft kam zum Mittagessen, das waren viel weniger Gäste als sonst üblich. Ich trug das Kleid, das eine Frau aus dem Dorf zu einer anderen Hochzeit getragen hatte und vorher schon andere – solche feinen Kleider werden bis zu zehn Mal ausgeliehen. So sah jede Braut gleich aus. Es wurde auch nicht getanzt – ohne Musik, kein Tanz. Wäre es anders gewesen – unsere Gewissensbisse wären viel zu groß gewesen.
So sind Sahid und ich jetzt dreizehn Jahre verheiratet und ich bereue keinen Tag davon (schüchternes Lachen). Er ist ein sehr guter Versorger der Familie und ein liebevoller Vater, der seine Kinder unterstützt.
Ich zog nach der Hochzeit ins Haus der Schwiegereltern. Sahids Vater war ein Greis, ich die vierte Schwiegertochter im Haus. Die anderen drei Brüder mit Kindern hatten jeweils Zimmer angebaut und die Schwiegertöchter führten ihren eigenen Haushalt. Im Haupthaus lebten Sahid und ich mit einem noch nicht verheirateten jüngeren Bruder und den Schwiegereltern. Oberhaupt der Familie war die Schwiegermutter. Sie bestimmte, was im Haushalt getan werden musste. Meine Aufgaben waren kochen, putzen, waschen – was die gute Schwiegertochter so alles macht.
Anfänglich, nach der Hochzeit, arbeiteten wir noch auf dem Feld. Ein paar Jahre später fanden Sahid und sein Bruder Arbeit als Maler und Lackierer. Da zogen wir um nach Gizir, in das Haus, das der Schwiegermutter gehört. Das liegt zwischen Shingal und Barch. Die drei älteren Brüder wohnten neben uns. Wir arbeiteten alle in die gleiche Haushaltskasse. Als unsere Kinder geboren wurden, wurde es zu eng im Haus. Die Schwiegermutter entschied, dass wir ein eigenes Zimmer bekommen, angebaut an das Haus. Der Jüngste blieb bei den Eltern, um sie zu versorgen. So ist das immer: Der jüngste Sohn sorgt für seine Eltern.
Auf Grund von Sahids Arbeit als Maler waren wir jetzt in der glücklichen Lage, etwas zu sparen und uns Möbel kaufen zu können.
Schon während der Zeit, als wir noch auf den Feldern arbeiteten, begann die Stimmung zwischen Arabern und Êzîden zu kippen. Nach dem Ende der Regierungszeit von Saddam Hussein, herbeigeführt durch den Angriff der amerikanischen Truppen, wurde nach einer Übergangszeit, in der Verhandlungen stattfanden, eine neue Regierung gewählt. Der erste Präsident des Irak war Dschalal Talabani, ein Kurde. Auf einmal war in der Bevölkerung der eine Êzîde, der andere Muslim. In der Polizeistation durften jetzt auch Kurden arbeiten und sie konnten in höhere Positionen aufsteigen. Den Êzîden ging es zunehmend besser. Das führte zu Unruhe.
Die Regierung verfügte, die Polizei solle die Araber schikanieren. Z.B. musste ein arabischer Mann drei Stunden vor der Polizeistation in der Sonne stehen. Da richtete sich natürlich Wut auf die Êzîden. Die Araber wurden neidisch, sie hatten vorher immer auf Saddam Husseins Seite gestanden.
Als dann der IS kam, schlossen sich viele Araber aus Rache an.
Abb. 2
Abb. 3
Am dritten August 2014, nachts um zwei Uhr, greift der IS an. Aus ungefähr einem Kilometer Entfernung sehen wir das Vorrücken der Kämpfer in Jeeps und Pickups auf uns zu. Unsere erwachsenen Männer organisieren sich und leisten Widerstand. Zum Eigenschutz hatten wir immer schon Waffen. Die können es aber nicht mit den Panzerfäusten des IS aufnehmen, wir haben nur Pistolen und Gewehre.
Zwei Stunden können wir sie aufhalten – bis nach vier Uhr morgens! Frauen und Kinder sind im Haus. Es ist alles noch dunkel. Alle bereiten die Flucht vor. Wir bewegen uns nur ganz geduckt. Auf allen Vieren ist unsere Großfamilie zusammen gekrochen und hat gepackt. Um sechs Uhr morgens, als der Mele (Muetzin) ruft, gehen die IS-Kämpfer in die Moschee zum Gebet. Wir rennen alle weg! Mit dem Auto, mit Pferdekarren und Eseln. Es ist die letzte Möglichkeit zu fliehen. Alle Richtung Berg.
Wer sich jetzt gerettet hat, ist gerettet. Wer nicht, der wird umgebracht. Wer rennen kann oder auch nur kriechen, der flieht. Nach drei Stunden haben wir den Berg erreicht. Es ist neun Uhr oder halb zehn. Wir sind auf dem Berg – die IS Kämpfer sind in Shingal. Vom Berg aus sehen wir, wie unsere heilige Pilgerstätte in die Luft gesprengt wird. Sehen den Rauch aufsteigen. Entsetzt steigen wir weiter auf den Berg hinauf. Alle sind erschöpft, durstig und hungrig. Die Kinder weinen. Es ist eine riesige Menschenmenge dort oben, die aus Shingal und den umliegenden Dörfern kommt. Wir sind verzweifelt, ich weine, genauso wie unzählige andere Frauen. Sogar die Männer weinen.
Ich bin nur darauf konzentriert, meine Kinder zusammenzuhalten. Mein Sohn ist drei Jahre alt, meine beiden Mädchen sind fünf und sieben.
Ich denke nicht daran, wie es meiner Verwandtschaft wohl geht – nur die Kinder, die Kinder retten.
Es ist ein Moment, da denkt niemand an den Anderen, es geht nur darum, sich und sein eigen Fleisch und Blut zu retten. Du denkst nicht, ob du Bruder oder Schwester hast, du denkst nur daran, dich und die Kinder zu retten.
Alle Menschen drängen weiter auf den Berg, die Umgebung nehme ich gar nicht wahr.
Drei Tage sind wir ohne Essen und Trinken – es gibt nichts, nichts. Mein Sohn wird krank. Drei Tage lang Angst um sein Leben. Keine Medikamente, kein Trinken. Sahid schlägt vor, den Sohn heimlich nach unten zu einem Arzt zu bringen. Aber das ist doch unmöglich! Zwei Kinder alleine oben lassen, da sterbe ich lieber mit den Kindern. Ich habe viel zu viel Angst, die beiden Mädchen in der Menschenmenge zu verlieren.
Wenn wir Glück haben, überleben wir. Wenn nicht, sterben wir. Ich werde nie im Leben vergessen, was ich dort erlebte. Ich habe so viel Angst um meine Kinder und so viel Kummer zu sehen, wie sie Hunger haben und Durst. Beides kann ich bei meinen kleinen Kindern nicht stillen.
Wird sind die Ersten auf dem Berg, die Letzten haben den IS auf den Fersen. Wir laufen immer weiter ins Gebirge. Vorne sind die Frauen, Kinder und die Älteren. Unsere Männer bilden die Nachhut. Sie leisten Widerstand gegen die Verfolger mit allem, was sie zur Verfügung haben, mit Waffen und anderen Gerätschaften. Sie kämpfen mit dem Mut der Verzweifelung, weil sie der Überzeugung sind, dass der IS uns alle umbringen wird. Wir Frauen haben unvorstellbare Angst, dass der IS uns erreicht. Ich habe große Angst um Sahid, dass ihn eine Kugel trifft und er stirbt – was wird dann aus den drei Kindern und mir? Ich schwöre bei Gott, das war das Schlimmste, was wir Êzîden erlebt haben. (Hat Tränen in den Augen).





























