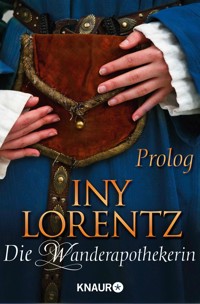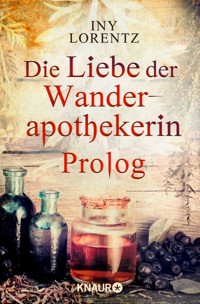Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wanderhuren-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Wanderhure geht weiter ... Band 5 der historischen Roman-Reihe der Bestsellerautorin Iny Lorentz! Die ehemalige Wanderhure Marie lebt glücklich auf Burg Kibitzstein. Ihre Kinder sind erwachsen, die Töchter bereits verheiratet, und nun soll auch ihr Sohn Falko unter die Haube. Doch Falko ist ein Heißsporn - heißblütig, übermütig und einer hübschen Frau niemals abgeneigt,. Als er sich bei einem Turnier den Zorn eines Gegners zuzieht, sieht der Fürstbischof von Würzburg keine andere Möglichkeit, als Falko für einige Zeit nach Rom zu schicken. Eine gefährliche Mission – nicht nur weil er des Fürstbischofs schöne Nichte in die Ewige Stadt begleiten soll … Dort soll das junge Mädchen Vorsteherin in einem Nonnenkloster werden. Zwar kann Falko zunächst der Versuchung widerstehen, die Schöne zu verführen, stürzt sich jedoch in Rom in eine Affäre mit der Tochter seines Todfeindes. Damit gefährdet er die Aufgabe, die dort auf ihn wartet: Er soll den Besuch des deutschen Königs Friedrich III. und seine Kaiserkrönung vorbereiten, und die Widersacher lauern schon … Ein farbenprächtiger historischer Roman Band 5 der Wanderhuren-Reihe entführt erneut mit einer packenden Geschichte ins Mittelalter des 15. Jahrhunderts. Opulent und bildgewaltig entfaltet sich ein historisches Panorama vor der Kulisse des mittelalterlichen Deutschlands und Italiens. Gewohnt gekonnt verbinden Iny Lorentz historisches Wissen mit Spannung und guter Unterhaltung zu einem fesselnden historischen Schmöker. »Spannend, emotional und historisch fundiert.« Lisa »Iny Lorentz rockt den historischen Roman! In ihren Büchern ist so viel los, dass es einem ganz schwindlig wird - spannend, ereignisreich und flott erzählt. So ist auch TÖCHTER DER SÜNDE.« denglers-buchkritik Alle Bände der historischen Saga um die Wanderhure Marie und deren Reihenfolge: - Band 1: Die Wanderhure - Band 2: Die Kastellanin - Band 3: Das Vermächtnis der Wanderhure - Band 4: Die Tochter der Wanderhure - Band 5: Töchter der Sünde - Band 6: Die List der Wanderhure - Band 7: Die Wanderhure und die Nonne - Band 8: Die Wanderhure und der orientalische Arzt - Band 9: Die junge Wanderhure (Prequel zu Band 1) - Band 10: Die Wanderhure. Intrigen in Rom
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:6 Std. 48 min
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Iny Lorentz
Töchter der Sünde
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Auf Kibitzstein hat Marie Adler sich mit dem Würzburger Fürstbischof Gottfried Schenk zu Limpurg arrangiert. Ihre Kinder sind mittlerweile erwachsen und Trudi und Lisa bereits verheiratet. Außerdem hat der Fürstbischof angedeutet, für Falko Adler eine passende Ehe stiften zu wollen. Das Leben könnte im Grunde für Marie nicht schöner sein, doch da geschehen zwei Dinge, die das Schicksal aller auf Kibitzstein verändern werden.
Inhaltsübersicht
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Zweiter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Dritter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Vierter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Fünfter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Sechster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Siebter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Achter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Neunter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Anhang
Geschichtlicher Überblick
Die Personen
Der Reisezug
Franken
Rom
Weitere Personen
Geschichtliche Personen
Glossar
Erster Teil
Der Auftrag
1.
Kardinal Taddeo Foscarelli blieb stehen, hob den Kopf und lauschte. Hatte er nicht eben hastige Schritte hinter sich vernommen? Sein Herz schlug jedoch so hart und schnell, dass es in seinen Ohren widerhallte und alles andere übertönte. Weiter!, befahl er sich selbst, lief ein Stück die Ruinen entlang und schlüpfte hinter einen Vorsprung. Im nächsten Augenblick vernahm er Stimmen.
»Dort vorne muss er sein!«
Sie waren ihm auf der Spur! Foscarelli überlegte angestrengt, was er tun konnte. Leider schien der Mond so hell, dass man ihn sehen würde, sobald er aus dem Schatten der Mauer trat. Auch war ihm klar, dass er selbst dann in Gefahr schwebte, wenn es sich bei seinen Verfolgern nur um lumpige Räuber handelte. Allein das juwelenbesetzte Kreuz, das er unter dem Wams trug, war mehr wert, als ein Handwerker in drei Jahren ehrlicher Arbeit verdienen konnte.
»Nimm dich zusammen!« Hatte er das gesagt oder nur gedacht? Im Grunde war es gleichgültig, wer hinter ihm her war. Der Dolch eines Räubers war ebenso scharf wie der eines Meuchelmörders, beide brachten den Tod.
»Ich hätte besser aufpassen müssen!« Sich im schmalen Schatten der Hauswände haltend, schlich er weiter bis zur Einmündung der nächsten Gasse. Da vernahm er vor sich hastige Schritte und bog nach links ein.
»Dort drüben ist er!«, rief jemand.
Foscarelli begann zu rennen. An Räuber glaubte er nicht mehr, denn so viele Banditen, wie in seiner Nähe lauern mussten, kümmerten sich gewöhnlich nicht um einen einzelnen Spaziergänger.
»Jetzt haben sie Meuchelmörder auf mich angesetzt!« Diesmal vernahm er die eigene Stimme und schalt sich einen Narren. Wenn er so weitermachte, brachte er diese Schurken selbst auf seine Spur. Er hetzte weiter, bog erneut ab, weil vor ihm Geräusche aufklangen, und sah dann zur linken Hand die im Mondlicht bleich schimmernden Säulen eines alten Tempels in die Höhe ragen. Rechts von ihm rauschte der Tiber. Also war er schon recht weit vom Weg abgekommen.
Um sich in Sicherheit bringen zu können, hätte er die entgegengesetzte Richtung einschlagen müssen, aber als er nach einem Schlupfloch suchte, durch das er ungesehen in die Stadt käme, sah er im Mondlicht zwei Männer die Straße entlangkommen. Räuber waren es mit Sicherheit nicht, denn einer trug die Tracht eines Edelmanns. Die Maske, die der Mann sich um das Gesicht gebunden hatte, bewies, dass er keine guten Absichten hatte. Er kam Foscarelli bekannt vor.
So oder so hatten sie sich ihm gewiss nicht aus Vergnügen nach Mitternacht an die Fersen geheftet. Damit sah er nur noch einen Ausweg: Er musste einen Bogen schlagen und versuchen, seinen Verfolgern über die Tiberbrücke nach Trastevere zu entkommen. Der Priester der dortigen Kirche Santa Maria war nicht nur sein Freund und Verbündeter, sondern kannte auch einige kräftige Handwerksburschen, die seinen Feinden einzuheizen verstünden.
Der Kardinal schlich im Schatten einer halbverfallenen Häuserzeile weiter, bog dann in eine Seitengasse ein, die zum Tiber führte, und stand auf einmal dem Edelmann gegenüber. Obwohl dieser lächelte, musterten die Augen hinter der Maske ihn kalt. An diesem falschen Lächeln erkannte Foscarelli seinen Gegner.
Der Maskierte zog seinen Dolch und trat auf den Kardinal zu. »Ich dachte mir doch, dass Ihr dieses Schlupfloch wählen würdet.«
Foscarelli versuchte zurückzuweichen, hörte aber hinter sich Schritte und begriff, dass sein Weg hier zu Ende war. Ich hätte klüger sein und ein paar Leibwächter mitnehmen sollen, dachte er. Sein Auftrag war jedoch so geheim gewesen, dass er auf jegliche Begleitung verzichtet hatte. Dennoch musste etwas durchgesickert sein, sonst hätte man ihm nicht auf dem Rückweg auflauern können. Mit dem Gefühl, versagt und seine Verbündeten enttäuscht zu haben, blickte er dem jungen Mann ins Gesicht.
»Warum wollt Ihr Eure Seele mit dem Mord an einem Mann der Kirche belasten, Signore C …«
Weiter kam er nicht, denn der Edelmann stieß ihm mit einer beinahe lässigen Bewegung die Klinge in die Brust. Der Kardinal riss den Mund auf, brachte aber keinen Laut mehr hervor, sondern sank langsam zu Boden.
Sein Mörder zog den Dolch aus der Wunde und wischte ihn an Foscarellis Umhang ab. Dann schob er ihn wieder in die Scheide und spuckte vor seinem Opfer aus. »So wie dir wird es jedem ergehen, der sich uns in den Weg stellt, notfalls auch dem Papst!«
»Sagt so etwas nicht, Signore«, wandte ein junger Mann ein, der mit seinen Kumpanen den Kardinal seinem Herrn zugetrieben hatte wie ein Stück Wild.
»Ein Kardinal unterscheidet sich weniger vom Papst als so ein Knecht wie du von mir«, antwortete sein Befehlsgeber spöttisch. »Kommt nun! Oder wollt ihr von den Wachen bei der Leiche gefunden werden?«
Mit diesen Worten reichte der Maskierte seinen Helfern ein paar Münzen, tippte mit zwei Fingern an seinen kappenartigen Hut und ging mit raschen Schritten von dannen.
Hinter ihm blieb der Leichnam des Kardinals zurück. Einer riss dem Toten das juwelengeschmückte Kreuz ab, zwei weitere beraubten ihn seiner Kleidung und warfen den Leichnam in den Tiber. Lautlos verschwanden die Männer in den tintenschwarzen Schatten der Nacht.
2.
Etliche Wochen später saß der Würzburger Fürstbischof Gottfried Schenk zu Limpurg auf seinem Ehrenplatz und starrte düster auf die Ritter, die sich auf dem Anger zum Buhurt versammelten. Seine Gedanken befassten sich jedoch mehr mit der Nachricht, die er am Vortag erhalten hatte. Sein alter Freund Taddeo Foscarelli war in Rom ermordet worden. Nun gab es immer wieder Streitigkeiten in der Heiligen Stadt, und nicht selten kam blanker Stahl ins Spiel. Gottfried Schenk zu Limpurg bezweifelte jedoch, dass Kardinal Foscarelli einem simplen Raubmord oder einer nachrangigen Streitigkeit zwischen Adelsfamilien zum Opfer gefallen war. Immerhin hatte sein Freund den Besuch Friedrichs III. in Rom vorbereiten sollen. Dort wollte der König seine erwählte Braut heiraten und sich vom Papst zum römischen Kaiser krönen lassen.
Es gab genug Menschen, für die allein die Tatsache, dass der deutsche König die Heilige Stadt aufsuchen wollte, Grund genug war, alles daranzusetzen, sein Kommen zu verhindern. Würde Friedrich III. von Seiner Heiligkeit, Nikolaus V., empfangen, wäre das ein Zeichen für den ganzen Erdkreis, dass die Zwistigkeiten zwischen dem Reich und dem Heiligen Stuhl endgültig der Vergangenheit angehörten. Und die Kaiserkrönung würde Friedrich weit über die anderen Könige der Welt hinausheben. Schon der Gedanke daran mochte für einen ehrgeizigen Herrscher wie Karl VII. von Frankreich nur schwer zu ertragen sein. Diesem war bereits Friedrichs geplante Heirat mit Eleonore, der Schwester König Alfons’ V. von Portugal und Enkelin Ferdinands I. von Aragon, ein Dorn im Auge.
Leises Zischeln der Damen, die unweit von ihm auf der Ehrentribüne dem Turnier zusahen, beendete den Gedankengang des Fürstbischofs. Er blickte auf und erkannte, dass er das Signal zum Beginn des Buhurts überhört haben musste, denn die Ritter sprengten bereits gegeneinander. Noch während er sich fragte, was den Damen missfallen mochte, streifte sein Blick Bruno von Reckendorf, der ein Stück entfernt von ihm saß und das Geschehen mit einem Ausdruck höchster Befriedigung verfolgte.
Der Fürstbischof rieb sich nachdenklich über die Stirn. Bis zum Vortag hatte Reckendorf als der beste Turnierritter Frankens gegolten. Dann aber hatte er Falko Adler auf Kibitzstein, jenen jungen Mann, dessen Ruhmesstern zu steigen begann, noch vor dem eigentlichen Turnier zum Zweikampf gefordert. Zur Überraschung aller hatte der Kibitzsteiner seinen Gegner mit einem derben Lanzenstoß aus dem Sattel gehoben.
Eigentlich hätte Reckendorf der Verletzung wegen, die er sich beim Sturz vom Pferd zugezogen hatte, das Bett hüten müssen. Doch er hatte sich auf die Tribüne gequält, um sich den Buhurt anzusehen.
Obwohl Gottfried Schenk zu Limpurg sich um den Sohn seiner Base sorgte, vergönnte er ihm die Abreibung. Bruno von Reckendorf war überheblich geworden. Da der Junker nach dem Zweikampf vor Wut über seine Niederlage geschäumt hatte, bereitete das erwartungsvolle Grinsen auf seinem Gesicht dem Fürstbischof Sorgen.
Er blickte nach vorne auf die Kämpfer, die ihre Lanzen bereits gebrochen hatten und sich nun im Schwertkampf maßen. Vier Ritter, die der Fürstbischof anhand ihrer Wappen als Freunde des Reckendorfers erkannte, drangen unter Missachtung aller Regeln auf Falko Adler ein. Noch verteidigte sich der Kibitzsteiner verbissen, doch da lenkte einer seiner Gegner das Pferd um ihn herum, um ihn von hinten anzugreifen.
Das Tuscheln der Damen wurde lauter, und der Fürstbischof sah, dass auch Falkos Mutter Marie Adlerin das Geschehen mit besorgtem Gesicht verfolgte. Die Schwestern des Kibitzsteiners schienen außer sich vor Wut über das unritterliche Vorgehen der vier Männer.
Verärgert wollte der Fürstbischof dem Herold das Zeichen geben, den Buhurt zu beenden, da packte etliche Pferdelängen entfernt ein Mitstreiter seinen Gegner mit der gepanzerten Faust und riss ihn aus dem Sattel. Noch während dieser zu Boden fiel, spornte der Kämpe sein Pferd an und eilte Falko Adler zu Hilfe.
Es handelte sich um Peter von Eichenloh, Herr auf Fuchsheim und Magoldsheim und Schwager des Kibitzsteiners. Zwei gegen vier war immer noch ein schlechtes Verhältnis, dachte der Fürstbischof gerade, da drängte ein weiterer Ritter einen von Falkos Feinden ab und deckte ihn mit einem Hagel von Schwertschlägen zu.
»Bravo, Hilbrecht!«, rief Lisa von Henneberg, die Ziehschwester des jungen Kibitzsteiners, und forderte ihren Ehemann Otto auf, ebenfalls zugunsten ihres Bruders einzugreifen.
Doch das war nicht mehr nötig. Der Ritter, den Hilbrecht von Hettenheim angegriffen hatte, sank aus dem Sattel, und die Zuschauer konnten erkennen, dass seine Rüstung sich rot färbte. Auch Peter von Eichenloh hatte einen der Feinde seines Schwagers zu Boden geworfen, während Falko selbst innerhalb weniger Augenblicke die beiden restlichen Gegner niederkämpfte. Als Letzter sank Siffer Bertschmann, der Kastellan auf Reckendorfs Stammburg, aus dem Sattel und blieb rücklings auf der Erde liegen.
Da sich weitere Freunde von Reckendorf zusammenrotteten und Falkos Parteigänger sich um diesen sammelten, forderte der Fürstbischof den Herold auf, den Buhurt abzublasen.
Für Augenblicke sah es so aus, als würden Reckendorfs Anhänger das Fanfarensignal missachten und trotzdem angreifen. Dann aber ließen sie die Schwerter sinken, doch es war nicht zu übersehen, wie aufgebracht sie waren.
»Das geschieht ihnen recht!«, hörte der Fürstbischof Marie Adlerin rufen und begriff, dass diese Worte den vier am Boden liegenden Rittern galten, die nun von der Kampfbahn getragen wurden. Der Leibarzt des Fürstbischofs eilte zu ihnen und befahl, den Rittern die Rüstungen abzunehmen. Als er sich über sie beugte, wirkte seine Miene besorgt.
Auch wenn Gottfried Schenk zu Limpurg hoffte, dass keiner der Männer das Leben verlor, hielt er die Hiebe, die sie erhalten hatten, für voll und ganz verdient. Immerhin hatte er zu diesem Turnier geladen, um seinen Gefolgsleuten und den Gästen die Gelegenheit zu geben, sich im ritterlichen Zweikampf zu üben, und um sich mit ihnen zu beraten, wie sie sich zu dem immer unverschämter werdenden Auftreten des Ansbacher Markgrafen Albrecht Achilles stellen sollten. Einen so blutigen Kampf und unehrliches Handeln hatte er nicht erwartet, insbesondere nicht von seinen engen Gefolgsleuten.
Mit zorniger Miene erhob er sich und stieß seinen Bischofsstab auf den Boden. »Der Kampf ist für heute vorbei. Ich fordere die Herren auf, anschließend ohne Ausnahme beim Bankett im Festzelt zu erscheinen. Dort werde ich mitteilen, was ich von diesem Buhurt halte. Wer sich weigert oder gar das Fest vorzeitig verlässt, wird auf fünf Jahre aus dem Herzogtum Franken verbannt.«
Zwar trug Gottfried Schenk zu Limpurg als Würzburger Fürstbischof aus alter Tradition heraus den Titel eines Herzogs von Franken, doch seine Macht reichte kaum über das Hochstift hinaus. Dennoch war eine solche Strafe schmerzhaft, denn die meisten der hier versammelten Ritter verfügten über Besitz und Verwandte im Würzburger Land, die sie in einem solchen Fall fünf Jahre lang nicht aufsuchen durften. Daher war der Fürstbischof davon überzeugt, dass alle ins Festzelt kommen würden, auch wenn sie so verletzt waren, dass man sie tragen musste.
3.
Falko streckte die Arme aus, damit sein Knappe Frieder ihm die Rüstung abnehmen konnte, und grinste seinen beiden Schwägern und Hilbrecht zu.
»Das war Hilfe zur rechten Zeit! Lange hätte ich mich nicht mehr gegen Bertschmann und seine Kumpane halten können.«
»Du hättest mir wenigstens einen davon überlassen sollen«, beschwerte sich Otto von Henneberg. »So sieht es aus, als hätte ich gezögert, dir beizustehen. Da werden einige gleich wieder die alten Kamellen aufwärmen.«
»Wenn wir heute zusammensitzen und den einen oder anderen Becher miteinander leeren, wird keiner den Schwätzern Glauben schenken«, antwortete Falko lachend, umarmte zuerst Otto, dann Peter von Eichenloh und zuletzt Hilbrecht von Hettenheim. »Ich danke euch allen dreien! Nun lasst uns zum Festzelt gehen. Kämpfen macht durstig.«
»Meine Kehle ist auch schon ganz ausgedörrt«, stimmte Hilbrecht ihm zu.
Seine beiden Schwäger aber sahen die Angelegenheit nicht so locker.
»Du solltest den Vorfall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Immerhin hast du Bruno von Reckendorf gestern nicht nur die Knochen gebrochen, sondern auch seinen Stolz verletzt. Das wird ihn weitaus mehr schmerzen«, warnte Peter von Eichenloh, und Otto von Henneberg stimmte ihm zu. »Die vier sind nicht aus Spaß auf dich losgegangen, und ihre Niederlage wird Reckendorfs Zorn nur noch mehr anheizen. Auf die eine oder andere Weise, so fürchte ich, wird er versuchen, dir zu schaden.«
»Wenn er so scharf darauf ist, hole ich ihn mir vor die Lanze! Und dann werde ich nicht mehr so zart mit ihm umspringen wie gestern.« Bestens gelaunt hängte Falko sich bei Hilbrecht ein und verließ mit diesem zusammen das Zelt, das ihnen während des Festes als Unterkunft diente.
Peter von Eichenloh sah ihm kopfschüttelnd nach. »Der Junge ist leichtsinnig! Ich weiß leider allzu gut, welcher Ärger uns aus dieser Sache erwachsen kann. Geht es hart auf hart, dann kommt es zu einer offenen Fehde mit Reckendorf und seinen Freunden, und die wird in kürzester Zeit halb Franken erfassen.«
»Ich glaube nicht, dass der Fürstbischof dies dulden würde. Aber komm jetzt! Mir ist es lieber, wir sind bei Falko und können ihn bremsen, wenn er den Mund zu sehr aufreißt. Was er Bruno von Reckendorf vorwirft, nämlich dessen Aufgeblasenheit, trifft teilweise auch auf ihn zu. Er bräuchte wirklich einmal einen Gegner, der ihm zeigt, wie es ist, vom Pferd gestoßen zu werden.«
Beiden Männern war klar, dass dies nicht leicht sein würde, denn sie hatten Falko in den letzten Jahren ausgebildet und ihn zu einem Kämpfer heranwachsen sehen, dem kaum einer das Wasser reichen konnte, vielleicht nicht einmal mehr sie selbst.
Als Peter von Eichenloh und Otto von Henneberg nach draußen traten, sahen sie Falko und dessen Freund fröhlich durch die Zeltgasse gehen. Diener und Edelleute winkten ihnen zu, und so manche Matrone schob ihre heiratsfähigen Töchter nach vorne, in der Hoffnung, sie würden dem Junker ins Auge stechen.
»Frau Marie sollte dem jungen Narren möglichst bald eine Frau besorgen, sonst grast er noch auf fremden Weiden«, brummte Peter von Eichenloh ungehalten.
»So wie du?«, spottete Otto von Henneberg.
Es war allgemein bekannt, dass man seinen Freund Peter in jungen Jahren mit einer Nichte des Fürstbischofs im Bett entdeckt hatte, und es hatten viele Jahre vergehen müssen, bis dieser sich wieder im Würzburger Land hatte sehen lassen dürfen.
Peter von Eichenloh wollte möglichst nicht mehr an diese Sache erinnert werden, denn er war seit mehreren Jahren verheiratet und Vater eines prächtigen Sohnes. Daher drohte er Henneberg nicht ganz spaßhaft mit der Faust. »Willst du eine Beule?«
»Ich meine nur, dass wir alles tun sollten, um Falko von Dummheiten abzuhalten. Er hat sich mit Reckendorf und dessen Freunden schon genug Feinde geschaffen. Weitere kann er wahrlich nicht brauchen.« Otto lachte leise und schlang den Arm um die Schulter seines Freundes.
Dieser zuckte zusammen und stieß einen Schmerzenslaut aus.
»Was ist mit dir?«, fragte Otto besorgt.
»Ein Schwerthieb gegen die Schulter – und zwar feige von hinten! Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich dem Reckendorfer und seinen Freunden selbst zu einem Tanz aufspielen, bis ihnen der Atem vergeht. Aber um Falkos willen müssen wir beide uns beherrschen.«
Mit diesen Worten betrat Peter von Eichenloh das Festzelt und wurde sofort von einem Diener empfangen, der ihn und Otto an die für sie vorgesehenen Plätze führte. Zu ihrer beider Bedauern saßen Falko und Hilbrecht etliche Schritte von ihnen entfernt und näher am Hochsitz des Fürstbischofs, der noch nicht erschienen war.
Dieser Umstand verschaffte Peter Zeit, sich im Zelt umzusehen. Die meisten Damen fehlten noch, doch weiter unten am Tisch entdeckte er seine Schwiegermutter. Sie schien in großer Sorge. Immer wieder streifte ihr Blick Falko, und für einen Augenblick sah es so aus, als wolle sie zu ihm hinübergehen. Dann aber ließ sie sich wieder auf die Bank zurücksinken und wandte sich ihrer Stieftochter Hildegard zu, die neben ihr saß.
Ein Fanfarenstoß kündete das Erscheinen des Fürstbischofs an. Gottfried Schenk zu Limpurg trug den Ornat des Reichsfürsten und deutete seinen geistlichen Stand nur durch ein silbernes Kreuz auf der Brust an. Mit harten Schritten, die seine Vertrauten als Ausdruck seiner schlechten Laune zu deuten wussten, ging er zu seinem Stuhl und wartete, bis alle Anwesenden sich erhoben hatten. Dann nahm er Platz. Eine große Lücke an der Tafel machte ihn darauf aufmerksam, dass Bruno von Reckendorf und dessen vier Freunde noch nicht erschienen waren. Dagegen waren andere Ritter, die sich beim Turnier Blessuren zugezogen hatten, längst von ihren Knechten und Knappen hereingeleitet oder gar getragen worden. Obwohl diese Missachtung ihn ärgerte, gab sie ihm zumindest die Gelegenheit, noch ein wenig über die Situation nachzudenken.
Sein Verwandter Reckendorf würde den Gesichtsverlust, den er erlitten hatte, nicht einfach hinnehmen, insbesondere, da seine Abneigung gegen Falko Adler einen weiteren Grund hatte, von dem der Kibitzsteiner nichts ahnte. Gottfried Schenk zu Limpurg biss die Zähne zusammen, um seinem Ärger nicht laut Ausdruck zu geben. Der junge Narr, wie er Bruno von Reckendorf im Stillen nannte, hätte sich in seine Pläne fügen sollen, statt Falko Adler herauszufordern. Jetzt herrschte offene Feindschaft zwischen beiden Sippen, und es würde schwer für ihn werden, sein Vorhaben doch noch in die Tat umzusetzen.
Der Blick des Fürstbischofs blieb auf Falko haften. Ein prachtvoller Bursche, dachte er. Zwar war der junge Ritter nur etwas über mittelgroß und schlank wie eine Tanne, aber ein geschickter und schneller Kämpfer. Allerdings hatte er ein arg hübsches Gesicht, das viele Männer dazu verführte, ihn für weibisch zu halten und daher zu unterschätzen. Gerade das durfte man bei diesem Kampfhahn nicht.
Gottfried Schenk zu Limpurg war froh, Falko ebenso wie dessen Schwäger Peter von Eichenloh und Otto von Henneberg unter seinen Gefolgsleuten zu wissen, denn der Appetit, den sein Nachbar Albrecht Achilles von Brandenburg-Ansbach auf neue Ländereien entwickelte, war schier unersättlich. Dazu strebte der Ansbacher mit aller Macht nach dem Titel eines Herzogs von Franken, der seit alters den Würzburger Fürstbischöfen vorbehalten war.
Mit diesem gefährlichen Nachbarn an seiner Flanke war es für den Fürstbischof unerlässlich, in seinem Herrschaftsbereich für Frieden und Ruhe zu sorgen. Mit beidem aber würde es schnell vorbei sein, wenn die beiden jungen Ritter ernsthaft aneinandergerieten und ihre Freunde und Verbündeten in den Streit hineinzogen.
Mit einem Mal entstand am Zelteingang ein solcher Lärm, dass Gottfried Schenk zu Limpurg aus seinem Grübeln gerissen und darauf aufmerksam wurde, dass es seinem Verwandten Reckendorf beliebte, samt Begleitung zu erscheinen.
Die langen Mienen der fünf jungen Männer verdüsterten sich noch mehr, als Falko und sein Freund Hilbrecht ihnen herausfordernde Blicke zuwarfen. Dem Fürstbischof war klar, dass die Jünglinge spätestens am nächsten Tag erneut aufeinander losgehen würden. Dann mochte es zu Schlimmerem kommen als zu ein paar Prellungen und verletztem Stolz. Ein Toter aber würde unweigerlich zu einer Fehde führen, die auch er nicht mehr unterbinden konnte.
Gottfried Schenk zu Limpurg überlegte verzweifelt, wie er diese Angelegenheit bereinigen konnte, ohne dass eine der beiden Gruppen ihm Parteinahme vorwerfen konnte. Dabei drängten weitaus schwerwiegendere Probleme: Sein Freund Foscarelli war ermordet worden, und er befürchtete, dass dahinter die Absicht stand, König Friedrichs Pläne zu sabotieren. Da der Tod des Kardinals ihn jener Person beraubt hatte, die ihn über die Lage in der Heiligen Stadt auf dem Laufenden hielt, benötigte er dringendst neue Augen und Ohren am Heiligen Stuhl.
Ein junger Priester, der unten an der Tafel saß, wie es sich für einen nachrangigen Kleriker gehörte, brachte den Fürstbischof auf eine Idee. Zuerst glitt sein Blick zu Eichenloh, doch als dieser sich mit schmerzverzerrter Miene an die Schulter griff, richtete er seine Aufmerksamkeit auf Falko. Es wäre nicht die schlechteste Lösung, den jungen Adler vorerst aus dem Würzburger Land zu entfernen. In der Zeit seiner Abwesenheit konnte er Reckendorf dazu bewegen, sich seinen Plänen zu beugen.
Zufrieden mit der Entscheidung, die er gerade getroffen hatte, nahm Gottfried Schenk zu Limpurg seinen Pokal von einem Pagen entgegen und trank seinen Gästen zu.
4.
Ich weiß nicht, was Reckendorf mehr schmerzt: sein Rücken, wo er sich gestern beim Sturz vom Pferd verletzt hat, oder sein Stolz«, raunte Hilbrecht von Hettenheim Falko zu.
Dieser ergriff grinsend seinen Becher und trank einen Schluck Wein. »Ich glaube, das eine nicht weniger als das andere. Den Stoß, den ich ihm verpasst habe, wird er so rasch nicht vergessen.«
»Er wird ihn dir auch nicht vergeben!« Hilbrecht wies auf die zornbleiche Miene des jungen Ritters, der in sichtlicher Erregung seinen Weinbecher zusammendrückte. »Wenn der könnte, wie er wollte, wärst du ein toter Mann!«
Falkos Blick galt jedoch weniger Reckendorf als dessen Freunden. Die vier hatten ihn beim Buhurt gegen alle Regeln gemeinsam angegriffen, und das würde er ihnen nicht vergessen. »Morgen beim Tjost werde ich mir jeden Einzelnen von ihnen vornehmen. Am liebsten wäre es mir, Reckendorf könnte ebenfalls wieder auf seinen Gaul steigen. Aber dazu ist er wahrscheinlich zu feige.«
»Ich habe einiges über Reckendorf gehört, und nichts davon deutet darauf hin, dass er das Wort Feigheit überhaupt kennt. Er trägt nicht zu Unrecht den Ehrentitel des besten Ritters von Franken«, wandte Hilbrecht ein.
Falko stieß einen Laut aus, der an das Knurren eines gereizten Hundes erinnerte. »Er trug diesen Titel, Hilbrecht! Nicht zuletzt mein Lanzenstoß gestern hat allen gezeigt, dass er dieser Ehre nicht wert ist.«
»Trotzdem solltest du dich jetzt nicht selbst für den besten Ritter im Frankenland halten. Denke nur an deine beiden Schwäger. Peter von Eichenloh ist der tapferste Krieger, den ich kenne, und Otto von Henneberg steht ihm kaum nach.«
Hilbrechts Warnung war berechtigt, dennoch stieß Falko ein Zischen aus. »Jeder von uns, dich eingeschlossen, ist besser als dieser Ritter Aufgeblasen!«
Da er seine Stimme diesmal nicht mäßigte, hörten etliche Männer am Tisch seinen Ausruf, darunter auch der Fürstbischof und Reckendorf. Der Junker wollte aufspringen und Falko zur Rede stellen, sank aber mit einem Aufstöhnen auf seinen Stuhl zurück und musste die Zähne zusammenbeißen, um nicht vor Schmerz zu schreien. Der Sturz vom Pferd hatte ihn schwerer verletzt, als er sich eingestanden hatte. Dem Arzt zufolge stand eine Heilung auf Messers Schneide, und er konnte von Glück sagen, wenn er nicht zum hilflosen Krüppel wurde.
Mit äußerster Selbstbeherrschung zwang er sich eine gleichmütige Miene auf und trank einen Schluck Wein. »Ich werde morgen nicht aufs Pferd steigen können«, sagte er leise zu Siffer Bertschmann. »Aber dann wird dieser Lümmel da drüben mir Feigheit vorwerfen, und viele Narren werden es nachplappern. Der Teufel soll den Kibitzsteiner holen!«
»Ich glaube nicht, dass Satan in eigener Person morgen früh gewappnet und gespornt erscheint, um dieses Jüngelchen herauszufordern. Das müssen wir schon selbst erledigen«, antwortete Bertschmann.
»Wenn Ihr den Kerl in den Dreck stoßt, verspreche ich Euch eine meiner Burgen als Eigenbesitz und werde außerdem dafür Sorge tragen, dass Ihr meine Schwester nach deren Rückkehr von ihrer Pilgerfahrt nach Rom heiraten könnt.« Mit diesen Worten streckte Reckendorf Bertschmann die Hand hin, die sein Kastellan ohne Zögern ergriff.
»Das ist sehr großzügig von Euch, Junker Bruno! Dafür verspreche ich Euch, dass die Knechte Falko Adlers Überreste hinterher mit dem Besen zusammenkehren können.« In seiner Freude legte auch Bertschmann seiner Stimme keine Zügel an und war daher im ganzen Zelt zu hören.
Reckendorf grinste trotz seiner Schmerzen. Da er seinen Freund kannte, wusste er, dass dieser alles in seiner Macht Stehende tun würde, um Falko Adler zu demütigen. Obwohl Bertschmann aus einer ritterlichen Familie stammte, verfügte er über keinerlei Besitz und war gewiss nicht der Mann, dem er seine Halbschwester unter normalen Umständen zur Frau gegeben hätte. Doch nun brauchte er einen Ansporn für seinen Kastellan, damit dieser den Kibitzsteiner in den Staub warf. Zudem würde Margaretes Hochzeit mit Bertschmann gewisse Pläne des Fürstbischofs vereiteln.
Gottfried Schenk zu Limpurg spürte die Spannung, die sich zwischen den verfeindeten Lagern aufgebaut hatte, und beschloss einzugreifen. Auf einen Wink von ihm trat sein Herold vor und forderte die Anwesenden auf zu schweigen, da Seine Durchlauchtigste Hoheit das Wort an sie richten wolle.
Das Murmeln und Zischeln im Zelt erstarb, und alle sahen erwartungsvoll den Fürstbischof an. Dieser ließ seinen Blick noch einmal über seine Gäste schweifen, die bereits zu einem guten Teil Partei für eine der beiden Seiten ergriffen zu haben schienen, und klopfte dann mit der flachen Hand auf den Tisch.
»Ich habe die Ritter und edlen Herren zu diesem Fest eingeladen, um ihnen die Gelegenheit zu bieten, sich im ehrlichen Zweikampf zu messen. Einige der Teilnehmer haben es jedoch gewagt, gegen die Regeln zu verstoßen und zu viert gegen einen einzelnen Mann anzureiten.«
Gottfried Schenk zu Limpurg legte eine kleine Pause ein und sah Falko Adler und den jungen Hettenheimer grinsen. Sie schienen zu glauben, er würde nun ihre Gegner bestrafen. Doch so einfach, wie die beiden Heißsporne es erwarteten, ließ sich das Problem nicht lösen.
»Um zu zeigen, dass ein solches Verhalten eines fränkischen Ritters unwürdig ist, habe ich beschlossen, die daran beteiligten Ritter einschließlich der Herren Bruno von Reckendorf, Falko Adler zu Kibitzstein, Hilbrecht von Hettenheim, Peter von Eichenloh und Otto von Henneberg die weitere Teilnahme an diesem Turnier zu untersagen!«
Kaum hatte der Fürstbischof das gesagt, sprang Falko voller Zorn auf.
»Das ist ungerecht!«, rief er. »Die haben mich zu viert angegriffen. Wären meine Freunde mir nicht zu Hilfe geeilt, hätten sie mich hinterrücks erschlagen. Diese Männer müssen bestraft werden. Nicht wir!«
Hilbrecht nickte heftig, und Otto von Henneberg war ebenfalls versucht, sich lauthals zur Wehr zu setzen. Dann aber sah er Peter von Eichenloh an, der wegen seiner Verletzung am nächsten Tag nicht in den Sattel steigen und kämpfen konnte, und schwemmte seinen Ärger mit einem kräftigen Schluck Wein hinunter.
»Es ist ganz gut, wenn der Junge morgen zusehen muss. Dann lernt er wenigstens, sich zu beherrschen«, sagte Eichenloh zufrieden.
Seine Schwiegermutter schien ebenso zu denken, denn sie zwinkerte ihm zu. Seine Frau Trudi hingegen sah so aus, als würde sie am liebsten selbst das Schwert ergreifen und auf die Gegner ihres Bruders losgehen.
»Ich bin es nicht gewohnt, in meiner eigenen Halle oder in diesem Fall meinem Zelt kritisiert zu werden«, antwortete Gottfried Schenk zu Limpurg scharf auf Falkos Einwand. »Wenn ich eine Entscheidung treffe, habe ich meine Gründe dafür. Merkt Euch das, Falko Adler! Und jetzt setzt Euch und benehmt Euch, wie es einem Edelmann gebührt.«
An dieser Zurechtweisung hatte Falko zu schlucken und blickte unwillkürlich zu seiner Mutter hinüber. Maries Miene verriet, dass sie dem Fürstbischof am liebsten für ein paar Heller die Meinung sagen würde. Nur Peter von Eichenloh war erleichtert, und das nicht nur seiner geprellten Schulter wegen. In seinen Augen hatte der Zwist zwischen Falko und Reckendorf bereits Formen angenommen, deren Folgen nicht abzusehen waren.
Gottfried Schenk zu Limpurg sah Falko immer noch tadelnd an. »Ich hindere Euch nicht am morgigen Kampf, weil Ihr mich erzürnt habt, Kibitzstein, sondern, weil ich einen Auftrag für Euch habe. Ihr werdet meiner Nichte Elisabeth auf ihrer Reise nach Rom Geleit bieten. Dort soll sie in Zukunft als Äbtissin der frommen Damen von Tre Fontane wirken. Der brave Priester Giso wird sich Euch anschließen, denn er muss in Rom Botschaften für mich überbringen, und Junker Hilbrecht mag ebenfalls mit Euch reiten, wenn es sein Wille ist.«
Falkos Miene hellte sich auf, und er versetzte Hilbrecht einen Stoß. »Du kommst doch mit, oder?«
Erst dann dämmerte es ihm, dass Herr Gottfried eine Antwort erwartete. Rasch stand er auf und verneigte sich in Richtung des Fürstbischofs. »Ich bin Euer ergebener Diener, Durchlauchtigster Herr!«
»Wenigstens teilweise«, schränkte Gottfried Schenk zu Limpurg ein und spielte damit auf die Tatsache an, dass der Kernbesitz der Kibitzsteiner Sippe als reichsfreie Herrschaft galt. Allerdings besaß die Witwe auf Kibitzstein, wie Falkos Mutter genannt wurde, einige Ländereien und sogar ganze Dörfer im Hochstift Würzburg und war ihm für diese dienstpflichtig.
Marie Adlerin nickte beifällig. Nicht umsonst hatte sie in der Vergangenheit hart für ihre Rechte und die ihres Sohnes gekämpft und dabei auch dem Fürstbischof die Stirn geboten. Mittlerweile war ihr Verhältnis zu Würzburg eher entspannt zu nennen, denn Gottfried Schenk zu Limpurg hatte sich als angenehmer Lehnsherr erwiesen. Daher haderte sie auch nicht damit, dass er ungefragt über ihren Sohn verfügte, denn auch sie war der Meinung, dass es für den Frieden im Hochstift besser war, wenn Falko die nächsten Monate außer Landes verbrachte. Bis dorthin, so hoffte sie, würde sich der Streit zwischen ihm und Reckendorf erledigt haben.
Im Gegensatz zu den Kibitzsteinern und ihren Freunden, die mit dem Spruch des Fürstbischofs zufrieden waren, haderte Bruno von Reckendorf mit Herrn Gottfrieds Entscheidung. Er empfand Falkos Bestallung zum Reisemarschall der zukünftigen Äbtissin des Frauenklosters von Tre Fontane als weiteren Schlag ins Gesicht. Während der Kibitzsteiner bei diesem Auftrag Ruhm und Ehre erwerben konnte, waren seine Freunde und er selbst als Turnierstörer gebrandmarkt und würden bei späteren Veranstaltungen Spott und falsche Verdächtigungen über sich ergehen lassen müssen. Vielleicht würde man sie sogar auch von der Teilnahme an anderen Turnieren ausschließen, bis Gottfried Schenk zu Limpurg sie wieder zu einem der von ihm abgehaltenen zuließ. Das konnte bis ins nächste Jahr hinein dauern, und so lange würde er mit diesem Makel leben müssen.
5.
Während es Bruno von Reckendorf gelang, seine Gedanken für sich zu behalten, vermochte Siffer Bertschmann sich nicht zu beherrschen und drohte Falko mit der Faust. »Das wirst du mir noch bezahlen, Wirtslümmel!«
Im Zelt wurde es so still, als hätte ein Zauber alle Geräusche erstickt. Die Menschen wussten, dass Falkos Vater vor mehr als zwanzig Jahren von Kaiser Sigismund das reichsfreie Lehen Kibitzstein erhalten hatte, doch über dessen Jugend war wenig bekannt. Gerüchte, Michel Adler wäre als Sohn eines Bierbrauers geboren worden und Falkos Mutter gar eine Hure gewesen, gab es zwar, doch selbst jene, die mit den Kibitzsteinern im Streit lagen, wagten es nicht, diese Verdächtigungen offen zu äußern. Immerhin hatte Frau Marie in Peter von Eichenloh einen Schwiegersohn, der seine Abstammung auf deutsche Könige und römische Kaiser zurückführen konnte. Auch ihr zweiter Schwiegersohn Otto von Henneberg zählte zu einem uralten, hochadeligen Geschlecht.
Selbst Falko, der seinen Vater früh verloren hatte, war die Herkunft seiner Eltern nur andeutungsweise bekannt. Aber das zählte in dieser Situation nicht. Zuerst stand er starr. Dann wurde er leichenblass, und er griff zum Schwert. »Ich pflege meine Schulden sofort zu zahlen, Bertschmann. Daher werdet Ihr mir umgehend Genugtuung geben!«
»Ihr beide gebt jetzt Ruhe!«, peitschte die Stimme des Fürstbischofs durch den Raum.
Falko drehte sich mit flackernden Augen zu ihm um. »Durchlauchtigster Herr, ich lasse mich nicht beleidigen!«
»Bertschmann ist betrunken! Bringt ihn hinaus, damit er seinen Rausch ausschlafen kann. Morgen mag er sich bei Euch entschuldigen. Tut er es nicht, wird er Euch nach Eurer Rückkehr aus Rom zur Verfügung stehen.«
Gottfried Schenk zu Limpurg war es leid, immer wieder Frieden zwischen den Streithähnen erzwingen zu müssen, und er nahm sich vor, ein ernstes Wort mit Reckendorf zu sprechen. Fast bedauerte er es, dass er ihn nicht auch mit einem Auftrag wegschicken konnte. Doch der Arzt hatte ihm mitgeteilt, dass sein Neffe noch einige Wochen an den Nachwirkungen des Sturzes leiden würde. Sobald Junker Bruno genesen war, würde er dafür sorgen, dass zwischen Reckendorf und Kibitzstein Frieden geschlossen wurde, und wenn er die beiden Streithähne so lange in einem Kerker nebeneinander anketten lassen musste, bis sie sich vertrugen. Wahrscheinlich wäre es am besten, wenn er Bertschmann und Hilbrecht von Hettenheim mit ihnen einsperrte. Nun, darum würde er sich später zu kümmern haben. Er wandte sich Falko zu.
»Meine Nichte wird in fünf Tagen in Würzburg erscheinen und am nächsten Tag unter Eurem Schutz weiterreisen. Euch bleibt daher genug Zeit, nach Kibitzstein zurückzukehren und Euch auszurüsten. Ich erwarte Euch spätestens am Abend des fünften Tages von heute an.«
»Ich werde zur Stelle sein!« Falko begriff durchaus, dass der Fürstbischof ihm einen Vorwand bot, während des weiteren Turniers nicht Zuschauer spielen zu müssen, und war ihm dankbar. Es wäre ihm schwergefallen, auf der Tribüne zu hocken, während andere Ritter sich auszeichnen konnten.
Da sich der Fürstbischof gerade seinen Weinkelch füllen ließ, wandte Falko sich an Hilbrecht. »Die Reise wird ein Heidenspaß! Wir werden Italien sehen, das Juwel in der Krone der Welt, und vielleicht sogar vom Heiligen Vater selbst die Absolution erhalten.«
»Du hast es ja auch nötig, um Vergebung zu bitten«, spottete sein Freund, der sich nicht weniger als Falko auf diese Reise freute.
Gottfried Schenk zu Limpurg bemerkte den Überschwang der jungen Burschen und hoffte, dass ihre Vorfreude die beiden nicht dazu verleitete, unvorsichtig zu sein. Dann aber schüttelte er den Kopf. Man konnte Falko Adler auf Kibitzstein vieles nachsagen, doch bisher hatte der junge Mann es noch nie an der nötigen Umsicht fehlen lassen. Dennoch beschloss er, ihm einen Trupp erfahrener Reisigen mitzugeben.
»Trinkt, meine Gäste! Die Knechte sollen nun das Mahl auftragen. Kämpfen macht hungrig, und ihr wollt morgen ja nicht entkräftet vom Pferd fallen.«
Lachen antwortete auf die launigen Worte. Selbst Falko schmunzelte und zwinkerte dann seinen Schwestern zu. Trudi winkte kurz, während Lisa fröhlich lächelte. Sie mochte Falko, auch wenn dieser den Worten ihres Mannes Otto von Henneberg zufolge noch wie junger Wein war, der erst gären musste. Hildegard hingegen blieb still neben ihrer Stiefmutter sitzen. Als einzige von Maries Töchtern war sie noch unverheiratet und hatte bereits den Wunsch geäußert, als Nonne ins Kloster zu gehen. Zwar hielten ihre Schwestern nichts davon, doch Marie wollte Hildegard die freie Wahl lassen.
Marie blickte ebenfalls zu ihrem Sohn hinüber, der den Ausschluss vom Turnier und die Zurechtweisung durch den Fürstbischof überwunden zu haben schien, und machte sich ihre Gedanken. Gerne ließ sie ihn nicht auf diese Reise gehen. Immerhin würde sie in weniger als zwei Jahren sechzig Jahre alt werden, und da konnte es dem Herrgott jederzeit gefallen, sie abzuberufen. Doch sie wollte nicht sterben, wenn ihr Sohn in der Fremde weilte.
Sie wusste jedoch selbst, dass sie die Entscheidung des Fürstbischofs nicht rückgängig machen konnte. Falko war als Besitzer etlicher Herrschaften auf Würzburger Gebiet dessen Lehensmann und musste für Bischof Gottfried solche Dienste leisten. Außerdem mehrte es seinen Ruhm, wenn er die Äbtissin unversehrt in ihrem römischen Kloster ablieferte.
Sie nahm sich vor, Falko ins Gewissen zu reden, damit er Vorsicht walten ließ. Zudem würde sie, sobald er zurück war, darauf drängen, dass er sich ein Weib nahm. Zwar unterstützte Hildegard sie auf Kibitzstein, doch über kurz oder lang würde ihre Stieftochter entweder ins Kloster gehen oder vielleicht doch heiraten. Dann benötigte Kibitzstein eine Herrin, die das Gesinde anleitete und die Wirtschaftshöfe überwachte. Bei ihrem letzten Besuch in Würzburg hatte der Fürstbischof bereits anklingen lassen, er werde ihr bei der Suche nach einer passenden Braut behilflich sein. Dies war ihr recht, denn eine von Gottfried Schenk zu Limpurg gestiftete Ehe bedeutete nicht nur eine Verbindung mit einem eingesessenen Adelshaus, sondern auch eine stattliche Mitgift, die den eigenen Reichtum angenehm mehren würde.
Zufrieden mit diesen Aussichten wandte Marie sich ihren Töchtern zu. Trudi hatte im letzten Jahr ihren ersten Sohn geboren und führte als Peter von Eichenlohs Ehefrau ein glückliches Leben. Für ihre eigene Tochter hatte der Himmel wahrlich gut gesorgt. Doch auch bei Lisa konnte sie nicht klagen. Zu ihrer und wohl auch aller Überraschung hatte ausgerechnet Otto von Henneberg um sie geworben. Er war ein tapferer Ritter aus gräflichem Geschlecht, der zudem hoch in der Gunst des Fürstbischofs stand. Ohne die weiße Narbe, die sich quer über sein Gesicht zog, wäre er ein hübscher Mann gewesen. Ihrer Ziehtochter Lisa gefiel er so, wie er aussah, und sie selbst fand ihn nach anfänglichen Bedenken recht sympathisch. Genau wie Peter von Eichenloh war auch er stets bereit, ihr beizuspringen, wenn es Probleme gab.
Marie hätte zufrieden sein können, doch als sie kurz zu Reckendorf hinübersah, überkam sie ein ungutes Gefühl. Der Mann zerfraß sich vor Rachsucht, und das nur, weil er in einem ehrlichen Stechen aus dem Sattel gehoben worden war. Diese Haltung hielt sie für verderblich, und sie nahm sich vor, alles zu tun, um ihren Sohn vor Schaden zu bewahren.
Bei dem Gedanken lachte sie über sich selbst. Falko war gewiss in der Lage, auf sich selbst aufzupassen. Zwar nannte sogar sein Freund Hilbrecht ihn einen Tollkopf, doch er hatte früh gelernt, was Gefahr hieß und wie ihr zu begegnen war. Außerdem würde er während der nächsten Monate fern von hier weilen, und bis zu seiner Rückkehr mochte Bruno von Reckendorfs gekränkte Eitelkeit vergessen sein.
6.
Da er von der weiteren Teilnahme am Turnier ausgeschlossen war und Gottfried Schenk zu Limpurg ihm Urlaub gewährt hatte, hielt Falko nichts mehr auf dem Fest. Am nächsten Morgen ließ er sein Pferd satteln und machte sich auf den Weg zu seiner heimatlichen Burg.
Hilbrecht von Hettenheim begleitete ihn. Als Jüngster von vier Brüdern hatte er nicht viel Erbe zu erwarten und war daher froh, in das Gefolge des Fürstbischofs aufgenommen zu werden. Nun grinste er übermütig und wies mit einer unbestimmten Geste nach Süden.
»Das wird eine schöne Reise werden, Falko. Ich habe viel von Italien erzählen hören. Es heißt, es gäbe kein schöneres Land auf dieser Welt. Die Sonne scheint das ganze Jahr über warm, das Obst ist süß und saftig und der Wein traumhaft gut. Und dann erst die Mädchen! Sie sollen schön und feurig sein, nicht so schamhaft wie unsere Frauen.«
»Nicht jede ist schamhaft«, spottete Falko und dachte dabei an die Ehefrau eines schon älteren Ritters, die ihm bei seinem letzten Aufenthalt auf der Feste Marienberg schöne Augen gemacht hatte. Nur mit Mühe war es ihm gelungen, ihren Avancen auszuweichen, ohne sie zu beleidigen. Allerdings reiste er seitdem seltener nach Würzburg, denn er wusste, dass die Schöne ihr Vorhaben zwar aufgeschoben, aber nicht aufgehoben hatte. Er mochte ihren Ehemann jedoch zu sehr, um ihm Hörner aufzusetzen. Auch wenn er es für eine Dummheit hielt, sich mit fünfzig ein um über dreißig Jahre jüngeres Weib zu nehmen, wollte nicht er derjenige sein, der in diese Ehe einbrach.
»Es ist wirklich gut, dass wir jetzt nach Rom reisen«, sagte er nachdenklich.
»Es fällt dir wohl schwer, weiterhin den Ritter Tugendsam zu spielen?«, spottete Hilbrecht, der seine Gedanken gelesen zu haben schien.
»Das musst du gerade sagen! Wenn du eine junge, hübsche Dame vor dir siehst, fängst du zu stottern an und bringst kein gerades Wort heraus.« Falko versetzte seinem Freund vom Sattel aus einen leichten Stoß und trabte an.
Hilbrecht schloss gleich wieder zu ihm auf. »Es kann nicht jeder so ein geschmiertes Maul haben wie ein Pfaffe. Wenn ich da an Giso denke! Der kann den ganzen Tag predigen, ohne auch nur ein Mal Atem zu holen.«
»So schlimm ist Giso auch wieder nicht«, verteidigte Falko den jungen Priester. »Auf jeden Fall ist es schön, dass er mit uns kommt. Mit ihm wird es gewiss lustig. Außerdem kann er neben seinem Latein auch ein wenig von diesem welschen Gebrabbel, das man in Italien spricht. Ich wäre da vollkommen verloren.«
»Das glaubt dir doch kein Mensch! Ich wette mit dir, wenn du eine Frau in Italien nur anschaust, bringt die dir alles bei, was du dir nur wünschst …«
Obwohl Falko sein bester Freund war, schwang Neid in Hilbrechts Stimme mit, und er wünschte sich, ebenso unbefangen auftreten zu können. Zu seinem Leidwesen aber hatte es ein hübscher Bursche mit himmelblauen Augen leichter, die Herzen anderer Menschen zu gewinnen. Er selbst war etwas kleiner als Falko, dafür um einiges wuchtiger gebaut und mit einem kantigen Gesicht geschlagen, das er in trüberen Augenblicken sogar derb nannte. Seine Augen waren so nichtssagend braun wie seine Haare, und seine Schüchternheit und sein Hang zum Stottern machten es ihm schwer, auf Leute zuzugehen und sie für sich zu gewinnen.
Bevor er jedoch weiter mit sich und seiner Erscheinung hadern konnte, klang Falkos Stimme auf. »Reden wir von etwas anderem.«
»Und wovon?«
»Von der Dame, die wir nach Italien geleiten sollen. Schätze, sie wird über vierzig sein, eingetrocknet wie eine Weinbeere und bei jedem derben Wort zusammenzucken. Wir werden uns zusammennehmen müssen, mein Freund, damit sie uns nicht zu einem Ave-Maria nach dem andern verdonnert, um all die Sünden abzubüßen, die nur in ihrer Einbildung bestehen.«
Falko brachte diese Zukunftsaussichten so drollig hervor, dass Hilbrecht hellauf lachen musste. »Dann halten wir uns eben an Giso. Der verträgt es, wenn man ehrliches Deutsch mit ihm spricht.«
»Du sagst es! Trotzdem müssen wir auf die Äbtissin Rücksicht nehmen. Am besten ist es, du reitest neben ihrer Sänfte her. Da du sowieso kaum ein Wort zwischen den Zähnen hervorbringst, kannst du sie auch nicht erzürnen.«
Diesmal versetzte Hilbrecht Falko einen Stoß und war weg, bevor dieser sich revanchieren konnte. Während ihres weiteren Rittes spotteten sie immer wieder über die Nichte des Fürstbischofs, und Falko begann schließlich, mit künstlich hoher Stimme so geziert zu reden, wie er es sich bei der Dame vorstellte. Hilbrecht bog sich vor Lachen, und als sie zu Mittag beim Wirt in Schnepfenbach einkehrten und sich ein Stück saftigen Braten schmecken ließen, hatten sie ihren Streit mit Bruno von Reckendorf und dessen Gefährten vergessen. Stattdessen weilten ihre Gedanken in einem paradiesischen Land, in dem aus den Brunnen Wein statt Wasser floss und wunderschöne Mädchen tapferen Rittern Blumenkränze flochten.
7.
Nach dem Abschluss des Turniers ritt Gottfried Schenk zu Limpurg zurück nach Würzburg und ruhte sich von den Anstrengungen des Festes aus. Am dritten Tag ließ er Giso rufen.
Der junge Priester trat zögernd in das Schlafgemach des Fürstbischofs, der mit aufgerichtetem Oberkörper in seinem Bett saß und in einem Stoß Papiere blätterte. Den hohen Herrn anzusprechen, wagte er nicht, und so blieb er an der Tür stehen.
Es dauerte eine Weile, bis Herr Gottfried ihn zu bemerken schien. »Komm näher, Bruder in Christo!«
Die freundliche Anrede verwirrte Giso. Immerhin entstammte Gottfried Schenk zu Limpurg einem uralten Adelsgeschlecht und trug zudem den Titel eines Fürstbischofs von Würzburg und eines Herzogs von Franken. Dazu nahmen viele seiner Verwandten hohe Ämter ein. Er hingegen war der Sohn eines schlichten Freibauern, und nur die Gunst der Herrin zu Kibitzstein hatte es ihm ermöglicht, zu studieren und Priester zu werden. Nun trat er zwei weitere Schritte auf das Bett zu und blieb erneut stehen.
Gottfried Schenk zu Limpurg musterte ihn kurz und wies dann auf die Weinkanne, die auf einer Anrichte stand. »Du kannst mir einen Becher Wein einschenken und den zweiten Becher für dich nehmen.«
Giso wusste, dass der Fürstbischof selbst Bürger und Leute von Adel empfing, ohne diesen einen Trunk reichen zu lassen. Bei einem einfachen Priester wie ihm war ein solches Angebot daher verwunderlich. Doch er griff, ohne zu zögern, zu, um den hohen Herrn nicht zu verärgern, und reichte Herrn Gottfried den vollen Becher. »Auf Eure Gesundheit, Euer Durchlaucht, wenn ich so sagen darf.«
»Du darfst!« Auf den Lippen des Fürstbischofs erschien ein Lächeln, dem es jedoch an Fröhlichkeit fehlte. »Du wirst dich vielleicht gefragt haben, weshalb ich ausgerechnet dich nach Rom schicken will?«
»Nun, Herr, ich … Es steht mir nicht zu, Eure Entscheidungen zu hinterfragen«, antwortete Giso.
»In diesem Fall solltest du es aber tun. Ich schicke dich nämlich nicht zum Heiligen Stuhl, um dir einen Gefallen zu tun oder dich zu protegieren, sondern um jemanden dort zu haben, der Augen und Ohren für mich offen hält. Das muss ein Mann sein, der den Kopf nicht allein deswegen auf den Schultern trägt, um einen Hut darauf zu setzen.«
Herrn Gottfrieds unverblümte Worte überraschten Giso, und er wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Der Fürstbischof schien keine Antwort zu erwarten, denn er trank einen Schluck und fuhr dann fort. »Es geht um eine sehr wichtige Angelegenheit, mein Freund. Komm näher, damit ich nicht so laut reden muss!« Gottfried Schenk zu Limpurg winkte Giso nahe heran, dass dessen Ohr beinahe seinen Mund berührte.
»Du wirst in Rom ein Natternnest vorfinden! Verrat und Mord sind an der Tagesordnung, und jeder sucht seine Vorteile auf Kosten der anderen zu mehren. Die Franzosen spielen dort munter mit, dazu noch weitere Intriganten, die ich nicht kenne. Du wirst herausfinden müssen, wer unsere Feinde sind, und deren Einfluss bekämpfen. Es geht um sehr viel! König Friedrich III. will zu Beginn des nächsten Jahres nach Rom reisen, um dort seine Braut in Empfang zu nehmen und zu heiraten. Außerdem ist geplant, dass Seine Heiligkeit, Nikolaus V., ihn zum römischen Kaiser krönen soll. Dies gefällt sehr vielen nicht, und daher werden diese alles daransetzen, um die Zeremonie zu verhindern – notfalls auch durch Friedrichs Ermordung.«
Giso fehlten die Worte. Weshalb schickt der Fürstbischof ausgerechnet mich nach Rom, einen kleinen Priester ohne jede Verbindung zu wichtigen Leuten?, fragte er sich. Die Aufgabe, die ihm gerade gestellt worden war, schien ihm unerfüllbar. Doch ein Blick in das verbissen wirkende Gesicht seines Herrn ließ ihn von jedem Widerspruch Abstand nehmen.
»Die beiden jungen Ritter, die dich und meine Nichte nach Rom begleiten, sollen bis zu Friedrichs Besuch dort bleiben und dich unterstützen. Es ist notwendig, dass du Männer bei dir hast, die auf deinen Rücken achtgeben. Ein Freund von mir, Kardinal Foscarelli, wurde vor einiger Zeit ermordet. Es war bekannt, dass er die Sache des Königs am Heiligen Stuhl vertrat und an der Einigung zwischen Herrn Friedrich und dem Papst an wichtiger Stelle beteiligt war. Finde seine Mörder und führe sie ihrer gerechten Strafe zu, mein Sohn! Ich werde es dir reichlich lohnen!«
Foscarellis Mörder zu finden und richten zu lassen war der letzte Dienst, den Gottfried Schenk zu Limpurg seinem ermordeten Freund erweisen konnte. Da die Schurken ganz gewiss auf der Seite der Feinde des Königs zu finden waren, würden Giso, Falko und Hilbrecht irgendwann auf sie stoßen, und dann war es gut, wenn seine Abgesandten vorgewarnt waren. Der Fürstbischof erteilte dem jungen Priester noch einige Ratschläge, klopfte ihm zuletzt aufmunternd auf die Schulter und forderte ihn auf, ihm noch einmal den Becher zu füllen.
»Übrigens ist meine Nichte Elisabeth bereits gestern Abend in Würzburg eingetroffen. Hier kann sie sich noch ein wenig erholen, bevor sie mit dir und den beiden jungen Rittern nach Rom weiterreist. Ich lasse dich zu ihr führen, damit ihr euch kennenlernt.« Der Fürstbischof nahm die Glocke, die auf dem Tischchen neben seinem Bett stand, und läutete.
Kurz darauf erschien ein Diener, der zu wissen schien, was sein Herr von ihm wollte, denn er verbeugte sich und forderte Giso auf, mit ihm zu kommen.
Der junge Priester erinnerte sich gerade noch rechtzeitig daran, dass auch er sich vor dem Fürstbischof zu verbeugen hatte. Dann folgte er dem Diener, bis dieser vor einer Tür stehen blieb und sie für ihn öffnete.
Als Giso eintrat, sah er sich zwei älteren Nonnen in dunklen Gewändern gegenüber und überlegte schon, welche von ihnen die Äbtissin sein könnte. Da fiel sein Blick auf eine Dame, die auf einem bequemen Stuhl saß und ihm interessiert entgegensah, und er musste schlucken. Er wusste nicht, welche Vorstellungen sein Freund Falko sich von der Nichte des Fürstbischofs machte, doch auf jeden Fall stand diesem eine faustdicke Überraschung bevor.
8.
Im fernen Rom saß am gleichen Tag Francesca Orsini an einer reich gedeckten Tafel und unterhielt sich angeregt mit ihrem Tischnachbarn Antonio Caraciolo. Dabei ignorierte sie die mahnenden Blicke ihrer Mutter ebenso wie das immer dunkler werdende Gesicht des jungen d’Specchi, der seine Eifersucht kaum mehr zu verbergen wusste.
»Darf ich Euch noch ein Stückchen von diesem Schwan vorlegen?«, bot Antonio ihr eben an, obwohl genug Pagen und Lakaien bereitstanden, um die Gäste ihres Vaters zu bedienen.
Da Schwanenfleisch nicht zu Francescas Vorlieben zählte, schüttelte sie den Kopf. »Nein danke, ich ziehe ein Wachtelbrüstchen vor.«
Sofort schoss Cirio d’Specchi hoch und spießte eine Wachtel auf. Doch als er sie quer über den Tisch auf Francescas Teller legen wollte, rutschte ihm der Vogel von der Fleischgabel und fiel ihr in den Schoß.
Einen Augenblick lang saß sie wie erstarrt da. Dann aber durchbohrte ihr empörter Blick den jungen Mann. »So etwas Ungeschicktes! Ihr habt mein Kleid ruiniert.«
Cirio d’Specchi starrte die junge Frau an, die nach dem Willen ihres und seines Vaters sein Weib werden sollte, und schwankte, ob er sich entschuldigen oder ihr klarmachen sollte, dass nur ihr unziemliches Turteln mit Antonio Caraciolo dieses Unglück herbeigeführt hatte. Sobald sie verheiratet waren, würde Francesca sich anders verhalten müssen, dafür würde er sorgen.
»Ihr schweigt? Seid Ihr ein Bauer, der nicht weiß, wie er sich in der feinen Gesellschaft zu benehmen hat?«
Francescas Worte waren eine weitere Ohrfeige für den jungen d’Specchi. Da er in Anwesenheit ihrer Eltern nicht laut werden wollte, biss er die Zähne zusammen und tröstete sich mit dem Gedanken, dass er Francesca am Tag nach ihrer Hochzeit mit dem Lederriemen beweisen konnte, wer ihr Herr war. Mit einer fahrigen Bewegung griff er nach seinem Weinpokal – und stieß ihn um.
Das Lachen seiner Verlobten klang hell durch den Raum. »Ihr solltet in den Spiegel schauen, Signore Cirio, dann würdet Ihr tatsächlich in das Gesicht eines Bauern sehen.«
Diese herbe Beleidigung traf Cirio d’Specchi doppelt, weil Francesca auf die Tatsache anspielte, dass seine Ahnen keine Adeligen, sondern Spiegelmacher gewesen waren. Diesmal hielt ihn nur ein mahnendes Räuspern seines Vaters davor zurück, um den Tisch herumzulaufen und die Spötterin vor ihren Eltern und allen Gästen zu züchtigen.
Unterdessen war ein Diener auf Francesca zugetreten und tastete auf ihrem Schoß nach der Wachtel. Nach Ansicht des Hausherrn verweilten seine Finger zu lange an dieser Stelle, und er klopfte mit der flachen Hand auf den Tisch.
»Francesca, es ist das Beste, du gehst auf dein Zimmer und ziehst dich um.«
Der Diener hatte inzwischen die Wachtel ergriffen und wollte nun die Soßenflecken mit einem Tuch abreiben. Das ging Francesca jedoch zu weit. Sie schob ihn mit einer scheinbar beiläufigen Bewegung beiseite, stand auf und verneigte sich vor ihrem Vater. »Ihr habt wie immer recht, mein Herr. Ich werde tun, was Ihr mir angeraten habt.« Im Stillen sagte Francesca sich, dass sie so viel Zeit mit Umziehen verbringen würde, bis die Festlichkeit so gut wie zu Ende war. Sie hatte wenig Lust, sich mit Cirio d’Specchi zu unterhalten, auch wenn sie den Mann nach dem Willen ihres Vaters in einigen Monaten heiraten musste. Mit diesem Vorsatz verließ sie den Festsaal und stieg die Treppe zu ihrer Kammer hoch.
Ihre Zofe Annunzia erwartete sie bereits oben am Treppenabsatz. »Was denkt Ihr Euch nur dabei, Signore Cirio so zu behandeln? Er ist ein stolzer Mann und wird es Euch, sobald Ihr sein Weib seid, vergelten lassen.«
»Er soll es probieren«, antwortete Francesca mit einer verächtlichen Geste. »Und jetzt komm mit! Ich will dieses Kleid ausziehen. Der Geruch der Wachtelsoße, den ich diesem Trottel zu verdanken habe, widert mich an.«
»Euch sollte eher Euer ungebührliches Benehmen anwidern!« Da Annunzia Francesca kannte, seit diese an der Brust ihrer Amme gelegen hatte, nahm sie kein Blatt vor den Mund. Zwar hätte auch sie ihrer Herrin einen vornehmeren Verlobten gewünscht als den Sohn des dem niederen Adel angehörenden Dario d’Specchi, doch es war nun einmal der Wille ihres Vaters, das Bündnis mit dieser Familie durch eine Heirat zu bekräftigen. Das hatte politische Gründe, die keine Rücksicht auf die Befindlichkeit der Braut nahmen, doch auch in so einem Fall hatte ein Mädchen seinem Vater zu gehorchen.
Das sagte sie Francesca auch, als sie hinter ihr in die Kammer trat und begann, ihr das Kleid auszuziehen. »Ihr könnt froh sein, wenn Conte Ercole Euch für Euer Verhalten nicht den Stock kosten lässt«, mahnte sie. Damit konnte sie Francesca jedoch nicht ängstigen.
Diese wusste, dass ihr Vater es bei ein paar tadelnden Worten belassen und sie stattdessen dazu auffordern würde, in den nächsten Tagen in sämtlichen großen Kirchen Roms die Messe zu besuchen. Da es recht kurzweilig war, den Predigten der Priester zuzuhören und den Liedern der Chorknaben zu lauschen, war ihr das sogar recht. Außerdem bot sich bei San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore und San Paolo fuori le Mura gewiss die Möglichkeit, Freundinnen zu treffen und mit ihnen zu schwatzen. Vielleicht konnte sie dabei sogar eine Begegnung mit ihrem Verehrer Caraciolo herbeiführen und sich weitere Komplimente anhören.
Annunzia ahnte, dass die Gedanken ihrer Herrin sich mit ganz anderen Dingen beschäftigten als mit ihrer Heirat, und räusperte sich. »Ihr solltet Euch tummeln, damit Ihr wieder in den Festsaal kommt.«
Da Francesca genau das nicht wollte, setzte sie sich in ihren Unterröcken auf einen Stuhl und verlangte, dass ihre Zofe ihr ein Glas mit Fruchtsaft brachte, der mit Eis aus den Albaner Bergen gekühlt wurde.
»Ich habe Durst!«, betonte sie, als Annunzia nicht sofort das Zimmer verließ. »Unten wird nur Wein gereicht, und ich will keinen schweren Kopf bekommen.«
Das war zwar auch im Sinne ihrer Zofe, dennoch dachte diese nicht daran, das Getränk selbst zu holen. Sie rief eine Dienerin herein, erteilte ihr diesen Auftrag und wandte sich wieder ihrer Herrin zu. »Und jetzt ziehen wir uns wieder an!«
So hatte die Zofe mit Francesca gesprochen, als diese noch ein kleines Kind gewesen war. Die junge Dame dachte nicht daran, ihr zu gehorchen. Stattdessen streckte sie die Beine aus und stöhnte. »Mir tun die Füße weh! Der Schuster gehört ausgepeitscht, denn er hat meine Schuhe viel zu eng gemacht.«
»Aber als Ihr sie vorhin angezogen habt, haben sie doch gepasst«, rief Annunzia aus, nahm einen der Schuhe, die Francesca abgestreift hatte, und steckte ihn auf deren linken Fuß.
»Also, mir erscheint er nicht zu eng!« Diesmal lag ein tadelnder Ton in der Stimme der Frau, und Francesca stellte sich bereits auf eine Predigt ein. Sie beschloss, den Vortrag bei einem Ohr hinein- und dem anderen wieder hinausrauschen zu lassen. Bevor es jedoch dazu kam, klopfte es an der Tür, und die Dienerin kehrte mit einer Karaffe und einem Becher zurück. Ihr auf dem Fuß folgte eine von Cirio d’Specchis Schwestern.
Celestina war vierzehn Jahre älter als ihr Bruder und mit einem Notar der Stadtverwaltung verheiratet. Nun war sie bestrebt, Cirios Verlobung mit Francesca zu ihrem eigenen Aufstieg in der Gesellschaft zu nutzen. Sie trat in das Zimmer, ohne dazu aufgefordert worden zu sein, blieb vor Francesca stehen und stemmte die Fäuste in die Hüften. »Ihr benehmt Euch schamlos, meine Liebe! Fast könnte man meinen, Euch wäre eine Ehe mit meinem Bruder zuwider. Dabei ist er voller Nachsicht mit Euch. Mein Gemahl Goffredo würde solches Verhalten bei mir nicht dulden.«
Francesca zog eine Augenbraue hoch. »Ich kann Euch nicht ganz folgen, meine Liebe. Habe ich Eurem Bruder die Wachtel auf sein Gewand fallen lassen oder er mir? Es liegt an ihm, sich bei mir zu entschuldigen.«
»Ihr habt ihn einen Bauern genannt!«, schäumte Celestina Iracondia auf.
»Wenn er sich wie einer benimmt, darf er sich nicht beschweren, wenn er so genannt wird«, konterte Francesca scheinbar gelassen. Doch in ihr kochte die Wut nicht weniger hoch als in ihrer Besucherin. Seit ihre Verlobung mit Cirio d’Specchi beschlossene Sache war, versuchten die vier Cs, wie sie seine Schwestern Celestina, Clementina, Concettina und Cristina insgeheim nannte, ihr vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten habe.
»Mein Bruder benimmt sich nicht wie ein Bauer«, schrie Celestina ihre künftige Schwägerin an. »Ihr hingegen führt Euch auf wie eine Hure!«
»Ich glaube, der Familienname Eures Mannes färbt auf Euch ab, meine Liebe, denn ich erkenne unzweifelhaft Anzeichen von Jähzorn an Euch«, spottete Francesca.
»Ihr werdet es noch erleben, wohin Euer Hochmut Euch führt! Doch glaubt nicht, dass ich Mitleid mit Euch haben werde, wenn mein Bruder Euch mit der Rute züchtigt.« Diese Drohung war das Einzige, das Celestina noch einfiel, doch auch damit erreichte sie bei ihrer zukünftigen Schwägerin keinen Sinneswandel.
»Euer Bruder verkehrt wohl oft im Hause Eures Ehemanns, weil auch er so vom Jähzorn gepackt zu sein scheint«, antwortete Francesca herausfordernd.
Celestina war kurz davor, ihr ein paar Ohrfeigen zu versetzen. Nur der Gedanke, dass Francescas Vater Gewalt gegen seine Tochter zum Anlass nehmen könnte, die Verlobung aufzukündigen, hielt sie davon ab. »Ich habe Euch gewarnt«, fauchte sie Francesca an und verließ wutschnaubend das Zimmer.