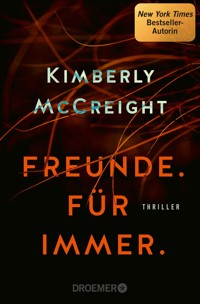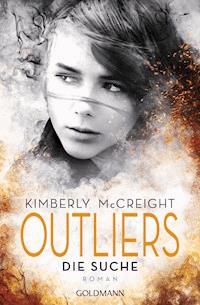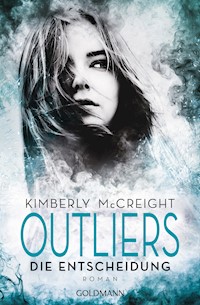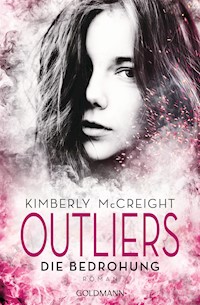12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Weißt du, wer deine Mutter früher war? Mit ihrem Thriller »Tochterliebe« bietet die New York Times-Bestseller-Autorin Kimberly McCreight raffinierte psychologische Spannung um die Sünden der Vergangenheit und eine Mutter, die ihre Tochter auf die falscheste Weise beschützen will. Studentin Cleo hat nicht das beste Verhältnis zu ihrer Helikopter-Mutter Kat. Während Cleo sich von ihren Gefühlen leiten lässt und dabei auch mal an den falschen Mann gerät, führt Kat das perfekt durchgeplante Leben einer glücklich verheirateten, extrem erfolgreichen New Yorker Anwältin. Jedenfalls ist es das, was Cleo denkt – bis Kat eines Abends spurlos verschwindet. Ausgerechnet an jenem Abend, an dem es eine Aussprache zwischen Mutter und Tochter geben sollte. Als Cleo zum Abendessen im perfekt durchgestylten Haus ihrer Kindheit eintrifft, herrscht Chaos im Wohnzimmer, im Ofen brennt das Essen – und von Kat fehlt jede Spur. Schließlich entdeckt Cleo einen blutigen Schuh ihrer Mutter unter dem Sofa und weiß: Etwas Schreckliches muss passiert sein. Cleo hat nicht die leiseste Ahnung, wie dunkel die Abgründe sind, in die sie blicken wird. Hochkarätiger Pageturner mit mehr als einem überraschenden Dreh – perfekte Unterhaltung für Fans von Freida McFadden, Julie Clark, Alex Michaelides oder Claire Douglas. Mit ihren wendungsreichenThrillern erobert Kimberly McCreight nicht nur regelmäßig die New York Times-Bestsellerliste: Nicole Kidman beteiligt sich an der Verfilmung der Thriller und wird selbst eine Hauptrolle spielen. »McCreights neuestes Werk erforscht die Mutterschaft in all ihrer Komplexität – verpackt in einem atemlosen, schockierenden Thriller, den ich nicht aus der Hand legen konnte.« Bestseller-Autorin Jodi Picoult Entdecke noch mehr Nervenkitzel von Kimberly McCreight, bei dem nichts so ist, wie es scheint: · Eine perfekte Ehe · Freunde. Für immer · Die perfekte Mutter
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kimberly McCreight
Tochterliebe
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Kristina Lake-Zapp
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Studentin Cleo hat nicht das beste Verhältnis zu ihrer Helikoptermutter Kat. Während Cleo sich von ihren Gefühlen leiten lässt und dabei auch mal an den falschen Mann gerät, führt Kat das perfekt durchgeplante Leben einer glücklich verheirateten, extrem erfolgreichen New Yorker Anwältin. Jedenfalls ist es das, was Cleo denkt – bis Kat eines Abends spurlos verschwindet. Ausgerechnet an jenem Abend, an dem es eine Aussprache zwischen Mutter und Tochter geben sollte. Als Cleo zum Abendessen im perfekt durchgestylten Haus ihrer Kindheit eintrifft, herrscht Chaos im Wohnzimmer, im Ofen brennt das Essen – und von Kat fehlt jede Spur. Schließlich entdeckt Cleo einen blutigen Schuh ihrer Mutter unter dem Sofa und weiß: Etwas Schreckliches muss passiert sein. Cleo hat nicht die leiseste Ahnung, wie dunkel die Abgründe sind, in die sie blicken wird.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
CLEO
ZIVILKLAGE GEGEN DARDEN PHARMACEUTICALS
KATRINA
CLEO
1. November 1992
KATRINA
ABSCHRIFT DER AUFGEZEICHNETEN SITZUNG
CLEO
ZWEI TAGE ZUVOR
KATRINA
BEZIRKSGERICHT DER VEREINIGTEN STAATEN FÜR DEN BEZIRK NEW YORK
CLEO
KATRINA
16. November 1992
CLEO
ABSCHRIFT DER AUFGEZEICHNETEN SITZUNG
KATRINA
EIN TAG ZUVOR
CLEO
KATRINA
CLEO
KATRINA
24. November 1992
CLEO
ABSCHRIFT DER AUFGEZEICHNETEN SITZUNG
KATRINA
CLEO
1. Dezember 1992
KATRINA
ABSCHRIFT DER AUFGEZEICHNETEN SITZUNG
CLEO
The Wall Street Journal
KATRINA
CLEO
AM TAG DES VERSCHWINDENS
KATRINA
CLEO
KATRINA
24. Dezember 1992
CLEO
ABSCHRIFT DER AUFGEZEICHNETEN SITZUNG
KATRINA
CLEO
KATRINA
CLEO
The New York Times
EPILOG
DANK
Für Harper & Emerson
Was für ein Geschenk, euch zu kennen.
Was für eine Ehre, eure Mutter zu sein.
Sobald sie geboren war, hatte ich nie mehr keine Angst.
Joan Didion, Blaue Stunden
Prolog
Sobald man etwas sehen kann, fangen die Lügen an. Natürlich allesamt wohlgemeint. Freundinnen, Freunde, Familie, Ärztinnen und Ärzte und sogar vollkommen Fremde – im Grunde sagen dir alle, die deinen Schwangerschaftsbauch betrachten:
Keine Sorge, wenn es so weit ist, wirst du schon wissen, was zu tun ist.
Keine Sorge, du kannst dich auf deine Mutterinstinkte verlassen.
Keine Sorge, dein Körper hat bald seine alte Form wieder.
Keine Sorge, du wirst eine fantastische Mutter sein.
Keine Sorge, es ist nicht so anstrengend, wie es jetzt wirkt.
Keine Sorge, Mutter zu sein ist die lohnendste Arbeit der Welt.
Keine Sorge, du wirst dein Mutterdasein sehr viel mehr lieben, als du denkst.
Zumindest Letzteres stimmt, wenngleich es sich um eine gefährliche Simplifizierung handelt.
Es ist in der Tat grenzenlose Liebe, die du in der Sekunde empfindest, wenn du dein Kind, ein warmes, sich windendes Etwas, an deine nackte Brust drückst. Du würdest sterben, um dieses Kind zu beschützen, und vermutlich, so stellst du voller Unbehagen fest, würdest du dafür sogar töten. Diesen Teil von dir kanntest du bislang noch nicht – wild, animalisch. Er verleiht dir das Gefühl von Macht – und löst gleichzeitig Furcht in dir aus.
Das ist deine erste wahre Einführung in die Mutterschaft, diese Studie über Widersprüche.
Und dann ist da noch der Preis für diese grenzenlose Liebe, vor dem dich niemand gewarnt hat: die Sorgen und die schlaflosen Nächte. Die Angst, dass dein Kind krank wird, traurig ist oder einsam. Und dass das alles deine Schuld ist. Oder dass es eines Tages deine Anrufe nicht mehr beantwortet. Die bedingungslose Liebe zu deinem Kind bedeutet ja nicht, dass es verpflichtet ist, deine Liebe zu erwidern.
Oh, da ist noch etwas: Du wirst so vieles missverstehen. Nicht zuletzt, weil es auf keine einzige der Fragen, die die Mutterschaft mit sich bringt, eine richtige Antwort gibt.
Und was ist mit den wenigen Malen, wenn du tatsächlich einen Volltreffer landest? Nun, das führt dich lediglich zu der Annahme, dass andere Mütter die ganze Zeit über das Richtige tun. Und du wirst dich noch mehr anstrengen.
Du wirst dich so sehr anstrengen, dass deine Augen brennen und deine Arme schmerzen. Bis dein Herz zu Staub zerfällt.
Du wirst alles tun, was nötig ist. Selbst wenn du gar nicht weißt, was nötig ist. Vor allem dann. Mach dich darauf gefasst, denn das wird dein Job sein, und zwar für immer: Du wirst alles richten müssen einschließlich der Dinge, die sich nicht richten lassen.
Solange ihr beide leben werdet.
CLEO
Unser Haus in Brooklyn aus rötlich gelbem Sandstein sieht schön aus, ein warmes Gold im schwindenden Aprillicht. Heimelige, makellose Park-Slope-Perfektion, natürlich dank meiner Mutter. Gott bewahre, dass sie jemals etwas Geringeres als Perfektion schaffen würde. Und dennoch stehe ich hier wie erstarrt an der Straßenecke, einen halben Block von dem Haus entfernt, in dem ich aufgewachsen bin, voller Furcht. Und das ist nicht unbedingt etwas Neues.
Ich könnte jetzt kehrtmachen und in die U-Bahn steigen. Zur New York University zurückfahren, zu dieser Party in meinem Studentenwohnheim, die vermutlich bald anfängt. Zu Will. Aber etwas lässt mich zögern. Es ist die Art und Weise, wie sich meine Mutter diesmal bei mir gemeldet hat. Sie hat drauf bestanden, persönlich mit mir zu reden, und zwar sofort. Das ist nicht unbedingt etwas Neues. Doch dann hat sie gesagt, sie verstehe, warum ich nicht kommen wolle, und mich darum gebeten. Sie hat mich förmlich angefleht, zum Abendessen zu kommen. Sie klang so … ernst – und das gab den Ausschlag. Natürlich komme ich. Während der letzten vierundzwanzig Stunden hat sie übrigens wieder auf ihre bewährte Methode zurückgegriffen: knallharter Druck. Allein die Nachrichten, die ich vor einer kleinen Weile im Zug erhalten habe: Bist du unterwegs? Sitzt du schon in der U-Bahn? Bist du bald hier? Als stünde man vor einem Erschießungskommando – soist es, meiner Mom zu texten.
Eine Autohupe gellt auf der Prospect Park West, und ich flitze über die Straße. Auf der obersten Stufe vor unserer Haustür drücke ich auf die Klingel und warte. Wenn meine Mom hinten in ihrem Arbeitszimmer ist, hört sie das Klingeln vielleicht nicht. Und ich habe natürlich meine Schlüssel vergessen.
Das Smartphone summt in meiner Hand.
Und? Will. Mir stockt der Atem.
Ich weiß noch nicht genau, wann. Ich werfe einen Blick auf die Handy-Uhr. Schon halb sieben. Soll ich dir schreiben, wenn ich auf dem Rückweg bin?
Wir hängen zusammen ab, gehen ab und zu miteinander ins Bett. Das ist alles.
No Prob, antwortet er einen Herzschlag später. Und wieder spüre ich dieses Flattern in meinem Bauch. Okay, vielleicht ist es etwas mehr, als nur miteinander abzuhängen.
Ich drücke erneut auf die Klingel. Warte. Immer noch nichts.
Ich schicke eine Textnachricht: HALLO? Bin seit 15 Min. da.
Es sind erst fünf Minuten, aber da meine Mutter mich mittels emotionaler Gewaltanwendung dazu gebracht hatte, nach Brooklyn zu fahren, kann sie mir jetzt wohl zumindest die Tür öffnen. Außerdem friere ich hier in meinem weißen Rippen-Tanktop und der tief auf der Hüfte sitzenden Jeans. Natürlich wird sie wieder ein großes Ding daraus machen: Wo ist deine Jacke? Wo ist deine restliche Kleidung?, ganz zu schweigen von dem, was sie zu meinem neuen Augenbrauen-Piercing sagen wird.
Ich klopfe an die Tür, die in dem Momentaufschwingt, in dem meine Knöchel das Holz berühren.
»Mom?«, rufe ich und betrete das große, offene Haus. Wohn- und Essbereich links, Küche auf der rechten Seite. »Die Tür war nicht richtig zu …«
Etwas riecht verbrannt. Ein Kochtopf steht auf dem Gasherd, eine der vorderen Flammen brennt, der Topf ist schon schwarz. Ich haste hinüber, stelle den Herd aus, schnappe mir ein Geschirrtuch und bugsiere den Topf in die Spüle. Anschließend drehe ich den Wasserhahn auf. Eine Dampfwolke steigt zischend in die Höhe, als das Wasser in den leeren Topf schießt.
Neben einem ordentlichen Haufen klein geschnittener grüner Bohnen steht auf der Anrichte eine offene Packung Couscous. Auf der Kücheninsel entdecke ich ein halb leeres Glas Wasser. »Mom!«, rufe ich.
Aus dem Ofen kommen knallende und zischende Geräusche. Als ich die Tür öffne, schlägt mir ein Schwall Hitze und grauer Rauch entgegen. Der Bräter, den ich herausreiße, ist mit schwarzen Steinen gefüllt, vermutlich Hähnchenteile.
»Das Essen verbrennt!«, rufe ich. Im selben Moment schrillt der Rauchmelder los. »Scheiße!«
Ich will gerade auf einen Stuhl steigen, um ihn auszuschalten, als ich ein lautes Geräusch vernehme – wumm, wumm, wumm. Es kommt aus der Richtung, wo sich das Arbeitszimmer meiner Mutter befindet. Scheiße.
»Mom!«
Das Wummern hört auf.
Dicht an die Wand gedrückt, schleiche ich durch den Flur, am Bad vorbei, doch als ich vorsichtig ins Arbeitszimmer hineinschaue, stelle ich fest, dass es leer ist. Der Laptop meiner Mom, den sie bei der Arbeit benutzt, liegt auf dem Fußboden neben der Tür, was merkwürdig ist. Ansonsten ist alles so tadellos aufgeräumt wie sonst.
Das Wummern beginnt erneut. Ich stelle fest, dass es durch die Wand kommt, aus dem angrenzenden Haus, dem von George und Geraldine – nein, nur noch von George, denn Geraldine ist gestorben. George war früher ein berühmter Arzt, ein Neurochirurg, doch inzwischen leidet er an Alzheimer. Meine Mom versucht, ein Auge auf ihn zu haben, und bringt ihm manchmal Lebensmittel vorbei. Mit Sicherheit stellt George ziemlich seltsames Zeug an, so ganz allein in dem Haus. Im Augenblick scheint er gegen die Wand zu hämmern. Er hat das schon früher getan, damals, als ich noch zur Highschool ging, immer dann, wenn er wollte, dass meine Freundinnen und ich leiser waren.
Der Rauchmelder schrillt noch immer. Wahrscheinlich regt er sich deshalb auf.
Ich kehre in die Küche zurück, springe auf den Stuhl und drücke auf die Reset-Taste. Endlich verstummt der Alarmton. Eine Sekunde später verstummt auch Georges Klopfen.
Ich blicke über die Kücheninsel hinweg auf den langen Esszimmertisch und den dahinterliegenden Wohnbereich. Makellos.
»Was zur Hölle geht hier vor?«, wispere ich. Man kann meiner Mom so einige unschöne Dinge vorwerfen, aber sie ist nicht der Typ Mensch, der einfach verschwindet.
Ich entdecke etwas unter dem Sofa, springe vom Stuhl und laufe hinüber, um es genauer ins Auge zu fassen. Es handelt sich um einen hellgrauen flachen Leinenballerina, sehr schlicht, sehr teuer. Solche Schuhe gehören zur Standardausstattung meiner Mutter. Als ich ihn unter dem Sofa hervorziehe, sticht mir ein verschmierter rotbrauner Fleck an der Seite ins Auge. Ich kehre in die Küche zurück und bemerke jetzt erst das zerbrochene Glas auf dem Fußboden. Die Scherben liegen glitzernd in einer Pfütze, die aussieht wie Wasser. Auf dem Hartholzfußboden ist noch ein Fleck, glänzend, kreisförmig, in der Größe eines Tellers. Die Flüssigkeit ist dicker als Wasser. Als ich mich bücke, um sie genauer zu betrachten, stelle ich fest, dass sie die gleiche Farbe hat wie der rotbraune Schmierstreifen auf dem Ballerina. O mein Gott! Das ist Blut.
Ich lasse den Schuh fallen. Mit zitternden Händen ziehe ich das Handy aus der Gesäßtasche meiner Jeans.
»Hey!«, meldet sich mein Dad. »Ich komme gerade aus dem Flieger!«
Und für den Bruchteil einer Sekunde denke ich: O prima, dann müssen Mom und ich wenigstens nicht allein essen. Als wäre die Welt nicht soeben explodiert.
Ich richte den Blick wieder auf den Fleck. Blut. Definitiv.
»Dad, ich glaube, Mom ist was passiert!«
ZIVILKLAGE GEGEN DARDEN PHARMACEUTICALS
Im Namen aller schwangeren Patientinnen, die das Medikament Xytek gegen Krampfanfälle oder zur Migränebehandlung zwischen dem Datum der Erstzulassung am 25. Oktober 2021 und jetzt eingenommen haben, wurde heute im Southern District von New York eine zivilrechtliche Klage gegen Darden Pharmaceuticals zugelassen. Die Sammelklage wurde von einer namentlich nicht genannten Klägerin eingereicht, die behauptet, dass Darden Pharmaceuticals von den Risiken für schwangere Patientinnen und ihre ungeborenen Kinder wusste und sich darüber hinwegsetzte. Weiter wird behauptet, dass die Einnahme von Xytek »schwere körperliche Schäden bei Neugeborenen und in einigen Fällen sogar deren Tod« zur Folge hatte. Angesichts der Zahl potenzieller Klägerinnen könnte daraus eine der kostspieligsten Rechtsstreitigkeiten im Pharmasektor erwachsen, für Darden Pharmaceuticals stehen möglicherweise mehrere hundert Millionen Dollar auf dem Spiel. Im Hinblick auf das Gerichtsverfahren erklärte Dardens Chefjurist Phillip Beaumont: »Xytek ist ein Medikament, das Zehntausende von Leben gerettet und Hunderttausenden ein lebenswertes Dasein ermöglicht hat. Die Daten machen deutlich, dass Xytek sowohl ausgesprochen sicher als auch enorm wirksam bei der Minderung und sogar Beseitigung lebensbedrohlicher epileptischer Anfälle ist, und ebenso sicher erweist es sich bei der Bekämpfung von Migräne. Wir freuen uns auf den Tag vor Gericht, an dem wir dies öffentlich beweisen können.« Der Umsatz von Xytek lag allein im letzten Jahr bei über zwei Milliarden Dollar. Als wir diesbezüglich um eine Stellungnahme baten, teilte uns einer der Anwälte der Klägerin mit: »Darden Pharmaceuticals hat bekannte Risiken ignoriert. Man hat den Profit über die Sicherheit der Patientinnen gestellt, wofür Hunderte von Neugeborenen den Preis bezahlen mussten. Wir gehen davon aus, dass dieser Fall die Art und Weise, wie die Pharmaindustrie ihre Geschäfte abwickelt, verändern wird genau wie die Art und Weise der beschleunigten Arzneimittelzulassung durch die Arzneimittelbehörde.«
KATRINA
Ich öffnete die Augen, geblendet von der Sonne, die durch die breite Fensterfront hereinfiel. Es dauerte eine Sekunde, bevor mir einfiel, wo ich war und mit wem – in letzter Zeit kein unbekanntes Gefühl. Das erste Mal, als dies geschah, geriet ich in Panik, fürchtete, ich hätte einen Blackout, jemand hätte mir etwas in den Drink getan. Aber nein, ich hatte mich freiwillig dafür entschieden, hier zu sein, in einem fremden Bett.
Nicht dass Doug noch immer ein Fremder für mich war – nicht nach einem halben Dutzend Dates und drei gemeinsamen Nächten. In dieser schönen neuen Welt des Datens, in der ich die Hälfte der Abkürzungen googeln musste – ENM, GGG –, zählte das in etwa so viel, als wäre ich mit ihm verheiratet. Bisher war es eine steile Lernkurve gewesen, aber damit kam ich klar. Ich wusste, dass ich Doug mochte. Womöglich war dies ein Anfang – wovon auch immer.
Ich hörte ihn neben mir im Bett tief und gleichmäßig atmen. Zum ersten Mal war ich bis zum Morgen geblieben. Tatsächlich war es auch das erste Mal, dass ich seit meiner Trennung vor vier Monaten mit einem Mann die Intimität einer gemeinsam verbrachten Nacht teilte. Und das fühlte sich bedeutsamer an als Sex. Hier lag ich also, neben einem anderen Mann als Aidan, und sah zu, wie die Sonne aufging. Ich wartete darauf, dass sich ein Gefühl der Schuld einstellte, doch stattdessen wurde ich von Erleichterung überwältigt, dass ich es so weit geschafft hatte.
Doug und ich hatten uns bei einem Unternehmensevent von Darden Pharmaceuticals kennengelernt, zu dem ich als Juristin der Kanzlei Blair & Stevenson ebenfalls eingeladen war. Statt mit auf den Golfplatz zu gehen, hatten wir es uns beide auf der Veranda des Clubhauses bequem gemacht, wo wir das gleiche Buch lasen: Schnelles Denken, langsames Denken. Ihn ließ die Lektüre interessiert wirken, mich dagegen, so fürchtete ich, nur hart und emotionslos – worüber sich Aidan permanent beschwert hatte. Doug hingegen schien entzückt über diesen Zufall zu sein. Genau genommen schien ihn alles an mir zu entzücken.
Es gefiel mir gar nicht, dass Doug ein Senior Executive bei einem unserer Mandanten war. Einem neuen Mandanten, wohlgemerkt. Kein Mandant, für den ich tätig war, doch Vorschriften waren nun mal Vorschriften, und von romantischen Beziehungen wurde dringend abgeraten, ohne Offenlegung waren sie sogar strikt verboten. Allerdings war die Vorstellung, die Details meines frisch aufkeimenden Sexlebens der Personalabteilung mitzuteilen, nur schwer zu ertragen. Zu schwer. Daher hatte ich entschieden, die Umstände unseres Kennenlernens bequemerweise zu vergessen. Außerdem war ich in der Kanzlei immerhin Partnerin – was mir gestattete, die Regeln großzügig auszulegen. Auch Doug verstieß mit unserer Verbindung gegen die Richtlinien von Darden Pharmaceuticals, aber vielleicht bestand der Reiz ja gerade darin, dass unsere Beziehung geheim bleiben musste. Zudem respektierten wir die Schweigepflicht – keiner von uns sprach über seinen Job.
Ich war einfach nur glücklich, jemanden zu daten, den ich im echten Leben kennengelernt hatte. Onlinedating hatte sich für mich zum großen Teil als Desaster erwiesen. Diese Treffen bekamen schon Bestnoten, wenn ich es durch ein komplettes Abendessen schaffte. Der ganze Prozess wirkte auf mich höchst befremdlich: mit mir völlig unbekannten Leuten zu »matchen«; der gestelzte, unangemessen intime Nachrichtenaustausch mit jemandem, dem man noch nie begegnet war; die gepimpten Profile, die an glatte Lügen grenzten. Ich hatte das Ganze für ein vorübergehendes, unvermeidliches Unterfangen gehalten – eine hässliche Abrissbirne für mein altes Leben.
Aber Doug? Er war ein echter Glücksgriff: lustig und liebenswert und unglaublich klug. Genau wie ich hatte er unvorstellbar hart arbeiten müssen, um dahin zu kommen, wo er jetzt war. Außerdem stellte sich heraus, dass wir jede Menge Gesprächsstoff hatten. Seine Tochter Ella war in Cleos Alter, und Doug, einem Witwer, fiel es genauso schwer, eine Verbindung mit ihr aufzubauen, wie mir mit Cleo. Ella war Sängerin, Doug in erster Linie Wissenschaftler, dann Geschäftsmann. »Eine Geschichte der Gegensätze«, hatte er ein wenig traurig bei unserem ersten Date gesagt. »Über die ich mir weniger Gedanken machen würde, wenn es mir nicht so wichtig wäre, die Kluft zu überbrücken.«
Doug war auf eine charmante Weise verschroben. Mithilfe von YouTube-Tutorials brachte er sich bei, frische Pasta zuzubereiten, außerdem arbeitete er sich langsam durch die laut American Film Institute hundert besten Filme aller Zeiten. Zudem war er ausgesprochen attraktiv mit seinen grau melierten Haaren, den intelligent dreinschauenden haselnussbraunen Augen und dem ansteckenden Lachen. Nicht so umwerfend wie Aidan – das waren nur wenige Männer –, und auch nicht so groß. Dafür war Doug nicht annähernd so egozentrisch wie er. Außerdem war er (unerwarteterweise) ein exzellenter Liebhaber, in allen wichtigen Belangen sanft und in den richtigen Momenten durchsetzungsfähig.
»Bist du wach?«, fragte er verschlafen, drehte sich zu mir um und schlang einen Arm um meine Hüfte, das Gesicht im Kissen vergraben.
»Sorry, wenn ich dich geweckt habe«, sagte ich. »Schlaf weiter.«
»Hm, okay«, erwiderte er und zog mich enger an sich. »Aber nur wenn du auch weiterschläfst.« Eine Sekunde später ging sein Atem wieder tief und gleichmäßig. Doug war süß – das war es, was ich am meisten an ihm mochte. Süß und lieb. Manchmal merkte man gar nicht, wie sehr man etwas brauchte, bis es einem direkt unter die Nase gehalten wurde. Anscheinend hatte ich mich verzweifelt nach jemandem gesehnt, der freundlich zu mir war.
Bemüht, kein Geräusch zu machen, hob ich mein Handy vom Fußboden auf. Vielleicht waren Arbeitsnachrichten eingegangen. Es gingen immer Arbeitsnachrichten ein, sogar an einem Samstagmorgen um neun Uhr dreißig. Keine Message von Cleo – natürlich nicht. Sie und ich hatten während der vergangenen drei Monate so gut wie gar nicht getextet. Trotzdem war ich jedes Mal enttäuscht, wenn ihr Name nicht auftauchte.
Meine Assistentin Jules hatte mir zwölf Nachrichten von Mandanten weitergeleitet, keine davon so dringend, wie sie offenbar dachten.
Meine Mandanten befanden sich in der Regel in einer prekären Lage und waren so sehr von der Suche nach einer schnellen Lösung getrieben, dass die Einhaltung von Wochenenden zur Nebensache wurde.
Ich hatte außerdem eine Voicemail von Mark, meinem Boss, bekommen, der mich fragte, ob ich mich mit Vivienne Voxhall in Verbindung setzen könne. Vivienne, eine meiner wenigen weiblichen Mandanten, war die hochkarätige CEO von UNow, einer neuen Social-Media-Plattform, die die Welt der College-Studentinnen und -Studenten in Aufruhr versetzte. UNow wurde entwickelt, um Instagram ernsthaft Konkurrenz zu machen. Außerdem sollte UNow natürlich Geld einbringen, sehr viel Geld. Vivienne hatte das Marketing für Spotify, iTunes und Hulu geleitet – sie zählte zu den erfolgreichsten Frauen in der Tech-Welt, nicht zuletzt, weil sie als Programmierexpertin galt, die in der Branche glaubwürdig rüberkam. Allerdings hatte sie ein Aggressionsproblem, was kürzlich dazu geführt hatte, dass sie einem eher mittelmäßigen Senior Executive Manager namens Anton drohte, ihn mitsamt seinem Stuhl »aus dem Fenster zu werfen«, sollte er es noch einmal wagen, damit herumzukippeln, während sie redete. Zu Viviennes Verteidigung musste angebracht werden, dass sich besagter Senior Executive den Frauen gegenüber, die mit ihm zusammenarbeiteten, absolut unverschämt verhielt. Vivienne hatte allerdings nicht immer so edle Ziele für ihre Wut – und bisher hatte sie lediglich das Glück gehabt, Geschichten wie diese unter Verschluss halten zu können. Jetzt allerdings drohte der Typ damit, sich an die Medien zu wenden, sollte man ihm keine Führungsposition bei UNow zuweisen – auf jeden Fall eine beeindruckende Chuzpe. In Anbetracht des bevorstehenden Milliarden-Dollar-Börsengangs von UNow hätte das Timing nicht schlechter sein können.
Mark kannte diese Details natürlich nicht. Er war die unparteiische Kontaktperson der Kanzlei. Ich war die praktische Problemlöserin – die Mittelsfrau, die unseren Mandantinnen und Mandanten gegen einen entsprechenden finanziellen Aufwand in brisanten Situationen aus der Patsche half. In Anbetracht dessen, dass Mark Germaine geschäftsführender Partner bei Blair & Stevenson war, war es logisch, dass er nicht nur meine Rolle, sondern sogar die Existenz dieser Rolle bestritt. Dass ich kein Wort darüber verlieren durfte, war mir klar, obwohl es nie explizit erwähnt wurde. Dabei ging Mark zweifellos davon aus, dass ich mit Aidan darüber gesprochen hatte. Ehepartner waren von den meisten Vertraulichkeitsauflagen in der Regel stillschweigend ausgenommen. Allerdings war es mir nie in den Sinn gekommen, Aidan solche Dinge anzuvertrauen, auch nicht vor zehn Jahren, als ich die Stelle angenommen hatte. Genauso wenig wie mir in den Sinn gekommen war, diesen Mangel an Vertrauen als problematisch zu betrachten. Ich war an Geheimnisse gewöhnt.
Und so folgten wir einem bestimmten System: Mark nannte mir Namen und Telefonnummer eines für gewöhnlich hochrangigen Mitarbeiters, der für einen bestehenden Firmenkunden tätig war. Mark versicherte dem Mandanten – normalerweise dem Arbeitgeber des schuldigen Arbeitnehmers –, dass ich das Problem aus der Welt schaffen würde. Und ich wandte mich erst wieder an Mark, wenn der Schlamassel tatsächlich offiziell aus der Welt geschafft war. Was in der Zwischenzeit passierte, war meine Sache.
Vivienne jedoch schreckte nicht davor zurück, Mark mitten in der Nacht anzurufen, um zu bekommen, was sie wollte. Es war typisch für sie, dass sie mir nur wenige Minuten Zeit ließ zu antworten, bevor sie über meinen Kopf hinweg handelte.
Ich habe gestern am späten Abend mit Vivienne gesprochen, schrieb ich Mark zurück. Die Sache ist bereits geklärt.
Diesmal war Vivienne wegen der Sprachnachricht einer aufdringlichen New York Times-Reporterin ausgerastet. Ich hatte ihr vor weniger als acht Stunden versichert, dass die Times auf keinen Fall eine Story über Vivienne bringen würde, ohne zu versuchen, zuvor ein offizielles Statement von ihr zu bekommen. Eine einzige Sprachnachricht würde da nicht genügen. Die Story würde so lange auf Eis liegen, wie Vivienne nicht ans Telefon ging. Ein weiteres Problem gelöst – zumindest vorerst.
Ja, meine Arbeit konnte durchaus befriedigend sein, sogar wenn ich dafür immer wieder durch ziemlich trübe Gewässer waten musste. Hatten all diese vermögenden, privilegierten Menschen – von denen einige ziemlich widerwärtige Dinge getan hatten – tatsächlich eine zweite Chance verdient? Wahrscheinlich nicht. Ich jedoch vermutlich auch nicht.
Hinter dem Fenster glitzerte der Hudson River. Die Aussicht war spektakulär, das Apartment eine beeindruckende, loftähnliche Wohnung mit einem Schlafzimmer und poliertem Eschenholzboden. Allerdings bevorzugte Doug das Einfamilienhaus in Bronxville – in der Zweitwohnung fühlte er sich einsam. Zumindest hatte er sich so gefühlt, bis ich einwilligte, über Nacht zu bleiben.
Ich schlüpfte aus dem Bett und schlich auf Zehenspitzen ins Bad, wobei ich dem Drang widerstand, mich zuvor anzuziehen. Auf diesem Gebiet musste ich permanent an meinem Selbstbewusstsein arbeiten.
Als ich ins Schlafzimmer zurückkehrte, war Doug wach. Er saß aufrecht im Bett, die Füße auf dem Fußboden, und blickte verstört auf sein Smartphone.
»Ist alles okay?«, fragte ich.
Ohne die Augen vom Handy zu wenden, legte er die freie Hand in den Nacken und schüttelte den Kopf. »Ich habe gerade eine total seltsame Nachricht bekommen …«
»Von der Arbeit?«, fragte ich, ging um das Bett herum auf die andere Seite und hob BH und Shirt auf, die noch an genau der Stelle auf dem Fußboden lagen, wo ich sie in der Nacht hingeworfen hatte.
»Nein«, sagte er und blickte auf. »Nein. Es ist … Wir hatten damals einen Studienberater engagiert, wegen Ella …«
Ich wartete darauf, dass er seinen Gedanken zu Ende brachte, doch er rieb sich bloß die Stirn. Also zog ich mich eilig an, trat an seine Bettseite und setzte mich neben ihn.
»Und jetzt meldet er sich? Wie lange ist das her? Doch bestimmt drei Jahre.«
»Mindestens«, bestätigte Doug und schaltete eilig das Handy aus, als ich einen Blick aufs Display werfen wollte.
»Möchtest du darüber reden?«, fragte ich.
»Ich erinnere mich nicht mal an den Namen des Beraters, nur noch an den des Unternehmens, für das er tätig war – Advantage Consulting.« Er verstummte. Nach einem kurzen Moment fuhr er fort: »Jemand erpresst mich. Will Geld, Schweigegeld. Für etwas, was ich nicht getan habe.«
Ich legte eine Hand auf seinen Rücken. »Oh, das tut mir leid. Das klingt … schrecklich.«
Doug nickte. »Ja. Und seltsam. Wir haben für nichts Illegales bezahlt. Ich meine, der Typ hat gewisse Optionen angedeutet, ja. Du weißt schon: ›Gegen einen Aufpreis könnte ich mehr für Sie tun‹, doch das haben wir nicht in Anspruch genommen.« Er runzelte die Stirn. »Wir haben ihn allerdings auch nicht sofort gefeuert, obwohl das vermutlich das Richtige gewesen wäre. Wir hätten uns an einen anderen Berater wenden sollen – die einzige moralisch integre Vorgehensweise.«
»Und die Erpresser drohen, dass sie behaupten, du hättest etwas Illegales getan, wenn du nicht zahlst?«
Erpressung – das war etwas, womit ich mich auskannte. Ich blickte auf Dougs noch immer schwarzes Display, wollte, dass er mir die Message zeigte, damit ich mir ein Bild machen konnte, womit genau er es zu tun hatte. An der Art und Weise, wie die Forderungen formuliert waren, konnte man sehr viel erkennen.
»Ja, angeblich wollen sie Anzeige bei der Polizei erstatten. Außerdem haben sie gedroht, Ella zu erzählen, ich hätte sie mittels Bestechung an die Amherst gebracht, was mir, ehrlich gesagt, sehr viel mehr Kopfzerbrechen bereitet. Die Polizei wird die Wahrheit schlussendlich ans Tageslicht bringen, aber was ist mit meiner Tochter? Das wird ihr den perfekten Vorwand liefern, sich endgültig von mir abzuwenden.«
Ich wusste, wie er empfand, kannte ich dieses Gefühl doch ebenfalls nur allzu gut. Mein eigenes Handy vibrierte in meiner Hand.
Ruf mich sofort an. Aidan. Großartig.
Aidan liebte es, mittels kryptischer Forderungen meine umgehende Aufmerksamkeit zu erlangen, vor allem an Wochenendvormittagen, an denen ich möglicherweise indisponiert war. Er wusste, dass es funktionierte, weil ich mir Sorgen machte, es könnte um Cleo gehen. Ich war immer noch Cleos offizieller Notfallkontakt. Zwanzig Jahre lang hatte ich Formulare ausgefüllt – Schulformulare, Gesundheitsformulare, Formulare für Sport- und Freizeitaktivitäten, Notfallformulare für Veranstaltungen, Kursbelegungen, Klassenfahrten –, Formulare, von deren Existenz Aidan nicht die leiseste Ahnung hatte. Auch jetzt noch war es mein Handy, das klingelte, wenn Cleo krank oder verletzt oder sonst wie außer Gefecht gesetzt war. Wenn sie jedoch eine Krise hatte, in der sie selbst zum Telefon greifen konnte, war es ohne Frage Aidan, den sie anrief. Die beiden standen einander sehr viel näher als sie und ich, spätestens seit Cleo ins Teenageralter gekommen war. Vor allem jedoch seit Kyle.
»Jetzt wirkst du aufgewühlt.« Doug deutete mit dem Kinn auf mein Handy.
»Ich muss kurz rausgehen und das Gespräch annehmen«, sagte ich. »Es ist Aidan.«
Diesmal legte Doug mir die Hand in den Rücken. »Das tut mir leid.«
Doug verstand es. Alles. Nach nur drei Wochen hatte ich das Gefühl, er würde mich auf eine Weise verstehen, wie Aidan es nie getan hatte.
»Sehen wir uns bald wieder?«, fragte ich, als ich aufstand.
Doug lächelte. »Darauf kannst du dich verlassen.«
Ich rief Aidan vom Gehsteig der West Street aus zurück. Sobald ich seine Stimme hörte, verpuffte die Erinnerung an Dougs Hände auf meinem Körper in der kühlen Aprilluft.
»Ja, hallo.« Aidans Ton klang scharf, als wollte er sagen: Das hat ja lange gedauert. »Tut mir leid, dass ich dich von … keine Ahnung … von wem auch immer wegreiße.«
Es gelang ihm überzeugend, verletzt zu klingen. Die Trennung war auf meine Initiative hin erfolgt, auch wenn Aidan mir im Grunde keine Wahl gelassen hatte. Er wollte »an den Dingen arbeiten« – das heißt, er wollte, dass ich vergaß, was geschehen war, und wieder so tat, als wäre alles in Ordnung.
Auf alle Fälle war es meine Idee gewesen, unsere Trennung vor Cleo geheim zu halten und erst einmal abzuwarten, bevor wir etwas so Offizielles wie eine Scheidung in die Wege leiteten – zumindest bis zu den Semesterferien im Sommer. Sie hatte sich erst vor Kurzem aus dem akademischen Loch befreien können, in das sie gefallen war, als sie Kyle gedatet hatte. Ich wollte nicht für einen weiteren Rückschlag verantwortlich sein. Außerdem wusste ich, dass eine Scheidung, selbst eine Trennung, der letzte Nagel in meinem Sarg gewesen wäre. Ihren geliebten Dad zu verlassen war genau der Beweis, den sie brauchte. Dafür, dass ich tatsächlich das grässliche, emotionslose Monster war, als das sie mich bei unserem letzten Streit dargestellt hatte.
»Was gibt’s, Aidan?« Hinter der Ecke heulten Sirenen, einer der scheinbar nie endenden Feuerwehr-Korsos auf dem West Side Highway. Ich drückte mir einen Finger ins freie Ohr.
»Es geht um Cleo«, sagte er.
»Tatsächlich?« In Wirklichkeit ging es nie um Cleo. »Schieß los.«
»Wo bist du? Es klingt, als stündest du mitten auf dem Brooklyn-Queens Expressway. Wenn der Typ ein Apartment so nah am Highway hat, würde ich mir an deiner Stelle einen neuen Freund suchen.«
»Aidan, was ist mit Cleo?«
»Egal, ich kümmere mich darum«, antwortete er.
»Worum kümmerst du dich?«
»Schrei mich nicht an.«
»Ich schreie nicht.« Aber er hatte recht: Ich schrie tatsächlich. »Sag nicht, Kyle ist wieder im Spiel.«
»Kyle? Nein, mit ihm hat das nichts zu tun. Ich denke, dafür hast du gesorgt.«
»Zum Glück.«
»Cleo sieht das anders.«
Natürlich tat sie das. Durch den Schlamassel mit Kyle war Cleos Verhältnis zu mir nicht mehr nur »schwierig«, sondern unverhohlen feindselig. Ich hatte ihr damit gedroht, nicht länger für die Studiengebühren aufzukommen, wenn sie nicht mit ihm Schluss machte – mit diesem Versager und Drogendealer. Diesem reichen Versager und Drogendealer. Jedes Mal, wenn ich daran dachte, wie aggressiv meine Drohung geklungen hatte, wie wütend, bestrafend, fühlte ich mich schlecht. Zu meiner Verteidigung muss ich anbringen, dass Kyle Cleo in seine Drogengeschäfte hineingezogen hatte. Zum Glück hatte er sie nicht dazu gebracht, selbst Drogen zu konsumieren, sondern lediglich zu verkaufen. Trotzdem. Kyle, ein Dealer mit Treuhandfonds, tat dies vermutlich nur, um seine reichen Eltern zu ärgern.
Cleo hatte Aidan gegenüber beiläufig erwähnt, dass Kyle »ein bisschen was auf dem Campus vertickte«. Man musste Aidan zugutehalten, dass er mich sofort informierte. Und in dem Moment hatte ich mich der Sache angenommen. Hatte das getan, was ich am besten konnte: Ich hatte das Problem beseitigt.
Zunächst hatte ich Cleo gezwungen, mit Kyle Schluss zu machen. Anschließend hatte ich mich direkt an ihn gewandt, um ihm meinen Standpunkt unmissverständlich klarzumachen. Weder Cleo noch Aidan hatten davon gewusst, natürlich nicht; nette Anwältinnen tauchten nicht einfach so mit den Cops auf und warfen mit nicht ganz sauberen Drohungen um sich. Aber die Drohungen, die ich Cleo gegenüber ausgesprochen hatte, gaben ihr schon ausreichend Grund, nicht mehr mit mir zu reden. Trotzdem würde ich, wenn es sein müsste, alles wieder ganz genauso machen.
»Wie dem auch sei, es geht nicht um Kyle«, fuhr Aidan fort. »Cleo hat mich gefragt, ob ich ihr Geld leihen kann.«
»Geld?«
»Sie ist Studentin, schon vergessen? Ein wenig das Budget zu überziehen, ist nicht gleich etwas Schockierendes.«
Ich spürte, dass er mir etwas vorenthielt, hörte den Anflug von Besorgnis, der in seiner Stimme mitschwang.
»Ich verstehe nicht … Um wie viel Geld geht es?«
»Na ja … könntest du bitte ruhig bleiben?«
»Ich bin ruhig, Aidan«, sagte ich und biss fest auf die Innenseite meiner Wange.
»Zweitausend Dollar.«
»Zweitausend Dollar?« Jetzt schrie ich wirklich. »Wozu braucht sie so viel Geld? Dahinter steckt eindeutig Kyle!«
»So eindeutig ist das gar nicht. Cleo hat gesagt, dass sie den Kontakt zu ihm abgebrochen hat, und ich glaube unserer Tochter. Vielleicht solltest du zur Abwechslung auch mal jemandem vertrauen, Kat.« Aidans Stimme triefte vor Selbstgerechtigkeit. »Das war von jeher dein Problem – du vermutest immer das Schlechteste in einem Menschen.«
Nicht ganz unwahr, aber um mich ging es bei diesem Gespräch nicht. »Bitte sag, dass du Cleo gefragt hast, wofür das Geld ist.«
»Nein.«
»Nicht mal: ›Hey, wofür brauchst du die zwei Riesen, wenn du doch als Drogenkurier gearbeitet hast?‹«
»Ich finde es nicht gut, Menschen wegen der Fehler, die sie begangen haben, zu erniedrigen, Kat. Das verstehe ich nicht unter Liebe.«
Aidan hatte eine furchtbare Art, Dinge auf den Punkt zu bringen, selbst wenn er vollkommen im Unrecht war.
»Ich mache mir Sorgen, Aidan«, sagte ich, um einen ruhigen Ton bemüht. »Ich fürchte wirklich, dass das etwas mit Kyle zu tun hat.«
»Und wenn schon! Du kannst nicht alles kontrollieren, Kat – Cleos Make-up, die Art, wie sie sich kleidet, mit wem sie sich trifft. Na schön, dann macht sie vielleicht einen weiteren Fehler. Sie ist im College, und College-Kids machen Fehler! Sieh dir an, wohin es geführt hat, sie derart unter Druck zu setzen. Cleo ist ein Mensch, sie hat Gefühle!«
Aidan wusste genau, wo er ansetzen musste.
»Ja«, erwiderte ich zähneknirschend, »ich bin mir durchaus bewusst, dass unsere Tochter Gefühle hat. Bitte ruf sie zurück, und sag ihr, dass du wissen musst, wofür sie das Geld braucht. Frag sie nach Kyle. Ich bin mir sicher, dass sie dir die Wahrheit sagen wird, Aidan. Sie vertraut dir.« Schmeicheleien – auch ich wusste, welche Knöpfe ich bei Aidan drücken musste.
Er schwieg einen Moment lang. »Okay … das kann ich machen«, räumte er schließlich ein. »Doch zunächst muss ich noch etwas anderes mit dir besprechen … etwas, was nichts mit Cleo zu tun hat.«
»Und was?«
»Ich … ähm … ich bin mit dem Film in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Ich würde es begrüßen, wenn du mir endlich Zugriff auf das Familienvermögen gewährst, immerhin gehört es zur Hälfte mir.«
Jetzt war ich es, die schwieg. Aidan würde mich bei der Sache mit Cleo unterstützen … wenn ich ihm Geld gab? Das hatte er zwar nicht explizit so formuliert, natürlich nicht, aber das war auch gar nicht nötig.
»Hallo? Bist du noch dran, Kat?«, fragte Aidan. »Ich denke nicht, dass es unverschämt ist, dich darum zu bitten, immerhin sind wir seit fast zweiundzwanzig Jahren verheiratet. Betrachte es meinetwegen als Leihgabe, aber wie gesagt: Es ist auch mein Geld.«
»Nein«, sagte ich ruhig.
»Nein, du stimmst mir zu, dass es nicht unverschämt ist, oder nein, du wirst mich nicht auf das Konto zugreifen lassen? Herrgott noch mal, Kat, es ist ernst!«
Ich räusperte mich. Nein, er würde mich nicht dazu bringen, das zu tun, was er wollte, indem er mir das Gefühl vermittelte, ich wäre ein schlechter Mensch, wenn ich es nicht tat. So lief das nicht mehr. »Ja, Aidan«, antwortete ich daher. »Ich werde dir Geld für deinen Film geben. Sobald du herausgefunden hast, was zur Hölle mit unserer Tochter los ist.«
CLEO
»Cleo!« Janine lächelt breit, als sie die Haustür öffnet und mich auf der Schwelle stehen sieht. »Was machst du denn hier?«
In Jeans und kurzärmeligem T-Shirt, die dicken, dunklen Haare am Hinterkopf zu einem lockeren Knoten geschlungen, sieht sie aus wie ein Model. Janine zählt zu den Müttern, die mit allem cool sind, aber nicht auf eine peinliche Art und Weise. Sie ist cool – und immer nett. Total verständnisvoll. Als Annie einmal richtig Ärger bekam, weil sie in der achten Klasse die Schule schwänzte, hatte Janine Mitleid mit ihr. Damals waren wir noch Freundinnen, und ich war so neidisch auf Annie, weil sie Janine hatte, während ich mit einer Mom à la Cruella de Vil geschlagen war.
»Cleo, Liebes – stimmt etwas nicht?«, fragt Janine und macht einen Schritt auf mich zu. »Du wirkst so … Ist alles okay?«
Ich öffne den Mund, um zu antworten, doch meine Kehle schnürt sich zusammen. Ich bringe kein Wort hervor. Kann kaum atmen.
»Oje, Cleo, komm erst mal rein.« Janine zieht mich ins Haus und schließt die Tür. »Bist du verletzt, Cleo? Hat dir jemand wehgetan?«
Annie kommt die Treppe herunter und erstarrt auf der Hälfte der Stufen. Sie wirft mir einen Blick zu, dann geht sie die restlichen Stufen herunter, ohne mich weiter zu beachten. Annie und ich verloren uns aus den Augen, als wir mit der Highschool in Beacon anfingen und sie sich einer, sagen wir, »lesewütigeren« Gruppe anschloss. Während ich mit einigen der cooleren Kids Party machte. Aber so eng war ich mit denen nun auch nicht gewesen. Es machte bloß Spaß, mit ihnen abzuhängen. Annie und ich hätten Freundinnen bleiben können, hätte sie mich deswegen nicht verurteilt.
»Was ist los?«, fragt Janine und führt mich ins Wohnzimmer, wo sie mir bedeutet, auf der Couch Platz zu nehmen. »Was hast du da in der Hand? Wessen Schuh ist das?«
Ich blicke auf meine Hände. Ich halte noch immer Moms Ballerina umklammert, dabei kann ich mich nicht mal mehr erinnern, dass ich ihn aufgehoben habe.
Janines Gesichtsausdruck wird ernst. »Cleo, was ist mit dem Schuh?«
Ich erkläre eilig, was zu Hause passiert ist – zumindest das, was ich weiß –, und füge hinzu, dass mein Dad unterwegs ist. Er ist derjenige, der mir gesagt hat, dass ich zu Annie gehen soll, die auf der anderen Straßenseite wohnt. Dort wäre ich in Sicherheit. Während ich rede, weiten sich Janines Augen. Ihre Kinnlade fällt herab, doch dann zwingt sie sich zu einem Lächeln. »Es ist richtig, dass du gekommen bist. Alles wird gut.« Sie dreht sich zu Annie um. »Süße, könntest du Cleo bitte ein Glas Wasser holen?«
Annie funkelt mich an, bevor sie in die Küche geht. Okay, wir haben uns vor ein paar Jahren in unterschiedliche Richtungen entwickelt, und wir haben uns schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Aber ist das ein Grund, so angepisst zu sein?
»Ich rufe deinen Dad an, damit er weiß, dass du hier bist.« Janine nimmt ihr Handy vom Couchtisch, dann vergewissert sie sich, dass die Haustür abgesperrt ist, checkt die Fenster und zieht die Vorhänge zu, einen nach dem anderen. Unterdessen ist aus der Küche zorniges Türenknallen zu hören.
»Oh, Aidan, Gott sei Dank, dass ich dich erwische.« Pause. Janine legt die Hand in den Nacken und drückt so fest zu, dass ihre Fingerspitzen weiß werden. »Ja, sie ist hier, und es geht ihr gut. Mach dir keine Sorgen.« Sie nickt. »Okay. Wir bleiben hier. Bis gleich.«
Annie kehrt ins Wohnzimmer zurück und drückt mir ein Glas Wasser in die Hand, dann lässt sie sich in den Sessel fallen, der am weitesten von der Couch entfernt steht.
»Dein Dad wird bald hier sein«, sagt Janine. »Die Polizei sollte ebenfalls jede Sekunde eintreffen.« Janine blickt auf den Schuh in meiner Hand. »Ach, Liebes, den nehme ich.« Sie geht in die Küche und kehrt mit einer Plastiktüte zurück. »Leg ihn hier rein.« Sie verknotet die Griffe und stellt die Tüte in den Vorraum.
»Ich habe mich erst kürzlich bei Annie nach dir erkundigt, Cleo!« Janine klingt beinahe fröhlich. Als wären wir Freundinnen, die sich getroffen haben, um ein wenig zu plaudern. »Aber sie hat gesagt, ihr seht euch nie.«
»Es ist eine große Uni, Mom«, knurrt Annie. »Außerdem habe ich nicht behauptet, dass wir uns gar nicht mehr sehen.«
Janine verdreht gutmütig die großen blauen Augen. »Ich bitte dich, genau das hast du gesagt!«, neckt sie ihre Tochter.
»Ich habe gesagt, dass wir nicht mehr befreundet sind.« Annie steht auf. Ihre selbstbewusste Lässigkeit ist wie weggeblasen. Sie sieht gut aus mit ihren zurückgebundenen blonden Haaren und dem dezenten Make-up. Annie war schon immer viel schöner, als ihr bewusst zu sein schien, doch seit sie an der New York University ist, entfaltet sie sich richtig. Sie ist Mitglied in einer der großen Schwesternschaften, ein richtiges Popular Girl inmitten eines Meers von Durchschnittsblondinen – eine hübscher als die andere, aber keine von ihnen schön. »Ich studiere im Hauptfach Biologie, Cleo Englisch, da gibt es nicht viele Überschneidungen, stimmt’s, Cleo?« Sie sieht mich seltsam an, fast so, als würde sie etwas ganz anderes meinen.
»Warum braucht die Polizei so lange?«, murmelt Janine. Sie hat Angst, das ist offensichtlich, auch wenn sie sich Mühe gibt, dies zu verbergen. »Das hier ist doch wirklich ein Notfall.«
Annie starrt mich immer noch an.
»Und, wie läuft’s bei dir so?«, erkundige ich mich beiläufig. Wenn ich mich ganz normal verhalte, belässt sie es vielleicht dabei.
»Du meinst, wie es in den letzten sechs Jahren so gelaufen ist?«
Herrgott.
»Klar, in den letzten sechs Jahren«, erwidere ich ausdruckslos. Langsam geht sie mir auf die Nerven.
Um genau zu sein, war es Annies Gerede über mich, das unserer Freundschaft ein Ende gesetzt hat. All diese Gerüchte im Abschlussjahr, ich würde mit den Freunden meiner Mitschülerinnen schlafen, dabei stimmte das gar nicht. Angeblich hatte Annie diese Gerüchte in die Welt gesetzt. Sie leugnete dies, und ich hatte keine Beweise, aber ich habe ihr nie wieder vertraut. Überhaupt fällt es mir seitdem schwer, meinen Freundinnen zu vertrauen.
Es klingelt. »Oh, gut. Das muss dein Vater sein.« Janine springt auf und öffnet die Tür. Eine Sekunde später kommt Dad hereingestürmt.
»Cleo!« Er zieht mich fest in seine Arme. Und für einen kurzen Moment fühlt es sich gut an, als wäre alles in Ordnung. Doch noch während er mich umarmt, fällt mir auf, dass sein Rücken feucht ist vor Schweiß.
Janine tritt an eines der Fenster und zieht den Vorhang ein kleines Stück zur Seite, aber so, dass man sie von der Straße aus nicht sehen kann. »Ich glaube, da kommt die Polizei. Endlich.«
»Alles okay?«, fragt mein Dad. Er sieht bestürzt aus.
»Hm«, erwidere ich nur, denn wenn ich versuchen würde zu sprechen, bräche ich hundertprozentig in Tränen aus.
»Alles wird gut, Cleo«, versichert auch er mir, doch er klingt wie ein Roboter. »Alles wird gut.«
Ich deute in Richtung der Plastiktüte. »Willst du Moms Ballerina sehen?«, frage ich. Er muss wissen, dass dies keine »Alles wird gut«-Situation ist.
»Ähm …« Mein Dad streicht sich mit der Hand über die Stirn.
»Nein, nein, nein«, schaltet Janine sich ein. »Außer der Polizei muss sich keiner den Schuh ansehen.«
»Glaubst du, Mom geht’s gut?«, frage ich mit zitternder Stimme und löse mich aus der Umarmung.
»Natürlich geht es ihr gut.« Jetzt klingt er ruhig und zuversichtlich. Und ich möchte ihm glauben. Wirklich.
»Ich bin zu spät gekommen«, sage ich schuldbewusst. Meine Stimme bricht. Ich habe seit Monaten nicht mehr mit meiner Mom gesprochen. Ich war so wütend auf sie. Aus gutem Grund, aber im Augenblick ist das nicht von Belang. »Wenn ich da gewesen wäre …«
»Nein, Cleo.« Janine tritt auf mich zu und zieht mich nun ebenfalls in die Arme. »Was immer passiert ist – es hat nichts damit zu tun, dass du dich verspätet hast. Deine Mutter würde nicht wollen, dass du dir Vorwürfe machst. Und das Letzte, was sie wollte, wäre, dass du in Gefahr gerätst. Außerdem wissen wir noch gar nicht, ob ihr tatsächlich etwas zugestoßen ist.« Sie umfasst meine Oberarme und schiebt mich ein Stück von sich, um mir in die Augen zu schauen. »Ich bin mir sicher, dass es ihr gut geht.«
Doch wir alle wissen, dass das nicht stimmt. Da ist das Blut – auf Moms Schuh und auf dem Fußboden in der Küche. Ihr ist definitiv etwas zugestoßen. Etwas Schlimmes.
Okay, die Schreib-AG war eigentlich ganz cool, auch wenn das Ganze im Grunde nur darauf hinausläuft, dass Daitch versucht, so zu tun, als wäre dieses Höllenloch nicht eher ein Ort für Kinderschutzbehörde und Jugendamt.
Ich hatte noch nie zuvor etwas »Kreatives« geschrieben, und es war schön, mal für eine kurze Zeit nicht ich selbst zu sein. Der College-Tutor hatte recht: Eine Figur zu sein, ist eine Flucht. Wir sollten einen Aufsatz schreiben, inspiriert von dem Blick aus dem Fenster, was in meinen Ohren komplett bekloppt klang – bis ich anfing. Und total gepackt wurde.
»Und immer suche ich nach den Rändern des Himmels«, lautete mein letzter Satz. Der Tutor sagte mir auf dem Weg nach draußen, dass mein Aufsatz richtig gut war. Und dann wiederholte er den Satz für mich – aus dem Gedächtnis.
Irgendwie war es angenehm, eine Ablenkung zu haben. Eine ganze Stunde nicht an Silas zu denken, der sich aus einem mir nicht bekannten Grund auf mich eingeschossen hat. Er hat mein Zimmer durchsucht – angeblich hat ihm jemand gesteckt, ich hätte Drogen eingeschmuggelt. Er hat meine gesamte Unterwäsche aus der Schublade genommen und auf dem Bett verteilt. Hat sämtliche Garnituren einzeln ausgeschüttelt, während er mich mit offenem Mund anstarrte. Ekelhaft.
Das Schlimmste ist, dass ich nicht einmal wütend bin. Alles, was ich empfinde, ist Furcht. Ich fühle mich klein.
KATRINA
Ich kam fünfzehn Minuten zu früh zu meinem Treffen mit Doug. Die Pünktlichkeit war der Macht der Gewohnheit geschuldet. Eine weitere Eigenschaft, die Cleo seit der Junior High nervte. Ja, es war nicht cool, zu früh zu kommen, doch Gott bewahre, wenn wir während ihrer Kindheit auch nur drei Sekunden zu spät dran gewesen waren!
Als es zwischen uns bergab ging und ich mir selbst die Schuld daran gab, beharrte meine beste Freundin Lauren darauf, dass Cleos Groll gegen mich normal, wenn nicht sogar gesund sei. Es sei ihre Art, sich von mir abzunabeln, und ein Zeichen dafür, dass ich einen sicheren Ort für sie geschaffen hatte, an dem dies möglich war.
Allerdings hatte ich, abgesehen von meiner Überpünktlichkeit, noch andere Dinge falsch gemacht. Dinge, die ich bereute. Und damit meine ich nicht nur die Sache mit Kyle. Meine Fehler als Mutter häuften sich, als Cleo von einem kleinen Mädchen zur Teenagerin heranwuchs und eigentlich einfach nur meine Liebe gebraucht hätte. Ich dagegen versuchte, alles zu regeln und Dinge, die in meinen Augen nicht so liefen, wie sie sollten, in Ordnung zu bringen. Und anstatt Cleo zu lieben, geriet ich in Panik. Weil ich hervorragend darin war zu handeln – wenn es um Gefühle ging, war ich nicht so gut. Und auf unsicherem Terrain war ich absolut Scheiße.
Ich denke, deshalb habe ich so ein Ding aus der Sache mit den Klamotten gemacht, aus dem schrecklichen schwarzen Make-up und all den Piercings, denn dies war etwas, was ich noch kontrollieren konnte, zumindest theoretisch. Und ich habe es weiß Gott versucht, in dieser Hinsicht hatte Aidan recht.
Am schlimmsten war es, als Cleo zu mir kam und mir erzählte, dass sie ihre Jungfräulichkeit verloren hatte. Fast hatte es den Anschein, ich würde den Anweisungen aus einem Leitfaden Was man als Mutter niemals tun sollte folgen. Ich sagte nur das Falsche. Um ehrlich zu sein, sagte ich grauenvolle Dinge. Dinge, die eine Mutter niemals zu ihrer Tochter sagen sollte und die dazu führten, dass zwischen uns etwas zerbrach – das hatte ich in Cleos Augen gesehen.
»Darf ich Ihnen noch eins bringen?«, fragte die Bartenderin und deutete auf mein leeres Weinglas.
Sie war eine ausgesprochen hübsche Brünette mit einem Nasenring, ihr linker Unterarm war voller leuchtender Tattoos. Sie sah nicht viel älter aus als Cleo, doch sie schien sich so viel wohler in ihrer Haut zu fühlen – wahrscheinlich, weil sie eine Mom hatte, die ihr die Gewissheit gab, geliebt zu werden, ganz gleich, was sie anhatte oder auf welche Weise sie sich auszudrücken versuchte.
»Sehr gern, das wäre großartig«, sagte ich und warf erneut einen Blick aufs Handy.
»Das hier geht aufs Haus«, sagte sie und stellte mit einem Augenzwinkern ein volles Glas vor mich hin.
Mein Gesicht wurde warm. Anscheinend ging sie davon aus, dass man mich versetzt hatte. In meinem Alter passierte einem das offenbar. Aber Doug war bislang immer zuverlässig gewesen und hatte mir jedes Mal eine Textnachricht geschickt, wenn er sich auch nur ein paar Minuten verspätete. Und einmal, als er unsere Verabredung absagen musste, hatte er Stunden vorher angerufen.
»Kat?«, hörte ich eine überraschte hohe Frauenstimme hinter mir fragen.
Ich drehte mich um, und da stand Janine, Annies Mom – schick wie immer in einem smaragdgrünen Jumpsuit, die Haare elegant hochgesteckt, in schwindelerregenden Heels, die sie trug, als wären es Flipflops. Janine war eine nicht berufstätige Mutter, der es gelang, stets up to date und gleichzeitig zugänglich und bodenständig zu sein. Sie schmiss die besten Partys in ganz Park Slope, und sie hatte stets die angesagteste Halloween-Deko. Ihr ebenso attraktiver, wenngleich ziemlich unterkühlter Ehemann Liam war ein erfolgreicher britischer Architekt, der, genau wie Aidan, permanent auf Reisen war. Annie und Cleo waren nur wenige Wochen nacheinander zur Welt gekommen, also hatten Janine und ich uns in jenen übernächtigten ersten Babymonaten sehr schnell angefreundet, zumal wir Nachbarinnen waren.
Doch da mein Mutterschutz auf vier Monate begrenzt war, hatte sich unsere Freundschaft von Anfang an angefühlt, als hätte sie ein Verfallsdatum. Außerdem war mir schon immer deutlich bewusst gewesen, dass Janine eine sehr viel bessere Mutter war als ich. Selbst die ersten Wochen handhabte sie so, wie sie alles handhabte – mit ruhiger Zuversicht, Pilates-Rückbildung und makellosem rotem Lippenstift. Liams Abwesenheit schien ihr nicht das Geringste auszumachen, vielleicht weil sie eine Vollzeit-Mom war. Dennoch hatte ich mich von ihrer Entspanntheit eingeschüchtert gefühlt, vor allem zu der Zeit, als keine von uns arbeitete. Janine war nicht damit überfordert, sich allein um Annie zu kümmern. Im Gegenteil, sie wirkte … begeistert. Ich dagegen versank im totalen Chaos, genau wie ich es erwartet hatte, und eben das war der Grund gewesen, warum ich anfangs keine Kinder hatte bekommen wollen.
Es war schwer, an seine Mutterinstinkte zu glauben, wenn man nie eine Mutter gehabt hatte.
Meine Eltern hatten sich aus dem Staub gemacht, als ich viereinhalb Jahre alt gewesen war. Anschließend wanderte ich von Pflegeheim zu Pflegeheim, bis ich neun war. Eine »unglückliche Verkettung von Ereignissen«, so eine Sozialarbeiterin, die einer weiteren interessierten Familie erklärte, warum ich noch nicht adoptiert worden war. Doch niemand wollte ein Kind, das bald einen zweistelligen Geburtstag feierte, ganz gleich, wie unschuldig die Erklärung dafür sein mochte. Und ein Kind, das schon seit Jahren in diesem System war, erst recht nicht.
Was meine Mutter betraf: Alles war möglich. Vor langer Zeit hatte ich mir selbst versprochen, dass dies eine Tür war, die ich für immer geschlossen lassen würde. Vielleicht war sie tot – an einer Überdosis oder bei einem aus dem Ruder gelaufenen Drogen-Deal gestorben. Vielleicht war sie high gewesen und bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Möglicherweise hatte sie sich auch zusammengerissen und führte ein ruhiges, produktives, glückliches Leben ohne mich. Vielleicht hatte sie weitere Kinder bekommen und war einem anderen kleinen Mädchen eine gute Mutter.
Trotz all meiner Zweifel hatte ich mich irgendwann dazu durchgerungen, ein Kind zu bekommen. Noch dazu mit erst sechsundzwanzig. Ich hatte mich von Aidans Überzeugung mitreißen lassen, dass ich eine großartige Mutter sein würde – ein Baby würde mich verändern, hatte er behauptet. Ich wollte ihm so gern glauben, wollte, dass seine Worte der Wahrheit entsprachen. Und in vielerlei Hinsicht taten sie das tatsächlich – allerdings nur während der Zeit, als Cleo zwischen zwei und ungefähr zwölf war. Während dieser kurzen Spanne zwischen den erschreckenden Risiken im Säuglings- und frühen Kleinkindalter, wenn es nicht selten um Leben und Tod ging, und den ebenso erschreckenden Unsicherheiten bei der Erziehung eines Teenagers. In diesen Jahren war ich eine exzellente Mutter, konsequent, zuverlässig und geduldig. Ich hielt sämtliche Zeitpläne ein, bot das richtige Essen an, begrenzte die Fernsehzeit und sorgte für ausreichend Schlaf. Doch als Cleo älter wurde, war es, als geriete mein Navigationssystem ins Stocken, und meine Zweifel gewannen zunehmend die Oberhand. Bald hatte ich komplett die Richtung verloren, und ich tat das Gegenteil von dem, was sämtliche Ratgeber empfahlen: Ich klammerte.
Dass ich so oft allein war, machte es nicht besser.
Als Cleo zwei Wochen alt war, flog Aidan nach Paris, um für seinen ersten Dokumentarfilm einen berühmten französischen Bioethiker wegen der schrumpfenden Polkappen zu interviewen. Ich erinnere mich noch genau, wie ich gerade im dunklen Kinderzimmer stand, die schreiende Cleo auf dem Arm, und versuchte, die fünfte schlaflose Nacht zu überstehen, als Aidan anrief. Sobald ich seine Stimme hörte, fing ich an zu weinen.
»Du musst dich einfach nur entspannen, Kat«, sagte er seufzend. »Sie spürt deinen Stress.«
»Ich kann das nicht, Aidan«, wisperte ich, obwohl ich in Wirklichkeit meinte: Ich kann das nicht allein.
»Selbstverständlich kannst du das«, widersprach Aidan, dann beschrieb er mir, wie wunderschön der Ausblick aus seinem Hotelzimmer war, mit der Sonne, die über dem Eiffelturm aufging. »Ich helfe dir doch.«
Was stimmt nicht mit mir?, hatte ich mich gefragt. Ich konnte mich glücklich schätzen, ich hatte einen liebenswerten Ehemann, der mich unterstützte, ein wunderschönes Baby, einen guten Job, ein fantastisches Zuhause, Geld – Dinge, von denen ich nie geträumt hatte, weder damals in Haven House noch später, als ich bei Gladys in ihrem prächtigen viktorianischen Haus in Greenwich wohnte. Ich hatte all dies bekommen, wofür ich dankbar sein konnte, aber ich fühlte mich die ganze Zeit über elend und verängstigt. Vielleicht sogar ein bisschen wütend, um ganz ehrlich zu sein – auf Aidan, aber auch auf Cleo, die doch nur ein winziges, hilfloses Baby war.
Während Cleos erster Lebensjahre war Aidan oft fort, um zu drehen. Er bekam ihre Koliken nicht mit, auch nicht die vier Male, bei denen eine Verletzung genäht werden musste, den monatelangen nächtlichen Terror, das Töpfchen-Training und die dritte Klasse, als ihre unmögliche Lehrerin sie zum Weinen brachte. Allerdings war er stets während der hellen Momente dazwischen da – in den Ferien, bei Festen oder wenn Cleo eine Auszeichnung bekam. Genau deshalb wünschte man – er – sich eine Familie: um den Finger durch die Glasur auf dem Kuchen zu ziehen, den ich Tag für Tag aufs Neue backte. Ich dagegen war die ganze Zeit über da trotz meiner grauenvollen Arbeitszeiten, die den Einsatz von zwei Nannys in verschiedenen Schichten erforderten. Pflege konnte man outsourcen, Mutter sein nicht.
Und jetzt stand plötzlich Janine hinter mir, wie um mich an all das zu erinnern, was ich am Ende vermasselt hatte.
»Janine!«, rief ich mit ebenso hoher Stimme, die allerdings eher panisch und nicht, wie beabsichtigt, munter klang.
Ich hatte völlig vergessen, dass es Janine gewesen war, die mir dieses Restaurant empfohlen hatte – ich bekam noch immer gelegentlich Gruppen-E-Mails von Park-Slope-Moms, die ihre Empfehlungen für dieses oder jenes teilten. Der Gedanke, dass ich ihr möglicherweise begegnete, wenn ich mich mit Doug hier traf, war mir nicht gekommen. Natürlich wusste Janine nicht, dass Aidan und ich getrennt waren. Ich durfte nicht riskieren, dass Annie davon erfuhr und es Cleo erzählte.
»O mein Gott, Kat, wie geht es dir?«, erkundigte sich Janine mit einem ungezwungenen Lachen, fuchtelte mit ihrer kleinen, silbernen Clutch herum und schaute sich um. »Ist Aidan auch hier?«
»Nein, ich treffe mich mit einem Mandanten.«
Janines Augen wurden misstrauisch. Skeptisch fragte sie: »Mit einem Mandanten? Ist dieses Lokal nicht etwas zu kuschelig dafür?«
»Ist es das?« Ich schaute mich ebenfalls um.
Sie hob die Augenbrauen, und ich konnte sehen, dass sie beschloss, nicht weiter nachzuhaken. Stattdessen deutete sie auf die Frau, die ihr gefolgt war.
»Meine Freundin arbeitet bei Tom Ford, und wir haben bei der Show viel zu viel Wein getrunken. Deshalb wollen wir jetzt eine Kleinigkeit essen und versuchen, wieder nüchtern zu werden. Vielleicht trinken wir auch einfach noch mehr Wein.« Tatsächlich, ihre Wangen waren gerötet, ihre Augen glasig. Plötzlich schien ihr etwas einzufallen. »Ach … wie geht es eigentlich Cleo?«
»Cleo?«
»Oh, entschuldige. Du siehst aus wie ein Reh im Scheinwerferlicht.« Janine lachte auf, dann beugte sie sich verschwörerisch zu mir. »Ich weiß, dass die Lage ein wenig … angespannt war wegen dieses Jungen …« Sie verdrehte die Augen. »Jungs sind immer ein Problem.«
Hatten Annie und Cleo wieder Kontakt miteinander? Oder … hatte sich Cleo an Janine gewandt, um mit ihr zu reden? Cleo hatte Janine schon immer toll gefunden, und für eine unangenehme Sekunde stellte ich mir vor, wie die beiden es sich in dem Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite gemütlich machten und eines der Mutter-Tochter-Gespräche führten, die Cleo und ich seit Jahren nicht mehr geführt hatten.
»Ja, Kyle …«
Janine schnitt eine Grimasse. »Richtig. Wie dem auch sei, ich denke, du hast das Richtige getan.«
Es klang so, als würde sie das Gegenteil meinen.
Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Ich bin mir nicht sicher, ob Cleo derselben Meinung ist.«
»Ach, was wissen die Mädchen denn schon?« Janine zuckte die Achseln. »Das wahre Problem ist doch, dass wir sie auf ein College so nah an ihrem Zuhause haben gehen lassen. Annie schläft mittlerweile mehrmals die Woche wieder in ihrem Kinderzimmer. Ich liebe meine Tochter, aber ehrlich … Irgendwann müssen sie auch mal flügge werden!«
Selbstverständlich war Annie zu oft zu Hause. Annie und Janine waren stets unzertrennlich gewesen, hatten an den Wochenenden gemeinsam auf den Stufen vor dem Haus gesessen und Kaffee getrunken oder waren kichernd zum Yoga gefahren. Damals, als Annie noch in der Highschool war. Welche Teenagerin hing schon freiwillig mit ihrer Mutter ab?
»Komm!« Janines Freundin fasste sie am Arm. »Unser Tisch ist fertig.«