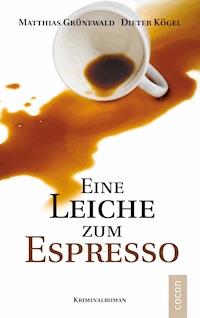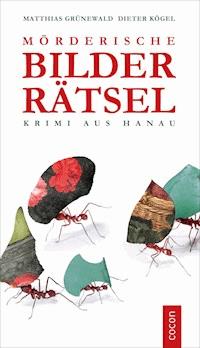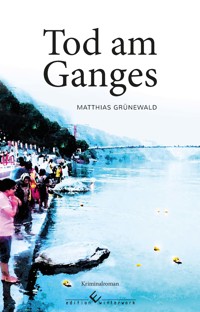
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition winterwork
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Herbert Schönfelder, Mittfünfziger und Kommissar aus Hanau, steht kurz vor einem Burnout. Ein Kollege empfiehlt einen Yogakurs in Indien, um neue Kraft zu tanken. Doch anstatt Entspannung findet er sich dort unvermittelt in einem Kriminalfall wieder. Die Leiche eines jungen Westlers wurde in Rishikesh ans Ufer des Ganges gespült. Die Ermittlungen führen Schönfelder ins spirituelle Herz Indiens, aber auch in die Verwicklungen der großen Weltpolitik. „Ein Reise-Yoga-Krimi wie ein indischer Bollywood Film. Überbordende Fülle wirbelt den Leser von Hanau durch den indischen Kosmos und zurück. Liebe inklusive.“
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verlages gestattet. Verwendung oder Verbreitung durch unautorisierte Dritte in allen gedruckten, audiovisuellen und akustischen Medien ist untersagt. Die Textrechte verbleiben beim Autor, dessen Einverständnis zur Veröffentlichung hier vorliegt. Für Satz- und Druckfehler keine Haftung.
Impressum
Matthias Grünewald
»Tod am Ganges«
www.edition-winterwork.de
© 2024 edition winterwork
Alle Rechte vorbehalten.
Satz: edition winterwork
Umschlag: Der Zweite Blick/ edition winterwork
Druck/E-BOOK: winterwork Borsdorf
ISBN Print 978-3-98913-071-5
ISBN E-BOOK 978-3-98913-080-7
Tod am Ganges
Matthias Grünewald
edition winterwork
Tod am Ganges
Herbert Schönfelder saß an seinem Schreibtisch in der Hanauer Polizeidirektion und klappte den Aktendeckel zu. Der Polizeihauptkommissar hatte fertig. Der Fall war abgeschlossen. Seine Augen blickten müde ins Leere, wie immer, wenn etwas zu Ende ging und die Anspannung nachließ. Herbert Schönfelder war Anfang 50. „Bestes Alter“, wie er stets zu antworten pflegte, wenn ihn jemand fragte, wie lange er es denn noch bis zur Rente habe. Er fühlte sich körperlich fit, auch wenn er mit den Jahren um die Hüften ein wenig fülliger geworden war und ein kleiner Speckring unter dem Hemd sichtbar war. Gleichzeitig konnte er auf die Erfahrung vieler Dienstjahre zurückblicken. Auf gelöste wie ungelöste Fälle. Das gab Sicherheit. Er musste nicht mehr wie ein Jungspund hyperventilieren und um Anerkennung kämpfen. Sein Wort hatte Gewicht. Und trotzdem lastete die Arbeit auf ihm. Der Erfolgsdruck. Die Quote, die es gar nicht gab aber trotzdem irgendwie zu erfüllen galt. Der Stress eben. Die Berge von Papierkram, die, trotz Computer, immer höher wurden, weil immer weniger Beamte immer mehr Aufgaben bekamen.
„Willkommen im Wirtschaftsleben“, hieß es dann aus dem Büro seines Chefs, wenn er sich beschwerte. Und dann war da noch der Regen, der seit ein paar Tagen unablässig gegen das Fenster prasselte. Gerade wollte er die Schublade seines Schreibfaches öffnen, in dem er für „Notfälle“ eine Flasche schottischen Hochlandwhiskey deponiert hatte, als es an der Tür klopfte.
„Herein“, rief er mürrisch.
Ein Kollege streckte den Kopf durch die Tür.
„Darf man eintreten?“
„Sonst hätte ich ja nicht hereingerufen.“
Schönfelder schüttelte missmutig den Kopf.
„So schlimm?“
Vor Schönfelder stand Jungkollege Mario Weinrich, mit dem er in so manchem schwierigen Einsatz war und auch einige Biere getrunken hatte. Das verbindet. Jung war etwas übertrieben. Immerhin war er schon 32 und seit zwei Jahren bei der Kripo. Doch weil seitdem keine neuen Stellen bewilligt wurden, blieb er der einzige Neuzugang der Hanauer Direktion, was Schönfelders Laune nicht verbesserte.
Schönfelder versuchte ein gequältes Lächeln, deutete dann auf die Fensterfront, an der das Wasser in dünnen Streifen herabfloss.
„Soll man da gute Laune haben?“
Weinrich holte tief Luft.
„Du brauchst mal Urlaub.“
Schönfelder rollte mit den Augen. Wie konnte Urlaub Abhilfe schaffen? Für die Zeit auf den griechischen Inseln oder beim süßen Leben an der Costa Brava würde er seine Dienststelle vergessen und sich sicherlich prima erholen. Aber dann, wenn er zurückkäme, träfe ihn das Elend nur umso schlimmer. Der Aktenberg wäre sicher bis unter die Decke angewachsen, weil jeder Kollege seine ungeliebten Arbeiten darauf packen würde, in der Hoffnung der alte Schönfelder mache das schon.
Weinrich nahm sich einen Stuhl und setzte sich seinem Kollegen gegenüber.
„Ich kann nicht mehr“, seufzte Schönfelder leise.
„Warst du schon mal beim Psychologen?“
„Hör mir auf mit der Psychokiste.“ Wenn er sich dort einen Termin geben ließe, würde ihn der Doc sicher dienstunfähig schreiben. „Burn-out“ stünde dann auf dem gelben Zettel oder zumindest „depressive Störung“, was letztlich auf das Gleiche hinausliefe. Er wäre weg vom Fenster. Weinrich verstand das Dilemma, in dem sein Senior Kollege steckte, wagte aber einen neuen Vorstoß.
„Ich mache regelmäßig Yoga.“ Dabei streckte er wie zur Demonstration beide Arme senkrecht über den Kopf, die gestählten Oberarme an die Ohren angelegt.
„Das hält beweglich und bringt Energie.“
Schönfelder schaute irritiert, angesichts der gymnastischen Übungen seines Kollegen. Schönfelder fielen tausend Gründe ein, warum er genau das nicht tun sollte. Der Gewichtigste: Er hatte keine Lust auf einen Kuschelkurs mit faltigen Hausfrauen.
„Bloß nicht“, sagte er und hob dabei abwehrend die Hände.
Weinrich ließ sich nicht beirren.
„Du musst ja keinen X-beliebigen Kurs machen, bei dem du stundenlang Oms brummst“, sagte er, als habe er Schönfelders Gedanken erraten. „In Indien gibt es super Angebote. Günstig und gut. Die haben Yoga schließlich erfunden. Außerdem kann man da sehr gut abschalten. Dort ist ein Trubel, ein Rausch an Farben und Gerüchen, da hast du in fünf Minuten alles vergessen, was dich an die Arbeit erinnert.“
„Bist du Verkäufer für Yogamatten? Kriegst du Prozente?“ Schönfelder fühlte sich in die Enge getrieben. Und ob die Aussicht auf Trubel und Rausch ihn locken könnte, wusste er auch nicht. Allerdings hatte er keine Lust auf eine Rehaklinik, die ihn vielleicht drei Monate oder noch länger aus dem Verkehr ziehen würde.
„Indien“, wiederholte er und dehnte dabei jeden Buchstaben. „Soll ich wochenlang Reis essen?“, blaffte er. Jetzt war es an Weinrich mit den Augen zu rollen.
„Lass mich nochmal darüber schlafen“, bat Schönfelder seinen Kollegen ein wenig versöhnlicher und fuhr sich dabei mit beiden Händen durchs Gesicht, als ließe sich aller Unmut wegwaschen. „Und kein Wort zu den Kollegen“, fügte er hinzu. Irgendetwas musste er tun. Das war klar. Weinrich nickte, klopfte Schönfelder aufmunternd auf die Schulter und verließ das Büro. Schönfelder sank wieder in sich zusammen und starrte erneut auf die Wassertropfen an der Fensterscheibe. Dann streckte er die Arme über den Kopf, so wie er es bei Weinrich gesehen hatte. In der Spiegelung des Fensters verglich er sein Resultat mit dem des Kollegen. Was er sah, gefiel ihm nicht. Zwei schlaffe Arme, die Mühe hatten, in die Streckung zu kommen. Ich muss etwas tun, wiederholte er.
Zunächst stellte er den abgeschlossenen Fall ins gegenüberliegende Regal, dann räumte er seinen Schreibtisch auf, solange bis die Arbeitsfläche leer war. Schönfelder lächelte zufrieden. Die Leere tat gut. Nichts, was er jetzt noch tun musste. Dieser Gedanke entspannte ihn.
Dann machte er sich auf den Weg in den siebten Stock. Dort lag das Büro des Polizeidirektors. Der Aufzug mit seinen blechernen und verbeulten Türen, an denen randalierende Alkoholiker, auf dem Weg zu den im Keller befindlichen Arrestzellen, ihre Wut ausgelassen hatten, fuhr nur langsam, mit einem gleichmäßigen Ruckeln, so als wehre er sich gegen seinen Fahrgast und wolle ihn abschütteln. Erreichte er das nächste Stockwerk, gab es einen kräftigeren Ruck, der wohl sagen wollte: „Und haben Sie sich ihr Anliegen gut überlegt?“ Schönfelder hatte überlegt. Er brauchte eine Pause. Die Sieben über der Türleiste leuchtete auf. Der Aufzug öffnete sich mit einem Zischlaut, der entfernt an ein Stöhnen erinnerte. Besucher waren hier nicht allzu gern gesehen, dachte Schönfelder und schaute beim Aussteigen vorsorglich noch einmal auf die TÜV Plakette des Aufzugs. 2025 stand da und somit war wohl alles in Ordnung.
Die Vorzimmerdame, Frau Meier, etwa in seinem Alter, blondiert, in einem enganliegenden Kostüm schaute nur kurz von ihrem PC auf und winkte ihn durch. Ihre Schminkutensilien lagen direkt neben der Tastatur. Schönfelder hatte sie wohl beim „Frischmachen“ gestört. Die Jalousien der Fensterfront waren heruntergelassen.
„Es regnet“, sagte sie schnippisch, als sie Schönfelders irritierten Blick bemerkte. „Davon wird man depressiv.“
Schönfelder lächelte. Er kämpfte angesichts des Regengraus mit ähnlichen Gefühlen. Und doch: Wenn er es nicht besser wüsste, hätte er seinem Chef eine Affäre mit der Sekretärin angedichtet. So im Halbdunkel, nur sie beide allein. Da könnte man auf solche Gedanken kommen. Und wenn es dazu noch regnet.
„Sie haben Glück“, unterbrach sie Schönfelders Gedankenspiele. „Der Chef ist gerade zurückgekommen.“
„Manchmal gibt es auch gute Tage“, antwortete Schönfelder und verwarf den Gedanken eines Tête-à-Tête zwischen Sekretärin und Chef auf dem siebten Stock.
„Mein lieber Herbert. Ich wollte gerade zu Ihnen.“
Sein Dienstherr, Paul Huber, Anfang Vierzig mit akkurat gebügeltem weißem Hemd und Krawatte, begrüßte ihn überschwänglich. Er trat als Macher auf, dynamisch und jovial. Huber war jemand, an dem alle Krisen abperlten, er lächelte sie weg und zeigte dabei immer Verständnis. Er war der Typ, der von allen Politikern geliebt wurde. Manche sagten, er sei wie ein Stück glatte Seife. Zu jenen zählte sich auch Schönfelder. Automatisch wich er einen Schritt zurück. Sie kannten sich zwar seit vielen Jahren und waren durchaus miteinander vertraut, doch eine derart freundliche Begrüßung ließ Schlimmes erahnen. Wahrscheinlich wollte ihn sein Chef mit einer neuen heiklen Aufgabe betrauen. Sonderermittlungen, die nur er machen könne, weil nur er die nötige Erfahrung dafür habe. Schönfelder wappnete sich für den Ernstfall.
„Der Fall mit den Albanern ist abgeschlossen, wie ich hörte“, begann Huber und platzierte seinen Hintern auf der Schreibtischkante. Schönfelder nickte und biss die Zähne zusammen. Jetzt kommt es, dachte er und sollte Recht behalten.
„Gute Arbeit“, lobte er zunächst, um dann fortzufahren: „Jetzt wo Sie wieder frei sind, haben wir etwas sehr Kniffliges, etwas das Fingerspitzengefühl erfordert. Sie sind genau der Richtige.“ Huber versuchte ihn mit schmeichelnden Worten zu umgarnen und deutete dabei immer wieder mit seinem Zeigefinger in Schönfelders Richtung. Eine Masche, die normalerweise von Erfolg gekrönt war. Aber nicht heute. Schönfelder winkte ab.
„Chef, ich brauche eine Pause.“
Ein Satz, der ihm schwerfiel, aber so unvermittelt aus ihm herausfiel, dass Huber erstaunt die Augenbrauen nach oben zog. Schönfelders Atem wurde flacher. Ein sicheres Anzeichen für Stress.
„Sie sind doch nicht krank, oder?“ Hubers Lächeln wurde dünner.
„Kriegen Sie jetzt bloß kein Burn-out. Sie sind einer unserer besten Ermittler.“ Huber baute weiter Druck auf und appellierte an Schönfelders Pflichtbewusstsein. Doch Schönfelder schüttelte beharrlich den Kopf.
„Ich brauche Urlaub.“
Huber atmete hörbar aus. „Ich dachte schon, es wäre etwas Schlimmeres. Burn-out! Da hört man ja, dass die Leute ein ganzes Jahr ausfallen. Ein Alptraum!“
Huber griff zu einer Packung Pistazienkerne, die hinter ihm auf dem Schreibtisch lag und reichte sie in Richtung Schönfelder. „Ist gut für die Nerven“, sagte er.
Schönfelder griff zu und Huber fand zu seiner guten Laune zurück. Dieses eine Mal könne er den Fall auch einem anderen Kollegen anvertrauen. Was er von Weinrich halte?
„Guter Mann“, sagte Schönfelder kurz, froh der zusätzlichen Arbeit entkommen zu sein. Dann wendete sich Huber den vermeintlich schönen Dingen wie Urlaub zu.
„Wo geht´s denn hin? Ich war letztens in Sizilien. Traumhaft.“ Huber verlor sich in schwelgerischen Beschreibungen von türkisblauem Meer und gegrillten Tintenfischringen, die er in einer schnuggeligen Trattoria in Siracusa verspeist hatte.
„Ein Gedicht. So etwas kriegt man hier in dieser Qualität gar nicht.“ Doch Schönfelder nahm Hubers ausufernde Elegie nur als ein entferntes Rauschen wahr.
Eine Antwort wartete sein Chef gar nicht ab.
„Geben Sie ihren Urlaub im Vorzimmer an. Frau Meier kümmert sich dann um alles. Gute Erholung.“
Das waren die letzten Worte, dann kehrte er hinter seinen Schreibtisch zurück und warf ebenfalls ein paar Pistazien ein. Schönfelder tat, wie ihm aufgetragen.
„Wo geht´s denn hin?“, wollte auch die Vorzimmersekretärin wissen.
„Ich … Äh, … vielleicht Indien.“
„Indien? Oh, wie romantisch. Taj Mahal…“
Schönfelder hob die Hand.
„Ist noch nicht sicher.“
„Aber den Taj Mahal müssen Sie besuchen, wenn Sie nach Indien fahren“, rief sie ihm nach.
Schönfelder stand schon am Aufzug.
Wieder öffnete sich die Tür mit einem Zischlaut und dann ruckelte er langsam in die Tiefe. Auf der ersten Etage legte der Lift einen Zwischenstopp für einen weiteren Fahrgast ein. Weinrich stieg zu.
„Ich habe dich schon gesucht“, sagte er, überrascht ihn hier anzutreffen. „Das ist für dich. Habe ich dir ausgedruckt. Steht alles drin über Yoga, wo man das machen kann, was es kostet und dann kommst du in drei Wochen wieder und alles ist gut.“
Schönfelder griff nach den Unterlagen. Er fühlte sich zu schwach, um dagegen zu protestieren. Dann erreichte der Aufzug das Erdgeschoss. Schönfelder grüßte zum Abschied. Jetzt nur noch schlafen. Er fühlte sich, als habe jemand bei ihm den Stecker gezogen.
Zu Hause fiel er in einen unruhigen Schlaf. Immer wieder wurde er wach, weil er von Elefanten träumte, die es sich auf seinem Brustkorb bequem gemacht hatten. Im Halbschlaf wandelte Schönfelder in die Küche seiner Singlewohnung. Arbeit und Frau, das passte nur in den seltensten Fällen zusammen, fand er, deswegen war Gerda, nach 20 Ehejahren auch ausgezogen. Dass es weniger an der Arbeit und mehr an ihrem gemeinsamen Leben lag, dem das Feuer abhandengekommen war, wollte er nicht wahrhaben. Im Kühlschrank stand noch eine angefangene Flasche Bier vom Vortag. Schönfelder leerte sie auf einen Zug als Einschlafhilfe und legte sich erneut hin. Die Elefantenherde war weitergezogen, doch der Schlaf war leicht und unruhig. Er wurde am nächsten Morgen früh wach, mit dem Gefühl kein Auge zugemacht zu haben. Der Regen hatte nicht nachgelassen und prasselte unaufhörlich gegen sein Fenster. Auch ein starker Kaffee brachte seine Lebensenergie nicht wirklich in Schwung. Jetzt, wo er sich eingestanden hatte, eine Veränderung zu brauchen, fühlte er sich nicht besser. Im Gegenteil. Es war so, als sei ein Damm gebrochen, dessen Fluten ihn unter sich zu begraben drohten. Schönfelder nahm die Unterlagen von Weinrich zur Hand.
„… und dann kommst du in drei Wochen wieder und alles ist gut.“ Die Worte seines Kollegen hallten in seinem Kopf wider, wie das Echo in einem Tunnel. Sein Blick verlor sich in den Papieren, die er in Händen hielt. Buchstaben begannen vor seinen Augen zu verschwimmen, als er zum Telefon griff. Was hatte er zu verlieren?
Dann ging alles schnell. Visaservice anrufen. Flug buchen, eine Mail an das Yogazentrum schicken und für alle Fälle orderte er einen Reiseführer „Indien der unbekannte Kontinent.“ Schönfelder atmete aus. Er hatte eine Entscheidung getroffen.
„All passengers of Air India flight AI 120 to Delhi are requested to proceed… .“ Der Aufruf für seinen Flug schallte durch die Lautsprecher am Frankfurter Flughafen. Schönfelder setzte sich in Bewegung zum Gate. Er konnte immer noch nicht glauben, wozu er sich hatte hinreißen lassen. Schönfelder in Indien, wo er seinen Urlaub ansonsten in Italien, auf Mallorca oder an der Ostsee verbrachte. Die Vorstellung in einen völlig anderen Kulturkreis einzutauchen, in dem, wie Weinrich sagte, alles, aber auch wirklich alles anders als in den heimischen Gefilden ist, beunruhigte und elektrisierte ihn zugleich. Er fühlte Anspannung, die Sinne waren geschärft. Aber das war ein gutes Zeichen. Indiz dafür, dass er das Leben um ihn herum wahrnahm. Er musste sich eingestehen, dass in der letzten Zeit das Leben mehr oder weniger an ihm vorbeigerauscht war, betäubt vom Hochlandwhiskey, dem er mehr zusprach, als ihm guttat. Vor allem war er damit beschäftigt, dass niemand merkte, was mit ihm los war. Diese Last fiel nun von ihm ab. In Indien kannte ihn niemand. Er musste nicht so tun, als ob er alles unter Kontrolle hatte und vor allem musste er keine Fassade aufrechterhalten, die schon längst Risse bekommen hatte. Schönfelders Kopf begann unweigerlich leicht zu nicken, wie bei einem Wackeldackel, der auf der Hutablage eines 70er Jahre Opels, dem Hintermann entgegennickte. Mit dem Ticket in der Hemdtasche und den Trolley hinter sich herziehend, folgte er dem blauleuchtenden Hinweisschild B 12, wo sein Flieger auf ihn wartete. Drei Wochen Erholung lagen vor ihm. Drei Wochen Tiefenentspannung mit ein paar gymnastischen Übungen. Und sollte doch etwas schief gehen, würde sein Medizinpaket helfen. Die Hälfte seines Trolleys war gefüllt mit Tabletten gegen Malaria, Kopfweh und Durchfall, Pflastern und Verbänden. Und dann hatte er sich auch einen Wasserentkeimer aufschwatzen lassen.
„Wo soll´s denn hingehen?“, fragte der Verkäufer in einem Outdoorladen. Als er Indien hörte, wiegte er bedächtig den Kopf hin und her.
„Oh la la“, sagte er nur und griff zielsicher in das Regal hinter ihm. „Der filtert bis zu 99,9 Prozent aller Bakterien und Viren aus dem Wasser. Das ist dann so sauber, wie zu Hause bei Ihnen aus dem Wasserhahn“, sagte der Verkäufer und hielt Schönfelder das gute Stück entgegen.
„Wie teuer?“, wagte Schönfelder einen Einwand.
„46,80 Euro“, kam die prompte Antwort. „Billiger als ein Klinikaufenthalt.“ Ein Verkaufsargument, das auch Schönfelder überzeugte. Beim erneuten Gedanken an den Keramikfilter huschte ein Lächeln über Schönfelders Gesicht. Indien ist kein Entwicklungsland mehr, sagte er sich und war sich sicher, das Gerät unausgepackt wieder mit nach Hause zu nehmen.
Die Stewardess am Gate im farbenfrohen Sari grüßte freundlich mit einem indischen „Namaste“ und legte dabei die Hände vor der Brust zusammen. Schönfelder nickte und nahm seinen Platz ein.
Er schaute aus dem Fenster auf das Rollfeld. Die Anspannung, die unzähligen Überstunden, alles blieb zurück, in dem Moment, in dem die Stewardess die Tür des Fliegers schloss. Schönfelder begann sich auf sein indisches Abenteuer zu freuen. Ein paar Gedanken schossen quer. Yoga mit 50. Schönfelder schüttelte den Kopf und erinnerte sich an die Midlife-Crisis älterer Kollegen, die ihrer verlorenen Jugend nachtrauerten und sich plötzlich eine Harley Davidson zulegten oder für einen Marathon zu trainieren begannen. Eine Midlife-Crisis muss man sich auch leisten können, waren stets Schönfelders Worte. Er hatte dafür keine Zeit. Stattdessen war er damit beschäftigt, Ganoven zu jagen. Schönfelder griff nach einer Zeitung, die an Bord verteilt wurde. Die erste Schlagzeile beschäftigte sich mit seinem Reiseziel. „Indiens heiliger Fluss Ganges. Wo ein Schluck Wasser tödlich ist.“ Ob der Wasserfilter vielleicht doch eine sinnvolle Investition war? Darunter gleich die nächste Schreckensmeldung: „Indien – das gefährlichste Reiseland der Welt. Für Frauen“. Über 30 Tausend Frauen werden dort jedes Jahr Opfer sexueller Gewalt, las Schönfelder. Eine Nachricht, die so gar nicht zum Image von meditierenden Heiligen passen wollte und ihn an Arbeit zu Hause erinnerte. Abschalten sagte er sich und legte die Zeitung beiseite.
Die Stewardess kam den Mittelgang entlang und kontrollierte die angelegten Sicherheitsgurte. Schönfelder sah sich um. Die meisten Passagiere waren Inder. Nur wenige Westler befanden sich in der Maschine. Schönfelder ertappte sich dabei, „Gesichter zu lesen“, wie er es nannte, und nach auffälligem Verhalten Ausschau zu halten. Einige der Passagiere machten sich an den Plastikhüllen der Kopfhörer zu schaffen und versuchten umständlich, die Videobordanlage in Gang zu bringen, indem sie auf die Knöpfe in der Armlehne hämmerten. Andere bereiteten sich auf ein Nickerchen vor, redeten auf den Nachbarn ein oder machten sich über die mitgebrachten Essensvorräte her. Schönfelder stellte seinen Suchblick ein. Er war nicht im Dienst. Sein Sitznachbar, ein massiger Herr mit Überbreite, lächelte in Schönfelders Richtung. Ein starker Parfümduft gepaart mit den Ausdünstungen von Schweiß und einem einfachen Deo umwehte seinen Nachbarn.
„Wo geht es denn hin?“, fragte er und lehnte sich weit in Richtung Schönfelder.
„Indien“, sagte Schönfelder knapp und wich dabei ein Stück in Richtung Fenster zurück. Er hatte kein Interesse daran, seine Reiseroute zu offenbaren.
„Da haben Sie Glück. Sie sind im richtigen Flieger“, meinte sein Nachbar, mit Schweißtropfen auf der Stirn und einem dünnen Oberlippenbart im Stil der 20er Jahre, scherzhaft.
„Sie müssen den Taj Mahal sehen. Ich war schon dreimal da“, fuhr er mit hessischem Akzent fort, bei dem jedes „ch“ unweigerlich zu einem „sch“ wird und strich sich dabei durch das schwarze Haar, das glänzte, als habe er es mit Speck eingerieben.
„Sind Sie in der Parfümbranche?“, ließ sich Schönfelder zu einer spitzen Bemerkung hinreißen, die allerdings ihr Ziel verfehlte.
Der Mann schüttelte den Kopf.
„Verkäufer?“, setzte Schönfelder das Ratespiel fort.
„Ja. Fast. Sehr gute Menschenkenntnis“, dabei hielt er lobend seinen Zeigefinger in die Höhe. „Sagen wir, ich bringe Leute zusammen. Netzwerker, heißt das Neudeutsch. Aber eigentlich bin ich Ingenieur für Pumpen. Das klingt ein wenig langweilig. Netzwerker klingt besser, finden Sie nicht?“, sagte er mit einem dröhnenden, selbstgefälligen Lachen.
Schönfelder nickte geflissentlich und überlegte, wie er dem Mitteilungsdrang seines Nachbarn entkommen könnte, doch der kam gerade erst in Fahrt.
„Indien ist ein tolles Land“, fuhr er fort.
„Es gibt nur zu viele Inder. Da müsste man mal aufräumen.“ Dabei lehnte er sich noch ein Stück weiter in Richtung Schönfelder und umnebelte seinen Nachbarn mit einem kräftigen Schwall seiner Ausdünstungen.
Schönfelder schaute den „Menschenzusammenbringer“ mit stechendem Blick an. War er hier an einen Rassisten geraten, der ihm die nächsten sechs Stunden Lektionen in Sachen Weltpolitik erteilen wollte? Schönfelder drückte sich weiter an die Außenwand des Fliegers und schloss die Augen. Nur so konnte er seinem Nachbarn entkommen. Er habe viel Schlaf nachzuholen, sagte er und meldete sich aus der gerade erst begonnenen Konversation ab. Sein Nachbar brummte verständnisvoll.
„Ja ja, Reisen geht in die Knochen“, und machte sich dann ebenfalls an Kopfhörer und Fernbedienung der Bordunterhaltung zu schaffen.
Kaum war Schönfelder eingenickt, weckte ihn die Stewardess mit einem Lächeln, das er aus dem Fernsehen zu kennen glaubte. Weiße Zähne, wie die der Lottofee, strahlten ihn an. „Geflügel oder vegetarisch?“ Dabei hielt ihm die Stewardess in ihrem faltenfreien, gelb weißen Sari mit roter Bordüre, zwei in Aluminium verpackte Plastikschalen entgegen, die einander zumindest äußerlich völlig glichen. Schönfelder fühlte sich wie bei einer Lotterie. Er hatte gewonnen. Allerdings war der Preis bescheiden. Schönfelder griff zur linken Aluschale.
„Gibt es auch ein Bier?“ Wieder lächelte die Stewardess und wackelte dabei mit dem Kopf. Sie war Inderin und Kopfwackeln hieß „Ja“, wie Schönfelder wenig später feststellte, als sie ihm eine Dose Kingfisher Bier aus indischer Produktion reichte. Danach schlief Schönfelder erneut ein. Wieder träumte er von Elefanten. Diesmal saßen sie nicht auf seiner Brust, sondern drängten ihn an eine Mauer, die zum Glück so stabil war, dass sie nicht in sich zusammenfiel. Schönfelder schreckte auf. Der Elefant saß neben ihm, war ebenfalls eingeschlafen und lehnte sich erneut in Schönfelders Richtung. Die Mauer war die Flugzeugwand. Und er war sehr froh, dass sie standhielt.
Der Rest des Fluges verlief ereignislos. Stück um Stück näherte er sich dem Subkontinent. Der rote Strich auf dem Bordbildschirm, der die zurückgelegte Route anzeigte, wurde länger und länger. Dass er sich Delhi näherte, konnte er an dem milchigen Dunst erkennen, in den der Flieger eintauchte. Irgendwo darin musste sich die Stadt verbergen. Delhi war auch als Indiens Hauptstadt des Smog bekannt. Der Flieger sank Meter um Meter der Landebahn entgegen. Schönfelder bereitete sich auf die Landung vor. Er war kein Vielflieger und erst recht kein Liebhaber von Achterbahnfahrten. Die Landung, zumindest dann, wenn der Pilot die Maschine etwas ruppig aufsetzt, jagte Schönfelder jedes Mal einen Schreck in die Magengrube. Doch der Pilot der Air India Maschine verstand sein Handwerk. Sanft setzten die dicken Gummireifen auf der Asphaltpiste auf. Dann war es geschafft. Wenig später öffnete sich die Tür und die Passagiere erhoben sich. Schönfelder tat es ihnen gleich und blickte sich ein letztes Mal um. Der Innenraum des Fliegers sah aus wie nach einer Abifeier: Papier, Erdnusstüten und Plastikbecher lagen auf dem Boden. Dazwischen zertretene Essensreste. Vielleicht war der Ausspruch seines Sitznachbarn „… da muss man mal aufräumen“ anders gemeint, als er ihn verstand.
Schönfelder ging durch den Schlauch des Andockfingers. Er war in Indien.
Was das wirklich bedeutete, spürte er erst, als er das klimatisierte Flughafengebäude verließ: 32 Grad tropische Hitze schlugen ihm entgegen, wie ein Hammer gegen den Kopf. Die Luftfeuchtigkeit ließ ihn schwitzen, als habe in der Sauna gerade jemand einen Aufguss verabreicht. Schönfelder hielt inne und stützte sich schweratmend auf einen kleinen Mauervorsprung, hinter dem eine Rolltreppe in der Tiefe verschwand. Indien würde anstrengend werden, war ihm in diesem Moment klar.
Bald hatte er es geschafft. Hinter ihm lagen über 250 Kilometer, die er zu Fuß oder mit schlecht gefederten Landbussen zurückgelegt hatte. Der kleine Char Dham: Indiens legendärer Pilgerweg durch die heiligsten Stätten im Himalaya. Badrinath war einer der Tempel auf seiner Reise. Vier Wochen schon war Maurice, den zu Hause alle nur „Mo“ nannten, unterwegs. Er hatte gerade sein Studium beendet und bevor er eine Festanstellung irgendwo in Deutschland annahm, wollte er noch einmal eine große Reise machen. Mo liebte die Berge, vielleicht lockten ihn die unerreichbaren Gipfel besonders, weil er aus der Norddeutschen Tiefebene bei Hannover kam, wo alles flach wie ein Brett ist. Und der Himalaya war der Gipfel der Gipfel. Es gab schlicht nichts Höheres. Vom Fuß des Tempels schaute er sehnsüchtig auf die Höhen der schneebedeckten Gipfel. Oben warteten die ewigen Gletscher auf ihn. Unvorstellbare Eisriesen, mächtig und still. Hinter dem Tempel schlängelte sich ein kleiner Trampelpfad in die Höhe. Einmal wollte er auf einem der Gebirgskämme stehen, den Göttern nahe sein und in die Weite schauen. Außerdem musste er Klarheit gewinnen. Er musste nachdenken. Und dazu erschien ein Aufstieg auf einen der Berggipfel genau das Richtige. Wenn sich der Blick in der Unendlichkeit verliert und es nichts mehr gibt, woran sich die Gedanken festhalten, kann Neues entstehen, so die Überlegung. Zwei Tage wollte er sich dafür Zeit nehmen und einfach mal so durch die Berge streifen. Niemanden sehen und mit niemandem sprechen. Niemanden sehen war in Indien schwierig. Wohin er ging, waren Menschen. Indien war voll. Die Busse, die Bahnen, die Rikschas. Mo holte tief Luft. Nach oben blickend, kalkulierte er die Höhenmeter und die Zeit und setzte sich in Bewegung. Um seinen Hals baumelte die Kamera, mit der er dieses Erlebnis dokumentieren wollte. Schritt um Schritt ging es nach oben. Der Tempel unter ihm wurde kleiner und kleiner. Mit jedem zurückgelegten Meter wurde die Aussicht gewaltiger. Schon konnte er das halbe Tal überblicken. Die Stimmen der Pilger verstummten. Alles, was er hörte, war der leichte Wind, der durch das Tal strich, und sein eigener keuchender Atem. Mo knipste Bild um Bild als Erinnerung, die er zu Hause vorzeigen wollte. Fotos vom ewigen Schnee sind immer beeindruckend. Mo schwitzte und keuchte und fühlte sich doch berauscht und zugleich beflügelt. Er war unweit von Indiens höchstem Berg Nanda Devi, der mit 7900 Metern die Achttausender Marke nur knapp verfehlte. Der Gipfel, dem er am nächsten kommen würde, war der Nelkantha. Ein echter 6000er. Zwar unerreichbar, aber aus der Nähe sehen, das war am Grat möglich. Oben angekommen würde er bis nach China und nach Nepal schauen können. Beide Länder waren höchstens 50 Kilometer Luftlinie entfernt. Schon der Tempel lag auf einer Höhe oberhalb von 3000 Metern. Bis zum Kamm der Bergkette waren es nochmals fast 1000 Höhenmeter. Der Weg wurde schlechter. Kleinere Felsbrocken lagen auf dem Weg und zwangen Mo zu einer Klettereinlage. Wahrscheinlich war es nur ein Trampelpfad für Bäuerinnen der Region, die hier zum Holzmachen aufstiegen. Kurz darauf endete der Weg vor einer Felswand, die senkrecht vor ihm aufragte. Mo war schon oft in den Alpen auf unwegsamem Gelände geklettert. Ein Abbruch des Weges schreckte ihn nicht. Er stoppte lediglich, um Atem zu holen und die Lage zu studieren. Mo betrachtete den Verlauf der Felsen und hielt Ausschau nach einer gangbaren Route. Längsseits eines mächtigen Überhangs gab es eine Rinne, mit Geröll gefüllt, die nach oben führte. Die wollte er nehmen. Ein Schluck aus der Wasserflasche, dann trugen ihn seine Füße weiter. Schritt um Schritt, keuchend aber stetig. Nur wer einmal auf einem Gipfel stand, wird verstehen, warum ein Bergsteiger diese Strapazen auf sich nimmt. Es ist der neue Blick und die Weite, die locken. Schmelzwasser vom nahen Gletscher rauschte ins Tal. Die Luft wurde kälter, eisiger. Trotzdem schwitzte er. Immer wieder musste er eine Pause einlegen. Die dünne Höhenluft machte alles noch anstrengender. Erneut ruhte sich Mo auf einem Felsen aus. Er hatte noch etwas zu erledigen und zückte sein Handy. Verrückt, dass man hier Empfang hat. Das Netz ist besser als in den Alpen, dachte er und tippte eine SMS. Die Sonne neigte sich auf ihrer Bahn bereits tief in Richtung der Gipfelkämme. Bald würde sie untergehen, doch es war nicht mehr weit bis zur ersten Etappe. Mo konnte es fühlen. Und dann nach einer weiteren Stunde hatte er es geschafft. Er stand auf dem Grat der Bergkette weit oberhalb des Badrinath Tempels, der nur noch als kleiner Fleck zu sehen war. Längst war es still geworden. Die Affen, die anfangs noch in den Bäumen kreischend umhersprangen, blieben zurück. Mo errichtete sein Nachtlager. Der Schlafsack war für extreme Temperaturen ausgelegt. Eine Investition, die sich nun lohnte. Mo schloss den Reißverschluss und betrachtete den Himmel über ihm. Die Dämmerung kam schnell. Sterne zogen auf und bevölkerten den klaren Nachthimmel in einer unvorstellbaren Anzahl. Über ihm war es so voll wie auf der Erde. Mo musste grinsen und schlief dabei ein. Der nächste Morgen begann für Mo früh. Die Sonne ließ sich noch nicht blicken. Dafür war es kalt. Reif hatte sich gebildet und überzog die spärlichen Grashalme mit einem weißen Glanz. Mo machte sich schnell auf den Weg. Laufen macht warm. In der Ferne ragte, wie er erhofft hatte, die schneebedeckte Spitze des Nanda Devi in den Himmel, die bereits von den ersten Strahlen des Sonnenlichts berührt wurde und wie ein weißer Diamant über die restlichen Gipfel hinweg strahlte. Mo folgte der Höhenlinie für einige Stunden. Immer wieder blieb er für einen Augenblick stehen, überwältigt von den Ausblicken, die sich ihm boten. Vor ihm aber lag ewiges Eis, soweit das Auge blicken konnte. Dahinter weitere Bergketten, die sich endlos fortsetzen. Mo streckte, in einem Gefühl von Glückstaumel, die Arme zur Seite, als wolle er den Gletscher umarmen, sein Blick in die Weite des Gletschers gerichtet. Mo kniff die Augen zusammen. Bewegte sich dort etwas? Kleine weiße Punkte auf dem Schneefeld auf der gegenüberliegenden Bergkette? Mo stutzte. Menschen? Mo zückte seine Kamera und schoss ein paar Bilder. Doch noch bevor er die Situation verstehen konnte, zerriss ein Knall die Stille der Bergwelt. Mo stand noch einen Augenblick wie erstarrt, dann fiel er kopfüber auf den Stein und blieb reglos liegen. Blut färbte den Felsen unter ihm rot.
Schönfelder tupfte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Eben noch im regnerischen Deutschland und jetzt im schweißtreibenden Indien. Fliegen war noch immer eine schwer zu fassende Erfahrung. Tausende von Eindrücken stürmten auf ihn ein, wie Wellen, die sich an einer Kaimauer brechen. Weinrich hatte Recht. Indien ist anders. Er hatte noch nichts von dem riesigen Kontinent gesehen und war sich doch in einem sicher: Indien ist vollkommen anders. Menschenmassen strömten ihm entgegen. Frauen in farbenfrohen Saris, Stoffe wie ein leuchtendes Gemälde. Indien war zweifelsfrei bunt. Und dann war da dieser Geruch, der schon am Flughafen in der Luft lag. Ein seltsames Gemisch aus Abgasen, Ausdünstungen von Müll, brackigen Pfützen und starken Gewürzdüften, angereichert von einer feuchten Hitze. Vor allem aber war es laut. Rufe schallten, Taxis und Busse hupten, Motoren brummten. Wenn viele Menschen an einem Ort dichtgedrängt zusammenkommen, geht dies nicht ohne Lärm.
Schönfelder hielt Ausschau nach dem Bus, der ihn zu seinem Ziel bringen sollte. Rishikesh, Yogahauptstadt Indiens und zur Zeit der Beatles spirituelles Zentrum für viele Westler, die den Sinn des Lebens in einem Ashram suchten.
„Taxi?“, rief eine schnarrende Stimme in Schönfelders Rücken. Schönfelder drehte sich um. Vor ihm stand ein hochgewachsener Inder mit fleckigem beigem Hemd, dessen Brusttasche von einem Bündel zusammengerollter Rupienscheine ausgebeult wurde.
„Taxi?“ wiederholte er und deutete auf einen schwarzen Ambassador am Straßenrand. Schönfelder winkte ab.
„Bus“, sagte er.
„No Bus“, sagte der Taxifahrer. „Only Taxi.“
Im Nu war er von weiteren Taxifahrern umlagert, die alle das gleiche sagten und ihm eine Fahrt in ihrem Wagen aufdrängen wollten.
„Best taxi in town“, behauptete einer der Fahrer. Ein anderer warb mit Air Condition und ein dritter behauptete: „New model“ und zeigte mit Nachdruck auf eine blitzende Karosserie, die am Straßenrand auf Kundschaft wartete. Schönfelder fühlte sich wie ein Fisch an einer Angel und wich zurück, den Blick hilfesuchend nach Rettung Ausschau haltend. Er fand einen Soldaten, der in seiner braunen Uniform die Pässe am Eingang zum Flughafen kontrollierte.
„Bus?“, fragte Schönfelder mit schwacher Stimme. Der Soldat verzog keine Miene. Nur sein Kopf wackelte.
Schönfelder wackelte zurück. Dann schickte ihn der Officer über den Taxiparkplatz einige hundert Meter voraus.
„Busstand“, sagte er militärisch knapp und deutete zielgenau in die Richtung. Schönfelder dankte. Die Gruppe der Taxifahrer blieb zurück. Ob sie enttäuscht waren oder nicht, konnte Schönfelder nicht erkennen. Wahrscheinlich war es ein Spiel, bei dem man das eine Mal gewinnt, ein anderes Mal verliert. Heute hatte der weiße Mann aus Europa Glück.
Der Bus, den Schönfelder nahm, war zwar klimatisiert, trotzdem schwitzten die Passagiere. Frauen wedelten sich mit einem Stück Karton frische Luft zu. Die Männer tupften sich unablässig die Stirn. Schönfelder schaute aus dem Fenster. Seit mehr als einer Stunde fuhr er bereits durch die Stadt, ohne dass ein Ende absehbar war. Zunächst entlang kolonialer Prachtstraßen, beiderseits von weitausladenden Bäumen gesäumt, mit herrschaftlichen Häusern. Später wurde die Bebauung dichter. Die schmucklosen Häuser wirkten wie lieblos aneinander geklebte Schachteln. Endlos erweiterbar. Brauchte man mehr Raum, wurden einfach ein paar weitere Mauern hochgezogen und angesetzt. Meter um Meter fraß sich das Gebilde aus Beton und unverputzten Ziegelsteinen in die Landschaft. Häuser und Straßenzeilen in einer Endloskette. Als seien sie nach einem „Copy and Paste“ Verfahren auf die staubige Erde gesetzt worden. Dazu Verkehrschaos. Und immer wieder Hupen, das Schönfelder bereits vom Flughafen kannte. Taxis, Busse, PKWs und Tuk-Tuks. Alle taten es. „BLOW HORN!“, stand auf dem Kipplader eines LKWs und war anscheinend als Aufforderung an die restlichen Verkehrsteilnehmer zu verstehen. Nur wer hupt wird gesehen. Schwarze Dieselschwaden vom vorausfahrenden LKW zogen an Schönfelder Fenster vorbei. Unwillkürlich hielt er die Luft an und atmete erst wieder, als die schwarze Fahne außer Sicht war. Je weiter er sich vom Zentrum entfernte, desto schlechter schienen auch die Straßen zu werden. Schlaglöcher, so groß, dass sie mühelos einen Fußgänger verschlingen konnten, zwangen die Autos zu gewagten Ausweichmanövern. Die Zahl der Menschen allerdings nahm nicht ab. In den staubigen Seitenstraßen der Vorstadt bahnten sich die Autos nur mühsam einen Weg durch die Menge. Am Rand einer belebten und vielbefahrenen Straße boten Händler aufblasbare Badeenten und Palmen mit Liegefläche für den Pool an. Zur besseren Kontrolle der Unversehrtheit des guten Stücks im aufgeblasenen Zustand. Statussymbole für ein gutes Leben. Wer sich angesichts von Staub und Elend eine aufblasbare Palmeninsel leisten konnte, hatte es geschafft und zählte von nun an zu Indiens beständig wachsendem Mittelstand. Eine Verkaufsverhandlung war offensichtlich erfolgreich. Das junge Paar schnallte eine drei Meter hohe Palme auf ihr Honda Hero Motorrad. Wenig später schrammte die Plastikpalme an Schönfelders Seitenfenster entlang, um kurz darauf im vorausfahrenden Verkehrsstau zu verschwinden. Das Motorrad war längst vom Verkehr verschluckt, doch die Palme tauchte immer wieder wie ein hüpfender Punkt in der Ferne auf. Stoßstange an Stoßstange quälten sich die Autos weiter. Wer die Wartezeit nicht mehr aushielt, wendete und fuhr hupend gegen den Strom oder legte, auf der Suche nach einer Umgehung, den Rückwärtsgang ein. Wie soll man sich hier erholen, fragte sich Schönfelder mit bleichem Gesicht und nahm einen kräftigen Schluck aus der Wasserflasche. Er befand sich offensichtlich in einem Bienenschwarm. Um ihn herum brummte es ohne Unterbrechung. Vielleicht hätte er sich doch besser informieren sollen, bevor er die Reise buchte. Erst als sie Delhi verließen, wurde es ein wenig besser. Bäume und Felder tauchten auf. Dazwischen Bewässerungsgräben, in denen eine dunkle Brühe mit öligen Flecken stand. Reste eines Regenschauers, die sich, angereichert mit Traktorenöl, zu einem unheilvollen Gemisch verbanden. Einfache Ochsenkarren und moderne Landmaschinen standen nebeneinander. Eine Gruppe Frauen arbeitete gebückt auf einem Feld. Am Straßenrand Werbeplakate, die auf Bambusstangen genagelt waren. Die Luft war auch hier dunstig. Schönfelders Augen klebten förmlich an der Scheibe und sogen die ersten Eindrücke eines fremden Landes ein. Bald darauf fuhr der Fahrer an eine Raststätte, deren Neonreklame aufgeregt flackerte. Die Passagiere strömten zu den Toiletten. Wie in Deutschland, bemerkte Schönfelder und war froh, etwas Bekanntes und Vertrautes gefunden zu haben. Schönfelder stand etwas verloren in der großen Halle des Rasthofes, die bis auf ein paar Plastikgarnituren und den Thekenbereich leer war. Was sollte er essen?
„Good, very good“, sagte ein indischer Mitreisender, der Schönfelders hilflosen Blick sah, und deutete in der abgegriffenen Speisekarte auf ein Gericht mit einem unaussprechlichen Namen. Dann lächelte er. Schönfelder lächelte zurück. Der erste Kontakt war hergestellt und er war gut verlaufen. Der Raststättenkoch mit fettverschmiertem T-Shirt, auf dem „Superman“ zu lesen war, nickte auf indische Art, als Schönfelder ihm das empfohlene Essen auf der Karte zeigte. Wenige Minuten später stand es vor ihm. Eine Hand voll runder Kugeln, die mit frittierter Panade überzogen waren.
„Cheese“, sagte sein indischer Freund und lächelte erneut. „Käse“, wiederholte Schönfelder und lächelte ebenfalls. Der frittierte Käse schmeckte wie ausgeleierter Gummi. Schönfelder ließ sich nichts anmerken und lächelte weiter. Den faden Geschmack spülte er mit einer übersüßten Limonade hinunter, deren Namen er auf einem Plakat am Straßenrand gesehen hatte. Limca, stand auf dem Etikett und schien ein indischer Klebstoff auf Zuckerbasis zu sein. Schönfelder kaute mühsam auf seinen frittierten Käsekugeln und begann sich zu sorgen. Was, wenn der Bus ohne ihn wegfahren würde?
Schönfelder behielt die Fahrgäste im Auge, bereit aufzuspringen, sollten sie sich in Bewegung setzen.
„Don´t worry“, sagte der Assistent des Busfahrers, der während der Fahrt Wasserflaschen an die Passagiere verteilte und gerade an Schönfelders Tisch vorbeikam. „Wenn es wieder losgeht, hupt der Fahrer.“ Dabei ahmte er das Hupen des Busses nach, drückte auf ein imaginäres Horn und lachte dazu. Anscheinend fiel Schönfelder auf. Sein unsteter Blick, seine Anspannung und dann war er einer der wenigen Westler im Bus. Zwei junge Paare, Studenten vermutete Schönfelder, fuhren in die gleiche Richtung, nahmen aber von ihm, dem Senior, keine Notiz. Ein Hupen holte Schönfelder aus seinen Gedanken. Der Assistent hatte Recht behalten. Die Fahrgäste sammelten sich und kurz darauf ging es weiter. Drei weiteren Stunden später erreichte er sein Fahrziel Rishikesh. Der Bus rollte in das Inter State Bus Terminal ein. Dutzende von Bussen parkten hier, fuhren los oder kamen aus den unterschiedlichen Landesteilen gerade an. Luxuriöse Busse mit Klimaanlage und klapprige, buntbemalte Tatabusse ohne Türen, die wohl nur innerhalb des Ortes fuhren und schwarze Dieselfahnen hinter sich herzogen. Schönfelder stieg aus, atmete tief durch, so gut es eben ging und nahm eine Motorrikscha zum Hotel. Den verlangten Preis zahlte er willig. Er war zu erschöpft für langwierige Verhandlungen. Der Fahrer strahlte glückselig, sicheres Zeichen dafür, dass Schönfelder zu viel bezahlt hatte. Das Tuk-Tuk schlängelte sich entlang der Hügelkette. Der Ort lag an den Ausläufern des Himalaya Gebirges, links und rechts des Ganges. Indiens heiligster Fluss, Mythen umrankt, verließ hier die Gebirgskette und strömte in Richtung der Ebene. Zahllose Treppen im Ortszentrum führten an das heilige Wasser, an dessen Ufer ebenso viele Tempel standen. Schönfelder hatte dafür keinen Blick. Er wollte ein Bett. Die lange Fahrt hatte Spuren hinterlassen. Das Hotel, vor dessen Portal ihn sein Fahrer absetzte, war ein moderner Glaskasten und versprach Ganges Blick. „Best view“, stand auf einem Transparent, das über die Frontseite gespannt war und die Übernachtungsgäste von ihrer Wahl überzeugen sollte. Die Empfangshalle war auf Kühlschranktemperatur herunter gekühlt. Der Portier, hochgewachsen und hager, residierte hinter einem hochglanzpolierten Tresen aus dunklem Holz. Über seinem Kopf rotierte ein Ventilator. Er trug ein schwarzes Hemd mit einer weißen Krawatte und hatte etwas von einem Bestatter.
„Willkommen im Hotel Ganga!“ Er hätte auch sagen können: „Das Krematorium ist gleich links.“ Gleichzeitig zog er einen mächtigen Folianten unter dem Tresen hervor, in dem sich Schönfelder verewigen sollte. Für einen Moment überlegte Schönfelder, ob er hier seinen Verbrennungstermin für den Übergang ins Nirwana eintragen musste. „Das Gästebuch“, sagte der Portier, der Schönfelders Zögern bemerkte und lächelte.
„Ich habe bereits gebucht. Über das Internet.“
„Yes, Sir. Bitte hier eintragen.“ Entweder er verstand ihn nicht, oder er wollte ihn nicht verstehen. Schönfelder seufzte und ließ die Prozedur über sich ergehen. Vor ihm lag ein Buch, das ihn an die sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts erinnerte. Mit seinen vergilbten Seiten und ausgefransten Rändern sah es aus wie ein Hüttenbuch in einer Jugendherberge, in das man handschriftlich Namen, Ankunftstag, Abreise, Geburtstag und vieles mehr eintragen sollte. Oder war es doch für Bestattungen? Es gab sogar eine Spalte für die Handynummer. Damit schied das Bestatterbuch aus. Telefonieren nach dem Tod machte keinen Sinn. Schönfelder füllte die geforderten Rubriken eilig aus. Nur das Feld „Beruf“ ließ er offen. Das ging niemanden etwas an, fand er. Doch der Portier war unerbittlich. Mit dem Zeigefinger pochte er auf die fehlende Eintragung „Profession“. Schönfelder seufzte. Staubsaugervertreter oder Salesman kam ihm in den Kopf. Dann verzichtete er aber doch darauf und schrieb korrekt „Policeman.“ Ehrfürchtig salutierte der Mann daraufhin vor Schönfelder, der schnell hinzufügte: „Im Urlaub.“ Trotzdem hatte er von nun an das Gefühl einer Sonderbehandlung. Der Portier brachte ihn persönlich auf sein Zimmer. „Best room“, sagte er immer wieder. Erst später verstand Schönfelder, dass jeder Raum in Indien immer ein „best room“ und jeder Preis immer ein „best price“ ist.