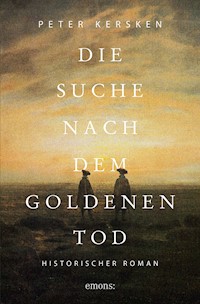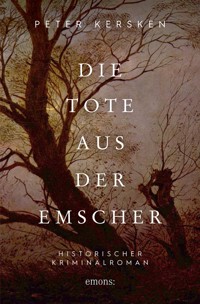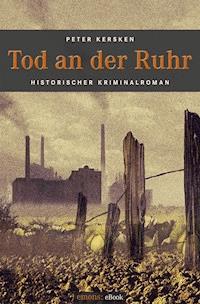
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
September 1866. Durch das Ruhrgebiet weht der tödliche Hauch der Cholera. Tausende sterben ringsum, doch den Sterkrader Polizeidiener Martin Grottkamp lässt der Tod eines Hüttenarbeiters, der mit klaffender Kopfwunde unterm Hagelkreuz liegt, nicht los. Grottkamp findet in den Taschen des Toten das fotografische Abbild eines nackten Mädchens. Er stellt Nachforschungen an und gerät in einen Strudel aus Verdächtigungen und unverhohlenem Hass, aus Aufwiegelei und Erpressung, aus Lohnhurerei und unzüchtigen Verhältnissen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Kersken, geboren 1952 in Oberhausen im Ruhrgebiet, studierte Philosophie und Literaturwissenschaft in Freiburg und Köln und arbeitete als Redakteur bei einer Kölner Tageszeitung. Er lebt als freiberuflicher Autor in der Eifel. Im Emons Verlag erschienen seine historischen Kriminalromane »Tod an der Ruhr«, »Im Schatten der Zeche«, »Zechensterben« und sein historischer Roman »Die Suche nach dem goldenen Tod«.
Dieses Buch ist ein Roman, und alle darin geschilderten Ereignisse sind frei erfunden. In besonderem Maße gilt das für Handlungen und Äußerungen der auftretenden oder erwähnten Personen, auch wenn einige von ihnen nicht der Phantasie des Autors entsprungen sind. Darüber hinaus sind Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen rein zufällig.
© 2014 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagzeichnung: Heribert Stragholz Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-659-1 Historischer Kriminalroman Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Meinem Vater
EINS
Bedrückt schob Dechant Witte das Kirchenbuch zur Seite und legte den Federhalter zurück in die hölzerne Schatulle. Nein, er konnte die Toten nicht auferwecken, das wusste er wohl. Aber irgendetwas in ihm sträubte sich dagegen, den Tod der beiden Kinder durch seinen Eintrag in das Sterberegister zu besiegeln.
Gerade erst hatte der noch junge Tag seine fünfte Stunde vollendet, doch für Dechant Anton Witte, den Pfarrer an Sankt Clemens in Sterkrade, war die Nacht schon vorbei. Er hatte kaum ein Auge zugetan, war in seiner Schlafkammer auf und ab gegangen, hatte versucht zu beten, bis seine trüben Gedanken ihn schließlich an den Schreibtisch seines Amtszimmers getrieben hatten. Nur gut, dass er Kaplan Winckelmann die Frühmesse übertragen hatte!
Missmutig gähnte er, rückte seine Brille zurecht und drehte den Docht der Petroleumlampe ein wenig höher. Dann zog er das Kirchenbuch wieder zu sich heran. »Oh, mein Gott, was hast Du nur vor mit meinen braven Sterkradern?«, murmelte er, während er durch das Sterberegister der vergangenen Monate blätterte.
Die Menschen starben an Auszehrung und an Wassersucht, sie starben an Schlagfluss und Brustfieber, an Wundentzündungen und Krampfanfällen. Nur hin und wieder, viel zu selten, befand Anton Witte, war unter den Todesursachen der Eintrag »Altersschwäche« zu lesen.
Die Frauen starben qualvoll im Wochenbett, die Männer starben ebenso qualvoll zwischen glühenden Schmelzöfen und flüssigem Eisen, und die Kinder starben in den Armen ihrer Mütter. Ja, die Kinder, vor allem die Kinder starben. Sie starben an Lebensschwäche, an Krämpfen, an Entkräftung, an Keuchhusten und wieder an Schwäche, immer wieder an Schwäche.
Als sei dem Schnitter Tod diese reiche Ernte noch nicht genug, war dann auch noch der Krieg über die Menschen gekommen, dieser unselige Bruderkrieg gegen die Österreicher. Sieben Männer würden nicht zurückkehren nach Sterkrade, hatten bei Trautenau und Königgrätz ihr Leben verloren. Sieben Männer, die ihre Familien zurückgelassen hatten, Frauen und Kinder, die jetzt nicht wussten, wie sie ohne ihre Ernährer weiterleben sollten.
»Waren das denn nicht genug Prüfungen, oh Herr?«, fragte Anton Witte leise und starrte auf dieses eine Wort, das er in der vergangenen Woche schon dreimal in das Sterberegister eingetragen hatte: Cholera.
Auch für die beiden Kinder des Hüttenarbeiters Schmelzer, die gestern, am heiligen Sonntag, heimgegangen waren zu ihrem himmlischen Vater, hatte der Pfarrer diesen Eintrag zu machen: »Todesursache Cholera«.
Er schob das Kirchenbuch wieder von sich, drückte sich mühsam aus seinem schweren Schreibtischstuhl hoch und ging hinüber zum Fenster. Aus zwei Petroleumlaternen fiel trübes Licht auf den Kirchplatz und die Dorfstraße. Nicht mehr lange, dann würde die Sonne aufgehen über den dritten September anno 1866. »Wenn der Herr überhaupt noch einmal die Sonne aufgehen lässt!«, seufzte Dechant Witte und schaute hinüber zur Kirche, zu seiner Clemenskirche.
Seit dreiunddreißig Jahren war er nun schon in Sterkrade. Damals hatte der Bischof ihn hierher geschickt, in ein Niederrheindorf, nördlich der Emscher an der alten Poststraße zwischen Köln und Münster gelegen, in ein Bauerndorf mit wenig mehr als tausend Seelen.
Nicht viel hatte er über Sterkrade gewusst, als er, gerade vierundzwanzig Jahre alt, an einem Frühlingstag des Jahres 1833 mit der Postkutsche aus Münster hier angekommen war.
Das alte Kloster der Zisterzienserinnen, das hatte er natürlich gekannt. Es war über Jahrhunderte hinweg der Mittelpunkt des Ortes gewesen, bevor es in der Ära Napoleons zwischen die Mühlsteine der großen Politik geraten war.
Von der aufstrebenden Eisenhütte am Rande des Dorfes, ja, von der hatte er damals auch schon gewusst, aber es war ein dürftiges Wissen gewesen.
Was diese Gutehoffnungshütte für Sterkrade bedeutete, wie sie das Bauerndorf veränderte und die Menschen von ihren seit Generationen beschrittenen Lebenswegen fortriss, das hatte er nicht gewusst, das hatte er damals nicht einmal geahnt.
Aber was hatte der junge Kaplan Witte überhaupt vom Leben gewusst? Nicht viel, wenn er es heute bedachte. Hier in Sterkrade hatte er das Leben kennengelernt. Hier erst hatte er erfahren, wie beschwerlich und mühselig es sein konnte, und hier hatte er gelernt, die Menschen zu lieben, die diese Mühsal geduldig ertrugen.
Er hatte ihnen beigestanden in ihrem harten Leben, so gut er es vermochte, zuerst als ihr Kaplan und später als ihr Pastor. Vor acht Jahren war er auch noch Landdechant des Dekanats Wesel geworden und hatte sich über diese Anerkennung seines Wirkens gefreut. Aber der bedeutendste irdische Lohn für seine rastlosen Mühen war ihm stets die Zuneigung seiner Schäfchen gewesen.
Wenn sie Halt brauchten und Trost in diesem Jammertal, dann war er an ihrer Seite. Wenn sie fassungslos dastanden in ihrem Elend, dann stand er neben ihnen. Dafür liebten sie ihn, seine Sterkrader.
Doch in dieser Septembernacht des Jahres 1866 mühte er sich selbst um Halt, brauchte er selbst Trost, suchte er selbst nach Antworten. Unverwandt sah er zur Kirche hinüber. Er ließ zu, dass seine Gedanken ihm entglitten– bis er erkannte, was er da tat: Er haderte mit Gott.
Anton Witte bekreuzigte sich. »Verzeih mir, Herr!«, murmelte er. »Ich weiß, dass Deine Ratschlüsse unergründlich sind, und dass es mir nicht zusteht, an ihnen zu zweifeln.«
Wieder seufzte er, tiefer dieses Mal als zuvor. Dann sagte er laut: »Ich muss es Dich dennoch fragen, himmlischer Vater, mit den verzweifelten Menschen hier und mit Deinem Sohn am Kreuz: Warum hast Du uns verlassen?«
Düster stand die Clemenskirche da, kaum hob sie sich ab vom finsteren Nachthimmel, der sie umwölbte, und weder von der Kirche herüber noch aus dem Himmel herab gab Gott der Herr seinem Diener Anton Witte eine Antwort.
Ein Schatten huschte über den Kirchplatz, bald darauf ein zweiter. Ihm folgten weitere in immer kürzer werdenden Abständen. Die schemenhaften Gestalten verschwanden in der Klostergasse, und Witte wusste, dass sie am Ende des Gässchens über den Marktplatz laufen und nach links in die Hüttenstraße einbiegen würden. Er wusste, dass ihnen ein schwerer Arbeitstag in den Werkstätten der Gutehoffnungshütte bevorstand.
Zwei der schattenhaften Wesen hatten es eiliger als die anderen. Sie näherten sich rasch, bogen nicht zur Klostergasse ab, sondern kamen direkt auf das Pfarrhaus zugelaufen. Nur Augenblicke später schlug der schwere Messingklopfer gegen die eichene Haustür.
Dechant Witte öffnete das Fenster und schaute hinunter. »Was gibt es denn?«
»Ein Glück, dass Sie schon wach sind, Herr Pastor!«, rief eine noch junge Männerstimme. »Da liegt ein Toter, oben hinterm Hagelkreuz, mitten auf dem Postweg. Sie müssen sofort kommen!«
»Nein, guter Gott, nicht schon wieder!«
»Was haben Sie gesagt, Herr Pastor?«
»Seid Ihr sicher, dass der Mensch tot ist?«, fragte Anton Witte zurück.
»Ja, ziemlich!«, sagte einer der beiden Männer.
»Was heißt ziemlich?«
»Er schien tot zu sein«, kam die Antwort.
»Gebt dem Heildiener Möllenbeck Bescheid!«, wies der Dechant die jungen Männer an, »und dem Polizeidiener Grottkamp auch!«
»Und Sie, Herr Pastor, kommen Sie nicht?«
»Natürlich komme ich!« Dechant Witte schloss das Fenster, ging hinüber zu seinem Schreibtisch, schlug das Kirchenbuch zu und löschte die Petroleumlampe.
***
Martin Grottkamp war schlecht gelaunt. Das Wetter ging ihm seit Tagen gegen den Strich. Es war zu kalt und zu regnerisch für die Jahreszeit.
»Gib auf Aegidius gut acht, er sagt dir, was der Monat macht«, knurrte er vor sich hin. Vorgestern, am Aegidiustag, hatte er zusammen mit Jacob Möllenbeck die Handwerker beaufsichtigt, die die Baracke für die Cholerakranken herrichteten– und war klatschnass dabei geworden. Es war also nicht damit zu rechnen, dass sich das Wetter in den nächsten Wochen bessern würde.
Er schlang sein schwarzes Cape enger um die Uniform, deren einst kraftvolles Blau mit den Jahren einem tristen Blaugrau gewichen war. Erst vor ein paar Tagen hatte seine Hauswirtin, die Witwe Schlagedorn, ihn darauf angesprochen. »Meinem Rock ist es wohl gerade so ergangen wie dem Himmel über Sterkrade. Der ist auch längst nicht mehr so blau wie früher«, hatte Grottkamp geantwortet. Die alte Frau Schlagedorn hatte verstanden, was er meinte, und sie hatte wehmütig genickt.
Die blitzenden Messingknöpfe und der stets blank gewienerte Ledergürtel verliehen seiner Uniform allerdings noch immer jenen hoheitlichen Glanz, den sie nach Grottkamps fester Überzeugung auszustrahlen hatte. Und so schien es ihm in der Ordnung zu sein, dass der Polizeidiener von Sterkrade einen Rock trug, der die Farbe des Himmels über dem Kirchdorf angenommen hatte.
Jetzt stapfte er aus dem Dorf hinaus in Richtung Hagelkreuz. Der Morgen dämmerte trübe. Grottkamp zog seine Uniformmütze tiefer ins Gesicht. Rechts der Straße, wo sich in seiner Jugend ein Waldstück bis zum Reinersbach und bis hinauf zur Holtener Straße erstreckt hatte, waren in den vergangenen Jahren neue Häuser entstanden. Auch links, zwischen den Feldern, wurde die Bebauung allmählich dichter. Sie reichte jetzt schon beinahe bis an den kurzen Stichweg heran, an dessen Ende die Baracke stand, in der die Cholerakranken mit dem Tode rangen.
Zum Hagelkreuz hin stieg die Straße leicht an. In dünnen Bächen floss Grottkamp der Regen durch die Fahrrillen der Fuhrwerke und Kutschen entgegen. Nicht immer schaffte er es, ihnen auszuweichen. Er war froh, dass er die Gummigamaschen über seine Lederschuhe gezogen hatte.
»Septemberanfang mit leichtem Regen kommt dem Bauern sehr gelegen«, ging es ihm durch den Kopf. Ja, seinen Herrn Bruder, den Bauern auf dem Grottkamphof, den würde das Wetter wohl freuen.
Nun, sei es ihm gegönnt, dem Paul. Seitdem er, Martin Grottkamp, sich mit dem älteren Bruder ausgesöhnt hatte, fiel auch für ihn so manches ab von dem, was auf dem Hof erwirtschaftet wurde.
Bauer auf dem Grottkamphof zu sein, wie sehr hatte er sich das einmal gewünscht! Aber es war anders gekommen, und er hatte keinen Grund, sich über sein Leben zu beklagen. Nicht einmal an einem Morgen wie diesem.
Was hatten die beiden jungen Hüttenarbeiter gesagt: »Auf dem Postweg liegt ein toter Mann, und der Herr Pastor Witte hat uns geschickt, Sie zu benachrichtigen.«
Aufgeregt waren sie gewesen, die beiden jungen Kerle, und erleichtert, als Grottkamp ihnen gesagt hatte, er werde die Unglücksstelle auch ohne sie finden. Sie könnten jetzt zur Arbeit gehen.
Schon genug Ärger würden sie wegen ihrer Verspätung bekommen, hatten sie gemeint. Der Meister in der Kesselschmiede werde ihnen bestimmt ein paar Stunden abziehen. Toter hin, Toter her, werde der sagen. Das interessiere ihn nicht, und das habe zwei Arbeiter auf dem Weg zur Schicht erst recht nicht zu interessieren.
Grottkamp nahm sich vor, diesem Herrn gelegentlich einen Besuch abzustatten. Der konnte doch nicht allen Ernstes den beiden jungen Männern Vorhaltungen machen. So einem Herrn Meister musste doch klar sein, dass es zu den Pflichten eines Bürgers gehörte, über einen Toten, der auf der Straße lag, umgehend die Obrigkeit zu informieren, also in diesem Fall ihn, den Polizeidiener Grottkamp.
Nun ja, dem Herrn Gendarm Schmitting Bescheid zu geben, das hätte es eventuell auch getan.
Ja, ja, Schmitting, der würde sich jetzt wieder aufregen. Wie sagte er immer, wenn er sich mal wieder bei einer mehr oder weniger wichtigen Angelegenheit übergangen fühlte: »Sie, Herr Polizeisergeant, Sie vertreten die Gemeinde Sterkrade, allenfalls die Bürgermeisterei Holten. Das Königreich Preußen, das vertrete ich. Und diese Angelegenheit, Grottkamp, die berührt die Interessen des Königreiches.«
Der arme Kerl, jetzt hatte er andere Sorgen– wenn er überhaupt noch welche hatte. Vorgestern Abend war er als einer der ersten Kranken in die Cholerabaracke gebracht worden, und gestern hatte Jacob Möllenbeck gesagt, es stehe gar nicht gut um den Herrn Gendarm.
In Grottkamps dichtem Bart hatten sich die Regentropfen zu einem kleinen Rinnsal formiert, das jetzt seinen Hals hinunterlief und hinter seinem Uniformkragen versickerte.
Er schüttelte sich und wischte energisch den Regen aus dem buschigen Bartgeflecht. »Mist, verdammter!«, schimpfte er. Vom Hagelkreuz herunter schaute der leidende Herr Jesus ihn strafend an. Martin Grottkamp bekreuzigte sich und schickte seinem Fluch ein »Gelobt sei Jesus Christus« hinterher.
Am Hagelkreuz gabelte sich die Straße. Grottkamp hielt sich rechts und sah auf dem unteren Postweg, noch vor der Holtener Straße, eine kleine Gruppe Menschen beieinanderstehen. Der Erste, den er erkannte, war Dechant Witte. Er kniete vornüber gebeugt auf der schlammigen Straße. Die Enden seiner Stola baumelten knapp über einer großen Wasserlache.
Dann entdeckte er Elisabeth Kückelmann.
Ja, er irrte sich nicht, die Frau, die da neben dem Pfarrer stand und weinte, war die, von der er einmal geglaubt hatte, sie gehöre zu ihm, die einmal sein Liesken gewesen war.
Sie hatten sich geliebt, und sie hatten sich einander versprochen, aber dann war Elisabeth Kückelmann doch nicht seine Frau geworden. Noch nicht ganz ein Jahr war er bei seinem Infanterieregiment in Deutz gewesen, als er erfahren musste, dass sein Liesken jetzt Elisabeth Terfurth hieß, dass sie die Ehefrau eines gewissen Julius Terfurth geworden war.
Und eben dieser Julius Terfurth lag jetzt kalt und steif neben einer Wasserlache auf dem unteren Postweg.
***
»Wenn du im Tode die Schuld der Menschennatur bezahlt hast, kehre heim zu deinem Schöpfer, der dich aus dem Staube der Erde gebildet hat«, betete Pastor Witte.
Grottkamp nahm seine Dienstmütze ab und blieb ein paar Schritte abseits der Gruppe stehen. Während Pfarrer Anton Witte sein Gesicht zum verregneten Morgenhimmel wandte und laut und voller Inbrunst die Sterbegebete sprach, neigte Grottkamp seinen Kopf, jedoch nur so weit, dass er unter den Augenlidern hervor die Umstehenden betrachten konnte.
Elisabeth Terfurth hatte ein dunkles Tuch über Kopf und Schultern geworfen, das sie mit beiden Händen vor ihrer Brust zusammenhielt. Sie weinte leise, genau wie die junge Frau, die sich bei ihr eingehakt hatte.
Das Mädchen ähnelte so sehr dem Liesken, das Martin Grottkamp vor vielen Jahren geliebt hatte, dass es ihm wehtat. Plötzlich erinnerte er sich wieder an diesen unsäglichen Schmerz, von dem er damals geglaubt hatte, er zerreiße ihm die Brust.
Doch das war lange her, und er war nicht mehr der einundzwanzigjährige Grenadier, den sein Liebchen verlassen hatte. Er war jetzt der Polizeidiener von Sterkrade, ein gestandener Mann von Anfang vierzig, der sich so weit im Griff hatte, dass er mit einem tiefen Atemzug die kurze Beklemmung seines Herzens zu lösen vermochte.
Was blieb, war diese leise Wehmut, die ihn in letzter Zeit immer wieder beschlich, wenn er durch das Dorf ging und vergeblich nach den Plätzen der Kindheit Ausschau hielt. Vieles von dem, was einmal bedeutsam für ihn war, war unwiederbringlich verloren. Das fühlte Martin Grottkamp auch jetzt beim Anblick der beiden weinenden Frauen.
Das Mädchen, das Halt suchend an Elisabeths Arm hing, war ohne Zweifel ihre Tochter. Der junge Mann, der an der anderen Seite neben ihr stand, hatte den Kragen seiner derb gewebten Wolljacke hochgeschlagen. Während er tröstend einen Arm um Elisabeths Schulter legte, trat er achtlos ins Wasser, so dass es über den Rand seiner Holzschuhe schwappte. Einer von Julius und Elisabeth Terfurths Söhnen, die beide noch zur Schule gingen, konnte dieser junge Mann nicht sein.
Einige Schritte abseits lauschte eine Frau mit gefalteten Händen den Gebeten Pfarrer Wittes. Sie beobachtete eher neugierig als teilnahmsvoll, was um den toten Julius Terfurth herum geschah. Es war Nepomukzena, die Ehefrau von Dietrich Huckes, der als Kranführer im Brückenbau arbeitete. Grottkamp wusste, dass die beiden seit Jahren in dem kleinen Haus lebten, das nur ein paar Ruten weiter am Rande des alten Postwegs stand.
Auf der anderen Straßenseite wartete mit gesenktem Kopf der Schreiner und Fuhrmann Theodor Verstegen. In der einen Hand hielt er seine zerknüllte Kappe, in der anderen den Zügel seines hellbraunen Brabanters. Gleichmütig ließ der schwere Hengst den unablässigen Regen und die nicht enden wollenden Totengebete über sich ergehen. Nur gelegentlich schüttelte er seine helle Mähne aus. Er war vor einen niedrigen, einachsigen Leiterwagen gespannt.
Mit dem Rücken zu Grottkamp stand sein alter Schulfreund, der Heildiener Jacob Möllenbeck. Er hatte den Polizeidiener noch nicht bemerkt.
»Deinen Erlöser sollst du sehen von Angesicht zu Angesicht, und allzeit stehend vor ihm, sollst du mit seligen Augen die Wahrheit hüllenlos schauen. Ja, in die Scharen der Seligen aufgenommen, sollst du die Wonne der Anschauung Gottes genießen in Ewigkeit«, betete Pfarrer Witte.
»Amen«, murmelten die Umstehenden.
Als Anton Witte sich von den Knien erhob, ließ das Mädchen seine Mutter los und reichte dem Pfarrer die Hand, um ihn zu stützen. Der nahm, dankbar nickend, die Hilfe an. Das Mädchen beugte sich hinab und versuchte, den lehmigen Schmutz von Wittes Priesterrock zu klopfen. Der Pfarrer schüttelte den Kopf.
»Lass nur, Martha, das hat wohl keinen Sinn«, sagte er freundlich. Dann griff er nach Elisabeths Arm. »Kommen Sie, Frau Terfurth, ich bringe Sie jetzt nach Hause.«
Elisabeth Terfurth ließ sich willenlos von Pastor Witte wegführen. Ihre Tochter und der junge Mann folgten den beiden. Kurz nachdem die kleine Gruppe sich in Bewegung gesetzt hatte, kam der Pfarrer eiligen Schrittes noch einmal zurück.
»Bringen Sie ihn schnell weg!«, wies er den Fuhrmann Verstegen an. »Ich möchte nicht, dass er noch so daliegt, wenn gleich die Kinder zur Schule gehen.«
Verstegen nickte, und während Anton Witte durch den anhaltenden Regen hinter den Frauen und ihrem jungen Begleiter hereilte, beugten der Fuhrmann und der Heildiener Möllenbeck sich zu dem Toten hinunter, um ihn auf den Leiterwagen zu tragen.
»Wartet noch! Lasst ihn liegen!«, forderte Grottkamp die beiden Männer auf.
Er war froh, dass Pastor Witte inzwischen außer Hörweite war. Natürlich würde er sich auch vom Herrn Pfarrer nicht von seinen Dienstpflichten abhalten lassen! Es war ihm jedoch angenehmer, den Toten und die Unglücksstelle in Augenschein nehmen zu können, ohne zuvor dem hochwürdigen Herrn klarmachen zu müssen, dass in dieser Angelegenheit korrektes amtliches Vorgehen notwendig war– Schulkinder hin, Schulkinder her.
Erschreckt hatte sich Jacob Möllenbeck herumgedreht. »Mensch, Grottkamp! Ich hatte dich überhaupt nicht bemerkt«, schimpfte er. Doch er und auch Theodor Verstegen traten widerspruchslos einige Schritte von dem Toten zurück.
»Entschuldige, Jacob!«, sagte Martin Grottkamp und klopfte seinem Freund auf die Schulter, »war nicht meine Absicht, dich zu erschrecken.«
Möllenbeck nahm die Entschuldigung mit einem Kopfnicken an. »Da gab es für mich nichts mehr zu tun«, murmelte er und deutete auf den Toten, der aus halb geschlossenen Augen ins Leere starrte.
Der Hammerschmied Julius Terfurth lag auf dem Rücken neben einer unregelmäßig geformten Wasserlache, die an keiner Stelle schmaler oder kürzer als sieben bis acht Fuß war.
Eine tiefe Platzwunde auf seiner Stirn war offenbar über Stunden vom Regen ausgewaschen worden und gab den Blick auf die Schädeldecke frei.
»Lag er so, als er gefunden wurde?«, fragte Grottkamp.
»Wohl kaum«, meinte Möllenbeck, und Verstegen, der ihnen gegenüber stand, zuckte mit den Achseln.
»Nein, Herr Polizeisergeant«, sagte Nepomukzena Huckes, die Frau des Kranführers, die immer noch aufmerksam die Szenerie beobachtete und jetzt zu den Männern trat.
»Haben Sie den Toten gefunden?«, erkundigte Grottkamp sich.
»Nein, zwei junge Arbeiter aus der Kesselschmiede wären auf dem Weg zur Hütte beinahe über ihn gestolpert. Einer von ihnen ist dann gleich zu unserem Haus rüber gelaufen, um Hilfe zu holen.«
»Und weiter?«, fragte Grottkamp.
»Ich bin sofort mit raus, mit der Petroleumlampe. Und als wir beide hier ankamen, da hockte der andere junge Mann noch über dem Terfurth und rief ihn an und rüttelte an seiner Schulter. Aber der hat sich nicht mehr gerührt, der Terfurth.«
»Wie hat er da gelegen?«, wollte Grottkamp wissen.
»Er lag mit dem Gesicht nach unten in der Pfütze, mitten drin. Ich hab den beiden jungen Kerlen gesagt, sie sollten ihn erst mal umdrehen. Sie haben ihn dann herumgerollt, so dass er auf dem Rücken neben dem Wasser zu liegen kam– genau so wie er jetzt liegt«, berichtete Frau Huckes. »Dann hab ich ihm mit der Lampe ins Gesicht geleuchtet, und dann hab ich den beiden Burschen gesagt, sie sollten laufen und den Pastor holen.«
»Mit dem Gesicht mitten in der Pfütze«, wiederholte Grottkamp nachdenklich. »So in etwa? Hier der Kopf und hier die Füße?«, fragte er Nepomukzena Huckes, während er ohne Rücksicht auf seine Schuhe in der Wasserlache hin und her watete.
»Ja, genau so hat er gelegen«, bestätigte die Frau.
»Also gut, du kannst ihn jetzt wegbringen«, sagte Grottkamp zu Verstegen. Und während der Fuhrmann und der Heildiener den Toten unter den Achseln packten, griff er mit beiden Händen um seine Fußgelenke.
»Lederschuhe«, stellte er fest, während sie zu dritt den leblosen Körper auf den Leiterwagen wuchteten.
»Nicht schlecht gekleidet für einen Hüttenarbeiter«, befand Möllenbeck. »Diese Jacke, das ist fester Leinenstoff, noch was anderes als dies billige Baumwollzeugs, das man jetzt überall bekommt.«
»Und der Herr trug nicht etwa eine Kappe, sondern einen Hut«, bemerkte Verstegen, während er die reichlich zerknautschte Kopfbedeckung des Toten, die unbeachtet auf der Straße gelegen hatte, auf den Leiterwagen warf.
»Hier ist noch etwas, Herr Sergeant«, sagte Nepomukzena Huckes und deutete auf eine Tabakspfeife, die bisher unter dem Körper des Toten verborgen gewesen war.
Grottkamp nahm sie aus dem Matsch und wischte sie, so gut es ging, mit den Händen sauber. Es war eine kurze, gebogene Pfeife mit einem Blechdeckel auf dem Pfeifenkopf. Eine Tabakspfeife wie diese besaßen viele Arbeiter der Gutehoffnungshütte. Das Rauchen während der Arbeit war ihnen gestattet, aber eben nur aus kurzen, mit Deckeln versehenen Pfeifen. Grottkamp wusste, dass es so in der Hüttenordnung geschrieben stand.
Er steckte das Fundstück in eine Tasche seines Uniformrocks. »Warte noch einen Moment«, sagte er, als Theodor Verstegen gerade ein Sacktuch über den Leichnam ziehen wollte.
Grottkamp knöpfte die triefendnasse Leinenjacke des Toten auf und schlug sie auseinander. Aus der Westentasche hing eine Uhrkette. Er zog die Uhr heraus und hielt sie an sein Ohr. »Sie geht nicht mehr«, stellte er fest. Drei Minuten vor Mitternacht war Julius Terfurths Taschenuhr stehen geblieben.
»Zeig mal her!«, bat Möllenbeck, und Martin Grottkamp reichte ihm die Uhr.
»Alles vom Feinsten«, sagte der Heildiener beeindruckt. Während er festzustellen versuchte, ob das Uhrgehäuse tatsächlich aus reinem Silber bestand, durchsuchte Grottkamp Terfurths Kleider.
Aus der linken Rocktasche fischte er einen bemerkenswert prall gefüllten ledernen Geldbeutel. In der rechten fühlte er einige ineinandergefaltete, durchweichte Papiere, die er vorsichtig herauszog. Um sie nicht weiter dem Regen auszusetzen, schob er sie unter sein Cape, ohne sie sich anzusehen, und ließ sie in die Brusttasche seiner Uniform gleiten.
Ein zerknülltes Schnupftuch war alles, was Grottkamp außerdem noch in den Kleidern des Toten fand.
»Seltsam«, murmelte er, während er die Uhr und den Geldbeutel in seinem Uniformrock verstaute.
Theodor Verstegen deckte den Leichnam zu. »Sag der Frau Terfurth, dass ich die Besitztümer ihres Mannes konfisziert habe«, trug Grottkamp dem Fuhrmann auf, »sonst denkt sie noch, er wäre beraubt worden.«
Der kräftige Brabanter hatte keine Mühe, das kleine Fuhrwerk mit dem toten Julius Terfurth aus dem Schlamm zu ziehen. Von Verstegen am Zügel geführt, trottete der Kaltblüter gehorsam in Richtung Holtener Straße davon.
***
»Du siehst müde aus«, stellte Grottkamp fest, als er zusammen mit seinem Freund Jacob Möllenbeck am Hagelkreuz vorbeiging.
»Bin ich auch«, erwiderte der Heildiener. »Ich war die halbe Nacht in der Baracke.«
»Dann kannst du heute Abend wohl nicht in die Marktschänke kommen, zum Solospiel?«
»Doch, doch!«, entgegnete Jacob Möllenbeck bestimmt. »Das habe ich jedenfalls fest vor. Ich muss mal an was anderes denken als an diese verdammte Cholera. Ich werde jetzt noch nachsehen, wie es in der Baracke steht, und dann versuche ich erst mal, ein paar Stunden zu schlafen. Also, wenn eben möglich, werde ich heute Abend dabei sein.«
»Wie geht es dem Gendarm Schmitting?«
»Er lebt noch«, antwortete Möllenbeck. »Wenn er die nächste Nacht übersteht, dann hat er gute Chancen, denke ich.«
»Wie viele Kranke hast du in der Baracke?«
»Im Augenblick nur noch sechs. Die beiden Kinder von Schmelzer sind gestorben.«
»Ich weiß«, sagte Martin Grottkamp leise.
Eine Weile gingen die beiden Männer schweigend nebeneinander durch den Regen. Dann fragte Grottkamp:
»Was glaubst du, wie lange der Terfurth schon tot war?«
»Auf jeden Fall einige Stunden«, antwortete der Heildiener. »Natürlich muss man berücksichtigen, dass die Leiche im Wasser gelegen hat…«
»Terfurths Taschenuhr ist kurz vor Mitternacht stehen geblieben«, unterbrach Grottkamp den Freund. »Könnte das der Zeitpunkt seines Todes gewesen sein?«
»Die Uhr hat wahrscheinlich erst versagt, nachdem Wasser in das Gehäuse eingedrungen war«, überlegte Möllenbeck. »Also, als die Uhr stehen blieb, lag der Terfurth schon eine Weile in der Pfütze. Ich denke, etwa eine halbe Stunde.«
Grottkamp nickte zustimmend. »Und woran ist Julius Terfurth deiner Meinung nach gestorben?«
Jacob Möllenbeck sah ihn erstaunt an. Für ihn war der Fall klar.
»Er ist gestolpert«, sagte er. »Mit Sicherheit hatte er sich mal wieder die Hucke voll gesoffen. In den vergangenen Monaten konnte man ihn doch beinahe jeden Abend betrunken durch Sterkrade torkeln sehen.«
Grottkamp wischte sich den Regen aus dem Gesicht. Während seiner abendlichen Inspektionen der Wirtshäuser hatte er Terfurth häufig unter den Zechern entdeckt, und gelegentlich war ihm der schwankende Hammerschmied bei einem seiner späten Rundgänge durch das Dorf begegnet. Er hatte ihn stets ignoriert.
So hielt er es mit all den Männern, die Abend für Abend volltrunken aus Schänken und Gasthäusern getaumelt kamen. Wenn sie ihr Leben nur mit Branntwein ertragen konnten, dann war das nach Martin Grottkamps Überzeugung ihre Angelegenheit, solange sie nicht herumgrölten und niemanden belästigten.
»Dieses Mal hat er eben Pech gehabt«, fuhr Möllenbeck fort. »Er ist mit dem Schädel auf einen Stein geknallt. Und der lag dummerweise mitten in einer Pfütze. Terfurth blieb mit dem Gesicht im Wasser liegen und ist ertrunken.«
Grottkamp schwieg nachdenklich.
»Gefällt dir irgendwas nicht an der Geschichte?«, fragte der Heildiener.
»Ich bin eine ganze Weile durch die Wasserlache gewatet«, antwortete Grottkamp.
»Und hast dir dabei die Schuhe ruiniert, trotz deiner Gamaschen«, stellte Jacob Möllenbeck fest.
»Die stopfe ich mit Zeitungspapier aus und stelle sie eine Nacht neben den Ofen. Wenn ich sie danach einfette, sind sie wieder wie neu.«
»Also, warum bist du in diesem Wasserloch herumgestapft?«
»Weil ich den Stein finden wollte, auf den der Terfurth gefallen sein könnte.«
»Und?«
»Ein paar flache Steinchen vom alten Straßenbelag, wie sie hier überall herumliegen, die gab es da auch.«
»Die können aber nicht Terfurths Kopfverletzung verursacht haben«, meinte der Heildiener.
»Ein größerer Stein war da nirgendwo. Nicht in der Wasserlache und auch nicht rings um sie herum.«
An der Einmündung des kleinen Weges, der zur Cholerabaracke führte, blieben die beiden Männer stehen.
»Das würde ja heißen…« Möllenbeck schüttelte den Kopf. »Nein, dass jemand den Terfurth erschlagen hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht hier bei uns in Sterkrade.«
ZWEI
»Kommen Sie rein, Grottkamp!« Gemeindevorsteher Carl Overberg saß vor seinem aufgeklappten Schreibschrank und drehte dem Polizeidiener den Rücken zu. »Kommen Sie rein und setzen Sie sich auf den Stuhl!«
Grottkamp hatte dem Hausmädchen der Overbergs sein durchnässtes Cape und seine Dienstmütze in die Hand gedrückt und betrat jetzt vorsichtig das Bureau seines Vorgesetzten.
Mit zwei großen Schritten, bei denen er versuchte, nur mit den Zehen aufzutreten, erreichte er den Stuhl, der zwischen Tür und Overbergs Schreibschrank an der getäfelten Wand stand. Als er sich gesetzt hatte, zog er seine Füße dicht an den Stuhl heran, damit seine nassen Schuhe nicht auf dem rot in rot gewebten Teppich zu stehen kamen, der einen Großteil der Bodendielen bedeckte.
Martin Grottkamp fühlte sich unbehaglich. Die Feuchtigkeit war durch das Cape in den Uniformrock gedrungen, die triefenden Hosenbeine klebten an seinen Schenkeln, und die Füße begannen in den nassen Schuhen zu frieren, obwohl der beinahe mannshohe, runde Gussofen von der Zimmerecke her eine angenehme Wärme verbreitete.
»Hier ist es ja. Genau das habe ich gesucht.« Overberg saß auf einem Hocker und beugte sich über die heruntergeklappte Arbeitsplatte des Schreibschrankes, die beinahe vollständig mit Akten bedeckt war. Darüber waren einige Laden des Schrankes mehr oder weniger weit herausgezogen. Alle waren mit beschriebenem Papier vollgestopft.
Ohne die Augen von dem Blatt zu lassen, das er in der Hand hielt, erhob Carl Overberg sich langsam und ging zum Stehpult hinüber, das vor dem Fenster stand. Noch immer hatte der Gemeindevorsteher den Polizeidiener keines Blickes gewürdigt. Am Stehpult vertiefte er sich in das Papier, nach dem er augenscheinlich eine Weile gesucht hatte.
Schon an diesem frühen Montagmorgen hatte der Herr Gemeindevorsteher sich herausgeputzt, als erwarte er den Hüttendirektor persönlich. Aber so kannte Grottkamp ihn.
Schon seit fast dreißig Jahren war Carl Overberg in Sterkrade.
Als die Hütte und damit auch die Einwohnerzahl des Dorfes kräftig zu wachsen begann, hatte der Holtener Bürgermeister erkannt, dass seine nur gelegentliche Anwesenheit in der Gemeinde Sterkrade nicht mehr ausreichte, um alle anfallenden Verwaltungsaufgaben zu bewältigen. Damals war der junge Schöffe Overberg hierher geschickt worden.
Nach dem Tod des alten Wilhelm Lueg im März 1864 war er dann auch noch ehrenamtlicher Gemeindevorsteher von Sterkrade geworden.
Über das blütenweiße Hemd mit dem gestärkten Kragen trug Carl Overberg eine nicht zu enge Weste, die seinen Bauchansatz verbarg. Sein dünnes, noch dunkles Haar war akkurat gescheitelt und glänzte pomadig.
Der Herr Vorsteher war gut zehn Jahre älter als sein Polizeidiener, in einem Alter also, in dem die meisten Menschen, die viel zu lesen haben, längst eine Brille brauchen. Carl Overberg tat das auch, trug seine Sehhilfe allerdings nur dann, wenn er allein in seiner Amtsstube war. Jetzt kniff er die Augen zusammen und hielt das Papier beinahe eine Armlänge weit von seinem Gesicht weg.
Über die weißen Hemdsärmel hatte er Ärmelschoner gestülpt, die bis zu den Ellenbogen reichten. Sein Rock hing über einem Bügel am Kleiderständer neben der Tür. Wenn das Dienstmädchen ihm einen wichtigen Gast meldete, so vermutete Grottkamp, brauchte Overberg nicht mal eine Minute, um die Ärmelschoner abzustreifen und sich mit Rock und fest geknüpftem Binder vom emsigen Büroarbeiter zum eleganten Repräsentanten der Gemeinde Sterkrade zu wandeln.
Zwischen Kleiderständer und Ofen standen zwei bequeme Sessel an einem runden Tisch, der mit Stapeln von Ordnern und Zeitungen beladen war. Ein Flügel des zweitürigen Bücherschrankes stand offen. Ohne erkennbare Ordnung waren darin Bücher und gebundene Handschriften nebeneinandergestellt und übereinandergeschichtet. Auch im schmalen Hochregal neben dem Fenster, schräg hinter dem Stehpult, lagerten Akten und Papiere.
Grottkamp wusste, dass der Eindruck fehlender Ordnung täuschte. Sterkrades Gemeindevorsteher Carl Overberg war nicht nur ein eitler, sondern auch ein penibler Mann. Mehr als einmal hatte Grottkamp sich darüber gewundert, dass Overberg Erlasse der königlichen Bezirksregierung in Düsseldorf, landrätliche Verordnungen oder Weisungen des Holtener Bürgermeisters sogleich bei der Hand hatte, wenn er es für nötig hielt, seinen Anweisungen durch hoheitliche Rückendeckung Nachdruck zu verleihen.
»Das muss ich Ihnen vorlesen, Grottkamp. Hier! Das ist das Wesentliche.« Overberg tippte mit einem Finger auf das Papier, das er inzwischen auf das Pult gelegt hatte.
Ein wenig zurückgelehnt, um den richtigen Augenabstand zu haben, las er so laut und energisch, als wäre der versammelte Gemeinderat sein Publikum:
»Aus der Einberufung der beiden in Sterkrade ansässigen Ärzte könnte eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung erwachsen.
Der Hüttenarzt, welcher für vier- bis fünftausend Arbeiter zur Verfügung stehen muss, namentlich in Unglücksfällen, kann für die medizinische Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Sterkrade nicht herangezogen werden.
Hinzu kommt, dass die Pockenkrankheit in hiesiger Gegend in letzter Zeit in höchst bedenklicher Weise um sich gegriffen hat. Es ist unzumutbar, dass bei solchen Zuständen kein Arzt in der Gegend ist! Der uns zunächst wohnende Dr.med. Herschen aus Oberhausen ist ebenfalls einberufen worden, so dass wir in Notfällen in den zwei Stunden entfernten Orten Dinslaken und Mülheim um Hilfe nachsuchen müssen!«
Triumphierend sah Overberg auf seinen Polizeidiener herab. »Nun, Grottkamp, was meinen Sie, wer das geschrieben hat? Wer schon vor Wochen vorausgesehen hat, wie die Dinge sich entwickeln würden?«
»Ich nehme an, dass Sie das waren, Herr Vorsteher«, sagte Grottkamp ohne erkennbare Begeisterung.
»Genau so ist es. Dieses Schreiben habe ich an die Militärbehörden gerichtet, und eine Zweitschrift habe ich Landrat Kessler in Duisburg zukommen lassen, mit der Bitte, er möge sich in unserem Sinne verwenden. Und was ist passiert?«
»Nun ja, Herr Gemeindevorsteher, die Militärs haben offenbar geahnt, dass der Krieg gegen die Österreicher eine blutige Angelegenheit werden würde. Jedenfalls haben sie unsere beiden Ärzte eingezogen.«
»Nicht nur das, Grottkamp, nicht nur das.« Overberg tippte aufgeregt mit einem Finger auf das Papier. »Die epidemische Krankheit, die ich befürchtet habe, hat Sterkrade erreicht. Und jetzt haben wir genau den Schlamassel, vor dem ich damals schon die hohen Herren gewarnt habe.«
»Na ja, die Pocken, die sind ja nun doch an uns vorbeigegangen«, bemerkte Grottkamp.
»Die Pocken oder die Cholera, was spielt denn das für eine Rolle!«, ereiferte sich Carl Overberg. »Allein in Essen sind dieses Jahr schon neunzig Menschen an den Pocken gestorben. Dass dieser Kelch an uns vorübergegangen ist, ist nur ein glücklicher Zufall. Dafür hat uns jetzt eben die Cholera erwischt. Und wenn die Herren Militärs nur ein wenig vorausschauender gewesen wären, dann hätten sie uns wenigstens einen Arzt gelassen. Dass jetzt die medizinische Versorgung der gesamten Sterkrader Bevölkerung in den Händen eines Heildieners liegt, das ist einfach ein Unding.«
»Vielleicht haben die zuständigen Behörden Ihren Argumenten nicht ganz getraut, Herr Vorsteher. Dass der Hüttenarzt für vier- bis fünftausend Arbeiter zuständig ist, das haben sie vielleicht für übertrieben gehalten.«
»Was wollen Sie denn damit andeuten?«
»Nichts weiter, Herr Vorsteher«, beeilte Grottkamp sich zu sagen. »Ich überlege nur, warum die Herren Militärs Ihre gewichtigen Einwände einfach so vom Tisch gefegt haben.«
»Nein, nein, Grottkamp! Jetzt liegen Sie schief! Die Hüttengewerkschaft Jacobi, Haniel & Huyssen hat nun mal einen einzigen Arzt für ihre drei Werke angestellt, für unsere Gutehoffnungshütte, für das Hüttenwerk Oberhausen und für die Antonyhütte in Osterfeld. Also, so um die viertausend Arbeiter sind das mindestens, die der Herr Werksmedikus derzeit zu betreuen hat.
Nein, Grottkamp, das Problem ist doch ein ganz anderes. Wenn es ums Militärische geht, dann sind die Belange der Zivilbevölkerung schlichtweg bedeutungslos.
Haben Sie sich mal gefragt, warum Sie auf den Straßen von Sterkrade so viele junge Männer herumlaufen sehen, obwohl Preußen sich im Krieg befindet? Nein? Ich will es Ihnen trotzdem sagen. Wenn die Herren Hüttendirektoren ihre Arbeiter reklamieren, dann ist die Militärbehörde großzügig. Dabei geht es nicht nur um Kanonenkugeln, die in der Antonyhütte gegossen werden. Nein, auch der Eisenbahnbau und der Brückenbau sind für die Herren Militärs äußerst wichtige strategische Angelegenheiten. Der Hüttenbetrieb, der muss auf jeden Fall weitergehen, auch in Kriegszeiten. Ob die Zivilbevölkerung währenddessen von Seuchen dahingerafft wird, das interessiert das Offizierscorps seiner königlichen Majestät nicht im Geringsten.«
»Herr Vorsteher, Herr Vorsteher, jetzt rütteln Sie aber an den Grundpfeilern der preußischen Staatsordnung.«
Overberg seufzte vernehmlich. »Sie haben ja recht, Grottkamp, Sie haben ja recht. Aber wenn man in diesen unseligen Zeiten an verantwortlicher Stelle steht, dann muss man einfach mal Dampf ablassen. Und wenn ich das bei Ihnen tue, dann weiß ich ja, dass es unter uns bleibt.«
***
Sterkrades Gemeindevorsteher sah über sein Stehpult hinweg auf seinen Polizeidiener herab.
Vielleicht war er manchmal zu vertraulich mit diesem Martin Grottkamp.
Aber er schätzte nun mal die gelegentlich schlichten, gelegentlich jedoch auch überraschend klugen Ansichten seines knorrigen Offizianten, wenngleich ihm dessen Schwärmerei von den Zuständen im alten Bauerndorf Sterkrade hin und wieder gegen den Strich ging.
Die Polizeidiener, im Rheinland häufig Polizeisergeanten genannt, waren heutzutage allzu oft invalide Trunkenbolde, von so geringer Bildung, dass sie kaum in der Lage waren, Dienstanweisungen zu begreifen und umzusetzen.
Wer mit dem Zivilversorgungsschein in der Tasche aus dem Militärdienst ausschied und seinen Namen schreiben konnte, der war als Ordnungshüter geeignet. So standen die Dinge nun mal im Königreich Preußen. Und obwohl sich die Klagen von Kommunalbeamten über ungeeignete und unzuverlässige Polizeidiener in letzter Zeit häuften, würde sich daran wohl auch nichts ändern.
Martin Grottkamp war ein Glücksfall. Er trank nicht, er war zuverlässig, und er konnte nicht nur seinen Namen schreiben. Er war durchaus in der Lage, einen polizeilichen Bericht zu verfassen, wenn es denn erforderlich war. Er wusste nicht nur genauestens, was in Sterkrade vor sich ging, sondern richtete seinen Blick auch über die Kirchturmspitze von Sankt Clemens hinaus, ja, er hatte sogar die »Rhein- und Ruhrzeitung« abonniert.
Der inzwischen verstorbene Wilhelm Lueg hatte vor gut sechs Jahren höchstpersönlich dafür gesorgt, dass Grottkamp der erste Polizeidiener der Gemeinde Sterkrade wurde. Und sogar der alte Lueg, der weitsichtige Hüttendirektor und ebenso weitsichtige Gemeindevorsteher, hatte hin und wieder Grottkamps Meinung zu Rate gezogen.
Ein gewisses Maß an Vertraulichkeit im Umgang mit diesem Polizeisergeanten, so befand Carl Overberg, ließ sich durchaus rechtfertigen.
Während Sterkrades Gemeindevorsteher seinen Untergebenen mit nachdenklichem Wohlwollen betrachtete, erkannte er plötzlich, in welchem Zustand sein Gegenüber sich befand.
»Mann, Sie sind ja völlig durchnässt«, stellte er fest. »Was haben Sie angestellt, Grottkamp? Sie holen sich ja den Tod! Und außerdem versauen Sie mir alles.«
Carl Overberg rief nach dem Hausmädchen und beorderte es mit Putzeimer und Wischtuch ins Bureau.
Während das Mädchen mit einem Lappen die Fußspuren wegwischte, die Grottkamp trotz aller Vorsicht auf den Holzdielen hinterlassen hatte, und die Wasserlache aufwischte, die sich zu seinen Füßen gebildet hatte, holte Overberg aus den Tiefen seines Schreibschrankes eine Karaffe mit Branntwein und füllte ein Glas.
Das Mädchen hatte den Putzlappen ausgewrungen und ihn anschließend unter Grottkamps durchnässte Schuhe gelegt.
»Hier, Mann, jetzt wärmen Sie sich erst mal auf!«, sagte Carl Overberg und reichte seinem Polizeidiener das fast volle Glas.
»Ein Schnaps am frühen Morgen? Ich weiß nicht recht, Herr Vorsteher.«
»Stellen Sie sich nicht an! Ein Schnäpschen wird einen alten Soldaten schon nicht umhauen.«
Während Grottkamp noch zögerte, fügte Overberg freundlich hinzu: »Nun los, trinken Sie schon! Das ist eine dienstliche Anweisung. Sie dürfen mir in nächster Zeit auf keinen Fall krank werden. Das ist jetzt genau die richtige Medizin für Sie.«
»Na gut, Herr Vorsteher!« Grottkamp fügte sich. Mit säuerlicher Miene kippte er den Branntwein hinunter. Als er sich einige Male geschüttelt hatte und das Dienstmädchen mit dem Putzeimer verschwunden war, forderte Overberg ihn auf: »So, nun erzählen Sie mal! Was haben Sie denn heute Morgen getrieben, bei diesem Sauwetter?«
Ohne unnötige Ausschmückungen berichtete Grottkamp seinem Gemeindevorsteher vom grausigen Fund der beiden jungen Hüttenarbeiter, von seinen eigenen Eindrücken an der Unglücksstelle und von seinen anschließenden Überlegungen.
»Mensch, Grottkamp!« Carl Overberg zupfte nervös an seinen Ärmelschonern. »Sie wollen doch nicht allen Ernstes behaupten, dass dieser Hammerschmied Terfurth das Opfer eines Verbrechens geworden ist?«
»Es sieht schon danach aus.«
»Also, Herr Sergeant, wir sollten zunächst mal alle anderen Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ein Mord hier bei uns in Sterkrade, also, das ist doch nicht nur höchst unwahrscheinlich, das wäre vor allem das Letzte, was wir derzeit brauchen könnten.«
Unruhig drehte Carl Overberg einige Runden über den roten Webteppich, dann stellte er sich wieder hinter sein Pult.
»Wenn dieser Kerl wirklich so betrunken war«, fuhr er fort, »dann ist er doch wahrscheinlich nicht nur einmal gestürzt. Irgendwo hat er sich vermutlich den Schädel eingeschlagen. Dann hat er sich wieder aufgerappelt und sich bis zu diesem Wasserloch geschleppt, wo er endgültig zusammengebrochen ist. Das würde erklären, warum kein Stein in dieser Lache zu finden war.«
»Das halte ich für höchst unwahrscheinlich, Herr Vorsteher, dass ein Mann mit einer solchen Kopfwunde sich noch mal aufrafft und weitergeht.«
Overberg hatte seine Ellenbogen auf das Pult gestellt und stützte seinen Kopf mit beiden Händen. Er dachte nach.
»Also, Grottkamp, wenn Sie sich ganz sicher sind, dass wir es hier mit einem Mord zu tun haben, dann müssen Sie heute noch nach Duisburg zum königlichen Kreisgericht. Dann muss die Justizbehörde eingeschaltet werden.«
»Sicher bin ich mir nicht«, gab Grottkamp zu.
Overberg nickte. Genau das hatte er von seinem Polizeisergeanten hören wollen.
»Eins muss Ihnen klar sein: Wenn Sie mit dieser Geschichte in Duisburg aufkreuzen, dann werden die Herren bei Gericht Sie nicht für voll nehmen. Wer den Justizapparat in Gang setzen will, weil ein Hüttenarbeiter sich total besoffen den Schädel eingeschlagen hat und in einer Pfütze ertrunken ist, der wird beim königlichen Gericht auf wenig Verständnis stoßen. Wenn dieser Terfurth beraubt worden wäre, dann sähe die Sache anders aus. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann trug der Tote ja sogar noch seinen Geldbeutel und seine Uhr bei sich.«
»So ist es«, bestätigte Grottkamp und kramte in seinen Rocktaschen herum. »Ich habe seine Habseligkeiten konfisziert.«
»Nein, nein!« Overberg winkte ab. »Halten Sie nur die Sachen bei sich– und bringen Sie sie in den nächsten Tagen der Witwe!«
»Das habe ich vor.«
Ein paar Augenblicke schwiegen die beiden Männer nachdenklich, dann sagte Overberg noch einmal mit Nachdruck: »Nein! Bei unserem derzeitigen Kenntnisstand sollten wir keinesfalls die Justiz einschalten. Wir würden uns nur lächerlich machen.«
***
Martin Grottkamp vermutete, dass der Gemeindevorsteher mit dieser Einschätzung richtig lag. »Wir müssen wohl zunächst weitere Nachforschungen anstellen«, meinte er.
»Nein, das müssen wir nicht.« Overberg winkte energisch ab. »Wenn wir es hier wirklich mit einem Gewaltverbrechen zu tun haben, dann ist das eine Angelegenheit der Gendarmerie.«
»Schmitting liegt krank in der Baracke.«
Overberg nickte. »Ich weiß, Grottkamp, ich weiß. Also müsste ich Landrat Kessler informieren. Und der würde uns vermutlich die Gendarmen aus Beeck und aus Oberhausen auf den Hals schicken. Normalerweise jedenfalls. Aber zurzeit werden nun mal alle Offizianten für die Cholerabekämpfung gebraucht. Nein, Herr Polizeisergeant! In der augenblicklichen Situation würden wir den hochwohlgeborenen Landrat Kessler mit diesem zweifelhaften Mordverdacht nur ganz unnötig belästigen.«
Grottkamp schätzte seinen Gemeindevorsteher durchaus. Gelegentlich konnte er sich allerdings des Eindrucks nicht erwehren, dass Overbergs Eitelkeit seinen Weitblick ein wenig trübte. Sein Bestreben, dem hochwohlgeborenen Landrat, dem wohlgeborenen Bürgermeister oder den Herren Direktoren der Hüttengewerkschaft zu gefallen, verleitete ihn hin und wieder zu den falschen Schlussfolgerungen.
»Herr Vorsteher«, sagte Grottkamp entschieden, »wenn wir die Sache auf sich beruhen lassen, dann läuft womöglich in Sterkrade ein Mörder frei herum.«
»Wenn wir nicht alle unsere Kraft in die Bekämpfung der Seuche stecken, dann wird die Cholera in den nächsten Wochen Schlimmeres anrichten als alle Mörder im Königreich Preußen zusammen«, entgegnete Overberg.
»Da haben Sie sicher recht, Herr Gemeindevorsteher«, gab Grottkamp zu. »Andererseits sagen Sie doch selbst, dass es gerade in unsicheren Zeiten unsere Pflicht ist, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Wenn wir jetzt einen Mörder laufen lassen, dann lebt er auch noch unter uns, wenn wir die Cholera längst vergessen haben. Und wenn er dann ein zweites Mal mordet, vielleicht sogar ein drittes und ein viertes Mal, dann ist der Ruf der Gemeinde Sterkrade bei den Obrigkeiten in Duisburg und Düsseldorf, vermutlich auch in Koblenz und Berlin, für alle Zeiten ruiniert.«
Overberg hatte seinen Platz hinter dem Stehpult wieder verlassen und lief im Zimmer umher.
»Also gut, Grottkamp«, sagte er nach einer Weile, während er weiter seine Runden drehte. »Dann versuchen Sie in Gottes Namen, Klarheit in diese Angelegenheit zu bringen! Aber Ihre sonstigen Dienstobliegenheiten dürfen keinesfalls vernachlässigt werden.«
»Werden sie nicht, Herr Vorsteher.«
»Hören Sie sich ein wenig um! Finden Sie heraus, was dieser Terfurth für ein Kerl war, mit wem er sich in den Schänken abgegeben hat, ob er ein guter Arbeiter war, in welchen Familienverhältnissen er lebte, kurzum, ob irgendjemand einen Grund gehabt hat, ihn ins Jenseits zu befördern.«
Grottkamp nickte. Dass Terfurths Familienverhältnisse ihm nicht gänzlich unbekannt waren, behielt er für sich. »Genau so werde ich es machen, Herr Vorsteher.«
»Aber bitte mit Diskretion! Es braucht ja nicht gleich das ganze Dorf von Ihrem Verdacht zu wissen.«
Grottkamp nickte wieder.
»Wenn Sie Anhaltspunkte dafür finden, dass Terfurth einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, dann können wir das Landratsamt beziehungsweise die Justiz einschalten. Wenn Ihre Nachforschungen ergebnislos bleiben, dann vergessen wir die Angelegenheit.«
»Jawohl, Herr Vorsteher.«
»Das Wichtigste ist der Kampf gegen die Cholera.«
»Jawohl, Herr Vorsteher.«
Die Feuchtigkeit war durch Martin Grottkamps Unterkleider bis auf seine Haut gedrungen. Der Branntwein stieg ihm allmählich in den Kopf, wärmte ihn jedoch nicht im Geringsten. Er fühlte sich unbehaglich und fror.
Overberg lief immer noch in der Amtsstube auf und ab.
»In Essen ist die Zahl der Choleratoten inzwischen auf über tausend gestiegen«, referierte er. »Wer es sich leisten kann, hat die Stadt verlassen. Auch die Krupps sollen schon geflüchtet sein.«
»Wer sind die Krupps?«
»Das darf doch nicht wahr sein!«, ereiferte Overberg sich. »Die Krupps sind in Essen das, was bei uns die Haniels und die Jacobis sind. Haben Sie denn noch nie was von ›Fritz‹ gehört, dem mächtigsten Dampfhammer in Preußen, oder von Alfred Krupps Kanonen?«
»Doch schon«, knurrte Grottkamp. »Der Name war mir nur gerade entfallen.«
»Na gut, lassen wir das! Zurzeit sieht es jedenfalls ganz übel aus, bei Krupp und auch anderswo. Mehrere Zechen und Hütten in Essen mussten schon die Arbeit einstellen, weil fast die komplette Belegschaft erkrankt ist.«
Carl Overberg unterbrach seinen Vortrag, blieb vor dem Fenster stehen und sah wortlos hinaus in den verregneten Septembertag. Erst nach einer ganzen Weile nahm er seine Wanderung durch das Bureau wieder auf und setzte seine Rede fort.
»Also, in Essen sind im Juli die ersten Krankheitsfälle aufgetreten, und binnen kürzester Zeit kam es dort zu einer regelrechten Explosion der Cholera, die natürlich durch die Verhältnisse in den Wohnvierteln der Arbeiter begünstigt worden ist. Die Essener kommen mit dem Bau von Arbeiterwohnungen einfach nicht nach. Da hat kaum jemand ein Bett für sich alleine, und dass sich zwanzig oder mehr Personen einen Abort teilen, das ist keine Seltenheit. Wie es da um die Hygiene steht, das können Sie sich leicht vorstellen.«
»Der Fortschritt fordert seinen Preis«, murmelte Grottkamp.
»Von Essen aus hat sich die Seuche allmählich entlang der Ruhr verbreitet«, fuhr Overberg fort. »In Dortmund geht man von sechshundert Toten aus, in Bochum sollen es schon fast siebenhundert sein, in Duisburg ist die Rede von etwa fünfhundert.«
»Ja, es ist furchtbar«, seufzte Martin Grottkamp, der die schrecklichen Zahlen bereits aus der Zeitung kannte.
»Natürlich ist es furchtbar! Aber wir sollten froh sein, dass die Cholera eineinhalb Monate gebraucht hat, um von der Ruhr bis an die Emscher zu gelangen. Uns hat zuerst die Angst erreicht und dann die Seuche. Seit Wochen laufen die Menschen zum Heildiener, sobald es in ihrem Darm nur ein wenig zwickt.«
Grottkamp nickte zustimmend. »Deshalb haben wir die Kranken frühzeitig isolieren können.«
»Ganz genau! Die Furcht ist in diesem Fall unser Verbündeter. Es ist gut, dass die Menschen wissen, was in den Nachbarstädten los ist. Wenn wir ihnen jetzt sagen, wie sie sich verhalten müssen, dann werden sie uns aufmerksam zuhören.«
»Mit Sicherheit werden sie das, Herr Vorsteher.«
»Sehen Sie Grottkamp, und dafür brauche ich Sie. Ich möchte, dass Sie heute noch mal die Angehörigen aller Erkrankten aufsuchen und auch ihre Nachbarn. Nehmen Sie die hygienischen Verhältnisse in den Häusern in Augenschein! Die Menschen sollen auf Reinlichkeit achten! Räume, in denen sich ein Cholerakranker aufgehalten hat und Gegenstände, die von ihm benutzt worden sind, müssen penibel gesäubert werden. Von einem Kranken getragene Wäsche muss ausgekocht werden, ebenso sein Bettzeug. Was mit Kot verunreinigt ist, sollte am besten verbrannt werden. Reden Sie noch mal mit den Leuten über die Gefahr, die von einem verschmutzten Abort ausgeht! Von Möllenbeck wissen sie vermutlich schon, dass sie keinesfalls ohne vorherige Desinfektion dort ihre Notdurft verrichten dürfen, wo ein Kranker seinen Darm entleert hat. Aber, Herr Polizeisergeant, bekräftigen Sie diese Warnung noch mal! Die Leute sollen sich meinetwegen hinter irgendeine Hecke hocken, wenn sie keine andere Möglichkeit haben.«
Grottkamp nickte. »Ich werde mich sofort auf den Weg machen.«
DREI
Wenn Martin Grottkamp von den Regeln abwich, die er selbst seinem Leben gegeben hatte, dann musste er einen triftigen Grund dafür haben. Dafür, dass er heute in einem öffentlichen Lokal zu Mittag speiste, obwohl er dies gewöhnlich nur dienstags tat, gab es sogar zwei Gründe.
Eine Zeitlang hatte Grottkamp neben seiner langsam trocknenden Uniform am Ofen gesessen. Er hatte seine alten Militärstiefel blank gewienert und auch die uninteressanten Berichte in der neuen Rhein- und Ruhrzeitung gelesen. Irgendwann hatte er festgestellt, dass das Stück Brot und die Käseecke, die er eigentlich am Mittag essen wollte, nicht gerade seinen Appetit anregten.
Da Overberg ihm empfohlen hatte, zur Stärkung seiner Gesundheit eine kräftige Mahlzeit einzunehmen, war ihm der Gedanke gekommen, in ein Gasthaus zu gehen. Doch die Empfehlung des Herrn Vorstehers allein reichte nicht aus, ihn zu einer Verletzung seiner Regeln zu verleiten, zumal sich wahrlich darüber streiten ließ, ob ein Stück Brot und ein Kanten Käse zusammen mit einer Kanne Kaffee nicht ein durchaus kräftiges Mittagessen ausmachten.
Dann war ihm durch den Kopf gegangen, dass er Julius Terfurth während seiner abendlichen Inspektionen der Wirtshäuser häufig im Gasthof »Zum dicken Klumpen« gesehen hatte und dass Terfurth auch den gestrigen Abend dort verbracht haben könnte.
Diese Überlegung und die Empfehlung des Gemeindevorstehers waren Gründe genug für Grottkamp, an diesem Montag in der Gastwirtschaft »Zum dicken Klumpen« zu Mittag zu essen.
Das Wirtshaus in der Nähe des Sterkrader Bahnhofs war eigentlich nicht sein Fall. Der Klumpenwirt Hubertus Küppken gefiel ihm ebenso wenig wie dessen Gäste. Aber gerade derentwegen war Grottkamp ein häufiger Besucher des Hauses, freilich kein allzu gern gesehener.
Wenn der Herr Polizeidiener erschien und Identifikationspapiere oder Gesindebücher überprüfte, dann hatte das schon für manchen Gast des Klumpenwirts die letzte Nacht in Sterkrade bedeutet.
Wer ohne ausreichende Mittel umherzog und nicht nachweisen konnte, dass er Arbeit hatte oder welche suchte, der war nach dem preußischen Gesetz nun mal ein Landstreicher. Streng genommen hätte er umgehend dem Kreisgericht in Duisburg zugeführt und zu einer mindestens sechswöchigen Gefängnisstrafe verurteilt werden müssen. So sah das Gesetz über die Bestrafung der Landstreicher, Bettler und Arbeitsscheuen es vor.
Gemeindevorsteher Carl Overbergs Sicht, dass ein mittelloser Fremder in Sterkrade ja vielleicht tatsächlich Arbeit suche und dass eine Ausweisung aus der Gemeinde als erste Maßnahme zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ausreichend sei, hatte sich für Grottkamp als vorteilhaft erwiesen. Der polizeiliche Aufwand reduzierte sich im Einzelfall erheblich. Es gab weder ellenlange Berichte zu schreiben noch wurden Zeugenaussagen vorm Gerichtshof erforderlich.
Die Ertappten fügten sich zumeist reumütig und kleinlaut den polizeilichen Maßnahmen, und sie ließen sich in Sterkrade nicht mehr blicken, wohl wissend, dass ein erneutes Ertapptwerden sie unweigerlich ins Gefängnis bringen würde.
Hubertus Küppken hätte vermutlich lieber den Leibhaftigen in seiner Gaststube begrüßt als den lästigen Polizeisergeanten Grottkamp, der seine Gäste vergraulte und ihm schon so manches Geschäft verdorben hatte. Allerdings war Küppken ein Mensch, dem es mühelos gelang, seine Abneigung hinter einem feisten Lächeln zu verbergen.
Doch als Grottkamp an diesem Montag im Gasthaus »Zum dicken Klumpen« auftauchte, vergaß Hubertus Küppken zu lächeln. Dass der Polizeidiener sein Etablissement zur Mittagszeit betrat, dass er, ohne die anderen Gäste zu beachten, zu einem Tisch in der Nähe des Tresens ging, sein Cape über einen Stuhl warf, seine Dienstmütze abnahm und sich niederließ, beobachtete der Wirt mit offen stehendem Mund.
Es dauerte jedoch nur ein paar Augenblicke, bis er sich wieder gefasst hatte und zu Grottkamp an den Tisch trat.
»Was kann ich für Sie tun, Herr Polizeisergeant?«, fragte er, und Grottkamp stellte fest, dass er sein feistes Lächeln wiedergefunden hatte.
»Sie können mir was zu essen machen.«
»Aber gerne. Eine Suppe vielleicht?«
»Nein, ich brauche was Kräftiges.«
»Wie wäre es mit einer Schüssel Bratkartoffeln?«
Grottkamp blickte den Wirt skeptisch an.
»In Schweineschmalz und mit einer gehackten Zwiebel gebraten?«
Martin Grottkamp kraulte unschlüssig seinen Bart.
»Vielleicht mit einer Handvoll Speckwürfel dazu?«
»In Schmalz gebratene Kartoffeln mit Zwiebelstücken und einer doppelten Portion Speckwürfel. Das ist es. Das können Sie mir bringen, Küppken.«
»Zwei Hände voll Speckwürfel. Geht klar, Herr Sergeant. Und ein Krug Bier, damit es besser rutscht?«
»Nein, einen großen Becher Kaffee möchte ich. Aber erst nach dem Essen.«
»Wie es beliebt, Herr Polizeisergeant«, entgegnete Küppken beflissen und verschwand eilig in der Küche.
Grottkamp war erstaunt darüber, wie wenig Gäste sich zu dieser Tageszeit in der Wirtsstube aufhielten.
Am Tresen standen zwei durchnässte Fuhrleute, die offenbar wie Gemeindevorsteher Overberg der Meinung waren, Branntwein sei das beste Mittel, um einer Erkältung vorzubeugen. An einem Tisch in der hinteren Ecke des Raumes saß der Kolonialwarenhändler Heinrich Krumpen, der mit einem gut gekleideten Fremden augenscheinlich Geschäftliches besprach. Der Fremde schob Krumpen gerade ein Papier zu, das dieser jedoch kopfschüttelnd zurückwies.
Sicher, im Gasthaus »Zum dicken Klumpen« verkehrten nicht nur Taugenichtse. Die Tür einer Wirtschaft, deren Hauptzweck die Beherbergung und Verpflegung von Reisenden ist, steht nun mal jedem offen, überlegte Grottkamp. Und dass sich unter ehrbare Gäste mit ordentlichen Papieren gelegentlich auch übles Volk mischte, das ließ sich in einem Gasthaus, das nicht mal hundert Ruten vom Bahnhof entfernt lag, wohl nicht vermeiden.
Seit der Inbetriebnahme der Bahnstation im Jahre 1856 hatte die Eisenbahn das Leben im Dorf beinahe so nachhaltig verändert wie das Hüttenwerk. Die Gutehoffnungshütte zog die Fremden an, und die Eisenbahn brachte sie in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit hierher.
Dass den Waggons nicht nur Menschen entstiegen, die Arbeit suchten oder auf einen guten Abschluss hofften, war fraglos nicht Hubertus Küppken anzukreiden. Doch Grottkamp verübelte ihm, dass er Gesindel allzu bereitwillig beherbergte, wenn es ihm nur ein paar Groschen einbrachte.
Die beiden jungen Frauen, die auf der Bank neben dem Fenster tuschelnd die Köpfe zusammensteckten, hielt Martin Grottkamp für Gäste der weniger feinen Sorte. Dafür hatte er einen Blick. Ein unbedarfter Beobachter hätte sie in ihren hoch geknöpften Flanellkleidern für Dienstmägde halten können. Aber eine Dienstmagd trank zur Mittagszeit keinen Branntwein in einem Gasthaus, sie legte in einer Arbeitspause ihre Schürze nicht ab, und sie trug gewöhnlich Holzschuhe.
Die jungen Frauen auf der Bank hatten geschnürte Lederschuhe an den Füßen und zeigten diese recht kokett her. Beide hatten ihre Beine übereinandergeschlagen, so dass man die fein gewebten Strümpfe der einen und die Spitzen des weißen Unterkleides der anderen sehen konnte. Was Grottkamp vollends misstrauisch machte, waren die Seidenschals, die beide um ihre Schultern geschlungen hatten. So zeigten sich wohlanständige Frauen nicht an einem Montagmittag in der Öffentlichkeit.
Küppken war inzwischen wieder hinter den Tresen zurückgekehrt und signalisierte Grottkamp, dass er noch eine kleine Weile auf seine Bratkartoffeln warten müsse. Der winkte den Klumpenwirt an seinen Tisch.
»Setzen Sie sich kurz zu mir, Küppken!«
Der Wirt wischte seine feuchten Hände an der blauen Schürze ab, die sich über seinen Bauch spannte. »Immer zu Diensten, Herr Sergeant«, murmelte er, rückte einen Stuhl zurecht und setzte sich Grottkamp gegenüber. »Ich hab mir schon gedacht, dass Sie nicht allein der Hunger hierher getrieben hat. Zum Essen waren Sie ja noch nie bei mir.«
»Besonders beliebt scheint Ihre Küche auch nicht zu sein«, stellte Grottkamp angesichts der wenigen Gäste fest, von denen offenbar keiner hier war, um zu speisen.
»Mittags läuft heutzutage nicht mehr viel, Herr Polizeisergeant. Die Leute haben keine Zeit mehr. Die Einheimischen können erst kommen, wenn sie Feierabend haben, die Fuhrleute treffen meistens erst ein, wenn es dunkel wird, und die Fremden, die hier logieren, die sehe ich tagsüber nur selten. Nein, Herr Sergeant, gegessen wird hier erst am Abend.«
»Nicht nur gegessen«, knurrte Grottkamp.
»Wollten Sie mit mir übers Geschäft reden?«, fragte der Klumpenwirt schnippisch.
»Wir könnten auch über die beiden jungen Damen da drüben reden«, konterte Grottkamp.
Küppken wirkte für einen Augenblick verlegen. »Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»Ich meine, dass es vielleicht richtig wäre, die Identifikationspapiere der Weibspersonen zu überprüfen.«
»Aber Herr Sergeant, sie sind erst mit dem Frühzug angekommen. Und jetzt machen sie halt eine kleine Pause, bevor sie sich nach Arbeit umsehen«, beteuerte der Wirt.
»Sagen Sie den beiden, dass ich sie einer polizeilichen Überprüfung unterziehen werde, wenn sie mir noch einmal unter die Augen kommen.«
»Geht klar, Herr Grottkamp!«
»Na gut. Dann reden wir mal über Julius Terfurth.«
»Um Gottes willen, der arme Kerl. Ich habe schon gehört, dass er tot ist.« Martin Grottkamp hatte das Gefühl, dass Hubertus Küppken wirklich betroffen war.
»War er gestern hier?«
»Ja, den ganzen Abend.«
Grottkamp nickte zufrieden. Es war also so, wie er es vermutet hatte. »Und mit wem war er zusammen?«, wollte er vom Klumpenwirt wissen.
»Mit allen und mit niemandem. Der Terfurth war eigentlich immer allein hier, so wie die meisten übrigens. Dann hat er mal mit diesem und mal mit jenem zusammengestanden und ein paar Worte gewechselt. Oft hat er da auf der Bank gesessen.«
»Und mit wem hat er sich gestern unterhalten?«
»Ich weiß es wirklich nicht so genau. Es war ziemlich voll gestern Abend. Also, er hat mal vor dem Tresen gestanden und mit einigen Kerlen geredet, die er anscheinend von der Hütte kannte. Und dann ist er eine ganze Weile neben einem Tisch stehen geblieben und hat den Leuten da beim Kartenspielen zugeschaut.«
»Los Küppken, denken Sie nach! Was war sonst noch?«
»Herr Polizeisergeant, Sie fragen ja so, als ob… Ich meine, ist der Terfurth denn nicht in eine Pfütze gefallen und ertrunken?«
»So sieht es wohl aus. Aber ich wüsste doch ganz gerne, was er in seinen letzten Stunden getrieben hat. Ob er zum Beispiel einen Streit hatte. Es könnte ja immerhin sein, dass bei seinem Sturz jemand nachgeholfen hat.«
»Nein, Herr Sergeant. Hier hat er sich mit niemandem gestritten. Aber, da fällt mir ein, ziemlich spät am Abend, da hat er eine ganze Zeit mit dem Lehrer Weyer da drüben am Tisch gesessen und sich unterhalten.«
»Mit dem Lehrer Weyer? Der trinkt doch gewöhnlich in der Marktschänke beim Ostrogge sein Bier. Seit wann verkehrt der denn hier?«
»Nun, er ist nicht gerade ein häufiger Gast. Aber ab und zu, wenn er mal neue Gesichter sehen will, der Herr Lehrer, dann kommt er halt her.«
»Und worüber hat er gestern mit dem Terfurth geredet?«
»Ich habe den beiden einige Krüge Bier an den Tisch gebracht. Dabei habe ich mitbekommen, dass sie über den Krieg gesprochen haben. Der Terfurth war der Meinung, dass die Preußen schon immer ganz hervorragende Soldaten waren, und da hätten die Österreicher von vornherein auf verlorenem Posten gestanden. Der Lehrer Weyer hat behauptet, nur weil sie ihre modernen Zündnadelgewehre hatten, die Preußen, und weil sie damit schneller nachladen konnten, hätten sie den Sieg davongetragen. So ein Quatsch, hat der Terfurth darauf gesagt. Mit der modernen Technik könnten die Menschen gar nichts gewinnen, auch keinen Krieg.«
»Also haben die beiden doch gestritten.«
»Nein, nein, Herr Polizeisergeant. Einen Streit kann man das wirklich nicht nennen. Die beiden waren schon arg betrunken und haben ziemlich heftig diskutiert. Aber mehr auch nicht.«
»Und wie endete die Diskussion?«
»Nun, der Lehrer Weyer ist irgendwann gegangen.«
»Und dann?«
»Dann hat der Terfurth noch eine ganze Zeit allein an dem Tisch gesessen und sich vollaufen lassen. Und als alle anderen Gäste weg waren, da saß er immer noch da.«
»Bis wann?«
Küppken dachte nicht lange nach. »Eine viertel Stunde vor elf ist er gegangen.«
»Die Polizeistunde gilt im Gasthaus ›Zum dicken Klumpen‹ wohl nicht«, murrte Grottkamp.
»Doch, doch, Herr Polizeisergeant«, entgegnete Küppken beschwichtigend. »Die Tür war schon lange abgeschlossen, und der Terfurth hat ja auch nur noch so dagesessen. Er konnte gar nichts mehr trinken, glaube ich. Aber wissen Sie, Herr Sergeant, einen Stammgast, den wirft man nicht so gerne raus. Wir haben also schon mal sauber gemacht und aufgeräumt, und als wir damit so ziemlich fertig waren, da wollte der Terfurth dann auch gehen. Ich habe ihn aus der Tür gelassen, hinter ihm wieder abgeschlossen und bin gleich danach ins Bett.«
Grottkamp strich skeptisch durch seinen Bart.
Der Wirt lächelte harmlos.
»Hat Julius Terfurth eigentlich geraucht?«, fragte Grottkamp nach einer Weile.
Der Klumpenwirt schüttelte den Kopf. »Nein geraucht hat er nicht. Jedenfalls habe ich ihn nie rauchen gesehen.«
***
Wenn Hubertus Küppken die Wahrheit gesagt hatte, dann hatte Julius Terfurths Taschenuhr noch zweiundsiebzig Minuten getickt, nachdem der Hammerschmied am Sonntagabend das Gasthaus »Zum dicken Klumpen« verlassen hatte.
Eine viertel Stunde vor elf Uhr hatte Küppken die Wirtshaustür hinter Terfurth abgeschlossen. Um drei Minuten vor Mitternacht war die Uhr in der Wasserlache auf dem Postweg stehen geblieben.
Wenn der Hammerschmied zu diesem Zeitpunkt, wie angenommen, seit etwa einer halben Stunde in der Pfütze gelegen hatte, dann hatte er für den Weg vom Wirtshaus bis zum unteren Postweg vierzig bis fünfundvierzig Minuten gebraucht.