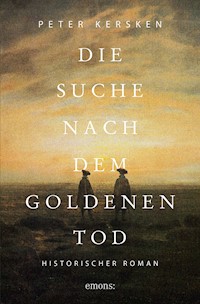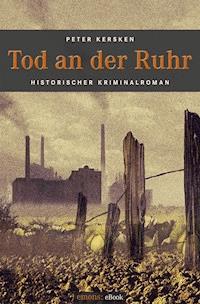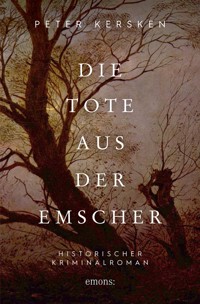
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historischer Kriminalroman
- Sprache: Deutsch
Der neue Roman des Ruhrgebiet-Chronisten Peter Kersken – authentisch, düster und glänzend recherchiert. September 1816: An Ruhr und Emscher scheint die Sonne seit Monaten nicht mehr, die Ernte verfault, es droht eine Hungersnot. Die Menschen haben Angst. Als eine kräuterkundige Bauersfrau tot aus dem Fluss gezogen wird, begibt sich der Untersuchungsrichter Anton Demuth an den Ort des Geschehens. Dort trifft er auf Menschen, die überzeugt davon sind, dass die Tote eine Hexe war, und die verzweifelt nach einem Schuldigen für ihr eigenes Schicksal suchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Kersken, geboren 1952 in Oberhausen im Ruhrgebiet, studierte Philosophie und Literaturwissenschaften in Freiburg und Köln und arbeitete als Redakteur bei einer Kölner Tageszeitung. Er lebt als freiberuflicher Autor in der Eifel.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung eines Motivs von commons.wikimedia.org/Gemeinfrei
Lektorat: Dr.Marion Heister
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-079-2
Historischer Kriminalroman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
Die Welt ist kompliziert, und das Leben ist schwierig.
Also suche nicht nach einfachen Antworten.
Und wenn Du zufällig eine findest, dann misstraue ihr.
Hiltrudis Freifrau von Hiesfeld, Brief an die Enkelin Hanna, 11. September 1816
Donnerstag, 12.September 1816
Der Fährmann Theodor Schimmel, der von allen Dores genannt wurde, stieß den flachen Kahn vom Werdener Ruhrufer ab. Er beäugte seinen Fahrgast, den einzigen, der heute hinüberwollte zur Essener Landstraße, mit unverhohlener Verständnislosigkeit.
Dass der Justizrat Anton Demuth jetzt der Stadt Werden den Rücken kehrte, ausgerechnet zu dieser Stunde, da von überall her hunderte und aberhunderte Menschen hineinströmten in das Städtchen an der Ruhr, das machte Theodor Schimmel sprachlos. Er fragte seinen Passagier nicht einmal nach seinem Reiseziel. Und als der Herr Justizrat mitten auf dem Fluss sagte: »Es regnet gar nicht, Dores, ist das nicht erstaunlich?«, nickte er nur stumm.
Anton Demuth war es recht, dass der Fährmann nicht fragte, wohin er unterwegs sei. Was hätte er schon sagen können? Zu einer Wasserleiche in der Emscher, irgendwo in der Nähe des Herrensitzes Oberhausen? Ja, vermutlich hätte er das dem alten Dores geantwortet. Viel mehr wusste er selbst nicht über das Ziel seiner unerwarteten Dienstreise, die er gerade ziemlich überhastet, aber keineswegs ungern angetreten hatte. Immerhin war er so im letzten Augenblick der Hinrichtung entkommen.
Noch vor einer knappen Stunde hatte er im Salon seiner Wohnung am Fenster gestanden und hinuntergeschaut auf den Marktplatz, hatte auf den massiven Eichenklotz gestarrt, der mitten auf dem rot gestrichenen Holzgerüst stand, das tags zuvor errichtet worden war. Er hatte zugesehen, wie ein paar Kerle einen schwarzen Sarg herangeschleppt und ihn auf das Gerüst gewuchtet hatten, und er hatte mit Grausen beobachtet, wie ein Knecht des Scharfrichters, nachdem er die Standfestigkeit des Hackklotzes geprüft hatte, das Henkersbeil geschärft und auf den Sarg gelegt hatte.
Die Bühne für die Hinrichtung war bereitet, und der königlich preußische Justizrat Anton Demuth, Kriminalrichter am Inquisitorialgericht zu Werden, hatte schaudernd an das Schauspiel gedacht, das dort zur Aufführung kommen sollte, und an die Rolle, die ihm darin zugedacht war.
Der Platz hatte sich allmählich mit Menschen gefüllt, durch alle Gassen waren sie herbeigeströmt, honorige Bürger und ärmliches Bauernvolk, Kinder und Alte, Frauen und Männer. Demuth hatte auf seine Taschenuhr geschaut und seufzend festgestellt, dass es allmählich Zeit wurde, hinüberzugehen zum Zuchthaus. Von dort sollte eine Abteilung Husaren den zum Tode durch das Henkersbeil verurteilten Delinquenten zum Blutgerüst führen, und der Kriminalrichter Demuth, zwei Gerichtssekretäre, ein Priester sowie der Scharfrichter und seine Knechte sollten die grausige Prozession begleiten. Auf dem Marktplatz sollte es dann Anton Demuths Aufgabe sein, als Vertreter der preußischen Justiz dem Delinquenten noch einmal das Todesurteil und die Bestätigung desselben durch König Friedrich Wilhelm vorzulesen.
Gerade hatte Demuth sich vom Fenster abwenden wollen, um seinen Zylinderhut aufzusetzen und seinen Gehrock überzuziehen, da hatte er unten vor dem Haus den Justizdirektor Hugo von Broich entdeckt, der sich durch die herbeiströmende Menschenmenge drängte. Nur Augenblicke später hatte seine Dienstmagd Klärchen Stüber den Herrn Direktor gemeldet.
Noch bevor Demuth seinen Vorgesetzten hereinbitten konnte, war der grußlos an Klärchen vorbei in den Salon gestürmt und hatte atemlos hervorgestoßen: »Wir müssen umdisponieren, Herr Kriminalrat, wir müssen umdisponieren.«
Dann hatte er sich eine Weile, nach Luft schnappend, an der Lehne des großen Sessels festgehalten und an dem verblüfften Anton Demuth vorbei aus dem Fenster geschaut. Hugo von Broich war mit einunddreißig Jahren halb so alt wie Demuth, aber schon von einer enormen Leibesfülle. Erst nachdem er ein paar Minuten schnaufend das Treiben auf dem Marktplatz betrachtet hatte, hatte Demuth erfahren, warum der Justizdirektor die Strapaze auf sich genommen hatte, sein Bureau im Gericht zu verlassen und ihn aufzusuchen.
Ein berittener Bote des Grafen Maximilian von und zu Westerholt-Gysenberg hatte im Gericht vorgesprochen und einen Leichenfund gemeldet. In den Morgenstunden war eine tote Bauersfrau mit einer höchst verdächtigen Kopfverletzung in der Emscher, nahe dem gräflichen Herrenhaus, entdeckt worden.
»Das müssen wir ernst nehmen, lieber Demuth, das müssen wir sehr ernst nehmen, und deshalb hätte ich gern, dass Sie sich um die Sache kümmern«, hatte von Broich gesagt und seinen Justizrat fragend angesehen. »Wissen Sie, wo das ist, das neue Schloss Oberhausen? Wenn Sie von Essen die Chaussee in Richtung Wesel befahren, dann überqueren Sie nach etwa anderthalb Meilen die Emscher, und genau da, linker Hand hinter der Brücke, liegt der Herrensitz mit der Poststation.«
»Ich weiß, wo das ist«, hatte Demuth gesagt, »Schloss und Posthaus gehören zu Sterkrade in der Bürgermeisterei Holten, also zum Kreis Dinslaken.«
»Ach ja, natürlich kennen Sie sich da aus, Sie waren ja viele Jahre Richter am Landgericht in Dinslaken«, hatte Hugo von Broich eifrig gesagt.
»Und ich bin in Sterkrade aufgewachsen«, hatte Demuth hinzugefügt.
»Umso besser, lieber Kriminalrat. Also, was halten Sie von meinem Vorschlag?«
Demuth war sich durchaus im Klaren darüber, dass von Broich ihn auch kurz und bündig hätte anweisen können, sich umgehend auf den Weg zu machen. Aber in den anderthalb Jahren, in denen sie beide jetzt am Kriminalgericht zusammenarbeiteten, hatte der Justizdirektor es stets vermieden, ihm gegenüber den Vorgesetzten herauszukehren. Anton Demuth nahm an, dass der junge Hugo von Broich sich so verhielt, weil ihn Gewissensbisse plagten, seitdem man ihn, den gerade dreißigjährigen Spross aus einem adligen Hause, im März 1815 zum Direktor des neu eingerichteten Inquisitorialgerichtes in Werden ernannt und den altgedienten Justizrat Demuth einmal mehr übergangen hatte. Die anderen Gerichtsangehörigen, zwei jüngere Kriminalräte, ein Justizassessor, ein Aktuar und vier Gerichtssekretäre, wussten ein Lied davon zu singen, dass der Herr Direktor auch anders konnte, dass er sehr wohl in der Lage war, unmissverständliche Anweisungen zu geben und sich jeden Widerspruch zu verbitten.
»Und wie machen wir es hier?«, hatte Anton Demuth gefragt und durchs Fenster hinausgeschaut auf den Marktplatz, auf dem sich immer mehr Menschen um das Blutgerüst gedrängt hatten.
»Wenn es Ihnen recht ist, dann vertrete ich persönlich bei der Hinrichtung das Gericht«, hatte von Broich gesagt.
Das war Anton Demuth überaus recht gewesen.
»Wollen Sie einen der Gerichtssekretäre mitnehmen? Den jungen Rüter vielleicht?«
»Ich schau mir gern erst mal allein an, was da passiert ist. Außerdem ist Hubertus Rüter als Protokollant bei der Hinrichtung vorgesehen.«
»Ach ja, das war mir entfallen«, hatte von Broich gesagt, und dann hatte er seinem Kriminalrat empfohlen, bei dem derzeit äußerst schlechten Zustand der Straßen nicht im Dunkeln zurückzukehren. »Wenn es Ihnen zu spät wird, da an der Emscher, dann übernachten Sie lieber im Posthaus.«
Der Gedanke, den Abend nicht lesend in seinem bequemen Lehnsessel zu verbringen, in der Nacht nicht in seinem weichen Bett zu schlafen und am nächsten Morgen nicht von den Geräuschen, die Klärchen Stüber in der Küche machte, und vom Duft frisch aufgebrühten Bohnenkaffees geweckt zu werden, behagte Anton Demuth zwar grundsätzlich nicht, aber er hatte dem Justizdirektor versprochen, eine Übernachtung im Posthaus gegebenenfalls in Erwägung zu ziehen.
»Wenn das hier unten auf dem Markt vorbei ist«, hatte er vorgeschlagen, »dann könnten Sie den Rüter nach Duisburg schicken, um den Professor Günther zu benachrichtigen. Eine Obduktion der Toten wird unumgänglich sein.«
Weil von Broich darauf nicht reagiert hatte, vermutlich hatte er an die erheblichen Kosten einer sachverständigen Leichensektion gedacht, hatte Demuth hinzugefügt: »Entsteht bei der äußeren Untersuchung eines Leichnams auch nur der geringste Verdacht, dass der Tod auf irgendeine Art gewaltsam erfolgt oder durch fremdes Verschulden verursacht sein könnte, so muss die Sektion durch einen Sachverständigen geschehen.«
»Ich weiß, Demuth. Paragraph 157 der Kriminalordnung. Na ja, der Verdacht auf ein Tötungsdelikt liegt zweifellos vor, also werden wir um eine Obduktion nicht herumkommen. Aber warum wollen Sie ausgerechnet Professor Günther?«
»Er ist ein vereidigter Arzt, zugelassen für gerichtlich veranlasste medizinische Untersuchungen, eine Autorität auf dem Gebiet der menschlichen Anatomie, und Duisburg ist nicht weit vom Schloss Oberhausen entfernt.«
»Na gut, dann machen Sie sich bitte auf den Weg. Nach der Exekution werde ich Hubertus Rüter nach Duisburg schicken«, hatte von Broich gesagt, und bereits eine gute Stunde später verließ Anton Demuth am jenseitigen Ruhrufer die Fähre, nickte dem alten Dores noch einmal zu und führte den Rappen, den einer der Gerichtssekretäre vor das zweirädrige Cabriolet gespannt hatte, die Uferböschung hinauf zur alten Landstraße nach Essen.
Dabei hatte er Mühe, das junge Pferd ruhig zu halten, denn eine aufgeregte Menschenmenge drängte ihm und dem kleinen Gespann entgegen. Jeder versuchte, einen Platz auf der Ruhrfähre zu ergattern, um rechtzeitig zur Hinrichtung auf dem Marktplatz in Werden zu sein.
Anton Demuth hielt nichts von öffentlichen Hinrichtungen. »Wenn die braven Leute sehen, wie Mörder und Räuber ihre Köpfe verlieren, dann werden sie es vorziehen, brave Leute zu bleiben«, hatten seine Professoren damals während des Studiums in Duisburg gern gesagt, aber er war in den vierzig Jahren, die er seitdem im Dienst der Justiz verbracht hatte, zu der Überzeugung gelangt, dass dieser Lehrsatz nichts anderes war als ein frommer Wunsch. Das blutrünstige Schauspiel auf dem Schafott war der Volkserziehung nicht im Geringsten dienlich, es trug allein zur Verrohung des Volkes bei. Daran hatte Demuth schon lange keinen Zweifel mehr.
Kaum hatte er auf der Sitzbank des Cabriolets Platz genommen und sich vergewissert, dass seine lederne Reisetasche neben ihm stand, da begann es zu regnen.
Er schob das Verdeck des Cabriolets so weit wie möglich nach vorn, schlug den Kragen seines Mantels hoch und zog den breitkrempigen Reisehut, den er dem Zylinderhut vorgezogen hatte, tief ins Gesicht.
Der Rappe setzte sich vorsichtig in Bewegung. Die Landstraße war durch den Dauerregen der vergangenen Wochen zu einer matschigen Piste geworden. Anton Demuth war gerade mal vierzig oder fünfzig Ruten weit gekommen, als das rechte Wagenrad so tief in den Morast sackte, dass er befürchtete, die leichte Kutsche könne umkippen. Vorsichtshalber stieg er ab.
Eine Weile führte er das Pferd am Zügel, bis er den Eindruck hatte, dass der Untergrund am linken Straßenrand ein wenig fester wurde. Er kletterte wieder auf den Wagen, doch es ging kaum schneller voran als zuvor. Der junge Rappe schnaubte vor Anstrengung. Demuth befürchtete, das Tier könne im Schlamm wegrutschen, und überließ es ihm, das Tempo zu bestimmen, dirigierte es lediglich mit dem Zügel so weit wie möglich nach links.
»Verdammtes Wetter«, sagte er mürrisch. Der Regen fiel leise und beharrlich aus dem diesigen Himmel.
Der wölbte sich seit Monaten finster und unheilschwanger über das Land, grau am Tag und schwarz in der Nacht. Schon so lange war dort oben kein freundliches Himmelsblau mehr zu sehen gewesen, war kein lichter Strahl mehr durch die Düsternis gedrungen, dass die Menschen längst aufgehört hatten, nach der Sonne Ausschau zu halten. Im Mai hatte auf den Ruhrhöhen noch Schnee gelegen, im Juni hatten die, die es sich leisten konnten, noch ihre Stuben beheizt, und im Juli war auch die letzte Hoffnung geschwunden, es könne in diesem Jahr noch einen Sommer geben.
Irgendwann im August hatte dann ein stetiger Nieselregen eingesetzt. Die seltenen Tage, an denen es seither trocken geblieben war, hatten nicht ausgereicht, um das Wasser auf den verschlammten Wegen und den morastigen Feldern versickern zu lassen. Das ganze weite Land zwischen Ruhr und Emscher war von unzähligen Pfützen und ausgedehnten Wasserlachen bedeckt.
Nach einer Stunde hätte Anton Demuth eigentlich die Essener Stadtmauer vor sich sehen sollen, aber er hatte gerade erst die Bauernschaft Rüttenscheid passiert. Es dauerte eine weitere halbe Stunde, bis er durch das Kettwiger Tor in die Stadt hineinfuhr, die er knapp zehn Minuten später durch das Limbecker Tor in Richtung Westen wieder verließ. Die Chaussee nach Wesel war besser befestigt als die alte Landstraße von Werden nach Essen, die Räder seines Wagens sackten jetzt nicht mehr so tief ein.
Auf der Straße waren nur wenige Fuhrwerke unterwegs, und auf den Feldern ringsum, wo an einem Werktag im September normalerweise ganze Bauernfamilien damit beschäftigt waren, die Getreideernte einzubringen, war kein Mensch zu sehen. Roggen und Weizen waren nur spärlich gewachsen in diesem Jahr, gerade mal einen Fuß hoch waren die Halme geworden, und die Ähren waren kümmerlich geblieben. Irgendwann hatten dann auch noch heftige Hagelschauer die kläglichen Feldfrüchte zu Boden gedrückt, wo sie jetzt im Regen vor sich hin faulten.
Die königlich preußische Bezirksregierung hatte vor ein paar Tagen per Erlass die Eröffnung der Jagdsaison vom September in den Oktober verschoben, um den Bauern noch ein paar Wochen länger die Möglichkeit zur Ernte zu geben. Anscheinend hoffte man in Cleve, das Getreide könne doch noch erntereif werden. Dabei sahen die Felder schon jetzt so aus, als wären etliche Jagdgesellschaften über sie hinweggeritten. Anton Demuth hielt den Erlass der clevischen Regierung für den hilflosen Versuch, noch zu retten, was nicht mehr zu retten war.
Hinter Altendorf fuhr er an einigen Heuböcken vorbei. Das Gras, das in den Sommermonaten gemäht worden war, war nie ganz trocken geworden. Hier am Straßenrand hing es in dünnen braunen Strähnen an den Holzstangen. Es roch modrig.
Auf einem Feld bei Frintrop beobachtete er ein paar Frauen, die mit den Händen angefaulte Kartoffeln aus der schlammigen Erde buddelten, die kaum größer als Kirschen waren.
Beinahe dreieinhalb Stunden waren seit Demuths Aufbruch in Werden vergangen, als das Cabriolet endlich über die Emscherbrücke am neuen Schloss Oberhausen rumpelte. Schon seit mehr als einem Jahrzehnt wurde jetzt an dem Anwesen des Grafen Westerholt-Gysenberg gebaut, dessen schnörkellose, moderne Architektur Anton Demuth gut gefiel. Hier war keine prunkvolle Residenz entstanden, sondern ein elegantes Herrenhaus ohne die prahlerische Pracht barocker Paläste. Während Demuth langsam am fürstlichen Neubau vorbeirollte, sah er vor sich, links neben der Landstraße, die Poststation. Dort würde man ihn erwarten, hatte Hugo von Broich gesagt.
Dass er recht ungeduldig erwartet wurde, wurde ihm klar, noch bevor er vom Kutschbock gestiegen war. Er hatte sein kleines Gespann gerade angehalten, als ein stattlicher Endfünfziger aus dem Posthaus herausgestürmt kam. Eine blaue Uniformjacke spannte sich über seinen Bauch. Sein üppiger grauer Bart wippte, während er die vier Stufen von der Tür des Hauses herabeilte zum Platz vor der Poststation.
»Sind Sie der Kriminalrichter aus Werden?«, rief er Demuth entgegen.
Der nickte.
»Gut, dass Sie endlich hier sind«, stieß der Uniformierte atemlos hervor, als er beim Wagen angekommen war.
Anton Demuth glaubte, einen vorwurfsvollen Unterton gehört zu haben, und entgegnete unwirsch: »Schneller ging es nicht.«
»Pardon. Ich hatte nicht die Absicht, Sie zu tadeln, Herr Kriminalrichter. Im Gegenteil. Ich weiß ja, in welchem Zustand die Straßen sind. Seit Tagen fallen alle Postkutschen aus. Ich kann mir vorstellen, wie mühselig Ihre Fahrt gewesen ist.«
Demuth stieg vom Cabriolet hinunter.
»Ich bin Friedrich Krumpe, der Postmeister«, sagte der Uniformierte.
Von den Stallungen hinter dem Posthaus kam ein junger Mann herbeigelaufen.
»Das ist Johann, unser Pferdeknecht. Wenn es Ihnen recht ist, kümmert er sich um den Rappen und den Wagen«, sagte Krumpe.
Demuth nickte zustimmend und nahm seine Tasche vom Kutschbock.
»Und Sie?«, fragte Krumpe. »Wollen Sie sofort mit Ihren Untersuchungen beginnen, oder möchten Sie zuerst mit ins Haus kommen? Meine Frau hat heute einen Topf Graupensuppe gekocht. Davon könnten wir Ihnen eine Schüssel anbieten.«
»Darauf komme ich später zurück«, erwiderte Demuth. »Ich möchte zuerst die Tote sehen.«
»Ja, gewiss, Herr Kriminalrichter. Wir haben die Anna Hasenleder in ihr Haus gebracht und sie aufs Bett gelegt.«
Anton Demuth war nicht begeistert. Was der Posthalter da sagte, klang so, als sei er einmal mehr auf dem Weg zum Ort eines Verbrechens, an dem wohlmeinende Helfer gedankenlos alle Spuren zertrampelt hatten, die ein Täter dort möglicherweise hinterlassen hatte. Hoffentlich war die Verstorbene nicht schon von ihren Angehörigen auf die übliche Weise zurechtgemacht, gewaschen, gekämmt und mit ihrem Totenhemd bekleidet worden.
»Anna Hasenleder? Das ist der Name der Toten?«
Krumpe nickte.
»Und wo ist sie gefunden worden?«
»Ein paar Minuten flussabwärts. In der Emscher. Ganz in der Nähe ihres Hauses.«
»Wer hat denn die Leiche entdeckt? Wissen Sie das?«, fragte Demuth.
»Ja natürlich. Das war Dina Becker, die Nichte von der Anna. Sie ist Stubenmagd im gräflichen Haushalt. Heute Morgen wollte sie zu ihrer Tante, und weil die nicht in ihrem Kotten war, hat sie sich draußen umgesehen, und da lag die Anna im Wasser. Die Dina ist laut schreiend zurück zum Herrenhaus gelaufen. Wir alle im Posthaus haben sie gehört, auch der Gendarm Schmitting, der gerade bei uns war. Der ist dann rüber zum Schloss, wo die Dina weinend im Hof kauerte. Ein paar Bedienstete und der Herr Graf selbst waren schon bei ihr. Und dann sind alle zusammen mit der Dina zum Fluss, und da haben sie die Anna gefunden und sie aus dem Wasser gezogen.«
»Ein Gendarm war dabei?«, fragte Demuth.
Friedrich Krumpe nickte.
»War der zufällig hier?«
»Nun ja, der Herr Gendarm Schmitting aus Dinslaken, der schaut immer wieder mal vorbei, vor allem wegen der Reisenden, die hier Station machen.«
Die Anwesenheit eines königlich preußischen Gendarmen ließ Demuth hoffen, den Körper der Toten doch noch in dem Zustand vorzufinden, in dem man ihn vor ein paar Stunden aus der Emscher gezogen hatte. Wenn der Herr Gendarm seine Dienstvorschriften kannte, dann wusste er, dass er den aufgefundenen Leichnam bis zum Eintreffen eines Kriminalrichters zu bewachen hatte, ohne selbst irgendwelche Untersuchungen oder Veränderungen an ihm vorzunehmen.
Während der Pferdeknecht Johann mit dem Gespann in den Ställen verschwand, kamen zwei Frauen aus dem Posthaus. Anton Demuth glaubte, die ältere der beiden zu kennen, war sich aber nicht sicher. Wenn er ihr schon einmal begegnet war, dann war das sehr lange her.
»Das ist meine Gattin«, sagte Krumpe. Die Frau blieb neben dem Postmeister stehen, deutete eine leichte Verbeugung an und betrachtete Demuth zugleich mit einem langanhaltenden fragenden Blick. Sie hatte ihr weißes Kopftuch im Nacken gebunden, so dass es wie eine Haube ihr Haar bedeckte. Über ihrem langen blauen Wollkleid trug sie eine Schürze, die ebenso makellos weiß war wie das Kopftuch. Sie war etwa so alt wie ihr Ehemann, aber nicht ganz so üppig.
Demuth zog seinen Hut. »Justizrat Demuth, Untersuchungsrichter am Kriminalgericht in Werden«, stellte er sich vor.
Als sie seinen Namen hörte, lächelte die Frau. Anton Demuth war sich jetzt sicher, dass sie sich irgendwann einmal gekannt hatten.
»Sie sind bestimmt hungrig nach der langen Fahrt«, sagte sie. »Darf ich Ihnen etwas zu essen machen?«
»Der Herr Kriminalrichter will zuerst die Anna sehen«, erwiderte Krumpe.
Das Lächeln verschwand aus dem Gesicht seiner Gattin.
»Jaja, die Anna, welch ein Unglück«, sagte sie und bekreuzigte sich. »Es musste wohl so kommen mit ihr.«
Der Posthalter deutete auf die junge Frau, die ein paar Schritte abseits stehen geblieben war. »Das ist Trudi, unsere Magd. Die wird Sie zum Haus der Toten bringen.«
Trudi machte einen Knicks.
»Meine Tasche brauche ich vorläufig nicht. Würden Sie sie mitnehmen ins Posthaus und darauf achtgeben?«, fragte Demuth den Posthalter.
Während Friedrich Krumpe nach der Reisetasche griff, schaute Demuth zum Himmel.
»Vielleicht sollte ich meinen Regenschirm noch herausnehmen«, sagte er.
»Ich glaube, den brauchen Sie nicht«, sagte Krumpes Frau. »Es hat ja aufgehört zu regnen, und der Weg ist nicht weit. Ein paar Minuten nur.« Er ließ den Schirm in der Tasche.
Der Karrenweg, ein unbefestigter Pfad, gerade so breit, dass ein Fuhrwerk darauf Platz fand, verlief an den Koppeln der Poststation vorbei in Richtung Schloss. Nicht ein Pferd war hier draußen zu sehen, aber mitten auf einer der abgegrasten, schlammigen Wiesen stand ein großes Zelt.
Trudi ging ein paar Schritte voraus. Hin und wieder sprang sie, trotz ihrer Holzschuhe, leichtfüßig von einer Wegseite zur anderen, um Pfützen und Matschlöchern auszuweichen.
»Lagern da auf der Wiese Soldaten?«, fragte Demuth in ihrem Rücken.
»Nein, Herr Untersuchungsrichter. Das Zelt gehört den Puppenspielern. Die sind seit ein paar Tagen hier.«
»Puppenspieler?«, wiederholte Demuth erstaunt.
»Ja, der Mechanikus Tendler, seine Frau und seine Tochter. Die kommen jedes Jahr mit ihren Marionetten hierher.«
»Geben sie auch eine Vorstellung?«
»Ja natürlich, Herr Justizrat, mehrere sogar. Dafür sind sie ja hier. Als erstes Stück bringen sie übermorgen Abend in der großen Gaststube im Posthaus die Geschichte vom Pfalzgraf Siegfried und der heiligen Genoveva zur Aufführung.«
»Ach was«, sagte Anton Demuth.
»Sie wohnen aber jetzt nicht mehr in dem Zelt. Das ging einfach nicht«, erklärte Trudi, »da war alles klatschnass, schon nach der ersten Nacht. Und die Tendlers, die waren so furchtbar durchgefroren, dass der Posthalter ihnen erlaubt hat, hinten in den Pferdeställen zu übernachten. Da ist es wenigstens trocken.«
Nach einer Rechtsbiegung führte der Weg am Nordflügel des Schlosses, an den Wirtschaftsgebäuden und am weitläufigen Schlosspark vorbei. Hinter dem Park schlängelte er sich durch Büsche und Sträucher zur Emscher, deren Windungen er von nun an folgte.
Wenige Minuten nachdem das Mädchen und er am Posthaus aufgebrochen waren, sah Demuth in einiger Entfernung einen unscheinbaren Kotten.
Ohne sich zu ihm umzudrehen, sagte Trudi: »Ich gehe aber nicht mit in das Haus.«
»Ist es das schon?«
»Nein, das ist der Hof von den Kleinrogges.«
Das Fachwerkgebäude machte einen verwahrlosten Eindruck. Von Balken und Fensterläden war die Farbe abgeblättert, aus einigen Gefachen war Lehm herausgebrochen. Niemand war zu sehen außer ein paar Hühnern, die im Matsch umherstolzierten. Aus einem Anbau drang ein Geräusch, das Demuth für das Scharren eines Pferdehufes hielt.
»Der Kotten von der Anna, der ist da«, sagte Trudi.
Demuth schaute dahin, wohin sie mit dem Finger wies, und sah hinter einem Gebüsch ein zweites Haus.
»Warum willst du da nicht hinein?«, fragte er das Mädchen. »Fürchtest du dich vor den Toten?«
»Eigentlich nicht. Aber so eine Hexe, die kann bestimmt auch noch einem Menschen etwas antun, wenn sie tot ist.«
»Was redest du da für einen Unsinn?«, fragte Anton Demuth bestürzt.
Kurz vor dem Haus der Anna Hasenleder blieb die Magd des Posthalters stehen, senkte den Kopf und fragte ängstlich leise: »Kann ich jetzt gehen, Herr Untersuchungsrichter?«
»Ja, von mir aus.« Demuth zuckte mit den Achseln.
»Hexen gibt es nur in Märchen!«, rief er hinter Trudi her. Die hatte ihren Rocksaum hochgerafft, um ihn vor Matschspritzern zu schützen, und lief in ihren Holzschuhen so flink davon, dass Anton Demuth ihr noch eine Weile verwundert nachschaute.
Dann sah er sich um.
Das Fachwerkhäuschen, vor dem er stand, war kleiner als der schmuddelige Kotten, an dem sie vorbeigekommen waren. Außer einem winzigen Sprossenfenster unmittelbar neben der hölzernen Tür hatte die Vorderfront nur ein weiteres Fenster. Dessen Läden waren, ebenso wie die Tür, dunkelgrün gestrichen. Das Gebäude war so niedrig, dass Demuth mit der ausgestreckten Hand beinahe die untere Reihe der Dachschindeln berühren konnte. Er ging an der linken Giebelseite vorbei zu einem Holzverschlag, der ein paar Schritte hinterm Haus auf einer Wiese stand. Darin meckerte eine Ziege.
Die Felder, die jetzt vor Anton Demuth lagen, sahen ähnlich trostlos aus wie die Ländereien, an denen er mit dem Cabriolet vorbeigefahren war. Sumpfige Wiesen, kümmerliches Getreide auf matschigen Äckern und weite Flächen mit bräunlich faulem Kartoffelkraut erstreckten sich vom Hof der Kleinrogges bis zum gegenüberliegenden Waldrand und nach links bis zu einer Feldhecke aus Haseln und Weißdorn. Zwischen den Sträuchern erkannte Demuth einen weiteren Kotten.
Er ging zurück zur Vorderseite von Anna Hasenleders Haus. Von hier aus waren es nicht mal zehn Ruten bis zur Emscher. Ein schmaler Pfad zum Wasser war ins Gras getrampelt worden. Er endete an einem Steg, der vom Ufer aus vier oder fünf Schritte über den Fluss ragte.
Demuth schaute flussaufwärts in die Richtung, aus der er mit Trudi gekommen war. Vom Anwesen des Grafen Westerholt sah er hinter den Baumwipfeln des Schlossparks nur das Glockentürmchen auf dem Gesindehaus.
Der Fluss schlängelte sich in zahllosen Windungen durch flaches Wiesenland, vorbei an dichtem Buschwerk, schlanken Erlen und stattlichen Weiden. In jedem Frühjahr überschwemmte die Emscher die Auen, das hatte Demuth als Kind oft erlebt. Im September jedoch war sie gewöhnlich ein schmales Flüsschen, das quirlig durch sein enges Bett plätscherte. In diesem Jahr war das anders, die Emscher hatte viel zu viel Wasser zum Rhein zu befördern. Auf der gegenüberliegenden Flussseite hatte sie die Wiesen überflutet und sich zu einem uferlosen See ausgedehnt.
Anton Demuth seufzte.
Die Emscherauen galten seit jeher als gutes, fruchtbares Land. Jetzt wurden nicht einmal hier Getreide und Kartoffeln erntereif. Die Wiesen waren versumpft, die Feldfrüchte lagen am Boden und faulten vor sich hin.
Demuth schaute kopfschüttelnd zum diesigen Himmel empor. Ohne Sonne verkümmerte alles Leben. Das wusste er. Aber wo die Sonne in diesem Jahr geblieben war, warum sie in diesem Sommer nicht geschienen hatte und ob sie jemals wieder die Erde erwärmen würde, das alles wusste er nicht.
Die Menschen hatten Angst, vor allem die, die von ihrer Hände Arbeit und vom Ertrag ihrer Äcker lebten. Sie begriffen nicht, was mit ihnen geschah und warum es geschah. Sie fürchteten um ihr Leben.
In seinem Bureau im Inquisitorialgericht und innerhalb der Stadtmauern von Werden war diese Angst bisher nicht zu Anton Demuth vorgedrungen. Auf dem Markt, beim Bäcker und beim Schlachter war zwar alles teurer als je zuvor, aber für ihn, den Herrn Justizrat, war das bisher kein Grund zur Besorgnis gewesen. Er hatte die geforderten Preise bezahlt und das bekommen, was er zum Leben brauchte.
Hier am Ufer der Emscher wurde ihm an diesem Tag jedoch bewusst, dass er auf derselben Erde lebte wie das einfache Volk. Wenn die Sonne nicht mehr wiederkäme, wenn im großen Königreich Preußen nirgendwo mehr eine Feldfrucht heranreifte, wenn man auch in Holland, in Bayern oder in Frankreich nichts Essbares mehr bekäme, weil es einfach nichts mehr gab, dann nützte ihm auch die Besoldung eines königlich preußischen Justizrates nichts mehr, dann würde er eines Tages mit all seinem Geld vergeblich über den Marktplatz in Werden laufen und am Ende genauso verhungern wie die ärmsten Bauern vor den Stadttoren.
Anton Demuth seufzte noch einmal, dieses Mal so laut, dass zwischen den Schilfgräsern, die vor ihm dicht gedrängt im Wasser standen, ein Blässhuhn erschrocken aufflatterte. Der Vogel flog laut kieksend emscherabwärts bis zur nächsten Flussbiegung, wo er im Dickicht von Schilf und Binsen verschwand.
»Sind Sie der Kriminalrichter aus Werden?«
Eine dröhnende Stimme riss Demuth aus seinen Gedanken. Er drehte sich um. Auf der steinernen Stufe vor Anna Hasenleders Haustür stand ein Mann, so schmächtig, dass Demuth sich verblüfft fragte, ob tatsächlich er derjenige war, der ihn gerade mit seinem kraftvollen Sprechorgan aufgeschreckt hatte.
»Justizrat Anton Demuth!«, rief er zum Haus hinüber.
Der Mann auf der Türschwelle war mit einem lindgrünen Uniformrock und einer grauen Hose bekleidet. Er hatte ein Gewehr mit aufgepflanztem Bajonett geschultert und trug auf dem Kopf eine Lederhaube, die ein preußischer Adler zierte.
»Ich bin der Gendarm Schmitting«, stellte er sich vor. Die dröhnende Stimme gehörte tatsächlich ihm.
Als die beiden Männer sich vor dem kleinen Haus begegneten, sah es so aus, als seien sie gleich groß, doch Schmitting stand immer noch auf der Steinstufe und Demuth davor.
»Sie haben bereits den Fundort des Leichnams in Augenschein genommen?«, fragte der Gendarm.
»Nun ja, eher die Lage des Hauses und die Umgebung. Wo Sie die Tote gefunden und aus dem Wasser gezogen haben, das werden Sie mir noch zeigen müssen.«
»Ja, selbstverständlich, Herr Untersuchungsrichter.«
»Aber jetzt möchte ich zuerst die Anna Hasenleder sehen«, sagte Demuth.
»Dann gehe ich mal vor.«
Schmitting zog die Holztür auf und trat ins Haus. Demuth nahm seinen Hut vom Kopf und folgte ihm. Hinter ihm schloss sich leise quietschend die Tür.
Es drang so wenig trübes Tageslicht in den Raum, dass Anton Demuth kaum etwas sah. Er verharrte auf der Stelle, bis seine Augen sich an das Halbdunkel gewöhnt hatten.
Er stand in einer Küche. Vom gestampften Lehmboden stieg feuchte Kälte auf. Auf einer offenen Feuerstelle glommen ein paar Holzscheite. Die Glut, aus der nur hin und wieder ein unruhiges Flämmchen züngelte, konnte die Kälte nicht aus dem Raum vertreiben. Eine Qualmwolke hing unter dem Rauchabzug. Die gekalkten weißen Wände waren rings um die Feuerstelle rußgeschwärzt.
Auf einer Truhe, die mit der gleichen dunkelgrünen Farbe angestrichen war wie die Fensterläden und die Haustür, waren Kräuter zum Trocknen ausgelegt. Darüber hingen ein paar Bretter an der Wand, vollgestellt mit Holzdosen, Töpfen und Tiegeln. Es gab ein altes Küchenbuffet, hinter dessen Glastür sich Teller, Schüsseln und Tassen stapelten. Auf einem dreibeinigen Hocker lag eine schwarze Schürze. Eine schmale Stiege führte hinauf zu einer Luke in der hölzernen Zimmerdecke. In der Mitte der Küche stand ein großer Tisch. Daran saßen auf zwei Stühlen und auf einer Bank ein alter weißhaariger Mann und zwei Frauen, die leise vor sich hin redeten.
Erst nach einer Weile erkannte Demuth, dass die beiden Frauen Rosenkränze in den Händen hielten.
»Nachbarn«, sagte Schmitting, jetzt mit einer kaum hörbaren Flüsterstimme. »Sie haben gefragt, ob sie hier für die Verstorbene beten dürften. Ich hielt es für richtig, ihnen das zu gestatten.«
Demuth nickte und folgte dem Gendarmen zu einer Tür, die weit offen stand. Dahinter lag ein zweiter Raum, die Schlafkammer. Sie war kleiner als die Küche und hatte einen Holzfußboden.
»Hier ist eine Stufe, stolpern Sie nicht«, sagte der Gendarm, als er vor dem Kriminalrichter die Kammer betrat.
Die matte Tageshelligkeit, die durch ein kleines Fenster in das Zimmer fiel, vereinte sich mit dem flackernden Schein zweier Kerzen zu einem beklemmenden Zwielicht.
Der Duft der Kerzen überraschte Anton Demuth. Das, was da abbrannte, war kein billiger Talg, sondern feinstes Bienenwachs, und die Messingständer, die die beiden stattlichen Kerzen trugen, hätten eher nach Werden in die Sankt-Ludgerus-Kirche gepasst als in einen ärmlichen Kotten an der Emscher.
Auch ein Buch hätte Demuth in diesem Häuschen nicht vermutet, und doch lag eines neben der Waschschüssel auf der Kommode am Fenster.
Vor der linken Wand stand ein großer dunkler Schrank, vor der rechten ein Bett, dazwischen ein Stuhl, über dessen Lehne ein gestricktes Wolltuch hing, dem Anschein nach ein Schultertuch. Demuth bemerkte darunter auf dem Holzboden eine kleine Wasserlache.
Zu beiden Seiten des Bettes brannten die Wachskerzen, und auf dem Bett lag die tote Anna Hasenleder.
Der Anblick der Toten verstörte Anton Demuth. Schaudernd wandte er sich ab, legte seinen Hut auf den Stuhl und holte tief Luft. Was war los mit ihm? Er war ein erfahrener Justizbeamter, und er konnte sich nicht daran erinnern, bei der Untersuchung eines Leichnams jemals die Fassung verloren zu haben.
Er fing sich, hoffte, dass der Gendarm Schmitting von seiner kurzen Schwäche nichts mitbekommen hatte, und wandte sich wieder der Toten zu. Er bemühte sich, sie sachlich und unbefangen anzuschauen.
Sie war bekleidet mit einem knöchellangen Rock, dessen Farbe Demuth für ein verwaschenes Blau hielt, und mit einer braunen, hochgeschlossenen Bluse.
Beide Kleidungsstücke waren noch feucht und schmiegten sich eng an den toten Körper. Anna Hasenleder war eine zierliche Person gewesen, ihr Gesicht war fein geschnitten, ihr langes schwarzes Haar war von grauen Strähnen durchzogen. Nicht ganz fünfzig Jahre mochte sie alt gewesen sein.
Anton Demuth sah sie, am Fußende des Bettes stehend, lange unverwandt an, dann wusste er plötzlich, was ihn so sehr erschüttert hatte. Es war die schauerliche Empfindung, dass noch nicht alles Leben aus dem Körper der Toten gewichen war. Sie lag da, als habe der Gevatter Tod sie noch nicht mit hinübergenommen, so als könne sie jederzeit ihre Augen wieder öffnen und aufstehen.
Trudi, die Magd des Posthalters, hatte Anna Hasenleder eine Hexe genannt. Was steckte dahinter? War das wirklich nur das unsinnige Hirngespinst eines ängstlichen, dummen Mädchens?
Ganz gewiss war es das, etwas anderes konnte es nicht sein. Anton Demuth schüttelte, ärgerlich über seine törichten Gedanken, den Kopf.
»Ist irgendwas nicht in Ordnung?«, fragte Schmitting.
»Welche Maßnahmen haben Sie getroffen, um sicherzustellen, dass die Frau tatsächlich tot ist?«, fragte Demuth zurück.
»Die üblichen«, antwortete Schmitting. »Ich habe ihren Puls gefühlt und ihre Körperwärme. Da war nichts mehr. Es war augenscheinlich, dass ihr Blut nicht mehr zirkulierte, sie war totenbleich und eiskalt. Und überdies atmete sie nicht mehr.«
»Wie haben Sie das festgestellt?«
»Als wir sie hier aufs Bett gelegt hatten, habe ich ihr einen brennenden Kerzenstummel vor Mund und Nase gehalten. Die Flamme hat sich nicht im Geringsten bewegt.«
»Nach einem Arzt haben Sie nicht geschickt?«
»Nein, Herr Kriminalrat. Dass der Frau nicht mehr zu helfen war, das war zu offensichtlich.«
»Na gut, Schmitting, aber Sie wissen vermutlich, dass Ihre Untersuchungen nicht ausreichend sind, um ganz sicherzugehen, dass wir es hier nicht mit einem Fall von Scheintod zu tun haben.«
»Ich weiß, dass es bei einem bis dato gesunden Menschen, der durch Erstickung oder Ertrinken zu Tode gekommen ist, ganz besonderer Sorgfalt bedarf, um eine todesähnliche Ohnmacht auszuschließen. Aber mit Verlaub, Herr Untersuchungsrichter, ich habe schon viele Tote in meinem Leben gesehen. Dass diese Frau nicht mehr lebt, das kann man nicht ernsthaft in Frage stellen.«
»Nein, das wäre töricht«, sagte Demuth leise, mehr zu sich selbst als zum Gendarmen, und dann versuchte er noch einmal, sich zu sammeln, die Frau auf dem Bett in aller Ruhe zu betrachten und sich jedes Detail des gespenstischen Bildes einzuprägen.
Er sah, dass die Nässe aus den Kleidern in das weiße Laken gezogen war, stellte fest, dass Anna Hasenleders Füße in dicken Wollsocken steckten, wie sie das Bauernvolk der Gegend gewöhnlich in Holzschuhen trug, und er bemerkte, dass die Hände der Toten nicht gefaltet, sondern bloß übereinandergelegt waren.
Der Gendarm schloss die Tür zur Küche, dann sagte er, bemüht, seine kräftige Stimme ein wenig zu dämpfen: »Genau so, Herr Kriminalrat, haben wir die Verblichene gefunden. Bekleidet mit blauem Rock und brauner Bluse, das Haar offen, so lag sie auf dem Rücken im Wasser. Der Körper hatte sich emscherabwärts, in der nächsten Flussbiegung, nahe am Ufer, zwischen Schilfgräsern und Binsen verfangen.«
»Trug sie nicht auch noch ein Schultertuch?«, fragte Demuth.
Schmitting sah ihn verblüfft an. »Woher wissen Sie das denn, Herr Kriminalrichter?«
Demuth wies auf das Tuch, das über der Stuhllehne hing.
»Ich weiß es nicht, aber ich vermute es wegen der Wasserlache unterm Stuhl.«
»Sie haben recht. Das Tuch hing auch zwischen den Gräsern, nur einen Schritt von der Toten entfernt. Es hat ihr gehört, das hat ihre Nichte Dina Becker bereits bestätigt. Es ist also davon auszugehen, dass Anna Hasenleder das Tuch umgelegt hatte, als sie einen Schlag auf den Kopf bekam und ins Wasser stürzte.«
»Der Herr Gendarm hat also schon selbstständig Befragungen durchgeführt und Mutmaßungen darüber angestellt, wie die Verblichene zu Tode gekommen ist?«, fragte Demuth so streng, wie er konnte. Dabei zog er seine buschigen Augenbrauen hoch und streckte sich ein wenig.
Schmitting schaute völlig unbeeindruckt zu ihm auf. Ohne das Bemühen, seine kräftige Stimme zu dämpfen, erklärte er: »Dina Becker tat von sich aus kund, dass das Schultertuch ihrer Tante gehört hatte. Dazu bedurfte es keiner Befragung. Über die Umstände, die zum Tode der Frau Hasenleder geführt haben könnten, habe ich mir in der Tat Gedanken gemacht. Dass ein königlich preußischer Gendarm, der beim Auffinden eines Leichnams zugegen ist, darüber nachdenkt, was geschehen sein könnte, widerspricht meines Wissens nicht den Bestimmungen der Kriminalordnung. Wenn Sie es allerdings wünschen, Herr Kriminalrat, dann werde ich meine Erkenntnisse selbstverständlich für mich behalten.«
Anton Demuth hatte einen Fehler gemacht. Der Versuch, diesem schmächtigen Gendarmen aus Dinslaken klarzumachen, wer jetzt hier das Sagen hatte, war eine dumme Idee gewesen. Schmitting wusste offenbar sehr genau, was er zu tun und zu lassen hatte.
»Ich wollte Sie nicht rügen, Herr Gendarm. Dazu sehe ich wirklich keine Veranlassung. Soweit ich das beurteilen kann, haben Sie hier geradezu vorbildlich Ihre Aufgaben wahrgenommen«, sagte Demuth, um einen versöhnlichen Ton bemüht.
Schmitting ließ sich vom Lob des Justizrates nicht besänftigen. Er schaute mürrisch vor sich hin und schwieg.
»Anscheinend haben Sie gleich nach dem Auffinden des Leichnams dafür gesorgt, dass ein Bediensteter des Grafen Westerholt nach Werden zum Kriminalgericht geritten ist. Allein das ist schon äußerst anerkennenswert«, sagte Demuth schmeichelnd. »Oder war das die Idee des Herrn Grafen?«
»Ich habe ihn unter Verweis auf den Paragraphen 149 der allgemeinen Kriminalordnung darum gebeten«, erwiderte Schmitting.
»Soso«, sagte Demuth und kramte in seinem Gedächtnis.
»So oft der Körper eines Menschen gefunden wird, dessen Tod nicht unter den Augen seiner Hausgenossen oder anderer unbescholtener Personen auf natürliche Weise erfolgte, ist das zuständige Kriminalgericht umgehend zu benachrichtigen. Bis zur Ankunft eines Kriminalrichters obliegt die Bewachung des aufgefundenen Leichnams sowie die Fürsorge für denselben der örtlichen Polizeibehörde oder der Gendarmerie.«
Ohne zu stocken, trug Schmitting den Passus aus dem preußischen Kriminalrecht vor. Das tat er mit einer so enormen Lautstärke, dass Anna Hasenleder ohne Frage hochgeschreckt wäre, wenn auch nur noch der kleinste Rest von Leben in ihr gesteckt hätte. Anton Demuth stellte beruhigt fest, dass sie nach wie vor reglos auf ihrem Bett lag.
»Es war also eine Selbstverständlichkeit, Sie schleunigst in Kenntnis zu setzen«, fügte der Gendarm seinem Vortrag hinzu.
»Leider ist ein so korrektes Vorgehen keineswegs selbstverständlich«, erklärte Demuth. »Wenn ein toter Mensch gefunden wird, der unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist, dann laufen die Leute gemeinhin erst mal zum nächsten Polizeisergeanten. Der schaut sich den Leichnam an und informiert seinen Bürgermeister, vielleicht auch direkt den Landrat. Der Nächste, der am Ort des Geschehens auftaucht, ist gewöhnlich ein vom Landrat entsandter Gendarm. Wenn der zu der Auffassung kommt, dass ein Verbrechen geschehen sein könnte, lässt er höchstwahrscheinlich das Landgericht benachrichtigen, in dessen Bezirk sich der Vorfall ereignet hat. Und wenn auch noch der herbeigeeilte Landrichter einen unnatürlichen Tod vermutet, dann wird die Angelegenheit endlich dem zuständigen Inquisitorialgericht angezeigt. So sieht das aus, Schmitting. Dass wir nach einem Tötungsdelikt erst am nächsten oder übernächsten Tag hinzugerufen werden, ist leider nicht die Ausnahme, sondern die Regel.«
»Das ist allerdings erstaunlich, Herr Kriminalrat. Die diesbezüglichen Bestimmungen sind doch eindeutig.«
»Das mögen sie wohl sein, Herr Gendarm, nur kennt sie längst noch nicht jeder. Vergessen Sie nicht, dass wir erst seit anderthalb Jahren wieder Preußen sind. Vorher war das hier der Kanton Dinslaken, und die Verwaltung und die Justiz waren französisch.«
»Da haben Sie natürlich recht, Herr Kriminalrichter«, sagte der Gendarm nachdenklich.
»Ich selbst bin erst seit einem Jahr in dieser Gegend«, fuhr er nach einer Weile fort, »bin aus dem Brandenburgischen in den Kreis Dinslaken versetzt worden, als es den genau genommen noch gar nicht gab. Die Kreisverwaltung hat ja offiziell erst im April ihre Arbeit aufgenommen.«
»So ist es, Schmitting. Vieles ist hier noch im Aufbau und im Umbruch. Das Inquisitorialgericht beziehungsweise Kriminalgericht gibt es ja auch erst seit dem vorigen Jahr, und sogar viele Beamte haben immer noch nicht begriffen, dass es seitdem die einzig zuständige Instanz für die Untersuchung von Kriminalfällen ist. Deshalb bleibe ich dabei, Herr Gendarm, dass Ihr korrektes und umsichtiges Vorgehen überaus lobenswert ist und keinesfalls selbstverständlich.«
Schmitting schaute nicht mehr allzu mürrisch drein. Er nahm sein Gewehr von der Schulter und lehnte es gegen eine Zimmerwand.
»Sind Sie davon in Kenntnis gesetzt worden, dass der Leichnam eine Schädelverletzung aufweist?«, fragte er.
»Der Bote, den der Graf von Westerholt nach Werden geschickt hat, hat sie erwähnt.«
»Ich nehme an, dass Sie die in Augenschein nehmen wollen.«
Demuth nickte.
»Wenn Sie hierher an das Kopfende des Bettes kommen, können wir die Tote gemeinsam auf die Seite drehen, und Sie können sich die Wunde genau ansehen.«
»Ja, das ist gut«, sagte Demuth, griff in die Innentasche seines Mantels, zog ein Lederetui hervor und entnahm ihm einen Zwicker. »Ich sehe eigentlich recht gut«, erklärte er dem Gendarmen, während er die Augengläser auf seine Nase klemmte, »aber wenn ich lese oder mir irgendwas ganz aus der Nähe anschaue, dann ist das Ding doch sehr hilfreich. Es macht alles ein bisschen schärfer und größer.«
Er stellte sich neben Schmitting. Beide beugten sich über die Tote.
Der Gendarm schob eine Hand unter ihre Hüfte, der Kriminalrichter griff unter ihre Schulter. Anna Hasenleders leichter Körper ließ sich mühelos zur Seite drehen. Demuth stellte fest, dass er beinahe so steif wie ein Holzbrett war.
Die Verletzung auf dem Hinterkopf entdeckte er sofort, aber erst als er einige Haarsträhnen beiseitegeschoben hatte, sah er, wie groß und tief die Wunde war.
»Für mich sieht das so aus, als habe da jemand mit großer Wucht zugeschlagen«, sagte Schmitting.
Demuth nickte. »Die Folge eines Sturzes ist das jedenfalls nicht.«
»Als ich die Verletzung sah, kam mir sofort ein Holzknüppel in den Sinn, einer von den vielen abgebrochenen Ästen, die hier überall unter den Bäumen herumliegen«, sagte der Gendarm.
»Ja, das könnte gut sein.«
Die beiden Männer ließen die Tote wieder auf den Rücken gleiten. Demuth nahm seinen Zwicker von der Nase und ließ ihn im Inneren seines Mantels verschwinden.
»Haben Sie die Absicht, eine Leichenschau zu veranlassen?«, fragte Schmitting.
»Das muss ich in diesem Fall«, entgegnete Demuth.
»Jaja, ich weiß. Paragraph 157 der Kriminalordnung. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, was dabei herauskommt. Die Frau hat an der Emscher einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen, ist besinnungslos ins Wasser gestürzt und ertrunken.«
»Es könnte auch sein, dass sie hier im Haus oder irgendwo anders erschlagen wurde und dass sie in den Fluss geworfen worden ist, als sie schon tot war.«
»Glauben Sie wirklich, das ließe sich noch klären? Ich weiß nicht, Herr Kriminalrichter. Dass ein Arzt bei einer Leichenschau herausfinden kann, ob es so oder so war, das kann ich mir nicht vorstellen.«
»Dem Mann, der Anna Hasenleder sezieren soll, dem traue ich das zu. Professor Günther von der Universität Duisburg ist ein ganz außergewöhnlicher Anatom, und er ist bereits informiert.«
»Ach, der Vater Günther?«
Anton Demuth, der inzwischen wieder am Fußende des Bettes stand, sah den Gendarmen fragend an.
»So nennen die Leute in Duisburg den Professor«, erklärte der. »Er kümmert sich um seine Kranken genauso fürsorglich wie um seine Studenten, sagt man. Und von denen, die seine Hilfe brauchen und ihn nicht bezahlen können, verlangt er nicht einmal Geld.«
»Ach was«, sagte Demuth. »Sie kennen den Professor Günther?«
»Ich weiß, was man in der Stadt redet«, entgegnete Schmitting. »Schließlich gehört Duisburg zum Kreis Dinslaken. Persönlich kenne ich den Herrn Professor leider nicht. Meinen Sie, dass er hierherkommt, um die Tote zu obduzieren?«
»Nein, das glaube ich nicht. Günther wird jemanden schicken, um sie abzuholen. Wo sollte er hier eine Obduktion durchführen? Er wird es mit Sicherheit vorziehen, den Leichnam in Duisburg vor seinen Studenten zu sezieren.«
»Schade.«
Schmitting griff nach seinem Gewehr, hängte es sich über die Schulter, schaute Anna Hasenleder an und sagte nach einer Weile viel zu laut: »Sie werden sehen, Herr Kriminalrichter. Auch wenn der berühmte Professor Günther die Sektion vornimmt, es wird nichts anderes dabei herauskommen als das, was ich Ihnen schon gesagt habe: Sie hat eins über den Schädel bekommen, ist ohnmächtig in die Emscher gestürzt und ertrunken.«
»Warten wir es ab.« Demuth ging zur Kommode hinüber und schlug das Buch auf, das neben der Waschschüssel lag. Es war Löwes ›Handbuch der theoretischen und praktischen Kräuterkunde‹. Während er durch das Nachschlagewerk blätterte, stellte er fest: »Die Frau hat sich ganz offensichtlich sehr eingehend mit der Heilwirkung von Pflanzen beschäftigt.«
»Ja, damit kannte sie sich bestens aus«, bestätigte der Gendarm. »Sie hat Heilmittel gegen allerlei Erkrankungen zubereitet. Die hat sie auf den umliegenden Märkten verkauft, und gelegentlich hat sie auch den Reisenden am Posthaus ihre Kräuter angeboten.«
»Wie gut kannten Sie Anna Hasenleder?« Demuth legte das Buch zurück und sah Schmitting fragend an.
»So gut wie die anderen Menschen auch, die am Emscherufer hinterm gräflichen Schloss leben. Ich schaue jede Woche in der Poststation nach dem Rechten, und hin und wieder gehe ich dann auch hier vorbei und spreche ein paar Worte mit den Leuten. Die Frau Hasenleder hab ich öfter bei ihrem kleinen Kotten gesehen, oder ich bin ihr begegnet, wenn sie unterwegs war, um Pflanzen zu suchen. Manchmal saß sie auch mit ihrem Kräuterkorb auf der Bank neben dem Posthaus. Sie hat immer freundlich gegrüßt, und ab und zu haben wir auch ein paar Worte über das Wetter und die schlechten Zeiten gewechselt.«
»Ich verstehe.«
»Was halten Sie denn davon, wenn wir uns jetzt mal draußen umsehen, Herr Justizrat? Ich könnte Ihnen zeigen, wo wir die Tote gefunden haben, und Ihnen dabei berichten, was ich bisher in Erfahrung gebracht habe.«
Demuth nickte zustimmend. Gern war er bereit, das zwielichtige Totenzimmer zu verlassen und anstatt des süßlichen Duftes der Bienenwachskerzen wieder frische Luft einzuatmen.
»Was machen wir mit den Nachbarn? Lassen wir die allein hier im Haus?«, fragte Schmitting.
»Das werden wir müssen«, sagte Demuth, während er seinen Hut vom Stuhl nahm. »Hier in der Gegend lassen die Menschen ihre Verstorbenen bis zum Begräbnis nicht allein. Sie halten Totenwache. Nachbarn, Familie, Freunde. Ein paar Leute werden vermutlich stets hier im Haus sein, bis der Leichnam zur Obduktion abgeholt wird.«
Sie verließen die Schlafkammer. Die Tür ließen sie weit offen stehen. Im Nebenraum saßen die Frauen und der alte Mann immer noch am Tisch, scheinbar unbeweglich, die Köpfe geneigt und leise murmelnd. Sie schauten nicht auf, als Demuth und Schmitting durch die Küche nach draußen gingen.
Vor dem Haus übernahm der Gendarm die Führung. Er ging über den Trampelpfad hinunter zum Steg.
»Hier hat die Hasenleder jeden Morgen in einem Blecheimer Wasser aus dem Fluss geholt. Dafür ist der Steg gebaut worden, vor Jahren schon. Zwischen sieben und halb acht hat sie das immer getan, sagt ihre Nichte, die Dina Becker. Die Eltern von der Dina sind gestorben, als sie noch ein Kind war. Da hat Anna Hasenleder, eine Schwester ihrer Mutter, das Mädchen zu sich genommen. Die Dina ist hier in dem Häuschen aufgewachsen. Jetzt ist sie Stubenmädchen im Schloss. Da hat sie ein eigenes Zimmer im Gesindehaus, aber manchmal übernachtet sie auch noch hier in der Kammer über der Küche. Sie hat anscheinend sehr an ihrer Tante gehangen. Die Leute sagen, dass kein Tag verging, an dem Dina nicht wenigstens mal kurz nach ihr geschaut hat. Oft ist sie morgens, wenn sie im Herrenhaus die Betten gemacht hatte, so gegen neun Uhr war das in der Regel, hierher zur Anna gelaufen, um mit ihr einen Kräutertee zu trinken und ein bisschen zu plaudern. Das wollte sie auch heute Morgen. Als sie die Tante nicht wie üblich in der Küche antraf, hat sie erst in der Schlafkammer nachgesehen, dann hat sie beim Ziegenstall hinterm Haus nach ihr gesucht und schließlich hier unten am Ufer. Sie ist auf den Steg gegangen und hat sich umgeschaut, und dabei hat sie dahinten in der nächsten Flussbiegung zwischen den Gräsern etwas gesehen, das sie für das Schultertuch ihrer Tante hielt. Also ist sie dorthin gelaufen und hat Anna Hasenleder zwischen den Binsen im Wasser liegen gesehen. Daraufhin ist sie kopflos und laut schreiend davongerannt. Im Schlosshof ist sie dann zusammengebrochen. Da haben der Herr Graf, ein paar Bedienstete und ich sie gefunden. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir aus ihr herausbekommen hatten, was passiert war, und bis sie in der Lage war, uns hierherzuführen.«
Während Schmitting redete, hatte Demuth einen langen, verzweigten Ast in der Uferböschung entdeckt und ihn aufgehoben. Er ließ ihn vom Steg ins Wasser gleiten. Die Strömung der Emscher erfasste ihn sofort und trieb ihn flussabwärts. Nur Sekunden später blieb er zwischen den Binsengräsern in der nächsten Flussbiegung hängen.
»Da ungefähr haben Sie die Tote gefunden?«, fragte Demuth.
»Ja, genau da«, antwortete Schmitting.
»Ein Beweis dafür, dass Anna Hasenleder hier ins Wasser gestürzt ist, ist das natürlich nicht«, sagte Demuth. »Aber es ist eine Möglichkeit.«
»Ich denke, es ist mehr als das, Herr Kriminalrichter. Wir können davon ausgehen, dass die Frau heute früh gegen halb acht hier Wasser schöpfen wollte, denn das hat sie jeden Morgen um diese Zeit getan. Rund anderthalb Stunden später ist sie von ihrer Nichte zwischen den Ufergräsern gefunden worden, mit einer klaffenden Kopfwunde und tot. Liegt es da nicht auf der Hand, dass sie heute Morgen genau hier beim Wasserholen überfallen worden ist?«
»Doch, das liegt auf der Hand«, sagte Demuth. »Aber wer sich bei einer Kriminaluntersuchung zu früh darauf festlegt, wie die Tat sich abgespielt hat, der läuft Gefahr, Dinge zu übersehen. Der nimmt eventuell Details, die für den Fall wichtig sein könnten, nicht zur Kenntnis, weil sie für die eigene Theorie belanglos sind.«
»Das verstehe ich.«
»Haben Sie eigentlich den Wassereimer schon irgendwo entdeckt?«
»Nein, Herr Justizrat.«
»Wenn die Anna Hasenleder beim Wasserholen niedergeschlagen worden ist, dann liegt er vielleicht irgendwo hier auf dem Grund des Flusses.«
»Ja, das könnte sein. Wenn ihr der volle Eimer aus der Hand ins Wasser geglitten ist, dann ist er zweifellos sofort gesunken.«
»Was meinen Sie, wie tief die Emscher hier ist?«
»Schwer zu sagen, bei dem Hochwasser.«
»Vielleicht könnte man vom Steg aus mit einer langen Holzstange den Grund absuchen.«
»Es wäre einen Versuch wert. Ich könnte den Gärtner im Schloss fragen, ob er ein paar Bohnenstangen hat.«
»Das ist eine ausgezeichnete Idee, Schmitting.«
Die beiden Männer gingen am Ufer entlang bis zur Flussbiegung. Dort zeigte der Gendarm dem Kriminalrichter die Stelle, an der die Tote im Wasser gelegen hatte.
»Uns war allen schnell klar, dass der Frau nicht mehr zu helfen war. Der Herr Graf hat die Dina Becker in den Arm genommen und sie getröstet. Er und eine Küchenmagd haben das Mädchen dann mitgenommen zum Schloss. Ich habe zusammen mit einem Knecht die Tote aus dem Wasser gezogen und sie ins Haus getragen.«
»Maximilian von Westerholt hat Dina Becker umarmt? Seine Dienstmagd?«
»Ich glaube, es hat ihn sehr bewegt, dass die Dina so gelitten hat. Der Herr Graf hat ja selbst erst vor kurzem einen geliebten Menschen verloren.«
»Seine Frau, nicht wahr? Ich habe davon gehört.«
»Ja, Herr Kriminalrichter. Eine traurige Geschichte. Die Gräfin Friederike ist im März hier im Schloss verstorben. Bei der Geburt eines Kindes. Mit vierundvierzig Jahren. Das hat den Grafen sehr erschüttert. Man erzählt, dass er nach Friederikes Tod vollkommen verzweifelt war. Da hatten die beiden jahrelang alles darangesetzt, dass die Familie hier auf einem schönen Landsitz leben kann, und jetzt, da bis auf ein paar Nebenräume und den Schlosspark fast alles fertig und ganz wunderbar geworden ist, ist plötzlich die Gräfin nicht mehr da. Ein bitterer Schicksalsschlag. Aber Maximilian von Westerholt ist ein gestandener Mann, der schon viel erlebt hat. Er hat es wohl inzwischen, nach einem halben Jahr, geschafft, seinen Schmerz zu überwinden und sich wieder dem Leben zuzuwenden. Jedenfalls sagen das die Leute, die ihn kennen. Ich habe ihn heute zum ersten Mal seit Monaten wieder gesehen. Wie ein gramgebeugter Mann hat er nicht auf mich gewirkt.«
Während Schmitting erzählte, war Demuth so nah an den Rand des Flusses getreten, dass seine Stiefel nass wurden. Er beugte sich vor, schob mit den Händen Binsen und Schilf auseinander, ging ein paar Schritte, hockte sich hin, ging noch ein paar Schritte und ließ unterdessen die Wasseroberfläche zwischen den Gräsern nicht aus den Augen.
»Wonach suchen Sie?«, fragte Schmitting.
»Nach dem hier.« Demuth hielt einen Holzschuh hoch. »Und ich denke, den zweiten finden wir auch hier irgendwo.«
»Ja, ich sehe ihn, gleich hinter Ihnen, Herr Kriminalrichter«, sagte der Gendarm.
Während die beiden Männer auf das Posthaus zugingen, betrachtete Demuth erstaunt dessen Ausmaße. Bei seiner Ankunft hatte es in der Nachbarschaft der eindrucksvollen Schlossanlage eher unscheinbar auf ihn gewirkt. Jetzt, da er sich dem Haus zu Fuß von der Emscher her näherte, bemerkte er, dass es ein durchaus stattliches zweigeschossiges Gebäude mit einer schmucken Fachwerkfassade und einem mächtigen schiefergedeckten Walmdach war. Im Stall, in der Remise und in der Scheune war Platz für Pferde und Kutschen, für Stroh und Heu, für Kohle und Ofenholz, für Mehlsäcke und Bierfässer und für manches andere, was den Reisenden den Aufenthalt in der Poststation angenehm machte.
Die Gaststube war dagegen überraschend klein, nicht viel größer als der Salon in Demuths Wohnung am Werdener Marktplatz. Sieben Tische waren im Raum verteilt. Ein Kerzenleuchter, so groß wie ein Wagenrad, hing von einem Deckenbalken herab. Die Bänke entlang der holzgetäfelten Wände waren so breit, dass erschöpfte Reisende darauf liegen konnten. Ein mächtiger Kachelofen versprach Wärme, auch wenn heute kein Feuer darin brannte.
Durch eine offen stehende Tür hinterm Schanktisch sah Demuth die Frau des Postmeisters am Küchenherd stehen. Die Magd Trudi räumte Gläser in ein Regal. Auf dem Schanktisch standen ein halbes Dutzend Flaschen und ein Bierfass. Hinter einer breiten, zweiflügligen Tür, die an diesem Nachmittag geschlossen war, vermutete Demuth den von Trudi erwähnten großen Gastraum, in dem übermorgen das Marionettenspiel aufgeführt werden sollte.
An einem der sieben Tische saß ein junger Mann, der in einem Buch las. In der Ecke neben dem Kachelofen trank ein vornehm aussehender Herr eine Tasse Kaffee und rauchte Tabak aus einer langstieligen Tonpfeife. Er schaute neugierig zu Schmitting und Demuth herüber, als die beiden an einem Tisch neben der Küchentür Platz nahmen.
Auf dem Weg zum Posthaus hatte Demuth den Gendarmen dazu eingeladen, mit ihm zu speisen. Schmitting hatte sich zunächst geziert. Dass er wohl gern noch etwas essen und trinken würde, bevor er sich wieder auf den Weg nach Dinslaken mache, hatte er gesagt, dass es aber keinen Grund dafür gäbe, dass der Herr Kriminalrichter die Zeche bezahle.
Demuth hatte erwidert, er werde die Rechnung für das Essen dem Direktor des Inquisitorialgerichtes vorlegen und sie zweifelsohne erstattet bekommen. Da der Herr Gendarm seit dem frühen Morgen dem Gericht zugearbeitet habe, sei es nur recht und billig, mit den Ausgaben für seine Beköstigung die Gerichtskasse in Werden zu belasten.
Er habe als Gendarm für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Kreise Dinslaken zu sorgen, hatte Schmitting entgegnet, und genau das habe er auch in den letzten Stunden getan. Für diesen Dienst werde er vom Königreich Preußen anständig besoldet, und eine extraordinäre Gratifikation sei ganz und gar nicht erforderlich. Wenn allerdings ein hochrangiger Staatsdiener wie der Herr Kriminalrichter das anders sehe, werde er selbstverständlich nicht auf seiner Meinung beharren, sondern die Einladung annehmen.
Demuth hatte ihn von der Seite angesehen und erwartet, ein fröhliches Grinsen oder ein verschmitztes Lächeln zu entdecken, hatte aber im sorgfältig rasierten Gesicht des Gendarmen keinerlei Anzeichen dafür gefunden, dass der irgendwas gesagt haben könnte, was er nicht todernst gemeint hatte.
Als sie sich in der Gaststube gegenübersaßen, bestellte Demuth bei der Frau des Postmeisters zwei Portionen Graupensuppe mit Roggenbrot und fragte den Gendarmen, ob er Familie habe.
»Nein«, sagte Schmitting.
Anton Demuth entnahm dieser sehr kurzen Antwort nicht nur, dass sein Gegenüber weder Gemahlin noch Kinder hatte, er schloss daraus auch, dass Schmitting nicht die geringste Neigung verspürte, mit einem Kriminalrat des Werdener Inquisitorialgerichtes über private Angelegenheiten zu sprechen. Also wechselte er das Thema und erkundigte sich danach, was den Herrn Gendarm dazu veranlasse, Woche für Woche einen Fußweg von beinahe zwei Meilen auf sich zu nehmen, um die Poststation am Schloss Oberhausen aufzusuchen.
Schmitting wurde umgehend wieder gesprächig. Ja, in der Tat, es sei ein weiter Weg, den er da jedes Mal zurückzulegen habe, etwa zweieinhalb Stunden laufe er bis zum Posthaus, und ebenso lange brauche er für den Rückweg nach Dinslaken. Aber das seien ja nicht etwa Spaziergänge, sondern überall dort, wo er vorbeikomme, schaue er natürlich nach dem Rechten, zum Beispiel im Kirchdorf Sterkrade, wo er ein ganz besonderes Augenmerk auf die wachsende Arbeiterschaft der Eisenhütte Gute Hoffnung habe. Noch in der vorigen Woche habe er einen ihm unbekannten jungen Mann bei den Erzgräbern angetroffen, der sich nicht ausweisen konnte. Ihm sei sofort aufgefallen, dass dieser Fremde einer steckbrieflich gesuchten Person sehr ähnlichsah, nämlich einem gewissen Johannes Bongars, gebürtig aus Rees, dreiundzwanzig Jahre alt, schwarzes Haar, flache Stirn, spitzes Kinn, fünf Fuß, sechs Zoll und drei Strich groß. Und tatsächlich, der Kerl sei genau dieser Bongars gewesen, ein Deserteur, der vom sechsundzwanzigsten königlichen Infanterieregiment in Magdeburg geflüchtet war.
Einige Wochen zuvor, als er einmal an der Emscher entlang durch die Bauernschaft Buschhausen, durch Byfang und Holten zurück nach Dinslaken gegangen sei, habe er in einer Feldscheune hinter Buschhausen einen verlotterten Menschen angetroffen, der sich bei genauer Überprüfung als ein Mann entpuppt habe, der bereits Monate zuvor des Vagabundierens und Bettelns überführt und aus dem Königreich Preußen ausgewiesen worden war.
Trudi brachte Suppe und Brot an den Tisch. Auch danach hörte Schmitting nicht auf zu erzählen. Immer wieder legte er seinen Löffel zur Seite und erörterte dem Kriminalrichter, wie vielfältig seine alltäglichen Bemühungen um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung waren. Dabei sprach er so laut, dass auch der lesende junge Mann, der Kaffee trinkende Herr und die Magd Trudi, die hinterm Schanktisch stand, einiges über die Dienstauffassung eines königlich preußischen Gendarmen erfuhren.
Während Anton Demuth die Graupensuppe vorzüglich schmeckte, hörte er den Einlassungen Schmittings mit Interesse, aber auch mit einem leisen Unbehagen zu. Der Herr Gendarm sah die öffentliche Ordnung nämlich immer dann bedroht, wenn irgendwo im Kreis Dinslaken fremde Menschen auf der Bildfläche erschienen. »Bleibe im Lande und nähre dich redlich« war für ihn nicht nur ein schöner Satz aus der Bibel, sondern ein göttliches Gebot, und ein Mensch, der sich daran nicht hielt, war ihm grundsätzlich verdächtig. Wer sich fern von Heim und Herd irgendwo herumtrieb, der führte selten etwas Gutes im Schilde.
Eine Poststation war ein Ort, an dem tagtäglich unbekannte Reisende auftauchten, ein Ort also, an dem permanent Ungemach drohte. Der Gendarm hielt es deshalb für dringend notwendig, mindestens einmal pro Woche das Posthaus am Schloss Oberhausen zu visitieren, die Fremden, die er antraf, zu kontrollieren und zu überprüfen, ob der Postmeister Krumpe seiner Verpflichtung nachkam, für jeden seiner Gäste einen Fremden-Meldezettel im Bürgermeisteramt in Holten einzureichen.
»Der gute Friedrich Krumpe scheint hin und wieder zu vergessen, dass er nicht nur ein königlicher Posthalter ist, sondern dass er zugleich auch ein Gasthaus betreibt und dass er sich, wie jeder Gastwirt in Preußen, an die Verfügung des hohen Polizeiministeriums zu halten hat, fremde Übernachtungsgäste den Behörden zu melden«, sagte Schmitting.