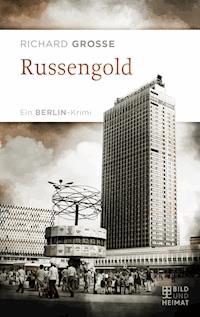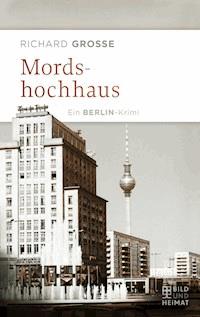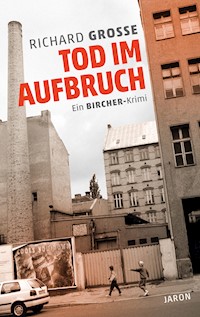
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bircher-Krimi
- Sprache: Deutsch
»Aber wir haben doch noch keine Ahnung, ob wir mit dem Duschgel punkten werden«, sagte Schulz leise. Wagner lächelte nachsichtig. »Stell dir vor, du müsstest einen Fünfjahresplan schreiben. Hast du damals gewusst, was im zweiten oder dritten Jahr wirklich abgesetzt wird? Nee, natürlich nicht, deshalb ist’s ja auch ein Plan. Der muss nur plausibel sein und gute Stimmung erzeugen. Die bei der Treuhand müssen davon überzeugt werden, dass wir mit unserem Super S im Osten punkten. Punkt, aus.« Berlin-Mitte, Anfang der 90er-Jahre. Aus der »Berliner Duft« ist die »Berlin Beauty« geworden, und ein »Berater« aus Bayern zeigt den »Ossis«, wie man in diesen Umbruchzeiten das große Rad dreht. Bis ein Toter den innerbetrieblichen Frieden stört. Karl Bircher, bis vor Kurzem Major, nun Kriminalhauptkommissar, nimmt die Ermittlungen auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Richard Grosse
Tod im Aufbruch
Kommissar Birchers vierter Fall Kriminalroman
Jaron Verlag
RICHARD GROSSE, geboren 1944 in London, ist von Beruf Diplomchemiker, promovierte und habilitierte im Fach Biochemie und wurde 1983 zum Professor für Biochemie an der Akademie der Wissenschaften der DDR berufen. 1994 verließ er die zellbiologische Forschung und gründete in Berlin ein humangenetisches Diagnostikl abor, die IMMD GmbH. 2018 beendete er seine berufliche Tätigkeit.
Er veröffentlichte mit Karl Bircher als Berliner Ermittler die Romane Mordshochhaus (2015), Russengold (2017) und Schrittfehler (2020).
Originalausgabe
1. Auflage 2023
© 2023 Jaron Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin
Umschlagfoto: Sandra Geisler
Satz und Layout: Prill Partners|producing, Barcelona
Lithografie: Bild1Druck GmbH, Berlin
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH
ISBN 978-3-95552-063-2
Inhalt
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Danksagungen
Weitere Bücher
EINS
»Mach’s gut, Herr Kriminalhauptkommissar«, flüsterte Karola ihrem Mann ins Ohr und schob ihn mit einem verschmitzten Lächeln zur Tür hinaus.
»Ebenso, Frau Restauratorin«, parierte Karl Bircher. Karola, Mitte fünfzig, war immer noch gertenschlank, sie hatte ein offenes, intelligentes Gesicht mit einem heiteren Zug um den kleinen Mund und schwachen Falten, die sich auf den Wangen verliefen. Zwischen den Augenbrauen deutete eine kleine Kerbe auf ihr Aktenstudium, ihre Stirn war wie glattgezogen. Karolas muntere Augen verrieten, dass sie blitzgescheit und neugierig war. Und so sah sie ihm auch hinterher, als er sich behäbigen Schrittes zum Fahrstuhl bewegte.
»Und lass dich nicht anquatschen«, rief sie ihm mit der Andeutung eines Hüftschwungs und klappernden Augenlidern hinterher. Er musste kurz auflachen, erkannte er doch sofort, worauf seine Frau anspielte.
Karl Birchers Arbeitsplatz, seit 1992 die zweite Berliner Mordkommission, befand sich in der Keithstraße in Schöneberg und die kreuzte die Kurfürstenstraße, die nichts Kurfürstliches an sich hatte. Hier befand sich der beliebteste Straßenstrich der Stadt. Als Bircher zu Beginn seiner Dienstzeit einmal beschlossen hatte, zur U-Bahnstation Kurfürstenstraße zu schlendern, war er auf Frauen einer Zunft getroffen, denen er in seinem ersten Ermittlerleben nie begegnet war. Diebstahl, Betrug, Tötungsverbrechen und Mord gab’s auch in der DDR, vereinzelte Prostitution auch – die Frauen wurden »Bordsteinschwalben« genannt –, aber hier und heute standen sie am helllichten Tage aneinandergereiht, als würden sie auf den nächsten Bus warten, da blies selbst Bircher die Backen auf. »Grenzenlose Freiheit«, hatte sein Vorgesetzter, Kriminaloberrat Pfeil, nur mit einem leichten Seufzer dazu bemerkt. Und auf Birchers ironische Nachfrage, ob sich die jungen Frauen in der Nähe der Mordkommission sicherer fühlen würden, hatte Pfeil noch entgegnet: »Die sind seit den 60er-Jahren hier«, als handelte es sich um ein Wohnrecht. Bircher entschied sich später für eine Flaniermeile anderer Art: Zwischen Bahnhof Zoo und Büro konnte er die Gedächtniskirche, Luxusboutiquen, das Aquarium und berühmte Warenhäuser sehen, und nichts ließ erahnen, dass sich einen Katzensprung entfernt das älteste Gewerbe der Welt niedergelassen hatte.
Karl Bircher, in der DDR fast 30 Jahre bei der Kriminalpolizei beschäftigt, zuletzt als Major der Morduntersuchungskommission im Präsidium am Alexanderplatz, hatte im Unterschied zur Mehrzahl seiner Kollegen die Überprüfungen des Berliner Senats glimpflich überstanden. Die Ostberliner Polizei war zum 1. Oktober 1990 dem Berliner Magistrat unterstellt worden – faktisch bedeutete das die Zusammenlegung der Behörden Ost- und Westberlins und das Ende des Präsidiums am Alexanderplatz. Für ihn hatten damit quälende Wochen der Ungewissheit begonnen. Er war bereits Mitte fünfzig, ein Alter, das neben seiner Herkunft und seinem Dienstgrad ein weiteres Hindernis dargestellt hatte, denn man verpflichtete nur ungern »Altgediente«, also DDR-Polizisten. Das mit dem Dienstgrad konnte er aus Sicht der neuen Direktion sogar nachvollziehen, allerdings hatte er sich ja nicht für den Bundesnachrichtendienst, sondern für die Mordkommission beworben.
Letzten Endes war er in den Dienst übernommen worden. Statt Major Bircher war er jetzt Kriminalhauptkommissar Bircher, das entsprach in etwa der Herabstufung um einen Dienstgrad, was ihn nicht sonderlich störte. Das wurde bei allen Polizisten aus der DDR so gehandhabt, eine Art Überholverbot für ostdeutsche Verkehrsteilnehmer. Leutnant Schmidter war ihm geblieben, wahrscheinlich war seine Akte unverfänglich genug. Vielleicht hatte sich aber auch jemand gedacht: »Die sind in Sachen Mord und Totschlag ein eingespieltes Team, besonders was den Osten betrifft, also lassen wir sie mal zusammen.« Manuela Riescher, »mein Sprachrohr«, wie Bircher seine Sekretärin immer scherzhaft genannt hatte, war ebenfalls übernommen worden. Sein Stellvertreter im Polizeipräsidium, Oberleutnant Angler, hatte gehen müssen und war von einem privaten Wachdienst angeheuert worden – er bewachte nun »Malls«, früher als Warenhäuser bezeichnet. Es hatte Bircher besonders gefreut, dass ihm mit Schmidter und Manuela Riescher zwei seiner engsten Mitarbeiter aus alten Zeiten direkt zugeordnet worden waren. Nie zuvor hatte Manuela ihren Chef so strahlen sehen wie an dem Tag, als sie sich bei ihm gemeldet hatte mit dem Satz: »Bin wieder hier, Karl, du behältst deine Sekretärin.« Das stimmte zwar nicht ganz, denn Manuela war in der zweiten Mordkommission als Sachbearbeiterin angestellt worden, aber das betrachtete sie als eine Art Formfehler. Für sie stand fest, dass ihre Erfahrungen als Sekretärin für Birchers Arbeit unersetzlich waren. Tatsächlich gehörte sie seit Jahren zu Birchers engsten Vertrauten im Präsidium. An einem der ersten Tage in der neuen Dienststelle hatte er grinsend bemerkt: »Du sorgst dafür, dass wir uns nicht zu sehr verändern.«
Es gab mit Angler also nur einen Abgang – nicht so schlecht, wenn man die politische Gefechtslage in Betracht zieht, resümierte Bircher. Mit Pfeil hatte er Glück, erinnerte er ihn doch in mancherlei Hinsicht an seinen ehemaligen Chef, General Meier, der sich nach der Reorganisation der Berliner Polizei im Ruhestand wiederfand. Pfeil war ein besonnener, der Sache zugewandter Beamter, der allein den Erfolg im Auge hatte und nicht zu erkennen gab, ob ihn der Lebenslauf eines neuen Mitarbeiters aus dem Osten interessierte. »Im Amt wird nicht zwischen Ost und West unterschieden, schließlich gilt unser Augenmerk den Ganoven, nicht unseren Biografien«, hatte er einmal ganz zu Anfang bemerkt. Er hatte es dabei belassen, Bircher zu einer Tasse Kaffee einzuladen und schmunzelnd zu fragen, ob er damit einverstanden sei, wenn sie von nun an Kollegen wären. Bircher hatte stumm genickt und ihn interessiert gemustert, wie bei einer Zeugenbefragung.
Im Allgemeinen geizte Pfeil mit Lob, die Anstrengungen auf dem Weg zum Erfolg seien mit dem Gehalt vergolten, schien er seinen Kollegen zu verstehen zu geben. Auch eine Eigenart, die Bircher nicht fremd war. Und wie General Meier neigte auch der Kriminaloberrat bei Beratungen zu Halbsätzen, als betrachtete er es als die Aufgabe seiner Mitarbeiter, die andere Hälfte zu formulieren. Bircher, dem Taktieren so fremd wie Tango war, hegte den Verdacht, dass sie dadurch späteren Korrekturen ihrer Ansagen – und damit einem Autoritätsverlust – vorbeugen wollten.
Zu Hause kommentierte Karl die Lage stets trocken: »Mir geht’s gut, denn wenn die alte Theorie stimmt, dass die kapitalistische Lebensweise nicht nur mehr Wohlstand, sondern auch mehr Kriminalität hervorbringt, dann habe ich mehr Arbeit als vorher, und davon träumen die meisten meiner Landsleute.« Seine Frau lächelte dann schwach und erinnerte ihn daran, dass er im Grunde seines Herzens ein Biologielehrer sei, der ein paar Jahre in der thüringischen Natur herumgeschweift war. Dort war sie ihm das erste Mal beim Pilzsammeln begegnet, doch dann war die Volkspolizei auf der Suche nach Verstärkung zufällig auf seine analytischen Fähigkeiten gestoßen und hatte ihn umgeschult. »Jetzt fange ich Verbrecher statt Schmetterlinge«, hatte er damals grinsend zu Karola gesagt. »Eigentlich merkwürdig«, hatte sie mal bemerkt und weise den Zeigefinger gehoben. »Damals in der DDR brauchte es mehr Biologielehrer als Kriminalpolizisten, jetzt ist es wahrscheinlich umgekehrt.«
Den Verlust seines Dienstwagens hatte er achselzuckend zur Kenntnis genommen, die Fahrbereitschaft reichte ihm. Meinem Gewicht tut der Verlust gut, sagte er sich. Seine Neigung, den Oberkörper beim Gehen leicht nach vorne zu beugen und die Stirn dabei zu runzeln, hatte sich mit den Jahren verstärkt. Hinter starken Brillengläsern musterten hellwache graugrüne Augen die Umgebung, wobei er oft den Hals reckte und so den Eindruck eines Spaziergängers erweckte, der auf der Suche nach etwas Verlorenem war. Aber auch in dieser ihm eigenen leicht geneigten Körperhaltung entging Bircher nichts. Mit stiller Belustigung verfolgte er insbesondere die Umbenennung aller möglichen Läden, gastronomischer Einrichtungen und Dienstleister. Friseure hatten sich über Nacht in Barbershops, Hair Cutters, Coiffeurs und einer gar in einen Cutman umbenannt, an jeder Ecke lud eine Trattoria, ein Ristorante, eine Bottega oder Osteria zu Spaghetti Bolognese ein. Wer Udo-Jürgens-Schlager im Ohr hatte, den zog es in die Akropolis Taverne oder ins Mythos, während der Asienliebhaber zwischen Hello Sushi, Secret Garden oder Sushi for You wählen konnte. Man hatte zu tun, sich die Namen zu merken. Bircher witzelte zu Hause, dass er jetzt neben dem Stadtplan auch ein Wörterbuch brauche, um sich in seiner Stadt zurechtzufinden.
Er dachte an Karola und lächelte in sich hinein, als er zur Straßenbahnhaltestelle in der Landsberger Allee ging, um in die Linie 15 zu steigen. Am Hackeschen Markt wechselte er in die S9, die ihn zum Bahnhof Zoo brachte, dann ging er den restlichen Weg zu Fuß in die Keithstraße. Unter den Lindenbäumen verringerte er sein Tempo auf das eines Spaziergängers im Urlaub und erreichte nach etwa zehn Minuten den Eingang zu seiner Dienstelle. Als er zum ersten Mal die imposante Fassade mit ihren Jugendstilelementen erblickte, hatte er staunend vor der Vorderfront aus mächtigen Sandsteinen gestanden, wie vor einer Festungsmauer, hinter der man Schutz sucht.
Mit einem angedeuteten »Morgen« zeigte Bircher dem Wachmann seinen Ausweis und stieg die Treppen hoch in die zweite Etage. So wie er früher im Präsidium den Paternoster gemieden hatte, ignorierte er jetzt den Fahrstuhl. Er mochte es nicht, während eines kurzen Aufenthaltes in einem engen Raum angesprochen zu werden.
In seinem spartanisch eingerichteten Büro – ein Schreibtisch und ein runder Birkenholztisch mit vier passenden Stühlen – stellte er sich wie üblich erst einmal ans Fenster, schob die Gardine zur Seite und betrachtete die Baumreihen zu beiden Seiten der Straße. Er ließ seine Gedanken schweifen und erinnerte sich ohne Wehmut an sein ehemaliges Dienstzimmer, den nahen Friedrichshain, an seine Spaziergänge im Herbst, wenn das Laub unter den Schuhsohlen raschelte, die Singvögel auf den Wiesen hüpften und er in Gedanken einen Fall durchging. Bircher war nicht der Typ Mensch, der sich mit der Vergangenheit aufhielt. Er verbrachte den größten Teil seiner Zeit mit der Aufklärung von Delikten, egal, ob sie einen Tag oder ein Jahr zurücklagen, ihn trieb das Gegenwärtige. Es kam allerdings vor, wenngleich sehr selten, dass er sich fragte, ob Kriminalhauptkommissar Bircher nicht doch nur eine Kopie von Major Karl Bircher sei, ob das Original ihn wie ein Schatten begleitete.
Er kontrollierte die Uhrzeit, gleich würde sein alter Freund Wolfgang Tetsche kommen, der nach wie vor in der Gerichtsmedizin angestellt war. In dieser Hinsicht hatte sich wenig geändert, wenngleich Tetsche mitunter mit verdrießlicher Miene darüber klagte, dass er jetzt ein Dienstleister sei, den das Gericht oder die Staatsanwaltschaft herbeizitierte, und dass er seine Untersuchungen in Leistungsziffern darstellen musste wie ein Buchhalter. »Was waren das für schöne Zeiten, als mich nur der Tod beschäftigte«, hatte er einmal gesagt.
Er hatte Bircher vor zwei Tagen angerufen und ihn »in einer bestimmten Sache« um ein Treffen gebeten. Wie immer hatte er genuschelt, als klemmte eine Zigarette zwischen seinen Lippen. Nach einem leichten Infarkt hatte er das Rauchen eingestellt, nicht jedoch seine Art, sehr leise zu sprechen.
Ein sachtes Klopfen an der Tür riss Bircher aus seinen Gedanken. Er drehte sich halb zur Tür und rief »Bitte!«. Die Tür öffnete sich einen Spaltbreit, und Tetsche schob sich ins Zimmer.
»Passt es jetzt?«, fragte er, als hätte er eine Weile im Korridor gestanden.
»Na klar, komm rein, Wolfgang.«
Tetsche legte seinen Mantel über den Stuhl und nahm am Tisch Platz. Bircher löste sich vom Fenster und setzte sich mit einem freundschaftlichen Klaps auf Tetsches Schulter zu ihm.
»Soll ich uns einen Kaffee besorgen?«
»Nee, nicht nötig. Ich halte dich nicht lange auf.«
Bircher musterte ihn mit geneigtem Kopf.
»Du bist das erste Mal hier, oder?«
»Stimmt. Der Wachhabende wollte mich nicht reinlassen. Ich habe ihm gesagt, er solle dich oder Manuela anrufen.«
»Verstehe.«
»Kannst du dich an Frau Wohlfahrt erinnern?«, kam Tetsche ohne Umschweife zur Sache.
»Na hör mal, Frau Wohlfahrt und ihre Männer, wie kann man die vergessen«, sagte Bircher und dachte an Herrn Wohlfahrt und die manipulierten Herzschrittmacher, die vor einigen Jahren mehrere Patienten das Leben gekostet hatten.
»War ein interessanter Fall. Wie hieß der gleich, der die Schrittmacher aus dem Tritt gebracht hat?«
»Der hieß Frank Schuster. Wir haben jetzt das Jahr 1992, Schuster wird vielleicht um das Jahr 2010 als freier Bürger in die Bundesrepublik entlassen.«
»Hm. Mir geht’s um einen Hund.«
Tetsche nestelte an seinem Krawattenknoten, als wollte er sich Luft zum Atmen verschaffen.
»Mich hat ein Freund, ein Tierarzt, konsultiert, dem wurde ein Hund zur Untersuchung gebracht. Die Besitzer glauben, irgendjemand aus der Nachbarschaft hätte ihrem Dackel was angetan. Der Hund ist gestorben.«
Bircher sah seinen Freund etwas entgeistert an.
»Wolfgang, seit wann interessieren wir zwei uns für Tiere? Unsere Leidenschaft gilt doch dem Menschen.«
»Ja, teile ich bekanntlich. Aber die Tierhalter bestanden darauf, dass ihr Hund obduziert wird, und mein Freund hat um Unterstützung gebeten, so ist das Tier bei mir gelandet. Einige Tage später ruft mich ein Internist an und berichtet über eine Patientin mit blutigem Durchfall, Koliken und Krämpfen, eine Frau Wagner, die ganz in der Nähe von dem Hund wohnt. Die Symptomatik war ganz ähnlich. Mein Kollege tippte erst auf Organversagen, aber na ja, dann wäre sie wohl jetzt tot. Ich dachte an eine Vergiftung und habe eine Reihe von Laboruntersuchungen veranlasst, für den Hund und die Frau. Ergebnislos.«
»Als Außenstehender könnte man vermuten, dass die beiden aus demselben Napf gefuttert haben«, sagte Bircher trocken und warf Tetsche einen mitleidigen Blick zu.
»Beide könnten an den Folgen derselben Intervention gelitten haben, aber der Hund hat es nicht überlebt«, antwortete Tetsche ungerührt.
»Intervention?«
»Na ja, etwas zu verzehren, das sie nicht vertragen haben.«
»Vielleicht haben sie denselben Fleischer.«
Tetsche seufzte mit nachsichtiger Miene.
»Karl, du denkst doch nicht etwa, dass mich der Dackel interessiert. Willst du jetzt mehr über Frau Wagner wissen?«
»Ist sie eine Berühmtheit?«
»Nee, sie ist die Gattin eines Herrn Wagner, der die Berlin Beauty berät, vormals Berliner Duft, wenn ich richtigliege.«
Birchers Gesichtsausdruck verriet erstmals ein gewisses Interesse. Auch der Kosmetikbetrieb Berliner Duft hatte mit dem Schrittmacher-Mordfall in Verbindung gestanden, genau wie Professor Sitte, mit dem er seither in herzlichem Kontakt stand. Der hatte ihm als Kardiologe mit Rat und Tat zur Seite gestanden, als es darum ging, die mysteriösen Abgänge mehrerer Patienten aufzuklären, die kurz nach der erfolgreichen Implantation eines Herzschrittmachers verstorben waren. Mit Sittes Hilfe war es gelungen herauszufinden, wie Schuster die Schrittmacher zur »Mordwaffe« umfunktioniert hatte.
»Frau Wagner jedenfalls plauderte gegenüber meinen Kollegen über den Betrieb und angebliche Querelen unter den Kollegen. Sie erwähnte Herrn Schulz, vormals bei der Berliner Duft, jetzt bei der Berlin Beauty Direktor, und deutete an, dass die Treuhandsubventionen nicht nur dem Betrieb guttun würden.«
»Geht’s genauer?«
»Vielleicht Veruntreuung.«
»Ach herrjeh, Gerüchte, Kollegen, die sich nicht vertrauen, Neid und Zukunftsangst, mein Lieber, wie viele Herrchen oder Frauchen leiden da wohl gerade an Durchfall.«
»Die Treuhand könnte die Berlin Beauty im Visier haben, deutete die Wagner an.«
»Na, das ist ja wohl ihre Aufgabe, nachzusehen, ob ihr Geld gut angelegt wurde. Deshalb musste Frau Wagner nicht übel werden.«
»Nee, eigentlich nicht«, nuschelte Tetsche.
Beide verfielen in ein nachdenkliches Schweigen. Bircher sann über die Macht des Zufalls nach. Was wollte Wolfgang andeuten?
Plötzlich schlug er mit der flachen Hand auf den Tisch.
»Du nimmst an, dass jemand im Umfeld der Geschäftsführung Frau Wagner einen Denkzettel verpassen wollte, weil sie zu viel weiß?«, ließ er sich auf eine Spekulation ein.
»Vielleicht war der Denkzettel gar nicht für sie bestimmt«, vermutete Tetsche und hob dabei leicht die Schultern. »Kannst ja mal deine Fühler ausstrecken.«
Er stand auf und schlüpfte in seinen Mantel.
»Ja, wir hören uns mal um. Mach’s gut, mein Lieber, und pass auf dich auf, besonders beim Essen.«
»Ja, werde schon nicht auf den Hund kommen.«
Sie grienten wie Verschwörer und klopften sich zum Abschied auf die Schultern.
Wolfgang Tetsche gehörte zu dem halben Dutzend Menschen, deren Urteil Bircher ernst nahm. Für Tetsche zählte nur, was er sehen, prüfen, bewerten und erklären konnte. Nie würde er zu einer Frage Stellung beziehen, ohne sich vorher ein genaues Bild gemacht zu haben. Bircher beschloss, Manuela zu beauftragen, ihre Fühler in Richtung Berlin Beauty auszustrecken. Irgendetwas könnte ja an der Sache dran sein.
Drei Tage später stand sie, stramm wie eine Soldatin, vor seinem Schreibtisch.
»Was gibt’s Wichtiges?«
»Ich sollte ein paar Informationen zur ehemaligen Berliner Duft einholen.«
»Ach so«, murmelte Bircher, der seit geraumer Zeit auf einen spannenden Fall wartete, etwas enttäuscht. Die Sache mit dem Hund und der Frau war ihm bereits aus dem Blick geraten.
»Passt es jetzt nicht?«
»Schieß los, setz dich bitte«, winkte er sie heran.
Wie üblich machte sie keine Anstalten sich zu setzen. Sie befürchtete, ihre Füße könnten über dem Boden baumeln, deshalb stand sie lieber. Bircher linste über seinen Brillenrand zu ihr hinauf.
»Ich habe bei den Kollegen des Wirtschaftsdezernats um einige Informationen …«
»Du darfst dich setzen«, unterbrach er sie mit einem listigen Grinsen. Sie zog eine Schnute und ließ sich vorsichtig auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch sinken.
»Die Berlin Beauty ist bekanntlich aus der Berliner Duft hervorgegangen.«
»Ja, das weiß ich«, sagte Bircher.
»Die Treuhand und Herr Wagner von Wagner’s Consulting sind im Gespräch mit einem Schweizer Unternehmen Swiss Scent, geschrieben S C E N T.«
»Und was heißt das?«
»Übersetzt heißt das Schweizer Duft. Ist schon komisch, Berliner Duft und Schweizer Duft«, kicherte sie.
»Neue Duftnote«, bemerkte Bircher trocken. »Ja und, was ist dabei?«
»Die bezahlen Wagner sehr gut, weil seine Gutachten den Laden attraktiv machen. Die Treuhand braucht die Gutachten für ihre Transaktionen. Der Geschäftsführer heißt Schulz, war schon zu DDR-Zeiten der Betriebsleiter. Ist alles irgendwie nicht unser Bier, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf.«
»Du darfst, und ich stimme dir zu. Kann nicht erkennen, was uns in Trab setzen sollte.«
Manuela faltete ihren Zettel zusammen und wartete, aber Bircher schien mit den Gedanken woanders zu sein. Er stellte sich gerade vor, dass Herr Schulz irgendein abgekartetes Spiel treiben könnte, um ein paar Mark für sich abzuzweigen, dass die Wagner davon Wind bekommen hatte, was Herrn Schulz zur Attacke verleitet hatte. Aber nee, wies er sich augenblicklich zurecht, das ist an den Haaren herbeigezogen. Ein Anschlag auf Frau Wagner macht überhaupt keinen Sinn, wenn überhaupt, dann hätte es Herrn Wagner oder jemand anderen aus seiner Firma treffen müssen.
Er räusperte sich, ein Zeichen für Manuela, flink aufzustehen und sich den Rock glatt zu ziehen.
»War das alles, Manuela?«
»Im Prinzip ja. In der Firma ist dann noch Frau Lehner beschäftigt, auch schon bei der Berliner Duft dabei gewesen. Ja, und die Wagners haben ein Sohn, Bernd, der studiert Jura und ist Praktikant bei der Treuhand.«
Sie warf Bircher einen forschenden Blick zu, wie um die Bedeutung dieser Information abzuschätzen. Er unterdrückte ein Gähnen und reichte ihr die Postmappe.
»Schick es ans Wirtschaftsdezernat. Lass deinen Zettel hier, wir unternehmen nichts weiter.«
»Klar. Na dann, tschüss, Chef«, flötete Manuela. Er hob warnend die Augenbrauen. Die Türklinke in der Hand drehte sie sich nochmal zu ihm um. Aber er beachtete sie nicht, denn ihm stellte sich gerade die Frage, wozu ein Kosmetikhersteller mit 40-jähriger Produktionserfahrung einen »Consultant« brauchte.
ZWEI
Wagner war auf den ersten Blick eine stattliche Erscheinung: breitschultrig, mit großem Bauch und einem rosigen Gesicht, aus dem die fleischige Nase hervorstach. Ohne ihn näher zu kennen war ersichtlich, dass er ein »Macher« war, ein vom Erfolg verwöhnter Unternehmer, der sich seinen Weg zu bahnen wusste. Egal wann man Wagner traf, es ging immer ums Geschäft, eines, das er gerade einfädelte, oder eines, das er gerade abschloss. Seine flinken Augen irrten rastlos durch den Raum, sie hatten etwas Flackerndes, als würden sie nach Orientierung suchen. Unterhielt man sich mit ihm, so fühlte es sich mitunter so an, als hörte er nicht seinem Gesprächspartner, sondern einem unsichtbaren Dritten zu. Aber weckte ein Thema doch einmal seine Aufmerksamkeit, riss er die Augen auf und nickte kurz und heftig, als hätte man ihm ganz aus dem Herzen gesprochen.
Neben den Geschäften war der Wein seine Leidenschaft, und auch die stand ihm ins Gesicht geschrieben. Es glänzte immer ein wenig wie mit einer feinen Patina überzogen, Augen und Lippen schimmerten feucht, wie bei einer Verkostung. Tatsächlich lagerten in seinem Haus Weine unterschiedlichster Sorten und Jahrgänge. Geschäfte machen und das Leben genießen, eines bedinge das andere, das war sein Credo.
Ungeachtet der Oberflächlichkeit im Umgang konnte er in bestimmten Situationen eine Herzlichkeit offenbaren, wie sie leutseligen Menschen aus dem Süden der Republik anhaftet. Dann kam es vor, dass er einem in Gesellschaft seine Pranke auf die Schulter legte, ein kumpelhaftes Lächeln aufsetzte und sich nach der Familie oder dem letzten Urlaub erkundigte. Seine Worte plätscherten dann plötzlich so sanft dahin wie Wasserperlen aus einer Brunnenfigur.
Nach seinen ersten Begegnungen mit den Mitarbeitern der Berlin Beauty hieß es: Der packt zu und ist nicht so belehrend wie andere Zugereiste. Und ein Siegertyp, wie wir ihn brauchen, nicht so ein Phlegmatiker wie unser Chef. Bei flüchtigem Hinsehen hätte Schulz zwar durchaus als sein leiblicher Bruder durchgehen können, beide waren von ähnlicher Statur, ihre Gesichtszüge spiegelten ihre Berufswege und Genüsse. Aber der erste Eindruck täuschte, im Unterschied zu Wagner war Schulz eher ein in sich gekehrter Mensch. Er war weder ein vor Lebenslust sprühender, noch ein von Trübsinn geplagter Zeitgenosse, sondern schlicht – ein langweiliger Zeitgenosse. Sein Gesicht ähnelte einem aufgehenden Teig, mit den leicht aufgedunsenen pockennarbigen Wangen, die schlaff unter den Augenlidern hingen. Aber wer sich mit Schulz unterhielt, fühlte sich verstanden, er galt als verständnisvoller Chef. Kein Draufgänger, eher ein hängender Mittelstürmer, der seiner Mannschaft mit geringem Aufwand zu dienen sucht.
Wagner hatte ihn vor zwei Monaten angerufen und sich als Geschäftsführer von Wagner’s Consulting vorgestellt. Er würde sehr gerne, ganz zeitnah, mit ihm über die Privatisierung des Betriebs sprechen. »Es kann nicht schaden, wenn Sie auf dem Weg in die Marktwirtschaft externe Expertise nutzen«, tönte er, als zitierte er aus einem Firmenprospekt. Schulz hörte mit leerem Blick zu und ordnete den Mann in Gedanken als einen weiteren Trittbrettfahrer ein. Er hatte so manchen Bericht über zwielichtige Berater gelesen, die sich an Subventionen und Fördermitteln bereicherten.
»Sie müssen einen starken Käufer finden, wenn der Betrieb überleben soll, und ich könnte Ihnen bei der Suche helfen. Ich berate auch die Treuhandgesellschaft in Berlin. Dort wurde ich auf sie aufmerksam gemacht«, sagte er.
»Hatten Sie mit unserer Branche zu tun?«, fragte Schulz beiläufig, er wollte das Gespräch rasch beenden.
»Nein, aber mit anderen Betrieben der DDR. Auch mit einigen, die in den Osten, Russland, Estland, Ukraine, exportierten.«
»Kiew auch?«
»Auch. Sie kennen sich da aber sicher besser aus, Herr Schulz.«
Allerdings, dachte er und hatte sofort seinen ukrainischen Partner Surab Tschiladse vor Augen. Er blinzelte nervös.
»Vielleicht wollen Sie sich mal in den nächsten Tagen unseren Betrieb ansehen?«, schlug Schulz vor.
»Ich brauche noch ein paar Tage für einige Recherchen und würde dann zu Ihnen kommen. Sagen wir, am übernächsten Montag, gegen zehn Uhr«, ließ sich Wagner nicht lange bitten.
»Ja, geht in Ordnung, also bis dahin«, willigte Schulz leicht überrumpelt ein.
An dem besagten Montag saß Wagner lässig vor Schulz, der ihn hinter seinem Schreibtisch wortlos musterte.
»Sie haben von der Treuhand, unter deren Kuratel Sie stehen, einen Kredit in Höhe von drei Millionen Mark erhalten. Bevor der in einem Jahr ausläuft, sollten Sie mit einem Käufer handelseinig sein«, legte Wagner ohne Umschweife los.
»Na, Sie sind ja gut informiert.« Schulz sah ihn aufmerksam an. »Und was erwarten Sie von mir?«
»Die Treuhand verlangt ausführliche Bewertungen Ihres Betriebs, ich kann Sie dabei unterstützen. Für Verkaufsverhandlungen benötigt es ein in sich geschlossenes Konzept, einen Businessplan.«
»Bislang haben die nur betriebswirtschaftliche Unterlagen angefordert«, sagte Schulz, dem es vor dem Businessplan graute.
»Ich habe hier ein Schreiben der Treuhand«, sagte Wagner und zog einen Umschlag aus seiner Aktentasche. Er reichte ihn Schulz, der ihn ungerührt öffnete und das Papier sorgfältig durchlas.
»Klar. Sie wollen uns also unterstützen.«
»So ist es. Die Treuhand verlangt eine Vorlage: Investitionsplanung, Abfindungen, Sozialpläne, Absatzanalysen, Marketing und so weiter. Dazu kommen Angaben …«
Schulz antwortete nicht. Er hatte davon gehört, dass die »Berater« Stundenhonorare von bis zu 400 Mark in Rechnung stellten, und er überschlug blitzschnell, wie viel aus dem Treuhandkredit an Herrn Wagner fließen würde, stünde der ein Jahr lang jede Woche für zehn Stunden auf der Matte. Eine satte sechsstellige Summe. Im Rechnen war Schulz stärker als im Verhandeln, und ihm dämmerte allmählich, warum Wagner die Berlin Beauty unterstützen wollte. Er beugte sich etwas nach vorn und setzte ein unverbindliches Lächeln auf.
»Herr Wagner, meine Mitarbeiter werden gerne helfen, wenn es darum geht, unseren Betrieb am Leben zu erhalten. Selbstverständlich freuen wir uns über gute Beratung und kommen gerne auf Ihr Angebot zurück.«
Wagner räusperte sich und hob die Augenbrauen, als wollte er zu einer ausführlicheren Erklärung ansetzen. Schulz atmete einmal tief durch.
»Lieber Herr Schulz, ich möchte Ihre angesehene Firma am Leben erhalten, sie darf nicht verscherbelt werden. Das ist schließlich ein gestandenes Unternehmen mit großem Potenzial für die Ostmärkte.«
Schulz war hin- und hergerissen. Wimmle ich ihn ab oder lasse ich die Sache ein paar Tage in der Schwebe? Wenn ich ihn rausschmeiße, könnte ich es mir mit der Treuhand verderben. Also, lassen wir ihn mal weiterreden.
»Was schwebt Ihnen also vor? Kennen Sie etwa einen Interessenten, der uns retten will?«, fragte Schulz.
»Zunächst muss ich sagen – und Sie werden mir da zustimmen: Findet sich nicht bald eine Lösung, geht Ihr Laden den Bach runter.«
»So sehe ich das auch, deshalb sitzen wir hier zusammen«, sagte Schulz mit einem langsamen Nicken. Wagner stützte beide Arme auf seine Oberschenkel, als wollte er sich zum Abschied erheben, gleichzeitig versuchte er mit gesenktem Kopf Blickkontakt zu halten. Ein nervöses Zucken um die Mundwinkel verriet seine Anspannung.
»Ich kenne mich in der Kosmetikbranche aus, bin ausgebildeter Chemieingenieur. Und ich habe gute Kontakte zu einem Unternehmen, das sich für Sie interessieren könnte, in der Schweiz«, sagte Wagner betont langsam. Sein korpulenter Körper hatte Spannung aufgenommen, was seinen Worten zusätzlichen Nachdruck verlieh.
»Was für ein Unternehmen?«, fragte Schulz scheinbar beiläufig, dem das Spiel allmählich bekannt vorkam.
»Swiss Scent ist der Name der Firma.«
Wagner lehnte sich abwartend zurück und faltete die Arme vor der Brust. Schulz nahm die Information reglos zur Kenntnis. Deshalb also die »Beratung«, der hat einen Kaufinteressenten, für den er unterwegs ist. Und die Treuhand ist vielleicht eingeweiht, also Vorsicht, riet ihm sein Instinkt.
»Nun, und wie würde es konkret weitergehen?«, fragte Schulz.
»Wir würden einen Plan erstellen, der den Käufer sensibilisiert.«
»Und Sie liefern die Marktanalysen?«
»So ist es. Zusammen mit Ihnen.«
»Ihre Gutachten gibt’s nicht für umsonst, und ich gehe davon aus, dass Sie keinen Vertrag mit den Schweizern haben«, tastete sich Schulz voran. »Sagen Sie mir konkret, wie unsere Chancen stehen, falls man Ihre Gutachten berücksichtigt.«
Wagner nickte, schlug die Beine übereinander und machte es sich auf seinem Stuhl bequem. Jetzt schien ihm das Gespräch zu gefallen.
»Ich bin an die Swiss Scent nicht vertraglich gebunden. Wie gesagt, ich arbeite mit der Treuhand zusammen. Meine Gutachten sind allerdings auf die Belange von Käufern zugeschnitten, die dem Unternehmen eine langfristige Perspektive zusichern.«
Schulz hob kurz die Augenbrauen. Eine langfristige Perspektive – schloss Wagner sich dabei selbst mit ein?
»Und der Schweizer Kaufinteressent ist seit Jahren erfolgreich?«
»Ja. In Europa, aber auch in der ehemaligen Sowjetunion.«
Schulz grinste. Er dachte an Surab Tschiladse in Kiew und die Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit.
»Wie hieß dieses Unternehmen doch gleich?«
»Swiss Scent AG, mit Sitz in Walchwil, Kanton Zug. Die handeln unter anderem mit hochwertigen Grundchemikalien für die Kosmetikindustrie.«
»Hm, noch nie was von denen gehört«, murmelte Schulz, dem weder der Firmen- noch der Ortsname irgendetwas sagte, was ihm merkwürdig erschien. Wagner schien seine Bedenken zu spüren.
»Ganz seriöser Familienbetrieb, mit denen haben Sie einen direkten Ansprechpartner und nicht zig Ebenen vor sich wie in Konzernen. Herr Kohlin, der Eigentümer, hat angedeutet, dass er sich bereits in erfolgversprechenden Gesprächen mit der Treuhand befindet.«
»Und warum keine deutsche Firma?«, hakte Schulz nach.
»Vielleicht hat ja die Treuhand noch andere Interessenten. Ich habe die Swiss Scent empfohlen, weil sie perfekt in unser Profil passt.«
»Wenn Sie meinen«, sagte Schulz, den das Wort »unser« störte. Der redet ja, als wolle er mit mir zusammen den Betreib leiten.
Wagners Augen fixierten Schulz kühl, als bestimmte er seinen Wert. Er räusperte sich wie vor einer wichtigen Mitteilung, und Schulz hob interessiert die Augenbrauen. Nähern wir uns jetzt dem Spielende?, dachte er. Wagner beugte sich verschwörerisch nach vorn.
»Lieber Herr Schulz, ich denke, Sie sollten Ihren Betrieb nicht ohne Gegenleistung abgeben. Sie verdienen eine Wertschätzung für die Arbeit der letzten Jahre, in denen Sie unter schwierigsten Bedingungen die Firma über Wasser gehalten haben. Schließlich ist es maßgeblich Ihnen zu verdanken, dass die Verkaufsaussichten gut sind.«
Schulz’ bleiche Wangen nahmen jetzt Farbe an, und in seinen Augen flackerte das Misstrauen, als hätte man ihm soeben ein zwielichtiges Angebot unterbreitet. Welche Wertschätzung? Will er mich für das Bundesverdienstkreuz vorschlagen? Oder mich am Verkaufspreis beteiligen? Er wusste nicht, worauf Wagner hinauswollte.
»Sie können mir das sicher genauer erläutern, was das bedeutet, diese Wertschätzung. Früher wurden wir Aktivisten«, entschloss er sich zu einem scherzhaften Vorstoß.
»Ganz einfach: Uns eint das Ziel – eine Ihnen bekannte Losung. Deshalb denke ich daran, Sie an meinem Beraterhonorar zu beteiligen. Wir können das vertraglich absichern, ganz sauber.«
Schulz pfiff leise durch die Zähne und hob den Kopf zur Zimmerdecke, als stünde er vor einer schwierigen Entscheidung. Na also, jetzt nähern wir uns dem Finale. Einer aus der neuen Bundesrepublik, der mich beteiligen will. Mal ein ganz neues Spiel.
»Ein Vertrag, zwischen uns?«, fragte er, als sei er überrascht.
»Ja. Denken Sie einen Moment darüber nach. Darf ich inzwischen Ihre Toilette benutzen?«
»Letzte Tür links auf dem Korridor.«
Wagner verließ das Zimmer, und Schulz begann den Kreislauf des Treuhandkredits nachzuverfolgen. Mein Betrieb erhält einen Überbrückungskredit von der Treuhand, bezahlt davon Wagner, der auch schon von der Treuhand bestellt wurde – der sahnt also ordentlich ab. Wagner spricht von »wir«, vielleicht weil er sich bei Berlin Beauty eine berufliche Zukunft vorstellt, aber das klappt wohl nur, wenn seine Schweizer zuschlagen. Und nun plant er, mich mit ins Boot zu holen, indem ein Teil seines Honorars in einen Seitenarm fließt, der direkt in mein Konto mündet. Na ja, dem Betrieb würde es nicht schaden, es ist letztendlich Wagners Geld. Eigentlich eine andere Form meiner Zusammenarbeit mit Surab, das ist auch nichts, was dem Betrieb schadet.
Wagners Rückkehr beendete seine Überlegungen.
»Nennen wir es eine Vereinbarung, die wir bei einem Notar hinterlegen können«, kam Wagner auf die letzte Frage zurück, noch bevor er sich wieder hingesetzt hatte.
»Verstehe«, sagte Schulz und nickte halbherzig. Er dachte für einen Moment an die Anwaltskanzleien und Steuerbüros, die in der Innenstadt wie Pilze aus dem Boden schossen. Man sollte Sprachschulen für Ostdeutsche eröffnen, zum Lesen von Schriftsätzen.
Schulz stemmte sich aus seinem Stuhl, Wagner erhob sich ebenso. Für einen Moment standen sie schweigend voreinander und schienen sich ihrer Glaubwürdigkeit vergewissern zu wollen. Schulz reichte ihm schließlich über dem Schreibtisch die Hand.
»Dann machen wir das so.«
»Sehr gut, ich vereinbare den Notartermin. Der sollte in der Schweiz stattfinden.«
Hinter Wagner schloss sich die Tür, und Schulz fiel erschöpft in seinen Bürosessel. Er stierte minutenlang geistesabwesend auf die Schreibtischplatte und gestand sich schließlich ein, dass Wagners Angebot schlicht zu verlockend war, um es auszuschlagen. Außerdem: Hätte er es abgelehnt, wer weiß, was dann in den Gutachten stehen würde. So bleibt man an Bord, reist zusammen in die Zukunft, die Fahrtkosten trägt Wagner. Ein breites Grinsen überzog sein käsiges Gesicht, als er an den Ausbau seines Wochenendhauses dachte.
DREI
Jutta Lehner hatte die vergangenen Wochen fast eine Million an Wagner’s Consulting GmbH überwiesen. Ihr drehte sich der Magen um, wenn sie Wagner einmal die Woche durch den Betrieb schlendern sah, wie er mit gespieltem Interesse fachlichen Erläuterungen der Mitarbeiter folgte, sich im Plauderton nach ihrem Befinden erkundigte und dabei aufmerksam in alle Ecken linste. Schulz steuerte derweil mit stoischem Langmut seine »Osterfahrungen« bei und konzipierte mit seinem Betriebsleiter Mewis eine moderne Fertigungshalle für die Massenproduktion der Duschgels, Salben und Seifen. Er entwarf mit Lehner eine Investmentplanung mit fiktiven Umsätzen und Gewinnerwartungen, die Wagner ein gekünsteltes Hüsteln entlockten, studierte die Personalmanagements westdeutscher Kosmetikunternehmen, um sich mit Bezeichnungen wie Account Manager, Cashflow, Discount, Public Relations oder Corporate Identity vertraut zu machen, und fragte sich, ob man all die Anglizismen übernehmen müsse. Wagner blies die Backen auf und knurrte mit einer wegwerfenden Geste: »Mia schreibn deutsch.« Als Schulz das Personalbüro versehentlich als Kaderabteilung bezeichnete, feixte Wagner: »Mensch Paul, alte Corporate Identity!«
Sie hatten sich beim Notar in Basel auf eine Beteiligung von 30 Prozent verständigt. Auf dem Rückflug hatte ihm Wagner mit einem verschwörerischen Grinsen das Du angeboten. »Bin der Hannes«, hatte er gesagt, und Schulz hatte sich innerlich gewunden und knapp »Paul« gesagt.
Seitdem liebäugelte er mit einem mittleren sechsstelligen Betrag. Seine Frau ahnte von alldem nichts, und er wusste nicht, wie er ihr den unerwarteten Wohlstand erklären sollte. Aber er stellte sich schon vor, wie das Wochenendhäuschen mit einem neuen, schicken Schieferdach und großen Verbundfenstern aussehen würde, wie er unter der Dusche auf Terrakottafliesen stehen oder auf dem modernen Herd einer neuen Einbauküche ein feines Abendessen zaubern könnte.
Allerdings wartete er jetzt schon seit Wochen auf die Auszahlung seiner Prozente und musste neidvoll zusehen, wie sich Wagner in der Nachbarschaft einen kleinen, aber feinen Bungalow hinstellen ließ.
Wagner schwärmte von neuen Duftnoten, die verstörend wie Liebeskummer, anregend wie Meeresrauschen und betörend wie schwerer Rotwein sein sollten. »Paul, die werden wir kreieren«, rief er überzeugt. »Das lieben die im Osten, die Russen.«
Für ihn waren alle, die in der ehemaligen Sowjetunion gelebt hatten, Russen. Und sie hatten seiner festen Überzeugung nach alle den gleichen Geschmack und die gleichen Sehnsüchte. Schulz lächelte bei solchen Kommentaren säuerlich – als würden sich Ukrainer oder Kasachen nach Parfüms aus Ostberlin sehnen … Wagner wollte sich ein Beispiel an dem legendären Parfüm Krasnaja Moskwa nehmen, das 1913, zum 300. Jubiläum der Romanow-Dynastie, von der Kiewer Firma Brocard auf den Markt gebracht worden war. Krasnaja Moskwa schaffte es zwar nicht zum Weltbestseller, aber zum beliebtesten Parfüm der östlichen Frauen, stellte Wagner einmal augenzwinkernd fest.
»Was ist aus der Firma Brocard geworden?«, erkundigte sich Schulz, als sie in Wagners Büro zusammensaßen.
»Die wurden verstaatlicht, aus Brocard wurde Neue Morgenröte.«
»Wir gehen den umgekehrten Weg. Na ja, und uns bleibt Berlin im Firmennamen.«
»Berlin Beauty klingt verführerisch«, sagte Wagner.
»Mag sein, aber auch ein bisschen nach Touristenwerbung«, erwiderte Schulz.
»Jedenfalls«, fuhr Wagner fort, »muss ich dringend etwas mit dir besprechen, Paul. Im letzten Gutachten hatten wir uns ja auf den ukrainischen Markt konzentriert, insbesondere auf Kiew. Wir sind uns darin einig, dass wir nicht versuchen sollten, mit Chanel, Cloé oder Lancôme in Konkurrenz zu treten. Die sollen ihre Parfüms verkaufen, aber bevor sich unsere ukrainische Kundin damit einnebelt, kommen wir zum Zuge. Und zwar«, er bückte sich zu seiner Aktentasche, zog ein Blatt hervor und schob es über den Tisch, »mit einem Duschgel: Super Sun Shine, klingt das nicht toll? Kursiv gesetzt, in einer halben Sonne, das assoziiert Morgentau, Sonnenaufgang, aber auch Dollarzeichen. Paul, da fängt doch jede Kiewerin an zu träumen, wenn sie unter der Dusche steht! Das müssen deine Leute hinkriegen, diesen Duft, der die Männer zum Taumeln bringt, Paul, die müssen das Weib riechen, bevor sie es sehen.«
Schulz starrte auf die halbe Sonne und versuchte sich vorzustellen, wie eine Ukrainerin unter der Dusche von Dollars träumte und wie Super Sun Shine mit einem harten Akzent ausgesprochen klingen würde.
»Du kennst doch die ehemaligen Sowjetbürger, was hältst du von der Strategie?«, fragte Wagner in sichtlich aufgeräumter Stimmung.
»Ja, glaube schon, dass wir mit Seifen und Duschgels besser punkten werden als mit einem Parfüm. Und sicher, der Duft muss denen irgendwie vertraut vorkommen«, murmelte Schulz.
Ein paar Tage später ließ er sich Krasnaja Moskwa kommen und prüfte den Duft. Anschließend roch es bei ihm wie nach einer östlichen Frauentagsfeier.
An einem klaren Spätherbsttag, zwei Monate nach dem Notartermin, stimmte Wagner einem Treffen nach Feierabend zu. Sie hatten sich im Konferenzraum verabredet. Wagner hatte seine Aktentasche vorsichtig neben sich gestellt. Schulz war das nicht entgangen, und für einen Augenblick hoffte er, sie würde sein Geld enthalten. Wie zwei Pokerspieler saßen sie sich gegenüber.
»Wie geht’s zu Hause, seid ihr alle in Berlin?«, bemühte sich Schulz um einen neutralen Gesprächseinstieg.
»Ja, alle hier, gesund und munter. Erika hatte eine Magenverstimmung und musste zum Arzt. Na ja, irgendein Lebensmittel, es geht ihr wieder gut.«
Schulz knetete seine Hände und sah nicht so aus, als interessierte ihn Frau Wagners Magenverstimmung.
»Und bei euch, auch alle wohlauf?«
»Ja, ja«, beeilte sich Schulz, das Geplänkel zu beenden. In seinem Gesicht hoben sich die Pockennarben wie rosa Sprenkel ab. Er legte die Hände wie zu einer Ansprache demonstrativ auf den Tisch und leckte sich die trockenen Lippen.
»Also, Hannes, es geht um die Gutachten. Wir haben bis dato fast 1,1 Millionen Mark an Honoraren an deine Firma überwiesen. Das ist ein gehöriger Anteil des Treuhandkredits, ein Drittel, um genau zu sein. Ich würde gerne erfahren, wie es um unsere Vereinbarung bestellt ist.«
Schulz hatte betont sachlich gesprochen. Wagner lächelte nachsichtig und klatschte aufgekratzt in die Hände.
»Tut mir leid, Paul, ich hatte längst vor, mich mit dir auszutauschen. Dein Anteil liegt auf meinem Konto, den tastet niemand an. Diese Verzögerung ist schlicht der Vorsicht geschuldet. Es wirkt nicht so gut, wenn ich kurz nach Eingang meines Honorars einen größeren Teil weiterleite. Und vor allem: wohin? Auf das Privatkonto des Geschäftsführers des Betriebs, für den meine Firma Gutachten anfertigt? Das geht nicht, da sind wir sicher einer Meinung, Paul. Also, lass uns überlegen, wie du an dein Geld kommst, ohne dass die Steuer oder sonst wer Wind davon bekommt.«
Während sich Wagners Bariton an den Saalwänden brach, linste Schulz ab und an zur Tür, als fürchtete er, jemand könnte sie belauschen. Wagner wartete mit geneigtem Kopf auf eine Reaktion. Schulz sah sich unsicher um, schließlich wandte er sich Wagner zu und nickte verhalten.
»Und, was schlägst du vor?«, fragte er mit leiser Stimme.
Wagner wippte auf seinem Stuhl, ließ ihn etwas zappeln. Es hatte den Anschein, als machte es ihm Spaß, Schulz auf die Folter zu spannen. Plötzlich ließ er den Stuhl mit einem lauten Knall auf das Parkett fallen, Schulz zuckte wie unter einem Stromstoß zusammen. Wagner beugte sich über den Tisch und legte seine breite Hand auf die von Schulz.
Bisher hat er mir nur gesagt, was alles nicht geht, dachte Schulz, und strich sich mit der freien Hand nervös über die Wange. Er befreite sich von Wagners Pranke und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Der sicherste Weg ist bar, klar«, sagte Wagner, amüsiert über sein Wortspiel. Schulz sah jetzt wie ein kurzatmiger Mann aus, der zu viele Treppen gestiegen war und nur noch schlecht Luft bekam.
»Und das geht so einfach?«, war alles, was er hervorbrachte.
»Klar, nächste Woche die ersten Fünfzigtausend. In drei Wochen die nächsten. In kleinen Scheinen, versteht sich.«
Schulz verstand. Die Steuer und die Finanzen. Ist nicht so wie bei uns damals, als es für den Werktätigen außer dem Gehalt, das zum Jahresende in den Sozialversicherungsausweis eingestempelt wurde, nichts groß zu versteuern gab. Niemand interessierte sich dafür, wie viel der Staat einbehielt. Das war jetzt alles anders.
»Einverstanden, machen wir es so, Hannes«, sagte Schulz und verspürte sogleich den dringenden Wunsch, so schnell wie möglich den Konferenzsaal zu verlassen. Aber Wagner schien es nicht eilig zu haben. Er hatte sich behaglich in seinem Stuhl zurückgelehnt und die Beine unter dem Tisch ausgestreckt, als wollte er den Ausgang des Gesprächs noch etwas genießen. Schulz zog die Mundwinkel zu einem gequälten Lächeln in die Breite. Wagner blickte über ihn hinweg in den Saal und zur Bühne des Konferenzraumes, als würde gleich der gemütliche Teil des Abends beginnen.
»Übrigens, Paul – sollte die Swiss Scent den Betrieb übernehmen, bleibst du Geschäftsführer, das habe ich schon im Vorfeld mit Kohlin abgeklärt. Ist doch in deinem Sinne, oder?«
Schulz sah ihn überrascht an.
»So, das kann Herr Kohlin entscheiden?«
»Er ist Mehrheitsgesellschafter und beruft den Geschäftsführer. So sind die Regeln, mein Lieber. Oder willst du den Job etwa nicht?«
»Natürlich würde ich mich freuen, wenn es so käme«, bedankte er sich stockend und schwieg wieder.
Wagner schien nun etwas einzufallen, er bückte sich zu seiner Aktentasche und kramte unter dem Tisch. Dann richtete er sich auf und streckte Schulz stolz zwei Weinflaschen entgegen.
»Für dich, mein Lieber, beste Sorten aus dem Süden Deutschlands. Darauf musstest du lange genug verzichten, jetzt heißt es Aufholen. Der Rote kommt aus dem Rheingau, ein Spätburgunder, und der Weiße stammt aus der Pfalz, ein Verwandter vom Pinot Noir und Chardonnay.«
Er hörte sich an wie ein Händler bei der Weinverkostung. Schulz hatte im ersten Augenblick auf einen Briefumschlag gehofft und musste sich Mühe geben, seine Enttäuschung zu verbergen. Er murmelte: »Hannes, ich habe doch nicht Geburtstag.«
»Na hör mal, würden wir uns nur an Geburtstagen einen Wein genehmigen, wären wir quasi schon tot. Also, den Roten lässt du bei Zimmertemperatur ein, zwei Stunden atmen, den Weißen schön kalt servieren, nicht offenstehen lassen«, dozierte Wagner. Ja ja, die westdeutschen Freunde, selbst das Trinken müssen sie uns erklären, dachte Schulz, nickte aber beipflichtend. Als hätten wir 40 Jahre lang nur Bier und Klaren gekippt.
»Wir stoßen dann zu Hause auf deine Gesundheit an«, bedankte sich Schulz brav.
»Und auf unser neues Duschgel! Schick deine Leute in die Spur. Wäre prima, wenn wir der Treuhand bald ein Muster vorstellen könnten. Möglichst bevor wir den Antrag auf Anschubfinanzierung stellen.«
Schulz warf ihm einen forschenden Blick zu. Ging Wagner bereits von der Genehmigung für die Swiss Scent aus?
»Wie hoch könnte die denn sein, vorausgesetzt, alles geht wie geplant über die Bühne?«, fragte Schulz.
»Ich denke, zwischen einer und zwei Millionen sollten drin sein.«
Schulz hielt den Atem an. Mit dieser Größenordnung hatte er nicht gerechnet.
»Ist das nicht etwas viel angesichts des Kredits, den wir bereits erhalten haben? Und wir können ja weder ein Produkt vorweisen, noch sind wir in konkreten Verkaufsverhandlungen.«
»Deshalb ja die Anschubfinanzierung. Aber sicher hast du recht, dass wir der Treuhand mehr als nur Ideen präsentieren müssen. Deshalb ja der Businessplan.«
»Ja, hast du erwähnt. Auf Englisch.«
»Sicher nicht auf Ukrainisch«, sagte Wagner trocken. »Mein Sohn wird helfen.«
»Wie das?«
»Ja. Ich habe einen Sohn. Er studiert Jura und absolviert ein halbjähriges Praktikum bei der Treuhand. Versteht sich, dass ich ihm von uns erzählt habe.«
»Hm, verstehe.«
»Er soll einen für unser Geschäft kompatiblen Plan besorgen, in der Treuhand lagern sicher Hunderte davon, den passen wir an, mit unseren Technologien, Produkten, Marketingstrategien, Financing und so weiter. Und mit Meilensteinen, die müssen sitzen«, sagte Wagner mit einem schelmischen Gesichtsausdruck.
Schulz schwirrten all die neuen Begriffe durch den Kopf, ihm schwindelte, als stünde er auf einer Felsklippe.
»Meilensteine, was ist das denn wieder?«, fragte er ungläubig.
»Das sind nichts anderes als Planziele, die zu erreichen sind, damit das Geld rüberkommt«, sagte Wagner mit einem Zwinkern.
»Aber wir haben doch noch keine Ahnung, ob wir mit dem Duschgel punkten werden«, bemerkte Schulz leise.
Wagner lächelte nachsichtig.
»Stell dir vor, du müsstest einen Fünfjahresplan schreiben. Hast du damals gewusst, was im zweiten oder dritten Jahr wirklich abgesetzt wird? Nee, natürlich nicht, deshalb ist’s ja auch ein Plan. Der muss nur plausibel sein und gute Stimmung erzeugen. Die bei der Treuhand müssen davon überzeugt werden, dass wir mit unserem Super S im Osten punkten. Punkt, aus.«
Sie sahen sich in die Augen, Wagner nickte aufmunternd, Schulz standen die Zweifel ins Gesicht geschrieben. Er atmete, als hätte er eine schwere Last auf der Brust.
»Kommt einiges auf uns zu«, brummte er.
Plötzlich schien Wagner eine spontane Idee zu kommen. Mit einem Ruck beugte er sich zu Schulz vor.
»Was hältst du davon, wenn ich als Prokurist bei dir einsteige? Dein Fachwissen und meine Erfahrung im Finanzsektor, das würde doch passen.«
Schulz musterte ihn lange.
»Paul? Hat dich mein Vorschlag verstummen lassen?«, holte ihn Wagner zurück in die Wirklichkeit.
»Äh, nee, kein schlechter Gedanke. Ich habe nur gerade an Frau Lehner gedacht.«
»Für Frau Lehner ist immer Platz in der Leitung«, sagte Wagner trocken. »Und jetzt lass uns gehen. Und vergiss den Wein nicht.«
Schulz sank erschöpft in seinen Sessel und stellte die Weinflaschen auf den Schreibtisch. Hinter halb geschlossenen Lidern ließ er die Ereignisse der letzten Monate Revue passieren. Seit einem Jahr stand ihre Produktion so gut wie still. Niemand wollte ihre Cremes aus den 50er-Jahren, Perlonta, Syxi oder Placenta, kaufen, genauso wenig ihre Parfüms Schwarzer Samt oder Jerry, die noch bis vor Kurzem in die Sowjetunion geliefert worden waren. Nur die Gurkenreinigungsmilch lief noch gut. Er erinnerte sich mit Wehmut an ihren Verkaufsschlager, Trivi, eine Salbe, mit der sich Millionen Sowjetbürger jahrzehntelang ihre Füße eingecremt hatten, um sie vor dem klirrenden Frost zu schützen. Und die werden in Zukunft alle unser Duschgel kaufen? Aufbruch mit Super Sun Shine? Er blies die Wangen auf und betrachtete die Flaschen auf seinem Schreibtisch. Wenigstens ein guter Ausblick. Zwei Rote wären noch besser gewesen. Ein Klopfen an der Tür ließ ihn aufschrecken. Es war halb sieben, um diese Zeit war gewöhnlich niemand mehr im Haus.
»Herein«, rief er und kniff die Augen zusammen. Im Türrahmen erschien Jutta Lehner.
»Darf ich dich kurz stören?« Sie streifte die Weinflaschen mit einem flüchtigen Blick und setzte sich. Schulz ärgerte sich, Wagners Geschenke nicht in seiner Aktentasche versenkt zu haben.
»Was gibt’s, Jutta?«, murmelte er.
»Ich habe gehört, dass sich eine Schweizer Firma für uns interessiert. Stimmt das?«
Wie gewöhnlich kam sie ohne Umschweife zur Sache, und ihre Haltung ließ keinen Zweifel aufkommen, dass sie eine klare Antwort erwartete.
»Woher weißt du das denn schon wieder?«, wich er aus.
»Wagner ist mir begegnet und hat sich nach meinem Befinden erkundigt. Wir haben über die Zukunft geplaudert, und er bemerkte beiläufig, dass eine Firma, irgendwas mit Cent, bei uns einsteigen wird. Wüsste er von der Treuhand. Ist an der Sache was dran?«, fragte sie und ihre Augen sandten klare Warnsignale.
»Die Firma, die sich noch in Verhandlungen mit der Treuhand befindet, heißt Swiss Scent«, korrigierte er sie leise, als vertraute er ihr ein Geheimnis an.
»Aha. Und Herr Wagner erfährt das so eben mal von jemandem aus der Treuhand.«
»Der Jemand ist Wagners Sohn, angehender Jurist, ist gerade im Praktikum bei der Treuhand«, erläuterte Schulz.
»Scent klingt wie Cent«, sagte sie und rümpfte die Nase. »Was heißt das auf Deutsch?«
»Duft«, sagte er trocken, ohne die Miene zu verziehen.
»Da denke ich an Schweizer Käse«, sagte sie ebenso trocken. »Die Berlin Beauty wird also vom Schweizer Duft gerettet?«
»Jutta, wir heben ab, wie die Swissair«, wechselte Schulz den Ton, erleichtert darüber, dass sie nicht weiter nach Wagners Plänen fragte. Hoffentlich mit mir an Bord, sagte sich Lehner und nickte geistesabwesend. Sie dachte gerade an die horrenden Beträge, die sie in den vergangenen Wochen an Wagner’s Consulting überwiesen hatte. Die Tagessätze lagen bei 3.000 Mark, fast ihr Monatsgehalt.
»Bist du unter die Weintrinker gegangen?«, wechselte sie abrupt das Thema und musterte mit geneigtem Kopf die Flaschen.
»Die hat mit Wagner geschenkt, als Gruß ins Wochenende«, sagte er schnell.
»Oder zum Einstand«, bemerkte sie süffisant und hoffte, dass Schulz noch etwas zu den Verhandlungen preisgeben würde. Aber er ging nicht weiter darauf ein und wechselte das Thema.
»Jutta, der Weiße ist für dich. Du magst doch Weißwein.« Sie blinzelte überrascht. Schulz war nicht gerade für seine Großzügigkeit bekannt.
»Oh, da kann ich nicht widerstehen«, sagte sie und wand sich etwas auf dem Stuhl. Sie dachte ans bevorstehende Wochenende und Markus Roth, ihren Nachbarn. Lehners Freund hatte sich vor zwei Monaten verabschiedet, seitdem fühlte sie sich manchmal wie eine Kriegerwitwe. Bald werde ich fünfzig, dachte sie in letzter Zeit immer öfter, wenn sie sich im Spiegel betrachtete.
»Dann genieß den Wein und ab ins Wochenende.«
Sie nickte und hatte es plötzlich eilig.
»Vielen Dank, Paul. Und ich werde beim Trinken an dich denken«, schäkerte sie und deutete einen Knicks an. Er sah ihr grinsend nach und dachte bei sich: Tolles Weib, unsere Buchhalterin.
Ich werde Markus auf ein Gläschen einladen, hatte sie bei Schulz beschlossen. Der sitzt auch jeden Abend allein vor der Glotze. Früher, als er noch mit seiner Freundin Karin zusammengelebt hatte, hatten sie sich gelegentlich zu dritt getroffen. Markus war kein Kostverächter – und zwar in jeder Hinsicht. Das hatte sie einige Male gespürt, wenn Markus’ Blick zu vorgerückter Stunde ihren Minirock gestreift hatte. Eines Tages hatte sie sich im Hausflur beiläufig nach Karin erkundigt und erfahren, dass die beiden sich getrennt hatten. Er war ihr etwas zerstreut vorgekommen, aber Jutta hatte nicht nachgehakt und beschlossen, zunächst abzuwarten, ob vielleicht eine Neue im Spiel war. Eine Neue war nicht aufgetaucht.
Heute werde ich bei ihm klingeln, beschloss sie. Er war als Wissenschaftler an der chemischen Fakultät der Universität angestellt. Soweit sie wusste, beschäftigte er sich mit irgendwelchen Kohlenwasserstoffsynthesen, gehörte dem sogenannten Mittelbau an und zitterte um seinen Job. »Ein Leben wie im Erdgeschoss einer edlen Villa – oben wohnt die Verwaltung«, so hatte er seine Lage einmal beschrieben und hinzugefügt: »Rate mal, wer auszieht, wenn das Geld knapp wird …«
Er war ein Jahr älter als sie, wirkte jedoch mit seiner sportlichen Figur und zupackenden Art ziemlich jung. Also, Jutta, beschloss sie, während sie sich die Lippen nachzog, heute Abend willst du es wissen.
Der Abend begann vielversprechend, denn der Wein rief bei Markus Begeisterungsstürme hervor. Er konnte kaum aufhören, mit der Zunge zu schnalzen.
»Wirklich Extraklasse«, murmelte er immer wieder mit glänzenden Augen, und sie hoffte, dieses Urteil würde sie miteinschließen.