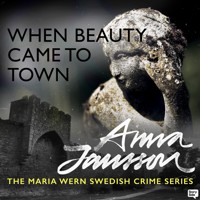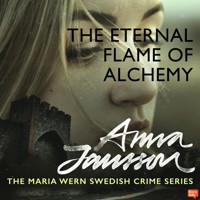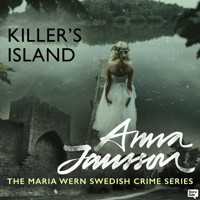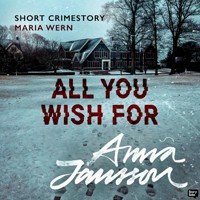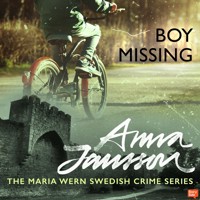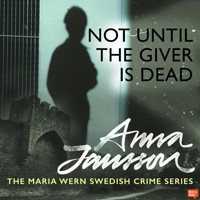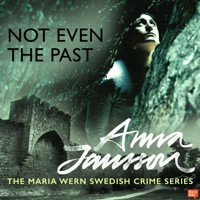Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kriminalinspektorin Maria Wern
- Sprache: Deutsch
Psychologisch ausgefeilt: Der preisgekrönte schwedische Kriminalroman "Tod im Jungfrauenturm" von Anna Jansson als eBook bei dotbooks. Gedankenverloren schlendert Mona Jacobson an einem langen Sommerabend zum Strand der Insel Gotland. Doch wenige Sekunden später ist alles anders – denn sie wird Zeugin, wie ein Mann ermordet wird. Ihr Mann. Es gibt nichts, was sie dagegen tun kann … und es gibt nichts, was sie dagegen tun will. Von nun an liegt ein dunkler Schatten auf Mona: Schuld, Angst und die verzweifelte Hoffnung, dass niemand hinter ihr Geheimnis kommt. Von all dem ahnt Kriminalinspektorin Maria Wern nichts, die auf der idyllischen Ferieninsel eine ruhige Urlaubsvertretung machen soll – und mitten hineingeworfen wird in einen Fall, in dem nichts so ist, wie es scheint … Ausgezeichnet mit dem schwedischen Goldpreis für den bestverkauften Krimi des Jahres: "Anna Jansson lässt eine rätselhafte Stimmung entstehen, die zur reichen historischen Vergangenheit und dem Volksglauben der Insel Gotland passt. Zweifellos hat sie mit diesem Roman einen großen Sprung gemacht", urteilte die Tageszeitung Nerikes Allehanda. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Skandinavien-Krimi "Tod im Jungfernturm" von Anna Jansson ist der dritte Teil ihrer schwedischen Spannungsreihe um Polizistin Maria Wern, die alle Fans von Tove Alsterdal und Camilla Läckberg begeistern werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Gedankenverloren schlendert Mona Jacobson an einem langen Sommerabend zum Strand der Insel Gotland. Doch wenige Sekunden später ist alles anders – denn sie wird Zeugin, wie ein Mann ermordet wird. Ihr Mann. Es gibt nichts, was sie dagegen tun kann … und es gibt nichts, was sie dagegen tun will. Von nun an liegt ein dunkler Schatten auf Mona: Schuld, Angst und die verzweifelte Hoffnung, dass niemand hinter ihr Geheimnis kommt.
Von all dem ahnt Kriminalinspektorin Maria Wern nichts, die auf der idyllischen Ferieninsel eine ruhige Urlaubsvertretung machen soll – und mitten hineingeworfen wird in einen Fall, in dem nichts so ist, wie es scheint …
Ausgezeichnet mit dem schwedischen Goldpreis für den bestverkauften Krimi des Jahres: »Anna Jansson lässt eine rätselhafte Stimmung entstehen, die zur reichen historischen Vergangenheit und dem Volksglauben der Insel Gotland passt. Zweifellos hat sie mit diesem Roman einen großen Sprung gemacht«, urteilte die Tageszeitung Nerikes Allehanda.
Über die Autorin:
Anna Jansson, geboren 1958 auf Gotland, ist gelernte Krankenschwester und begann 1997, Kriminalromane, Sach- und Kinderbücher zu schreiben. Zahlreiche ihrer Krimis um die Kommissarin Maria Wern wurden verfilmt und in Deutschland unter dem Serientitel »Maria Wern, Kripo Gotland« ausgestrahlt. Anna Jansson lebt mit ihrer Familie in Örebo.
Bei dotbooks ermittelt Maria Wern in folgenden Kriminalromanen: »Und die Götter schweigen« »Totenwache« »Tod im Jungfernturm« »Schwarze Schmetterlinge« »Das Geheimnis der toten Vögel«
***
eBook-Neuausgabe April 2018
Die schwedische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Silverkronan« bei Bokförlaget Prisma, Stockholm.
Copyright © der Originalausgabe 2003 Anna Jansson
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2006 Piper Verlag GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Bildmotives von shutterstock/schankz und shutterstock/Loneroc
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-130-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Tod im Jungfernturm« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anna Jansson
Tod im Jungfernturm
Ein Fall für Maria Wern – Band 3
Aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann
dotbooks.
Die Wissenschaft ist nur eine vorläufige Annahme in Erwartung neuer Entdeckungen. Dies ist meine Version der Geschichte über das Moor von Martebo und Knutstorp. Wenn ich hier und da an den üblichen Wahrheiten etwas gedreht habe, dann geschah das nur, um die Wahrheit ein wenig wahrheitsgetreuer erscheinen zu lassen.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen! Anna Jansson
Träumer, Verrückter – was gab sie dir zur Morgengabe, die Fee an deiner Wiege? Alles, was in Verbrechen und Leid entbrennt, alles, was du von Schimpf und Schande gekannt, alles, was die Träume versprechen, alles, was der Glanz der Sterne vortäuscht, alles, was noch nie die Welt gesehn, das bindest du dir zu einem Trauerkranz ... – wenn die Glocken läuten, die dumpfen, dann gehst du dahin mit deinem Reichtum und legst dich nieder zum Schlafen.
Aus der Gedichtsammlung »Gesänge eines Totentänzers« von Nils Ferlin
Kapitel 1
Wenn das Fernsehprogramm am Samstagabend eine andere Auswahl an romantischen Filmen geboten hätte, dann wäre Mona Jacobsson nicht der Beihilfe zum Mord verdächtigt worden. Wahrscheinlich wäre sie auch nicht von einer Schlange gebissen worden.
Doch jetzt trat sie in die Sommerdämmerung hinaus, knöpfte die selbstgestrickte, hellblaue Jacke zu und atmete ein paarmal tief ein. Die Luft war kühler, als sie angenommen hatte, als sie am Küchenfenster gestanden und über den Friedhof geschaut hatte. An der weißgekalkten Hauswand rankten die Kletterrosen in rotgelben Kaskaden zum Ziegeldach hinauf. Die Pfingstrosen standen verblüht und schmutzigbraun in den Beeten, sie waren verbraucht wie das flüchtige Grün des Frühsommers. Sie mußte dringend im Erdbeerbeet Unkraut jäten, und der Kiesweg wuchs auch schon wieder zu, doch das mußte alles warten. Es gab jetzt viel zu tun, doch sie hatte nicht die Kraft, es anzupacken.
Leicht, aber unbestechlich warf die Zeit ihren schwarzen Schatten auf die Sonnenuhr im Rondell. Jeder Tag enthielt genug eigene Schwere, eigene Qual. Zumindest hatte sie schon mal die Wäsche aufgehängt. Die grauweißen Bettücher flatterten im Wind, in der Mitte schon fadenscheinig. Nächte unruhigen Schlafs hatten ihre Spuren hinterlassen. Die unsichtbare Hand des Windes zog und zerrte an ihnen, rief zum Abenteuer eines wirbelnden Tanzes über die nächtlichen Wiesen. Doch die festen Wäscheklammern sorgten dafür, daß alles beim alten blieb, bei der zuverlässigen Ordnung des Grau.
Und dennoch lag ein Sehnen in der Luft, das spürte sie jetzt, ein Sehnen nach Sinnlichkeit. Vielleicht verbarg es sich im Rosenduft, der über den Garten zog, oder im ablandigen Wind, der sich nicht schämte, an ihre nackten braunen Schenkel zu rühren, oder in der Haut, die bei der Berührung eine Gänsehaut bekam, in dem spielerischen Streichen über die Haare. Doch Mona ahnte noch nicht, wohin ihre Sehnsucht sie an diesem Abend tragen würde.
Der Kiesweg zum Meer hinunter war von Roggen- und Rapsfeldern gesäumt. Im Graben neben dem Weg prangten Mohn, Gemeiner Natterkopf und Margeriten. Vom Kalkstaub gepudert, leuchteten sie samtig in der Abendsonne. Die fülligen Lippen der Löwenmäulchen verbargen Wollust, einen berauschenden Nektar.
Wenn die Sehnsucht einen Geruch hat, dachte sie, dann ist es eine Mischung aus wildem Thymian nach dem Regen, Wiesenblumen und Meersalz. So hatte es gerochen, als er sie zum erstenmal auf der Wiese am Strand im Schutz eines alten, verlassenen Schuppens und einer Steinmauer genommen hatte. Er hatte sie wegen ihrer runden, hellblauen Augen Zichorienauge genannt. Sie war so verzweifelt jung gewesen, und seine Worte so schön und so anders. Die Worte hatten ihre Haut schon eingefangen und gestreichelt, lange ehe seine Hände sie berührten. Sie hatten ihre Augen mit Glanz und ihren Körper mit Sehnsucht erfüllt. Die Kühle der Nacht gegen die Hitze der Haut. Die Küsse, denen man nicht widerstehen konnte und die sie unweigerlich weitertrieben. Seine Hand, die zielgerichtet die Taille des Kleides aufknöpfte und sich einen Weg in ihre Unterhose bahnte. Erfahrene Finger, die wußten, was sie suchten. Der Tau, der fiel. Ihr Nein, das zu einem Ja verführt wurde. Sie sah seine Hose auf dem Stein. Wir müssen vorsichtig sein. Ein flüchtiger Gedanke nur, der von der Begierde des Augenblicks verschluckt wurde. Die unscharfen Züge des Gesichtes im Schatten über ihrem. Schmerz, mit Genuß vermischt. Seine entspannte Schwere, eine feuchte Kälte, die sich über dem Körper ausbreitete.
Und als er sich gerade aus ihr zurückziehen wollte, rief jemand von oben vom Weg. Vater? Sie hatten sich dicht aneinander gepreßt. Still! Sein Arm war in einem festen Griff um sie erstarrt. Das Gehör war zum äußersten geschärft. Näherten sich die Schritte? Sie hatte den Herzschlag ihres Geliebten durch ihre Haut gespürt und nicht zu atmen gewagt. Wieder die Stimme, Vaters Stimme. Jetzt lauter. Sie hatte vor Angst geweint. In stiller Verzweiflung hatte sie zwischen Margeriten und Glockenblumen nach ihrer Unterhose gesucht. Auf dem Kleid war ein Blutfleck. Die Stimme erstarb, wie auch das Geräusch der Fahrradreifen auf dem Kies.
Sie hatte ihr Kleid in der weißen Mondstraße des Meeres gründlich ausgespült, ehe sie durch die Sommernacht nach Hause lief. Die Tanzmusik vom Fest am Djupviken verklang allmählich. Die Haustür war schon zur Nacht verschlossen, aber sie hatte den Reserveschlüssel an seinem Platz über dem Türpfosten im Waschhaus gefunden. Die Treppe hatte geknarrt, als sie sich voller Angst in ihr Zimmer geschlichen hatte. Als Vater die Tür aufmachte, lag sie steif und furchtsam unter der Decke, versuchte die Augen unter den dünnen Lidern still zu halten und ihre wilden Atemzüge zu beherrschen. Sie hatte zu Gott gebetet, daß Vater das Kleid nicht sehen und nicht an die feuchte Stelle fassen würde.
Und dieses Mal hatte sie Glück gehabt. Der Stoff war über einem Stuhl im Mädchenzimmer getrocknet. Als die Morgensonne die Blümchentapete beschien, war von dieser Nacht keine Spur mehr zu sehen. Aber es war nicht das letzte Liebestreffen auf der Wiese gewesen, ganz im Gegenteil. Ihre Sehnsucht schuf sich aus dem flüchtigen Wesen des Geliebten einen Gott, in dessen Gegenwart alles möglich war. Unter seinen Händen verwandelte sie sich in eine der Beneidenswerten jenseits der Grenze, in eine, die etwas taugte. Und das war alles, was sie damals wollte.
Wenn in dieser Sommernacht ihre Sehnsucht nach dem, was einmal gewesen war, sie nicht so stark heimgesucht hätte, dann wäre sie nicht Zeugin eines Mordes geworden. Aber die Lust, an eben diesem Abend den Ort zu sehen, an dem sie sich geliebt hatten, lenkte ihre Schritte zum Meer. Als die grauen Strandhäuschen ihr die Sicht freigaben, konnte sie unten am Wasser die schwarze Silhouette eines Mannes sehen. Sie legte die Hand über die Augen und blinzelte gegen die Sonne. Der ablandige Wind wehte ihr das Haar übers Gesicht, und eine Haarsträhne kitzelte sie an der Nase. Seine Bewegungen, als er seinen Kahn verließ und mit der schweren Zinkwanne im Schoß an Land schwankte, waren ihr wohlbekannt. Hering natürlich, niemals etwas anderes. Ab und zu eine Flunder, aber auch das immer seltener. Wilhelm blieb oben am Kiesweg stehen, stellte den Trog ab, nahm die Pfeife aus der Tasche und klopfte sie am Absatz aus. Gerade wollte sie ihren Mann rufen, als sie sah, daß er jemand anderen begrüßte. Dabei nickte er, indem er den Kopf in den Nacken warf, daß der Schirm seiner Mütze einem stoßenden Entenschnabel glich.
Sie blieb im Schatten. Der Wind riß an ihrem Körper und suchte sich seinen Weg in Jacke und Kleid. Sie hörte das Gespräch, das immer heftiger wurde, konnte aber die beiden nicht mehr sehen. Die Stimmen wurden leiser und unverständlicher und der Zorn immer größer. Die Worte machten ihr Angst, und sie kauerte sich, die Wange an der Hauswand, auf den Boden. Was hatte sie hier zu suchen? Die Tür zum Strandhäuschen schlug zu. Die Worte, die draußen blieben, ließen die Luft erzittern. Sie zogen sie an, obwohl sie, angeekelt vor Angst, in diesem Moment ahnte, was es bedeuten würde, wenn man sie entdeckte. Der Fischereianleger war menschenleer, die Touristen waren in ihre Unterkünfte gekrochen oder hatten sich aufgemacht, um sich in Visby zu vergnügen. Außer der Frau, die unter dem Fensterbrett zusammengekauert saß, gab es nur noch die beiden Männer, die Gier und den Tod.
Die Dunkelheit legte sich auf sie, als die Abendsonne im Meer versunken war und nur eine schmale Goldkante am Horizont hinterließ. Die Möwen schwiegen. Die Wellen glätteten sich. Da drin wurde eine Petroleumlampe angezündet, erst flackerte das Licht, dann wurde die Flamme ruhig. Die Männer standen einander gegenüber. Beide gleich groß, starrten sie sich in die Augen und maßen die Stärke des anderen. Die Kaumuskeln spielten, die Augen wurden schmal. Sie tanzten in langsamen kreisenden Bewegungen mit ausgebreiteten, leicht gebeugten Armen umeinander. Das hatte sie schon einmal gesehen, und es hatte keinen Sinn, dazwischen zu gehen. Wie wenn sich Kater bekämpfen und zu einem Knäuel aus Krallen und schneidend scharfen Zähnen werden, war es auch hier besser, sich fernzuhalten.
»Warum siehst du nur so verdammt dämlich aus!« Sie sah, wie sich Wilhelms Finger im Würgegriff um den Hals des anderen legten. Die unerwartete Verhöhnung, die durch die Luft fuhr, befreite ihn aus dem Griff.
»Du trägst die Verantwortung. Begreifst du, was du getan hast?« Das Flüstern drang genauso deutlich durch das Fenster wie die wütenden Rufe.
»Rede du mir nicht von Verantwortung!« Wilhelm schlug mit der Feuerzange zu, die er aus dem Holzkorb gezogen hatte. Aber dann war er einen Moment unaufmerksam, und ein kraftvoller Schlag traf sein Ziel. Wilhelm schwankte und fiel zu Boden. Dann wurde es still. Ohne nachzudenken stand sie auf und sah ihn zusammengesunken auf der Fußmatte liegen. Ein weiterer Schlag mit dem Schürhaken traf seinen grauen Kopf.
Sie mußte geschrieen haben. Hinterher erinnerte sie sich nicht mehr genau, alles geschah so schnell. Der Schrei im Kopf war so groß, vielleicht drang er nach draußen. Die Beine waren unter ihr zusammengesackt, als sie hätte weglaufen sollen. Jetzt war sie zur Mittäterin geworden. Zusammen sahen sie das Leben aus dem runden rosigen Gesicht weichen. Ungerührt sahen sie zu, wie es geschah. So greifbar und gleichzeitig unwirklich zu sehen, wie das Leben aus einem wohlbekannten Menschenkörper entwich. Ein Mensch, der eben noch geredet und seine Hände gebraucht hatte. Mona hatte in ihrer Arbeit Hunderte von Malen den Tod kommen sehen, als ein unvermeidlicher Teil des Lebens und manchmal als Befreier. Doch niemals in dieser Gestalt.
»Ich wollte ihn nicht töten!« Er drehte ihr Gesicht nach oben, sah, wie sich seine eigene Angst in ihrem Blick spiegelte. Als sie nicht antwortete, nahm er sie bei den Schultern und schüttelte sie. Sie schluckte und versuchte etwas zu sagen. Die Gedanken schwollen an und wurden zu groß für die Worte.
»Nein«, flüsterte sie. »Nein.«
Ihr eigener Gedanke war wie das Pendel der Schlafzimmeruhr im Augenblick des Todes stehengeblieben. Ein wiederkehrender Traum. Wer die Kraft besitzt, lenkt die Zeit. Sie hatte die Mordwaffe in die Hand bekommen. »Wirf den Schürhaken ins Wasser«, hatte er gesagt. Wenn sie es gewagt hätte, hätte sie in der Dunkelheit auf den Steg hinausgehen müssen, aber die Beine wollten ihr nicht mehr gehorchen als die Gedanken. Sie blieb allein draußen bei den Netzen stehen, wie ein bebender Schatten unter einem übermächtigen Sternenhimmel.
Anselms Fahrrad lehnte an der Wand des Häuschens. Unter dem Sattel befand sich eine Werkzeugkiste. Dort hinein steckte sie den Schürhaken und spannte den Lederriemen wieder fest. Die Kiste paßte ganz genau. Die Hände führten die Arbeit wie von selbst aus. Dann kam er hinaus, nahm das Fahrrad und fuhr, noch ehe sie nachdenken konnte, nach Hause, um Wilhelms Opel zu holen. Vielleicht hätte sie ihm sagen sollen, was sie mit dem Schürhaken gemacht hatte, aber sie wagte es nicht. In seinen Bewegungen war eine große Wut.
Sie schleppte sich willenlos mit der Last eines Menschenkörpers über den dunklen Hof mit den Netzen. Sie stolperte über Büschel von welkendem Natternkopf und spürte, wie ihre Arme langsam unter dem Gewicht der kräftigen Schenkel des Toten abstarben. Seine Stiefel scheuerten an ihrer Hüfte. Schritt für Schritt rieben und schabten sie durch den dünnen Stoff. Sie spürte den Geschmack von Metall im Mund. Der Mann, der die Kraft besaß, ging vorweg und trug den Toten unter den Achseln. Sie stolperten den Weg zum Auto hinauf und warfen das Opfer wie ein schweres Bündel in den Kofferraum seines eigenen Autos.
»Du fährst.« Er legte sich vor dem Rücksitz auf den Fußboden. Ihr Körper gehorchte automatisch, die rechte Hand legte den Gang ein. Die linke Hand zitterte auf dem Lenkrad, zitterte wie der restliche Körper von der Kälte, die von innen kam. Sie verließen den Fischereianleger in Eksta und fuhren die Küstenstraße zur Stadt entlang. Nicht nur Angst und Handlungsunfähigkeit machten sie zur Mittäterin, sondern auch Liebe. Und dennoch erstaunte es sie, daß er das für so selbstverständlich nahm, daß er ganz klar damit rechnete, daß sie seine Schuld mittragen würde.
Sie konnte im Dunkeln nur schlecht sehen. Die Brille lag noch auf der Fernsehzeitung neben der Fernbedienung und der leeren Tüte mit Süßigkeiten. Wie in einer anderen Zeit, in der noch nichts geschehen war. Sie konnte immer noch den salzigen Geschmack von Lakritz in ihrem Mund verspüren. Wenn sie nun in denselben Raum zurückkehrte, dann wäre alles unverändert und doch grundsätzlich anders. Durch das Schreckliche war sie selbst eine andere geworden. Wenn es einen guten Film im Fernsehen gegeben hätte, dann wäre sie nicht zum Strand gegangen. Dann hätte sie um diese Zeit in ihrem Bett gelegen, den Wecker gestellt und das Licht gelöscht. Das Seltsamste war, daß sie sogar ein Gefühl der Lust beschlichen hatte, eine Wärme in ihrem Schoß, als sie am Weggraben gestanden und die Löwenmäulchen angeschaut hatte.
Gerade erst. Wie seltsam! Wie hatte sie wieder von den Stelldicheins gelockt werden können, die doch in Entdeckung und Scham geendet hatten? Jetzt, im Dunkel des Autos, unter der Last von Angst und Schuld, war das unbegreiflich. Wie war doch ihr Leben von diesen Gefühlen angefüllt – Angst und Schuld. Manchmal hatten sie sich betäuben lassen, aber immer nur für einen Augenblick. Im Laufe der Jahre waren sie wie siamesische Zwillinge ohne eigenes Herz mit ihrem eigenen Ich zusammengewachsen.
Angst und Schuld. Vater hatte sie ins Gesicht geschlagen, ihre Haare fest gepackt und ihren Kopf gegen das Bettgestell gedonnert, bis sie keine Luft mehr kriegte. »Du verdammtes Balg bist an meiner Brieftasche gewesen!« Das stimmte. Die letzten Bonbons hatten nach Angst geschmeckt. Die letzten beiden. Die übrigen hatte sie verteilt, um dabei sein zu dürfen, um eine von ihnen sein zu dürfen, wenn auch nur für einen Augenblick. Sie hatte nicht damit gerechnet, daß Anselm es merken würde. Schließlich hatte sie immer nur ganz wenig genommen. Sie versuchte, sich vor seinem Mundgeruch zu schützen. Er stank nach Suff. Seine verzerrten Gesichtszüge vibrierten auf der Netzhaut. »Steh auf, wenn ich mit dir red! Seh mir inne Augen!« hatte Anselm gebrüllt. Sie hatte sich gezwungen, das Kinn hochzunehmen, und im selben Moment gespürt, wie ihr etwas Warmes und Feuchtes an den Beinen entlanglief. »Verdammtes Balg, stehste da und pißt dich ein! Ich werd's dir zeigen ...« Ein Schatten, der ihre Mutter war, ging dazwischen und wurde zu Boden geschlagen. Ein gequältes Weinen, ein heulender Schlag, der mit einem krachenden Geräusch niederdonnerte. Die alles übertönende Stille. Mona hatte es geschafft, hinauszukriechen und sich unter der Steintreppe zu verstecken. Vor Furcht erstarrt hatte sie den Schrei und den Schlag von drinnen gehört, unfähig, der zu helfen, die sie gerettet hatte.
Das war die schwerste Schuld. Daß der Mut sie so völlig verlassen hatte. Eine wütende Männerstimme, und sie wurde zu einem nassen Fleck auf dem Fußboden. So war es immer noch. Sie dachte an das Bündel da im Kofferraum. Wenn Wilhelm nun nicht richtig tot war! Wenn er sich im blinden Zorn auf sie stürzte, sobald sie den Kofferraum aufmachte. Nein, es war kein Pulsschlag mehr an seinem Hals gewesen. Das Leben war aus seinen Augen gewichen. Zwei Schläge, ein tödlicher und einer zur Sicherheit, das sollte für immer und ewig genügen.
Sie bog auf den Kiesweg ein, blieb am vereinbarten Ort stehen und zog sich die Arbeitshandschuhe an, genau wie der Mann, dem sie zu Willen war. Sie schleiften den Toten über die Kante und gingen dann im Mondlicht den Weg weiter. Sie bewegte sich unsicher in ihren dünnen Sandalen vorwärts. Der Mann, der vor ihr ging, ließ ihr aus Versehen einen Ast ins Gesicht schnellen. Es tat nicht weh auf der Haut, sondern fühlte sich eher an wie neue, weiche Tannensprößlinge. Die Angst war der Auslöser für den Schmerz. Dies war der Tropfen, der die Tränen überlaufen ließ und sie blind machte. Er ermahnte sie, leise zu sein, blieb stehen und horchte. Doch da waren nur die Geräusche der Nacht, der Wind in den Baumwipfeln, das Geraschel der kleinen Tiere im hohen Gras und das fast unmerkliche Rollen des Meeres an den Strand. Das Weinen, das in die Kehle zurückgedrückt wurde, übertönte sie alle. Sie hatte sich gewünscht, daß er sie umarmt hätte, doch das konnte er wahrscheinlich nicht. Dann hätten Härte und Entschlossenheit nachgelassen.
Sie trugen Stein um Stein in den Händen. Bedeckten den Körper, bis das Mondlicht den Toten im Grabhügel nicht mehr erreichen konnte. Und da passierte es: Als sie sich gerade nach dem letzten Stein streckte und ein Stück den Steinhaufen hinaufstieg, spürte sie den Schmerz. Den Schmerz, der sie später verraten und zur Anklage führen würde. Ein schwacher zischender Laut. Sie bemerkte es kaum. Dann das Brennen am Bein und das Rasseln, als der schuppige Körper mit seinem Zickzackmuster versuchte, sich davonzuschlängeln. Sie stand auf seinem Schwanz. Die Schlange erhob den Kopf erneut und wandte sich ihr zu. Unbeweglich beobachteten sie einander. Dann schwang das Tier den Körper hin und her und kam mit seiner spielenden Zunge auf sie zu.
Sie stampfte auf und hörte, wie der Kopf zwischen den Steinen und der zerschlissenen Sohle der Sandale zerquetscht wurde, spürte, wie er unter dem Schuh nachgab. Schreiend lief sie ins Gebüsch und hielt sich die Hände schützend vors Gesicht, versuchte, den Weg heraus zu finden, während ihr die Bilder vor den Augen flimmerten. Grauschwarze Äste zerkratzten ihre Beine. Die feste Faust über dem Mund brachte sie zum Schweigen. Er strich ihr übers Haar. Da nahm sie die Hand hoch, um seine Wange zu streicheln. Sie war schweißnaß.
»Ich wollte ihn nicht töten.«
»Nein.«
Er hielt ihr Gesicht jetzt mit beiden Händen, sah ihr lange in die Augen und überdachte seinen Entschluß.
»Was ich jetzt tun werde, wirst du nicht sehen wollen. Warte am Auto auf mich.«
»Ja.« Sie fragte nicht nach. Wagte es nicht. Schaffte es auch nicht. Seine Gesichtszüge waren im Mondlicht so hart. Das Kinn und die kräftige Nase leuchteten weiß. Die Augenhöhlen lagen tief im Schatten unter den Augenbrauen. Die scharfe Klinge glänzte im Mondlicht. Mona sah es aus dem Augenwinkel, ohne es wirklich zu bemerken. Es stimmte. Sie wollte nicht wissen, was er vorhatte.
Im Licht der ersten Dämmerung ließ er sie an der Kreuzung in Eksta raus und fuhr, um ihr Werk so zu vollenden, wie es sein mußte.
Kapitel 2
»›§ 15. Wenn jemand einen anderen überfällt und ihm beide Hände abhackt oder beide Füße oder ihm beide Augen aussticht, und der Mann dann noch lebt, dann sollen für jedes davon zwölf Silbermark gezahlt werden. § 16 Wenn einem die Nase so abgeschnitten wird, daß er Schleim und Rotz nicht zurückhalten kann, dann soll er ebenfalls zwölf Silbermark bekommen. § 17 Wenn einem die Zunge aus dem Kopf gezogen und abgeschnitten wird ... zwölf Silbermark. § 18 Wenn ein Mann am Geschlecht so verletzt wird, daß er nicht mehr der Vater von Kindern werden kann, dann gibt es sechs Silbermark für jeden Stein ... Wenn es so abgeschnitten ist, daß der Mann seine Notdurft nicht anders verrichten kann als wie eine Frau im Sitzen, dann soll er achtzehn Silbermark bekommen.‹ So steht es im Gutalag.« Vega Kraft ließ das Gesetzesheft auf ihre Knie sinken und schlürfte von der Untertasse, die sie geschickt auf drei Fingern balancierte, Kaffee in sich hinein, nahm noch ein Zuckerstück zwischen die Lippen und hob die Untertasse wieder zum Mund. Ihr kräftiges weißes Haar war mitten auf dem Kopf zu einem dicken Knoten gedreht, der bei jeder Bewegung mitwippte.
»Das klingt ja nicht gerade angenehm.« Kriminalinspektorin Maria Wern betrachtete ihre Vermieterin etwas verwirrt und wechselte einen raschen Blick mit ihrem Kollegen Tomas Hartman.
»Angenehm? So wie die miteinander umgingen, kann man verstehen, warum man vom finsteren Mittelalter spricht. ›Wenn du einem die Zähne ausschlägst, dann zahlst du für jeden Zahn, was er wert ist.‹ Das klingt in meinen Augen wie die Regeln bei Monopoly, wo Dinge nur geschehen, weil sie gewürfelt wurden – unweigerlich schneidet man jemandem die Zunge raus. Der Preis steht dann schon fest, auch wenn man in der Schloßstraße landet. Wenigstens kann man daran erkennen, daß die Zivilisation sich schon weiterentwickelt hat, denn das Gutalag ist Mitte des 14. Jahrhunderts niedergeschrieben worden. Ich dachte nur, es könnte gut sein, wenn ich euch mal das Gesetz vorlese, ehe ihr auf Streife geht. Gotland ist eine alte Bauerngesellschaft, die immer nach einer gewissen Autonomie gestrebt hat. Aber jetzt nehmt doch noch was. Du hast mein Schmalzgebackenes noch nicht probiert, Tomas. Bitte schön.«
Kriminalinspektor Tomas Hartman streckte folgsam die Hand nach dem überquellenden Kuchenteller aus und sah verstohlen zu Maria hinüber. Vielleicht schämte er sich ein wenig für seine Tante Vega. Ihr Hang zum Makabren konnte manchmal etwas anstrengend sein, und war sie erst mal in Fahrt, war sie nicht so leicht zu bremsen.
»Klinten ist wirklich eine nette Gegend.
Maria ließ ihren Blick auf Geißblatt und Rosen ruhen, die am gelben Zaun zur Norra Murgatan hinaufkletterten. Sie hingen in langen Ranken über das Fenster zur Dachwohnung, die sie für ein paar Sommerwochen gemietet hatte. Auf der gegenüberliegenden Seite erhob sich als Grundstücksgrenze hoch und grau die Stadtmauer, die dem Farnkraut Schatten spendete. Der kleine mit Kies bestreute Innenhof, auf dem sie saßen, war zu beiden Seiten von niedrigen Holzhäusern gesäumt. Sie gehörten Vega, die das eine über den Sommer vermietete, die untere Wohnung an Hartman und die obere an die Familie Wern.
Hartman hatte Maria im Vertrauen zugeflüstert, er und seine Frau hätten beschlossen, die schwierigsten Verwandten jeweils allein zu besuchen. Das schonte die Ehe. Dadurch, daß er während des Sommers ein paar Wochen auf Gotland arbeitete, konnte er nun zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Maria verstand das gut und nickte zustimmend. Die Küchentür stand offen, und im Schatten lag hechelnd ein Pudel mit gekreuzten Pfoten. Tjelvar, Vegas Augenstern.
»Nett? Haha! Früher wohnten hier nur Nichtsnutze und anderes Pack, Landstreicher und loses Gesindel. Hier auf den Klippen herrschten Flöhe, Läuse und Tuberkulose. Und das wurde nicht besser dadurch, daß der Schurke von Henker hier wohnte. Es war ein mittelalterliches Ghetto. Die Häuser sehen immer noch aus, als wollten sie vor Scham in den Boden versinken. Für einen erwachsenen Mann ist es nicht ganz einfach, hier durch die Türen zu gehen, Sie haben ja gesehen, wie Tomas den Nacken beugen mußte. Aber jetzt findet man die Gegend attraktiv. Wenn man die Norra Murgatan weiter hinaufgeht, dann kommt man zum Schurkenhügel, ein Stück weiter nach Norden haben wir den Galgenberg mit seinen drei Steinsäulen. Ich denke, das könnte ein inspirierendes Ausflugsziel für Gesetzeshüter sein. Einfache Bauerntölpel wurden auf dem Galgenberg gehängt, feineren Leuten schlug man auf dem Marktplatz den Kopf ab. Frauen kamen auf den Scheiterhaufen, wurden gesteinigt oder lebendig begraben. Sie aufzuhängen hielt man für unanständig, denn dann hätte man ja einen anstößigen Blick unter ihren Rock werfen können. Auf dem Weg hierher seid ihr ja über den Marktplatz gefahren, dort stand neben der alten Feuerwache der Pranger. Da wurden die Verbrecher in Halsketten gelegt, ausgepeitscht und dem allgemeinen Spott ausgesetzt. Dennoch war man in Visby recht mild in der Bestrafung und nicht so schnell mit der Todesstrafe zur Hand. Darf es noch eine Kleinigkeit zum Safranpfannkuchen sein, Maria? Vielleicht Multbeerkompott? Jetzt sparen Sie mal nicht so mit der Sahne und kasteien Sie sich nicht so. Lassen Sie Ihren inneren Schweinehund los und gönnen Sie sich etwas vom Guten, das das Leben zu bieten hat, das sage ich Ihnen. Butter und Sahne, bequeme Schuhe und Kleider, die nicht so eng sitzen. Ich esse, was ich will und wann ich will, aber gut muß es sein! Ich glaube ja nicht, daß die Männer solche Klappergestelle wollen. Da muß schon etwas zum Anfassen dran sein, nicht wahr, Tomas? Butter und richtige Sahne braucht man, das macht die Haut glatt und seidig.«
»Darüber habe ich noch nicht soviel nachgedacht«, antwortete Hartman diplomatisch. »Meine Frau sagt, die meisten Selbstmorde werden mit Messer und Gabel begangen.« Noch ehe er den Satz vollendet hatte, bereute er seine Worte. Aber zu spät.
»Es kann keinen Spaß machen, wie Marianne nur von Salatblättern zu leben. Kaninchenfutter.« Vega sah Hartman herausfordernd an, und der war in diesem Moment sehr froh, daß seine Frau nicht anwesend war. Sätze wie diese führten nämlich direkt in einen kalten Krieg.
»Das einzige, was mich am Gutalag richtig wütend macht, ist der Abschnitt über die Belästigung von Frauen«, fuhr Vega fort, als sie keinen Widerspruch hörte. »Pfui Teufel! Wenn man das liest, ist einem gleich klar, daß diese Gesetze von Männern gemacht wurden, und zwar von eingebildeten Chauvinisten! Da sieht man, wie fadenscheinig die mittelalterliche Ritterlichkeit war. Ein dünner Schleier der Romantik, hinter dem sich in Wirklichkeit nur eine tiefe Frauenverachtung verbarg. Die Sünde kam durch die Frau in die Welt, die dem armen Mann einen Apfel aufgeschwatzt hatte. Da siehst du es, Tomas, man kann mit Obst und Grünzeug gar nicht vorsichtig genug sein!«
»Was steht denn da?« fragte Maria.
Hartman bedachte sie mit einem abwehrenden Blick. Vega schob die Brille auf die Nase und hielt das Gutalag hoch. Diese Passage kannte sie auswendig.
»›Wenn du sie an der Schulter faßt, Strafe: fünf Örtugar. Faßt du sie an die Brust, Strafe: ein Öre. Faßt du sie um den Knöchel, Strafe: eine halbe Mark. Faßt du sie zwischen Knie und Wade: acht Örtugar. Faßt du sie noch höher, dann ist das der schamlose Griff, auch der Griff eines Verrückten genannt, da gibt es keine Geldstrafe, denn die meisten ertragen es, wenn man soweit gekommen ist.‹ Pfui Teufel, sage ich. So sind sie, die Männer, kein Wunder, daß man nie geheiratet hat. Wenn man sein ganzes Leben lang als Bademeisterin im Warmbadehaus gearbeitet hat, dann hat man alles gesehen, was man braucht, und noch etwas mehr. Aber Sie sind ja verheiratet.« Vega schenkte Maria einen hochmütigen Blick des Mitleids. »Er kommt wahrscheinlich später, Ihr Mann, oder?«
»Ja, Krister und die Kinder kommen nächste Woche nach Gotland, das hoffe ich jedenfalls. Kristers Mutter ist überraschend krank geworden, es ist das Herz. Deshalb sind sie in Kronviken geblieben, sonst wären wir gemeinsam hierhergekommen
»Ist es denn klug, in den Ferien zu arbeiten?« fragte Vega und sah von Maria zu Hartman.
»Wenn man kein Geld hat, hat man keine andere Wahl. Wir haben ein altes Holzhaus gekauft, das große Summen verschlingt. Ich denke, das Wichtigste ist jetzt renoviert, aber für eine Reise ist nichts mehr übriggeblieben. Also habe ich eine Sommervertretung auf Gotland angenommen, damit meine Familie in der Zeit hierherkommen und Ferien machen kann.
»Dann seid ihr also dieses Jahr vier Polizisten vom Festland. Wo wohnen denn die anderen?«
»Arvidsson und Ek haben irgendwo im Feriendorf Kneippbyn ein Häuschen gemietet«, sagte Hartman.
»Beim Pippi-Langstrumpf-Haus? Das ist doch nichts für erwachsene Männer!«
»Es gibt da eine Wasserrutsche.«
»Ach so, das erklärt alles.« Vega schob ihre Brille auf die Stirn, blinzelte gegen die Sonne und lehnte sich zurück, so daß die Gartenbank knackte. »Wieso arbeitet denn eine Frau bei der Polizei?« Sie verschränkte die Arme vor der Brust und ließ Maria nicht aus den Augen.
Tomas Hartman wand sich gequält. Erst hatte er es ja eine großartige Idee gefunden, sich bei Vega einzumieten, aber jetzt war er da nicht mehr so sicher. Er hatte vergessen, wie geradeheraus und fast distanzlos sie in ihrer Neugier war. Er selbst war sie ja schon von Kindesbeinen an gewohnt, doch nun, da Maria neben ihm saß, sah er seine Tante mit anderen Augen. Aber es galt, das Beste aus der Situation zu machen, und Hartman empfand es deshalb als seine Pflicht, an Marias Stelle zu antworten.
»Ich denke, daß Frauen aus demselben Grund zur Polizei gehen wie Männer: der Glaube an die Gerechtigkeit, das Gefühl, etwas zu tun, das für andere gut ist, etwas Notwendiges.«
»Ich kann nicht für alle sprechen. Aber ich habe schon in der neunten Klasse beschlossen, zur Polizei zu gehen«, warf Maria ein.
»Und warum?« Vega hielt mit ihrer Untertasse auf halbem Weg zum Mund inne und lächelte zum ersten Mal. Sie hatte gerade nach einer kritischen Musterung beschlossen, diese Festlandpflanze zu mögen, auch wenn sie nicht sonderlich gut mit der Sprache zurechtkam.
»Wir sind nach Uppsala gezogen, als ich gerade ins Gymnasium kam. Ich war neu und schüchtern und habe komisch geredet. Die Mädchen in der Klasse, in die ich kam, waren für ihr Alter schon ziemlich weit, tranken an den Wochenenden Alkohol, rauchten heimlich und trafen sich mit Jungs. Ich hingegen war noch ziemlich kindlich. Was als Außenseitertum begann, wurde zu einem regelrechten Mobbing. Meine Mutter, die zu jener Zeit politisch aktiv war, hatte eine Reihe von kritischen Artikeln verfaßt, und ihre Ansichten waren nicht nach dem Geschmack aller Eltern der Klasse. Somit wurde ich zu einem willkommenen Opfer. Wenn man einen Erwachsenen mit den Schimpfworten bedenken würde, die man mir in der Schule nachgerufen hat, dann wäre das eine grobe Beleidigung. Doch für Kinder gelten andere Regeln. Würde ein Erwachsener in den Vorratskeller eingesperrt, dann wäre das Freiheitsberaubung. Würde man einem Erwachsenen mit Zigaretten Brandwunden zufügen oder das Haar mit dem Feuerzeug abbrennen, dann wäre das eindeutig Körperverletzung. Nun betraf das aber ein Kind und wurde deshalb als grober Scherz heruntergespielt. Ich bin nicht einmal zur Abschlußfeier nach der Neunten gegangen.«
»Das hast du mir nie erzählt.« Hartman legte seine große, breite Hand auf die von Maria, lehnte sich vor und sah ihr in die Augen.
»Nein, das habe ich nicht. Es ist auch nicht so einfach. Einmal habe ich in der großen Pause gesehen, wie sie einen kleinen Jungen auf die Toilette zerrten. Sie haben ihn gezwungen, sich auszuziehen. Er war nicht größer als mein kleiner Bruder, und er hat vor Scham geweint. Ich wurde so wahnsinnig wütend, daß in dem Moment alle Angst von mir wich. Ich habe sie in ihre grinsenden Gesichter geschlagen, habe getreten und geschrieen. In meiner blinden Wut habe ich auch aus Versehen die Lehrerin geschlagen, die kam, um nachzusehen, was los war. Sag nichts, flüsterte der kleine Junge, und ich sah seine Angst. Sag der Lehrerin nichts. Ich bekam einen Eintrag mit einem Brief an meine Eltern. Am nächsten Tag hatte ich einen Termin beim Rektor. Die Eltern des Jungen hatten sich gefragt, warum es ihm so schlecht ging.«
»Hast du deinen Eltern nie erzählt, wie schlimm es dir ging?«
»Nein, ich habe mich geschämt, weil ich nicht so beliebt und erfolgreich war, wie sie mich gern haben wollten. Ich habe die Unterschrift meiner Mutter auf dem Brief gefälscht, das war nicht besonders schwer. Damals habe ich erkannt, daß es keine Gerechtigkeit und keine gerechte Gesellschaft geben wird, wenn wir uns nicht gemeinsam dafür einsetzen.«
Kapitel 3
»Mona! Mooona!« Als Mona aus dem Auto stieg, konnte man Anselms Schreie schon bis weit hinter den Geräteschuppen hören. Sie spürte, wie sich ihr Magen vor Angst zusammenzog. Verdammt! Sie schaute sich um. Wenn ihn nur niemand gehört und die Polizei gerufen hatte. Still, bitte sei doch still! Wieso war er bloß aufgewacht, der Alte? Der weckte ja das halbe Dorf mit seinem Gebrüll. Wenn sie nur damals stark genug gewesen wäre, ihren Willen durchzusetzen. Wilhelm war auch dafür gewesen, daß sein Schwiegervater ins Heim kam. Entscheide du, hatte er gesagt. Es ist dein Vater. Aber hatte sie gewagt, ihm das zu sagen? Nein. Es war nichts daraus geworden. Jetzt verfluchte sie ihre Feigheit. Das Fenster im oberen Stock stand weit offen. Im Mondlicht konnte sie sehen, wie Anselm lebensgefährlich weit mit dem Oberkörper aus dem Fenster hing wie ein Kuckuck aus einer Kuckucksuhr.
»Mooona!« Sie machte einen Schritt über einen zerschlagenen Blumentopf mit einer übel zerdrückten Geranie, lief über die verstreute Blumenerde, riß die Haustür auf und rannte die Treppe hoch, sie warf den Wäschekorb um, stolperte über die Schmutzwäsche, lief weiter.
»Ich bin hier, Vater.« Der Gestank, der ihr entgegenschlug, ließ sie würgen.
»Knall nich so mit der Tür. Verdammich, wo warst du?« Er wandte sich langsam vom Fenster ab, sank auf den Boden und sah sie mit blinden Augen an. Vorwurfsvoll. »Ich hab mich eingeschissen. Wo zum Teufel warstn du?«
»Ich habe wohl fest geschlafen.« Sie war froh, daß er ihr Gesicht nicht sehen konnte. Mit einem kräftigen Griff versuchte sie, ihm in den Rollstuhl hochzuhelfen, und spürte, daß sie sein Gewicht nicht mehr bewältigen konnte, wenn er nicht selbst mit den Armen mithalf.
»Ich mußte zum Fenster kriechen. Hat nich viel gefehlt, un ich wär rausgefallen, als ich mich hochgezogen hab. So soll's wohl sein, daß man so schnell wie möglich hier verschwindet, solang es noch was zu erben gibt. Der Blumenpott liegt unten an der Treppe. Soll da liegen bleiben! Wenn ich dich rufe, mußt du kommen, verdammich!«
»Vielleicht ist es am besten, wenn ich dich abwasche, während du auf dem Boden liegst.« Mona streckte die Hand nach dem Kissen aus und legte es unter seinen Kopf. Das Bett schwamm geradezu in Exkrementen. Er weigerte sich stur, im Sommer Windeln zu tragen. Es wäre auch besser, wenn er das Abführmittel nicht selbst dosieren würde, das hatte sie schon oft gedacht.
»Ich glaub, ich hab ein Auto gehört.« Mona wartete mit der Antwort, bis sie sich auf ihre Stimme verlassen konnte. Spürte die Angst wie eine neue Woge der Übelkeit kommen. Sie blieb ganz still stehen und wartete, bis sich ihr Atem beruhigt hatte.
»Ach so?«
»Hast du gesehen, wer das war?« fragte er.
»Ich habe nichts gehört. Hast du dein Insulin genommen?« Ihre Stimme war beunruhigend dünn.
»Verdammt!« Sie drückte die richtige Dosis aus dem Päckchen, gab ihm den Insulinstift und bemerkte dabei ihre schmutzigen und zerkratzten Hände und die nackten Beine. Die Schlange! Ein Schrecken fuhr ihr durch den Körper. Das Bein pochte, und an der Stelle, an der die Schlange ihre Zähne in ihre Haut geschlagen hatte, breitete sich bereits eine handtellergroße, häßliche Rötung aus. Konnte man an einem Schlangenbiß sterben? Vielleicht sollte man das Gift aussaugen. Oder einen Umschlag um das Bein machen? Sie traute sich nicht, zum Arzt zu gehen. Der würde bestimmt Fragen stellen, unangenehme Fragen. Der Fuß war stark angeschwollen und beulte sich zwischen den Riemen der Sandale aus.
Mona trug die schmutzigen Bettücher ins Badezimmer und besah sich im Spiegel. Sie erschrak vor ihrem eigenen Blick mit den aufgerissenen Augen. Die Blässe, die sich durch den sonnenverbrannten Teint drängte, ließ die Haut im Schein der Neonröhre grau wirken. Das Licht stach in den Augen und ließ die Kopfschmerzen unerträglich werden. Der Brustkorb hob und senkte sich mit einer Heftigkeit, die nicht normal war. Im Gesicht hatte sie eine Schramme, einen schmalen roten Strich vom Mundwinkel hinunter über das Kinn. Die Haare waren unordentlich. Sie pflückte einen kleinen Ast aus dem Haar. Wohin sollte sie sich wenden? Wie hatte das passieren können?
»Kommste jetzt mal bald? Wie lange muß man hier aufm kalten Boden liegen?« Seine Stimme klang nicht so scharf wie sonst. Wahrscheinlich schämte er sich ein wenig, weil er sich schmutzig gemacht hatte. Derlei Höflichkeit hielt nicht lange vor, aber man mußte für alles dankbar sein. »Hat er Flundern gefangen?«
»Was?«
»Wilhelm?«
Wilhelm. Großer Gott, was hatte sie getan! Wenn sie nicht so entsetzlich feige gewesen wäre, hätte sie sich geweigert mitzuhelfen. Die Polizei konnte jederzeit kommen und nach ihm fragen. Was sollte sie nur tun? Was sollte sie denen antworten? Schon bald würden sie hier sein, und dann würde sie bestraft und dem allgemeinen Getratsche ausgesetzt sein. Jesus, was würde auf den Höfen geredet werden! Die Schande würde schlimmer sein, als eingesperrt zu werden. Die Schande für die Kinder und die Verwandten und den Hof. Sie würde nie wieder im Laden einkaufen, nie wieder zur Arbeit gehen können. Wer würde sich schon von einer Verbrecherin pflegen lassen wollen? Den Demenzpatienten wäre es egal, wer ihre Windeln wechselte, aber die Angehörigen würden Anstoß nehmen und verlangen, daß sie die Station verließ. Es würde hinter ihrem Rücken geredet werden, aber mit ihr direkt würde man nicht mehr sprechen. Nie mehr Auge in Auge mit einem anständigen Menschen sein. Der Abgrund gähnte erschreckend tief.
»Hat er 'ne Flunder gefangen? Antwortest du mir noch heute oder nich?
Wilhelm! Hatte er Fische gefangen? Mona konnte vor ihrem inneren Auge sehen, wie er die Zinkwanne zur Strandhütte trug. Sie hatte ausgesehen, als wäre sie schwer gewesen. Wenn sie leer gewesen wäre, hätte er sie an einem Griff hinter sich hergetragen. Mein Gott, die Wanne stand sicher noch im Strandhäuschen, mit dem Fisch drin! Wenn auf der Fußmatte Blutspuren waren! Oder wenn jemand den Schürhaken fand, den sie unter dem Sattel des Fahrrads versteckt hatte. Er hatte sie gebeten, ihn ins Wasser zu werfen. Vielleicht hätte sie tun sollen, was er sagte, aber sie hatte sich nicht getraut, allein auf den Steg zu gehen. Sie wollte ihr Spiegelbild in dem schwarzen Wasser nicht sehen. Das hatte mit dem Traum zu tun. Sie wollte nicht ihr Gesicht durch die Wasseroberfläche sehen, von der anderen Seite her, wo Wilhelm war. Die Feriengäste würden mit der Fähre vom Festland kommen! Wenn auf dem Fußboden im Strandhäuschen Blut war, dann mußte sie es jetzt wegschrubben, ehe es eintrocknete.
»Hörst du mich, oder bist du stocktaub? Wo bist du, Mona?« Anselm drehte den Kopf mit den blinden Augen und fuhr mit der Zunge über die Zähne, so daß die Oberlippe sich ausbeulte.
»Hier, Vater. Sieht aus, als würde es Regen geben. Ich werde die Wäsche heute abend wohl reinnehmen müssen.«
»Du kriegst mich niemals allein in den Rollstuhl. Du mußt Wilhelm holen.«
»Es wird schon gehen, Vater.« Sie hörte selbst, wie verwegen das klang.
»Brich dir nur nich das Kreuz.«
Sie stellte sich breitbeinig hin, ging in die Knie und legte die Arme um seinen runden Bauch. »Halt dich mit den Händen am Rollstuhl fest. So! Jetzt hoch. Nein, nein, das geht nicht. Du mußt dich wieder auf den Boden setzen.«
»Sach ich doch. Du mußt Wilhelm holen!«
»Er schläft.«
»Dann weck ihn!«
»Nein, das geht nicht.« Sie konnte nicht verhindern, daß ihr ein hysterisches Kichern entwich.
»Das ist das Dümmste, was ich je gehört hab. Wilhelm! Wilhelm! Er muß sich aufraffen.«
»Nein, hör auf! Vater, hör auf!« Das Weinen steckte ihr in der Kehle. Anselm bemerkte die Veränderung und sah sie mit seinen vernebelten Augen forschend an.
»Was is los?«
»Er muß morgen früh mit dem Boot raus. Er braucht seinen Schlaf.«
»Und ich soll hier aufm Boden liegen. Na, danke!« Sie wischte seine braunen Finger mit einem Lappen ab und trocknete sie dann mit dem Handtuch. Die Nägel mit ihren Trauerrändern sahen schlimm aus, aber das mußte warten.
»Es wird wohl nicht anders gehen. Ich lege die Matratze hier auf den Boden, dann kannst du dich darauf legen, und ich stecke die Decke um dich fest. Das wird gut, wirst schon sehen, Vater.«
»Im Leben nich!« Er packte sie mit seinen kotverschmierten Nägeln fest am Unterarm. Die Augen wurden zu schmalen Schlitzen.
»Gute Nacht«, sagte sie mit zusammengebissenen Zähnen.
»Komm zurück, Mona!« befahl er. Sie versteifte sich, spannte alle Muskeln zur Verteidigung gegen seine Stimme an und schloß die Tür hinter sich.
»Komm zurück, komm zurück, du elendes Flittchen!«
Sie kroch in die Sofaecke im Wohnzimmer und hielt sich die Ohren zu, schloß lange die Augen, so lange, bis er verstummt war und sie wieder ihre eigenen Gedanken denken konnte.
Langsam öffnete sie die Augen und sah auf der gegenüberliegenden Wand das Familienporträt in seinem protzigen Goldrahmen. Sie selbst so jung mit auftoupiertem Haar und einem angespannten Zug um den Mund. Die Zwillinge Olov und Christoffer auf ihren Knien und Wilhelm wie ein Berg dahinter. Mürrisch unter den buschigen Augenbrauen hervorschauend warf er seinen Schatten über sie alle. Ein verlogenes Idyll, nur die halbe Wahrheit.
Mona lehnte sich nach vorn, um aufzustehen, der Kopf drohte zu bersten. Wilhelm sah sie vorwurfsvoll an, er bohrte seinen Blick in ihre blassen Zichorienaugen und hielt sie fest. Die Übelkeit kam so schnell, daß sie es nicht mehr auf die Toilette schaffte. Sie spürte die warme Flüssigkeit über ihre Füße rinnen. Ich hätte dich nie geheiratet, wenn ich nicht gemußt hätte, flüsterte sie zu ihrer Verteidigung und wischte sich mit der Hand über den Mund. Niemals.
Kapitel 4
Als Anselm endlich eingeschlafen war und die unaufhörlichen Beschimpfungen verstummten, rauschte die Stille in ihren Ohren wie das Geräusch eines großen Wassers. Hurenbalg, verdammtes Flittchen. Mona spülte seine Bettwäsche aus und sah das braune Wasser in den Abfluß wirbeln. Sie stopfte alles zusammen mit dem Hemd und der Unterhose in die Waschmaschine. Die Maschine rumorte los und sang laut, als würde sie in den letzten Zügen liegen, wie alle Geräte im Haus. Doch bei dem Lärm würde er vielleicht merken, daß es sich nicht lohnte zu schreien, wenn er wach wurde.
Jetzt mußte sie nachdenken! Sie mußte runter zum Strandhäuschen. Wie mechanisch sammelte Mona die Wäsche von der Treppe, wo Wilhelm sie hingeworfen hatte. Sie nahm sein rotkariertes Hemd hoch und warf es wieder hin, als hätte sie sich daran verbrannt. Es war, als würde sein Geist immer noch in dem Kleidungsstück, in dem zerschlissenen Stoff des Alltagshemdes leben. Sie zwang sich, es wieder hochzunehmen, faßte es an der äußersten Ecke an und legte es in den Wäschekorb. Die Unterhose, die vorn gelb von Urin war, hing wie ein geköpftes Huhn über der Treppenstufe. Die Strümpfe waren steif von Schweiß. Seine Arbeitshose mit dem eingetrockneten Schmutz auf den Knien stand fast von allein. Sie leerte Schrauben, Muttern und verbogene Nägel aus den Taschen.
Ein paar Mal hatte sie ihn vorsichtig gebeten, die Schmutzwäsche doch in die Waschküche zu tragen, aber er hatte ihre Bitten völlig ignoriert. Die Katze hatte mehrfach ihr Revier auf seinen Kleidern markiert, wenn der Schweißgeruch zu herausfordernd gewesen war. Hätte sie ihm das gesagt, dann hätte er das Tier sicherlich sofort erschossen. Wenn sie Veränderungen in seiner Körperhaltung bemerkte, hatte sie nicht gewagt, ein Thema wieder anzusprechen. Das Leben hatte sie dazu gezwungen, eine Meisterin im Interpretieren von Körpersprache zu werden und schon frühe Signale wie einen angespannten Nacken, ein plötzliches Schweigen, einen Tonfall, sich zu Schlitzen verengende Augen zu registrieren, um eine Katastrophe zu verhindern. Sie bemerkte jede Veränderung blitzschnell, um sich sogleich in ihr Innerstes zurückziehen zu können.
Gelb eingetrockneter Urin, peinliche Flecken ... Die Jungs hatten sich im Umkleideraum, als die Mädchen nach dem Sport unter der Dusche waren, ihre Unterhose geschnappt. Sie hatte nicht duschen wollen und sich deshalb noch im Gymnastikraum hinter der großen Matte versteckt. Der Körper war so mager gewesen und hatte nur zwei Mückenstiche als Brüste gehabt. Sie wollte sich den ungenierten Blicken der anderen Mädchen nicht aussetzen, wollte nicht verglichen und beurteilt werden. Die anderen, die etwas taugten, hatten einen BH mit Spitzenkante. Mona mußte sich mit Unterhemden zufriedengeben. Vater hatte laut losgelacht, als sie ihn um Geld für etwas derart Unnötiges gebeten hatte. Ihre Rippen staken vorn heraus und die Schulterblätter hinten, wie große Fledermausflügel. Sie hatte sich nicht getraut, sich in der Sonne auszuziehen, und war im Herbst die hellhäutigste in der Klasse. Aber das Schlimmste waren die Haarsträhnen, die an den beschämenden Stellen wuchsen. Das durfte niemand sehen. Niemand!
Sie wollte ihren Körper bedeckt halten, wurde aber von der Lehrerin ohne Pardon unter die Dusche geschoben und kam dann als letzte heraus. Es ist ja wohl nicht nett, nach Schweiß zu riechen, oder? Die Tür zwischen den Umkleideräumen war aus irgendeinem Grund nicht verschlossen gewesen. Sie hörte das Kreischen und das Lachen, und ihr wurde klar, daß sich die Jungs auf verbotenes Terrain begeben hatten. Das Handtuch, das sie sich um den Körper gewunden hatte, kam ihr viel zu klein vor. Sie hatte den Schimmelgeruch des Duschraumes noch in der Nase, als sie, halb hinter der Tür versteckt, herausschaute. Eine Unterhose ging von Hand zu Hand. Pfui, wie eklig! Mit Beweisstreifen! Sie betete im stillen, daß die Hose jemand anderem gehören möge. Sie wurde zur allgemeinen Betrachtung hochgehalten und dann hoch in die Luft geworfen. Irgend jemand kriegte sie auf den Kopf und dann, bei dem Versuch, sich zu ducken, auf die Schulter. Monas Kackhosen!
Die Wände hatten sich vor ihren Augen gebogen. Sie konnte die Gesichter voller Ekel und Schadenfreude sehen und schaute zu Boden. Und dort war ihr Blick dann festgewachsen, niedergeschlagen. Pfui, wie die stinkt. Angst und Scham. Der Lärm ihrer Stimmen echote in ihrem Kopf. Hast du dich eingepißt? Kack-Mona! Du stinkst so, daß wir dich nicht im Klassenzimmer haben wollen. Ins Scheißhaus mit dir, du Ekel!
Es gibt Schmutz, den man nicht wegwaschen kann, Unsauberkeit, die sich wie Maden in einen hineinfraß. Sie hatte ihre Unterhose gewaschen, bis Löcher im Stoff waren, aber was half das schon, wenn alle es gesehen hatten? Was nutzte es, wenn Mama tot war und Vater es nicht für notwendig hielt zu waschen? Sie hatte sich geschrubbt, bis sie rot war, bis es blutete, aber der Schmutz würde klebenbleiben und eins mit der Haut werden.
Im Dunkel des Schuppens standen zwei Fahrräder, das uralte von Anselm und ihr eigenes, von der Firma Monark. Das hatte Wilhelm ihr auf dem Flohmarkt in Klinte gekauft. Im Grunde war es gar nicht so schlecht, daß der Schürhaken im Werkzeugkasten unter dem Sattel von Anselms Fahrrad lag. Er würde es nie wieder benutzen, und die Jungen auch nicht. Mona tastete sich zu ihrem Fahrrad und stieß auf einen Lenker, trat den Ständer los und hob das Hinterrad hoch.
Als sie das Fahrrad aus dem Schuppen gezogen hatte, sah sie, daß das Küchenfenster des Nachbarn erleuchtet war. Ob Henrik Anselm hatte schreien hören? Mona verdrängte den Gedanken und hängte Plastiktüten mit Lappen, Seife und einer Thermoskanne mit heißem Wasser an das Lenkrad des Fahrrads. In den Tüten würde sie dann die Fische nach Hause zurücktragen können, wenn es denn welche gab. Wer weiß, bei wem Wilhelm überall angegeben hatte, wenn der Fang gut gewesen war. Falls die Polizei auftauchte und anfing Fragen zu stellen, mußte alles so sein, wie es sein sollte, auch wenn die Vorstellung, in den frühen Morgenstunden Fisch zu putzen, nicht gerade verlockend war. Die Müdigkeit ließ ihre Beine schwer werden, auch wenn sie bergab fuhr. Den Himmel kreuzten schwarze Wolken, die das Mondlicht verschwinden und es in blinkenden, Sekundenschnellen Wechseln wie geheime Lichtsignale wieder auftauchen ließen. Der Himmel weiß, was du getan hast! Du hast Blut an den Händen. Schuldig! Schuldig! Schuldig!
Im Strandhäuschen wagte Mona nicht, die Petroleumlampe anzuzünden, sondern tastete sich über den Boden. Sie rollte den Flickenteppich, auf dem Wilhelms Leiche gelegen hatte, zusammen und trug ihn an den Strand. Ein warmer Wind vom Land her umwehte ihren Rücken. Leise Wellen streichelten den Steg mit einem glucksenden Laut. Sie horchte auf menschliche Schritte, Autogeräusche, Stimmen. Doch die Nacht glitt leise wie ein Flügelschlag über den Fischereianleger. Am Ufer machte sie aus dem Teppich ein Bündel, füllte es mit Steinen und ließ alles zusammen vom Steg ins Wasser fallen. Etwas, was sie später bitter bereuen würde. Doch hinterher war man immer schlauer. Wenn die Angst die Sinne beherrscht, ist es schwer, klar zu denken.
Dann scheuerte sie wieder und wieder im Dunkeln den Boden des Strandhäuschens. Sie wusch und rieb alles weg, was von Wilhelm noch da sein konnte. Ganz genauso, wie sie es immer nach seinen Stiernächten im Dunkel des Schlafzimmers gemacht hatte, um danach Bettzeug, Unterrock und Unterhose zu wechseln. Erst jetzt wurde ihr klar, welche Erleichterung es bedeutete, daß es ihn nicht mehr gab. Sie schämte sich für diesen Gedanken, und trotzdem war da eine stille rieselnde Freude. Es gab ihn nicht mehr. Nun konnte sie allein über ihren Körper bestimmen. Sie tastete sich auf dem Boden bis zu der Zinkwanne vor und steckte die Hände in das unbekannte Wasser.