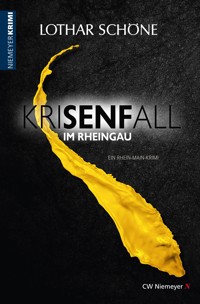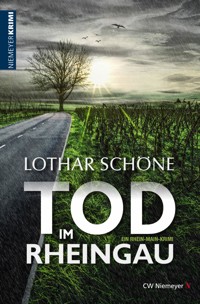
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In einem Rheingauer Weinberg wird ein Toter gefunden. In einem Mainzer Krankenhaus stirbt überraschend eine Frau. Normaler Lebensschwund? Nicht unbedingt. Gibt es hier einen Zusammenhang – einen mörderischen? Hauptkommissarin Julia Wunder und ihr deutsch-griechischer Assistent Vlassopolous Spyridakis ermitteln in Wiesbaden, Mainz und im Rheingau. Es geht um Ärzte, Apotheker, Krankenhäuser und unser Gesundheitssystem. Ein brisantes und daueraktuelles Thema, das für Spannung und Entsetzen sorgt. Und dabei undurchsichtige, halbseidene und kriminelle Charaktere ins Licht zieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Über den Autor
Widmung
1. Nur eine Bronchitis
2. Ich hätte da eine Idee
3. Die Leiche im Weinberg
4. Näher, Herr Kommissar!
5. Krieg mit anderen Mitteln
6. Für die Ewigkeit
7. Dr. Kapp lacht
8. Beipackzettel sind pures Gift
9. Böses Schlangenzischen
10. Sportwetten, verstehen Sie?
11. Ein plötzlicher Tod
12. Wer verschuldet ist, lebt gefährlich
13. Vlassi führt was im Schilde
14. Wo soll ich mich ausziehen?
15. Als Patient braucht man Gefahrenzulage
16. Ist die Trauer arg groß?
17. Sie passen in die Gegend!
18. Taten zählen, Schwätzer quälen
19. Tote leben gesünder
20. Pistole im Putzlappen
21. Die Engel sangen
22. Unser Gesundheitswesen: sehr, sehr krank
23. Viagra hilft auch nicht mehr
24. Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht?
25. Deutsch-griechische Wunder
26. Halbtote Männer im Transporter
27. Korruption? Im Gesundheitssektor?
28. Eine Hand wäscht die andere
29. Tätowierte Schlange bis unters Kinn
30. Herr Fredenthaler pfeift
31. Nivalux ist ein Segen
32. Die leidige Angewohnheit, den Löffel abzugeben
33. Sympathisch erst im Tod
34. Der Hund ist raffiniert
35. Mit Toten verhandeln fällt schwer
36. Volkstümlich heißt sie Burundanga
37. Ich arbeite in der Todesbranche
38. Die Initialen lauten A.H.
Lothar Schöne
Tod im Rheingau
Ein Rhein-Main-Krimi
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de
© 2016 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hameln
www.niemeyer-buch.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Carsten Riethmüller
Der Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.com
eISBN 978-3-8271-9797-9
EPub Produktion durch ANSENSO Publishing
www.ansensopublishing.de
Die Geschehnisse in diesem Roman sind reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Über den Autor:
Lothar Schöne, geb. in Herrnhut, arbeitete als Journalist, Hochschullehrer, Drehbuchautor und veröffentlichte Romane, Erzählungen und Sachbücher. Er erhielt eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen, unter anderem das Villa-Massimo-Stipendium in Rom, den Stadtschreiber-Preis von Klagenfurt/Österreich und den von Erfurt, den Literaturpreis der Stadt Offenbach a.M., zuletzt 2015 den Kulturpreis des Rheingau-Taunus-Kreises. Sein Roman „Der blaue Geschmack der Welt“ wurde von den Lesern der Tageszeitung Die Welt zum „Buch des Jahres“ gekürt, der Roman „Das jüdische Begräbnis“ in sechs Sprachen übersetzt. Derzeit wird die Verfilmung vorbereitet.
Für Dr. Norbert Enders
(„Was ist schon ein Mensch ohne Einsatz für Menschlichkeit?“)
1. Nur eine Bronchitis
„Keine Männer? Nicht den kleinsten?“
Julia Wunder lachte auf, warf ihren Kopf leicht nach hinten, sodass ihr Cormina-Damenschlapphut in hellem Rot leicht verrutschte. Dabei hatte ihre Freundin Bruni Graf keinen Witz gemacht, sondern in vollem Ernst gesprochen.
„Vielleicht hab ich so einen ganz kleinen unter dem Fingernagel“, flüsterte Julia ihr zu und lächelte verschmitzt.
„Du hast es gut“, stöhnte Bruni auf, „die Jagd nach Mördern und Vergewaltigern macht dich schon glücklich.“
Die beiden Frauen saßen im Maldaner, einem Café in der Innenstadt Wiesbadens. Sie hatten sich nach langer Zeit wieder einmal getroffen, um miteinander zu plauschen. Beide kannten sich aus der Schulzeit, hatten zusammen Abitur gemacht, waren sich auch im Studium nahe geblieben, dann aber hatten sie sich eine Weile aus den Augen verloren. Während Bruni Graf in der Werbebranche Fuß fasste, war Julia Wunder zur Polizei gegangen. Schon immer hatte sie das Gefühl gehabt, in manchen Dingen Männern überlegen zu sein, was sie beruflich auch unter Beweis stellte. Im Polizeipräsidium Westhessen war sie schnell zur Kriminalhauptkommissarin aufgestiegen, und das musste nicht der Schlusspunkt sein. Jetzt nickte sie auf die Frage ihrer alten Freundin etwas nachdenklich.
„Und gar keine Männer in Sicht?“, fragte diese mit einem tiefen Blick.
„Doch, doch, ich sehe genug Männer und muss nicht mal das Fernglas zur Hand nehmen ...“, antwortete Julia und ließ den Satz offen.
„Verstehe“, sagte Bruni knapp und griff zu ihrer Kaffeetasse, um einen Schluck zu trinken.
„Du verstehst?“
„Du hast kein Interesse an Männern“, antwortete Bruni.
„Na ja, so kann man das eigentlich nicht sagen.“
„Aber du hast im Moment auch keinen Bedarf, stimmt’s?“
Julia nickte wieder, gab aber keine Antwort. Die Freundinnen befanden sich im besten Alter, sie waren einundvierzig und zweiundvierzig Jahre alt, sahen attraktiv aus, und beide hatten schon üble Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Bruni Grafs langjähriger Freund hatte sich erst vor Kurzem Knall auf Fall nach New York in die Zentrale abgesetzt, um dort seine Chancen in der Agentur, in der sie beide arbeiteten, auszureizen. Das hatte Bruni ihrer Freundin erzählt. Keinen Moment dachte er offenbar daran, sie aus der Frankfurter Filiale nachkommen zu lassen, wie er ihr weisgemacht hatte. Bruni jedoch hatte fest daran geglaubt und fiel in ein tiefes Loch, als er nichts mehr von sich hören ließ.
Julia Wunder hatte einen ganz anderen Verlust erlitten. Ihr Ehemann war vor einem halben Jahr bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Obwohl sich seitdem einige Männer an sie herangerobbt hatten, zeigte sie ihnen die kalte Schulter. Zu ihrem Tisch, Bett und Herz ließ sie keinen vor. Ihr müsst draußen bleiben – das schien ihre Devise zu sein, wenn Männer ihr lange Blicke zuwarfen. Julia brauchte Zeit, sie hatte den Verlust ihres Ehemanns längst nicht verwunden, vielleicht stürzte sie sich deshalb so in die Arbeit.
„Weißt du“, sagte sie jetzt zu Bruni, „ich glaube, man verliert, was man liebt. Das scheint eine Art Naturgesetz zu sein.“
„Nein!“, rief ihre alte Freundin aus. „Das will ich nicht glauben, das darf einfach nicht sein.“
Julia sah Bruni ernst an und sagte nichts.
„Du bist doch nicht etwa Atheistin geworden oder Esoterikerin oder sonst was in der Richtung?“, fragte Bruni besorgt.
Die Hauptkommissarin nahm einen Schluck vom Kaffee, dann erklärte sie: „Esoterikerin auf keinen Fall. Aber wahrscheinlich ist mir der Glaube an ein wohlsortiertes irdisches Miteinander ein für alle Mal abhandengekommen ...“
„Wohlsortiert? Seit wann drückst du dich so geschwollen aus?“
„Vielleicht eine Berufskrankheit?“
„Du bist Zynikerin geworden.“
„Na ja, ich bin ja Polizistin. Da hab ich andauernd mit dem unsortierten irdischen Miteinander zu tun. Wahrscheinlich ist Zynismus da eine Art Berufskrankheit.“
„Kriminelle hat’s schon immer gegeben. Dass du deinen Mann verloren hast, ist was ganz anderes.“
Julia lehnte sich zurück und sagte ruhig: „Wie kann ein Mann, der nichts verbrochen hat und mit dem ich ein Herz und eine Seele war, plötzlich aus dem Leben gerissen werden. Das geht doch nicht.“
Bruni nickte: „Ja, du hast recht. Das will einem nicht in den Kopf. Da kann wirklich der große Zweifel kommen.“
Sie machte eine kleine Pause und sah Julia aufmerksam an. Behutsam fuhr sie dann fort: „Gut, dass wir uns getroffen haben, du leidest immer noch, dich muss ich ja regelrecht aufbauen.“
Bruni hielt inne, und ihr ging durch den Kopf, dass man eine Person erst dann richtig versteht, wenn man ihre Vergangenheit kennt. Ohne Vergangenheit ist ein Mensch wie ein Buch mit leeren Seiten. Dann fügte sie nachdenklich an: „Wenn ich mir’s recht überlege, ist das direkt ein theologisches Thema. Warum lässt Gott so etwas zu?“
Bruni Graf war überzeugte Katholikin, sie besaß einen deutlichen Gerechtigkeitssinn und wollte daran glauben, dass es fair und rechtschaffen in dieser Welt zuging, und wenn das nicht der Fall war, musste man dafür sorgen. Aber wie sollte das beim Tod von Julias Mann geschehen? Schlagartig wurde ihr auch klar, dass es ein himmelweiter Unterschied war zwischen dem, was ihr passiert war, und dem Ableben des Ehemanns ihrer Freundin.
„Ja“, murmelte Julia, „warum lässt Gott so etwas zu?“
Sie trank einen Schluck Kaffee, während Bruni ein Stückchen Kuchen auf die Gabel nahm, in den Mund steckte und plötzlich zu husten anfing. Es war ein regelrechter Hustenanfall, der kein Ende nehmen wollte. Sie japste nach Luft, und Julia klopfte ihr auf den Rücken, bis ihre Freundin schwer atmend zur Ruhe kam.
„Hast du dich verschluckt?“
„Das muss meine Bronchitis sein“, erklärte Bruni. „Wenn der Sommer zu Ende geht, kommt sie hervor.“
„Wenigstens erinnert sie dich an die Jahreszeiten“, stellte Julia Wunder trocken fest.
„Ja, leider“, lächelte Bruni und verabschiedete sich auf die Toilette. Als sie zurückkam, fand sie einen Zettel neben ihrer Tasse. Es war eine Nachricht ihrer Freundin, der Hauptkommissarin: Musste leider weg. Was Dringendes! Aber du musst mich unbedingt weiter aufbauen. Ruf bitte an.
2. Ich hätte da eine Idee
Dr. Manfred Kapp stand so abrupt auf, dass der Schreibtischstuhl nach hinten rollte. Bei Dr. Kapp, dem Chef der Firma Kappmed im Rheingau, handelte es sich um einen schlanken Mann Ende fünfzig mit einer Frisur, die bewies, dass der Haarhelm von Günter Netzer auch in purem Weiß lieferbar ist. Eigentlich war er ein beherrschter Typ. Doch was er gerade gehört hatte, machte ihn mehr als nervös. Er tigerte unruhig im Zimmer umher, als könne er dort eine Lösung finden, und ging jetzt zum Fenster. Sein Gesicht wirkte angespannt und die Kieferknochen knirschten. Im Stuhl vorm Schreibtisch wollte sich Alexander Heinscher ebenfalls erheben, blieb aber vorsichtigerweise sitzen, als er die Unruhe bei seinem Chef erkannte. Im Moment war es am besten, nichts zu tun und vor allem nichts zu sagen. Bloß keine Action, nur abwarten und ruhig dasitzen.
Nach einer Weile drehte sich Dr. Kapp herum, seine Stimme bebte: „Und wir können gar nichts tun? Überhaupt nichts?“
Heinscher deutete ein Kopfschütteln an und sagte leise: „Die Alternative wäre die Insolvenz.“
Die Augen Kapps funkelten, doch seine Stimme blieb gefährlich ruhig. „Insolvenz! Das wäre der Ruin! Der Ruin für uns alle.“
Alexander Heinscher nickte ergeben, dachte aber bereits darüber nach, ob Dr. Kapp wirklich recht hatte. Heinscher war zwar nicht mehr der Jüngste, aber als leitender Angestellter der Firma besaß er ein Insiderwissen, das er auch anderen Unternehmen gewinnbringend anbieten konnte – gewinnbringend für sich. Er musste schließlich vor allem an sich selbst denken und weniger an die Firma, die Dr. Kapp gehörte. Das traf sowohl bei einer Insolvenz zu wie auch bei der Alternative, die er kurz zuvor seinem Chef dargelegt hatte.
„Bei einer freundlichen Übernahme würden wir sicherlich besser fahren“, äußerte sich jetzt Alexander Heinscher.
Dr. Kapp rief aufgebracht: „Ich hasse Rayer, das ganze Unternehmen und die Chefs sowieso! Das sind Business-Menschen, nicht mehr. Von solchen Leuten kommt nichts, keine Innovation, keine einzige Neuerung, gar nichts! Haben die irgendetwas erfunden? Krankheiten eingedämmt? Den Patienten etwas zur Linderung geschaffen? Denen geht es nur um eines.“
Er sprach das letzte Wort so überdeutlich aus, dass kein Zweifel daran bestand, was er meinte – nämlich Geld.
Alexander Heinscher nickte, sein Chef kam zurück zum Schreibtisch. Es war auf einmal sehr still im Zimmer, bedrückend still. Doch in diese Stille hinein sagte jetzt Heinscher mit klarer Stimme: „Ich hätte da eine Idee.“
Kapp warf einen durchdringenden Blick auf ihn. „Reden Sie!“
*
Das Telefon kann durchaus ein Gerät sein, das angenehme Gefühle auslöst. Als Stefan Mitz, ein Angestellter der Firma Nelix im Rheingau, den Hörer auflegte, huschte jedenfalls ein zufriedenes Lächeln über sein Gesicht. Er drehte sich auf seinem Bürostuhl zum Computer, öffnete das Outlook, tippte eine Nachricht ein, überlegte einen Moment, löschte sie wieder und formulierte neu. Dann schickte er sie ab. Er rieb zufrieden seine Handinnenflächen aneinander und war sich sicher, dass ein weiteres Treffen mit dem Empfänger der Mail unnötig war. Regentropfen prasselten an die Fensterscheibe seines Büros, die Jahreszeit des Dauerregens kündigte sich an.
Der korpulente Endvierziger stellte sich ans Fenster, strich sinnend über seine Stirnglatze und sah hinaus. Unten öffnete sich gerade das Rolltor der Tiefgarage. Aber weder ein Auto fuhr heraus noch zeigte sich eine Person. Oder sah er da jemanden im Halbschatten? War das etwa Schlichtmann? Er besaß jedenfalls dessen Statur. Mitz konnte wegen des Regenschleiers nichts Genaues erkennen und wandte sich wieder seinen Gedanken zu. Sollte es doch draußen regnen und stürmen! Für ihn schien die helle Sonne, ja, das Wetter kam ihm ausgesprochen anregend und heiter vor. Und bald würde es noch viel heiterer für ihn werden, wahrscheinlich sogar paradiesisch. Mitz verlor sich eine Weile in genussreichen Betrachtungen über sein weiteres Leben, als es an der Tür klopfte und im nächsten Moment sein Chef im Raum stand, der Geschäftsführer der Firma Nelix, Gregor Schlichtmann. Er trug einen dunklen Kinnbart und sein nach hinten gestrichenes dunkelblondes Haupthaar sah feucht aus, als hätte er seinen Kopf kurz in den Regen gehalten.
„Sie sind noch da, Herr Mitz?“, fragte er.
„Die Überminuten addieren sich mitunter zu Überstunden.“
„Verstehe, verstehe, aber im Moment scheinen Sie eher das Wetter draußen zu genießen.“
Mitz ging zu seinem Schreibtisch. „Der Regen hat was. Man freut sich dann umso mehr auf die Sonne.“
„Wie auch immer. Haben Sie die Lieferung an die Wiesbadener Krankenhäuser fertig gemacht?“
„Aber natürlich. Es ist alles auf dem Weg.“
„Auch die Mainzer Lieferung?“
„Ebenso.“
„Dann bin ich zufrieden. Ich dachte, Sie seien schon weg.“ Auf Schlichtmanns Gesicht breitete sich Zufriedenheit und sogar eine gewisse Genugtuung aus. „Ihre Arbeitsmoral ist vorbildlich. Das muss ich Ihnen wirklich lassen. Aber für heute machen Sie bitte Schluss, Sie brauchen schließlich Ihren Feierabend.“
„Daran dachte ich eben auch schon“, erwiderte Mitz.
Schlichtmann lächelte ölig. „Ich muss mir sonst Sorgen um Ihre Gesundheit machen.“
Er verließ das Zimmer. Stefan Mitz sah ihm einen Moment sinnend nach, dann ging er zum Schrank in der Ecke und zog seine Regenjacke hervor. Für heute hatte er wirklich genug getan, mehr als sein Tagwerk vorschrieb. Er löschte das Schreibtischlicht und verließ sein Büro. Dann nahm er den Aufzug nach unten. Sein Auto stand in der Tiefgarage. Er besaß einen eigenen Platz, wie es ihm zukam. Einen Moment musterte er seinen betagten Opel Astra, bevor er einstieg. Eigentlich sollte er schon längst einen anderen Wagen fahren, einen, der seiner Stellung angemessen war. Und bald würde er sich das leisten können. Vorsichtig rangierte er das Auto rückwärts aus dem Parkplatz, schon einmal hatte er mit dem Heck einen Betonpfeiler gerammt, und nahm den Weg nach oben. Auf dem Hof draußen sah er keinen Menschen, offenbar war er wirklich der Letzte, aber wenigstens hatte sich seine Überstunde diesmal gelohnt.
Er musste von Johannisberg hinunter in den Rheingau fahren, nach Geisenheim, und von dort nach Oestrich. Es regnete immer noch, ein leichter Landregen ging nieder und milchiges Zwielicht ergoss sich über das Land. Die Strecke war kurvig und etwas holperig, aber Stefan Mitz liebte sie. Man sah das Rheintal von oben, der Fluss wand sich wie eine Schlange durch das Tal, und selbst jetzt im Regen sah er die Rheinschiffe, die wie Spielzeugschiffchen auf dem Wasser schaukelten. Das liebte er ganz besonders. Konnte es sein, dass er ein Rhein-Romantiker war? Wie jene vielen Besucher, die von weit her kamen, um die Loreley und das Niederwalddenkmal zu sehen. Er lächelte amüsiert. Hinter ihm tauchten die Lichter zweier Scheinwerfer auf. Sie kamen näher und schienen ihn zu schnellerem Tempo aufzufordern. Eigentlich ließ er am liebsten den Wagen im höchsten Gang rollen, es ging abwärts, wozu Treibstoff vergeuden. Jetzt gab er ihm einen Gasstoß, doch die nächste Kurve kam schon in Sicht, er musste abbremsen.
Er trat leicht auf die Bremse, aber sie reagierte nicht. Unmöglich, das konnte nicht sein! Sein Wagen war doch erst vor Kurzem in der Werkstatt gewesen. Mitz drückte wieder auf das Pedal, diesmal energischer. Nichts! Er trat sie bis auf den Anschlag durch. Keine Reaktion. Und das Auto wurde schneller. Der Wagen hinter ihm war dicht aufgefahren, vergrößerte jetzt aber den Abstand. Die nächste Kurve kam. Auf der Stirn von Stefan Mitz sammelten sich Schweißtropfen. Er versuchte, seine Hände ruhig zu halten. Jetzt bloß nicht die Kontrolle verlieren. Viel zu schnell sauste er um die Kurve herum. Der Wagen schleuderte. Angst kroch in ihm hoch. Seine Finger griffen zur Handbremse. Aber er würde sich überschlagen, wenn er sie abrupt zog. Vorsichtig hob er den Griff an – nichts passierte. Und der Wagen wurde immer schneller. Er spürte, wie sein Hemdkragen eng wurde, als sei es kein Kragen, sondern eine Schlinge, die sich zusammenzog. Panik überkam ihn, er hätte schreien können, aber sein Mund öffneten sich nicht. Die Straße wurde vor der nächsten Kurve schmaler, er riss das Lenkrad nach rechts und spürte, wie ein salziger Schweißtropfen seine Lippen berührte. Als das Auto abhob und in die Weinberge rauschte, erkannte er noch einen Obstbaum vor sich, dann knallte es – der prasselnde Regen verstummte jäh, er hörte nichts mehr und es wurde schwarz um ihn ...
Der Wagen hinter ihm fuhr in eine kleine Schneise am Rand. Die Tür öffnete sich, es dämmerte bereits, der Fahrer zog Latexhandschuhe an und streifte Plastiküberzieher über seine Schuhe, als wäre er ein Arzt, der sich für den Operationssaal vorbereiten wollte. Dann ging die Person mit schnellen Schritten zum Unglückswagen ...
*
Einige Stunden später, es war schon völlig dunkel, fuhr ein Transporter an einem bestimmten Abzweig von der Rheingau-Autobahn nahe Martinsthal ab. Sein Fahrer warf einen letzten Blick aufs Navi, aber er wusste schon, dass er das Ziel bald erreicht hatte. Es ging eine kurze Wegstrecke an einem Wäldchen entlang, dann kam eine Einbuchtung, in die er langsam hineinsteuerte. Geschützt hinter Bäumen und Sträuchern ließ er den Wagen ausrollen und schaltete Motor und Scheinwerfer ab. Er musste nicht lange warten und ein weiteres Auto fuhr auf den einsamen Parkplatz. Es war ebenfalls ein mittelgroßer Transporter, und sogar wenn es taghell gewesen wäre, hätte man die beiden Wagen verwechseln können. Der zweite Transporter hielt hinter dem ersten. Zwei Männer stiegen aus und gingen nach vorne zum anderen Wagen, wo jetzt der Fahrer die Tür öffnete und hinaussprang. Die drei Personen wechselten ein paar leise Worte. Besonders redselig war keiner von ihnen. Dann ging einer zum zweiten Transporter und rangierte ihn schnell und geschickt so, dass der Wagen mit seinem Heck an der Rückseite des ersten Transporters zu stehen kam.
Ohne weitere Worte zu verlieren, öffneten die Männer die Hintertüren ihrer Wagen. Zwei von ihnen stiegen in den Frachtraum des ersten, einer in den Frachtraum des zweiten Transporters. Von fern hörte man ein Hupen, und das Licht eines Scheinwerfers streifte die Bäume. Die drei Männer ließen sich davon nicht beirren. Sie verrichteten ihre Arbeit zügig und ohne auch nur eine Sekunde innezuhalten und luden den Inhalt des ersten Transporters in den zweiten. Schwer war die Arbeit nicht, denn es handelte sich lediglich um kleine Kisten.
3. Die Leiche im Weinberg
Vlassopolous Spyridakis war zu Fuß unterwegs und wollte gerade von der Wiesbadener Flaniermeile, der Wilhelmstraße, in die kleine Burgstraße einbiegen, als er den roten Ferrari vorbeifahren sah. Er blieb stehen, schaute ihm hinterher, und sein Blick wäre mit schmachtend einigermaßen korrekt wiedergegeben. Das musste ein Mondial sein, ein Automobil, das man nicht alle Tage sah – es sei denn, man lebte in dieser Stadt und tummelte sich öfter in der Nähe des Spielkasinos. Jetzt röhrte der Wagen auf, der Fahrer hatte mal kurz aufs Gas getreten, um die ahnungslose Welt aufhorchen zu lassen, was ihm im Fall von Kommissar Spyridakis absolut gelungen war, denn der machte eine verzückte Miene, als habe er soeben die ersten Klänge einer unbekannten Symphonie von Beethoven gehört.
Vlassopolous, den seine Freunde nur Vlassi nannten, war auf dem Weg zu seinem Lieblingsdönerimbiss in der Dreililiengasse. Er musste dringend etwas essen, sein Magen knurrte seit einiger Zeit wie ein eingesperrtes Tier, und da er sich für einen Feinschmecker hielt, kam nur dieser Imbiss für ihn in Frage. Es handelte sich um den besten Dönerimbiss in der Stadt – das war jedenfalls seine unerschütterliche Auffassung. Schnell hatte er die fest installierte Bude erreicht und Adil begrüßt, der ihm zunickte und schon wusste, welches Gericht er dem Commissario, wie er zu sagen pflegte, servieren sollte. Adil war als Junge mit seinen Eltern aus der Türkei gekommen und im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen. Er sprach ein nahezu akzentfreies Hessisch und war auch sonst nicht auf den Kopf gefallen.
Vlassi Spyridakis widmete sich seinem Lahmacun. Voller Hingabe ließ er die ersten Bissen im Mund zergehen, ja, das hatte er gebraucht, das war unbedingt nötig für sein weiteres Fortbestehen als Mensch und Polizeibeamter. Während er die nächste Portion mundgerecht klein schnitt, klingelte das Handy in seiner Jackentasche. Widerwillig zog er das Mobiltelefon heraus. Nach den ersten Worten von der anderen Seite wusste er, dass sein Genießerdasein ein Ende gefunden hatte. Seine Chefin, Hauptkommissarin Julia Wunder, war am Apparat und beorderte ihn ins Präsidium. Sie müssten in den Rheingau.
„Ein Mord?“, fragte Vlassi.
„In welcher Abteilung arbeiten Sie noch mal?“, fragte seine Chefin spitz zurück.
Da wusste er, dass er besser kein weiteres Aufschubmanöver starten sollte. Er schlang schnell noch zwei Bissen dieses vorzüglichen Lahmacun herunter, dann verabschiedete er sich von Adil mit einer Trauermiene, als habe gerade eine Leiche seinen Weg gekreuzt.
„Keinen Mokka heute, Commissario?“, rief der ihm hinterher.
*
Der VW Passat verließ die A 66 bei Eltville und fuhr am Rhein entlang in Richtung Oestrich-Winkel. Am Steuer saß Hauptkommissarin Julia Wunder, neben ihr befand sich ihr Assistent, Kommissar Vlassopolous Spyridakis.
„In den Weinbergen?“, fragte Vlassi seine Chefin.
Julia nickte.
„Weshalb müssen wir denn dahin, es gibt doch die Dienststelle Rüdesheim?“
In seiner Stimme schwang unüberhörbar Missmut.
„Der Kollege dort hat Zweifel, ob es ein Unfall war“, sagte sie, „wir sollen uns die Sache mal ansehen.“
„Um diese Zeit! An einem Samstag! Da sollte der werte Kollege die Angelegenheit besser selbst entscheiden.“
Julia warf ihm einen spöttischen Blick zu. „Haben wir denn heute Nachmittag etwas vorgehabt?“
„Heute spielt der SV Wehen-Wiesbaden. Heimspiel gegen Kickers Offenbach.“
Julia spitzte abschätzig die Lippen. „Dritte Liga. Und so was gucken Sie sich an?“
Kriminalkommissar Spyridakis zog es vor, nicht zu antworten. Wiesbaden hatte eben nur diesen Fußballverein, der einigermaßen was hermachte, und er war fußballbegeistert. Vlassi schaute auf die Straße draußen, als gäbe es da allerhand zu entdecken, eventuell sogar ein Spielfeld. Es hatte zwar aufgehört zu regnen, dafür lag jetzt ein grauer Schleier in der Luft.
„Überhaupt“, piekte Julia weiter, „gibt es doch nur einen Verein, den es sich anzuschauen lohnt ...“
„Sie meinen doch nicht etwa Bayern München?“
„Sie wissen schon, welchen ich meine.“ Julia Wunder hob blasiert die Nase, und ihr ausgefallener Luanda-Bortenhut in Dunkelrot rutschte ein Stückchen nach hinten, dann schob sie nach: „Den von der andern Seite des Rheins.“
Vlassi versuchte ruhig zu bleiben, dann aber platzte es aus ihm heraus: „Haben Sie denn kein bisschen Lokalpatriotismus im Leib?“
„Nein, wieso?“
„Weil Sie dann wüssten, dass ein Verein wie Mainz 05 niemals in Frage kommt.“
Auf Julias Gesicht zeigte sich ein Lächeln. „Aber sie spielen in der ersten Liga.“
„Bundesliga heißt das“, korrigierte Vlassi, „oder Reichenliga, Schnöselliga, lauter Millionärstruppen. Für die Kleinen muss man sein, für die Wiesbadener eben.“
„Aber die Mainzer sind doch so sympathisch“, ließ Julia nicht locker und richtete ihren seidenen Schal, passend zum Hut ebenfalls in Dunkelrot. „Außerdem gefällt mir ihr Trikot besser.“
Kommissar Spyridakis presste die Lippen aufeinander und sagte nichts. Aber seine Gedanken überschlugen sich: Trikot! Diese Anmerkung war ja wohl typisch. Weiberkram hoch drei. Demnächst würde seine Chefin erklären, dass sie es wunderbar findet, wenn sich die Spieler ihre Trikots vom Leib reißen. Julia warf ihm einen schnellen Blick von der Seite zu, sie konnte hinter seiner Stirn lesen, was er dachte, und sie wollte die Fopperei nicht lassen.
„Die Hosen der Mainzer gefallen mir auch sehr gut, und das Vereinsemblem sowieso, rot-weiß, das hat was“, erklärte sie mit vor Ernst triefender Stimme. „Und außerdem schlagen sie auch die Großen in der Schnöselliga.“
„Eben nicht!“, widersprach Vlassi.
„Für die Kleinen in der großen Liga muss man sein“, erklärte Julia ohne eine Miene zu verziehen. Sie schaute auf die Straße, wo gerade das Ortsausgangsschild von Winkel auftauchte, und legte unbarmherzig nach: „Und wenn sie gewinnen, dann sind sie gleich noch mal so sympathisch in ihren schönen Trikots.“
Vlassi verkniff sich eine Entgegnung. Gegen solche weibliche Logik, dachte er, komme ich nicht an.
Am Unfallort oberhalb Geisenheims begrüßte Julia Polizeimeister Windstock. Ja, ja, er komme aus Rüdesheim, ein Anruf habe ihn hergeführt, jemand habe das Auto im Weinberg gesehen, wo es einfach nicht hinpasste. Es sei gegen einen Baum geknallt.
Windstock ging bedächtig voran, Julia Wunder und Vlassopolous Spyridakis folgten ihm. Der Boden war durch den Regen aufgeweicht und etwas glitschig, was Vlassi, der es eilig hatte, wieder wegzukommen, sofort am eigenen Leib zu spüren bekam. Mit schnellem Schritt versuchte der lange Lulatsch Polizeimeister Windstock zu überholen, rutschte aus und schlug einen nahezu perfekten Salto.
„Oh“, sagte Julia und reichte dem rücklings daliegenden Kollegen die Hand, „ich wusste gar nicht, dass Sie für den Zirkus trainieren. Das kommt davon, wenn man schnell noch zu einem Spiel der Wiesbadener will.“
Vlassi lag im aufgeweichten Boden, ignorierte die Hand seiner Chefin und rappelte sich allein wieder hoch. Der Rüdesheimer Polizeibeamte sah ihm mitleidig zu.
„Zu viel Geschäftigkeit ist misslich“, ergänzte Julia und erläuterte ihrem Assistenten die Herkunft des Zitats: „Shakespeare.“
„Ich bin gleich wieder voll da“, erwiderte Vlassi, richtete sich auf und schob nach: „Auch Shakespeare.“
Der Astra war vorn stark verbeult, während der Obstbaum triumphierend in voller Größe dastand, als habe ihm das Auto nichts anhaben können.
„Unser Bäumcher sind widderstandsfähig“, erläuterte Windstock stolz und mundartlich korrekt.
Julia beugte sich zur offenen Tür und sah einen Mann überm Luftsack hängen. Abrupt wandte sie sich zu Windstock. „Sofort einen Arzt! Warum haben Sie noch keinen herbeigeholt?“
„Hab ich doch längst gemacht. Der Doktor Hamberg war schon da, musste aber wieder weg, dringender Hausbesuch. Hat den Tod von dem Fahrer festgestellt.“ Er deutete mit dem Kopf auf den Leblosen hinterm Steuer.
„Ein Unfall mit tödlichem Ausgang“, stellte Vlassi fest. „So was kommt alle Tage vor. Wozu holt man uns?“
„Des dacht ich auch, aber der Doktor Hamberg meint, der Unfall wär net dran schuld, dass dem des Lebe abhanden gekomme is.“
„Und warum?“
„Fragen Sie ihn selbst. Er will bald wiedderkomme.“
Kurz darauf eilte Dr. Hamberg mit raschen Schritten vom Straßenrand zur Unglücksstelle. Der Rüdesheimer Polizeimann stellte ihm Hauptkommissarin Wunder vor, die ihn sofort fragte: „Welche Zweifel haben Sie? Der Unfall war nicht die Todesursache?“
„Ich glaub nicht. Der Luftsack hätte ihm das Leben retten müssen, und hat es vermutlich auch getan. Aber mir kommt es so vor ... also ... wie eine Toxikose.“
„Bitte sprechen Sie Deutsch“, sagte Hauptkommissarin Wunder mit Stirnrunzeln.
„Na ja, eine Art Vergiftung.“
„Wie? Während der Fahrt hat er sich vergiftet?“, fragte Vlassi.
„Der Tote hat keine äußerlichen Verletzungen außer Prellungen und eventuellen Rippenbrüchen“, antwortete der Arzt, „aber die Pupillen sind unnatürlich geweitet.“
„Kann es sein, dass er vorher irgendwelche Drogen zu sich genommen hat?“, fragte Julia.
„Das ist möglich, aber wer nimmt absichtlich Drogen, die ihn fahrunfähig machen?“
„Mehr Leute, als man denkt, Alkohol ist auch eine Droge“, entgegnete Julia.
„Ein Selbstmörder“, stellte Vlassi mit der Miene eines Fachmanns fest. „Das scheint mir ganz klar.“
Julia sah ihn an. „Ohne Auto hätte er es einfacher haben können.“
„Wahrscheinlich wollte er seinen Selbstmord kaschieren“, überlegte Kommissar Spyridakis laut.
„Um wen handelt es sich überhaupt?“, fragte Julia den Rüdesheimer Polizeibeamten.
„Um Stefan Mitz. Hier ist der Personalausweis.“
„Sonst haben Sie nichts?“
Polizeimeister Windstock schüttelte den Kopf. Julia Wunder wandte sich zu Vlassi: „Benachrichtigen Sie den Erkennungsdienst, die müssen herkommen.“
„Meinen Sie wirklich?“, fragte Vlassi. „Das kommt mir relativ überflüssig vor, hier handelt es sich um einen Selbstmord, der nicht so aussehen soll.“
„Rufen Sie relativ schnell an!“, sagte Julia in einem Ton, der keinen Widerspruch erlaubte, und Vlassi fingerte nach seinem Handy in der Jackentasche. Den Fußballnachmittag mit seinem geliebten SV Wehen-Wiesbaden konnte er sich wohl an den Hut seiner Chefin hängen.
Laut sagte er: „Der erste Tag bei einem Mordfall ist einfach mörderisch. Vor allem, wenn es sich um einen vermeintlichen Mordfall handelt.“
*
Einige Stunden später, die Firma Nelix im nahe gelegenen Geisenheim lag längst in tiefem Dunkel und der Nachtportier konnte seit einiger Zeit seine Augen nicht mehr konstant offen halten. Bei ihm hatte sich Stefan Mitz vor nicht allzu langer Zeit verabschiedet, nicht wissend, dass er in den Tod fuhr. Aus der Kehle des Nachtportiers entrang sich ab und zu ein schnurchelnder Ton – das Fernsehprogramm zeigte allmählich Wirkung. Hin und wieder sank sein Kopf vornüber, bis er durch einen lauten Ton in der Glotze hochschreckte. Zum Glück kam das selten vor, denn aus Erfahrung bevorzugte der nächtliche Firmenbewacher stille Sendungen, und am liebsten war ihm das Programm mit den Bahnstrecken Deutschlands, es war einfach ideal zum Einschlafen. Verwunderlich war es nicht, dass er von dem Schatten des Mannes nichts mitbekam, der nicht weit an seinem Pförtnerhäuschen vorbeischlich. Der Unbekannte öffnete den Fußgängereingang an der Seite mit einem Nachschlüssel und verschwand in der Dunkelheit des Hofes. Offenbar kannte sich der Einbrecher mit der Örtlichkeit aus, denn ohne zu zögern ging er nicht etwa zum Hauptportal, sondern zu einer kleinen Pforte an der Seite des Gebäudes. Auch hier verschaffte ihm ein Schlüssel schnellen Zugang. Jetzt befand er sich im Lagerraum von Nelix. Der Schein einer Taschenlampe huschte über den Boden, und die Schritte des Eindringlings folgten dem Lichtstrahl. Die Medikamente in den Regalen interessierten ihn offenkundig nicht. Er stieg eine Treppe hinauf, öffnete die Tür oben und schaltete seine Taschenlampe aus. Sie war anscheinend nicht mehr nötig, der Mann wusste, wo er sich befand, er kannte offenbar die Örtlichkeit und ging im Dunkeln bis zu einer bestimmten Tür, die aus geriffeltem Glas bestand. Dort nestelte er in seiner Hosentasche nach einem bestimmten Schlüssel und schloss die Tür auf. Jetzt befand er sich im Büro des verunglückten Stefan Mitz.
Der Raum vor ihm lag in völliger Dunkelheit. Aber der Einbrecher kannte sich offenbar gut aus. Er wusste genau, wo der Schreibtisch stand, und als er bei ihm angelangt war, schaltete er den Computer ein. Der matte Schein des Bildschirms genügte, er spendete ausreichend Licht für die Zwecke des Eindringlings. Und soweit man sehen konnte, war nichts anderes als der Rechner selbst Gegenstand seiner Begehrlichkeit.
4. Näher, Herr Kommissar!
Die Stufen in die Unterwelt nahmen kein Ende. Das Gerichtsmedizinische Institut schien tatsächlich im Hades zu liegen. Jedenfalls kam es den beiden Lebenden so vor, als sie die Treppe hinunterstiegen. Die Toten selbst hat man noch nie nach ihrem liebsten Aufenthaltsort gefragt, ging es Vlassi durch den Kopf. Sie könnten auch nur schwer antworten. Und bei den Sterbenden getraut man sich nicht zu fragen, schließlich will man ihnen keinen Schreck einjagen. Bald bist du nicht mehr, aber sag mir schnell noch, wo du am liebsten hinkämst, wenn sich die Jenseitspforte für dich öffnet. Eine solche Frage ist mehr als unerwünscht, vor allem bei jenen, auf die der Tod wartet. Naheliegend beim Lieblingsaufenthaltsort wäre natürlich das Paradies oder wenigstens der Himmel. Die Hölle dagegen wird eher verschmäht, denn dort muss man Manna und andere Götterspeisen entbehren. Bestimmt ist der Himmel angenehmer, die Hölle dafür aber interessanter, man muss nur an die Gestalten denken, die man dort treffen kann. Auf jeden Fall werden Leichen in dieser Welt bevorzugt kalt aufbewahrt, möglichst unter der Erde.
„Die Bremsleitungen waren kaputt?“, fragte Hauptkommissarin Wunder im Gehen ihren Assistenten.
Vlassopolous Spyridakis nickte. „Laut Erkennungsdienst sahen sie angeschnitten aus. Da läuft Bremsflüssigkeit aus. Mitz konnte nicht stoppen, auch wenn er sich noch so angestrengt hat.“ Er machte eine Kunstpause, um dann seiner Chefin eine weitere profunde Überlegung mitzuteilen: „Aber es könnten auch Marder gewesen sein. Marder beißen zu gern in Bremsleitungen.“
„Was nun?“, fragte Julia und warf ihren hellbraunen Schal nach hinten. „Angeschnitten oder angebissen?“
„Na ja, angeschnitten.“
Julia Wunder trug heute einen Damen-Bogarthut in dunklem Braun, der ausgezeichnet mit ihrem Schal harmonierte. Sie und Kommissar Spyridakis waren in einem mit Linoleum ausgelegten Gang angelangt. Es roch streng nach einem Reinigungsmittel, und Vlassi hob witternd die Nase. „Arbeiten die hier unten eigentlich noch mit Formalin?“
„Wenn man tief einatmet, kann’s das Leben kosten.“
Vlassi atmete sofort ganz flach.
„Flachatmer sind auch gefährdet“, bemerkte Julia Wunder.
„Und Sie? Atmen Sie überhaupt noch?“
„Ach, ich hab mich schon dran gewöhnt. An den Atmungstod. Resistenz nennt man so was.“
Die beiden wandten sich nach rechts und schritten den Gang entlang. Kommissar Spyridakis hatte sich entschieden, ebenfalls resistent zu werden, und atmete wieder normal.
„Mitz war angestellt bei der Firma Nelix im Rheingau, in der Nähe von Geisenheim“, erklärte er, „ein medizinischer Großhandel.“
„Denen müssen wir einen Besuch abstatten.“
„Mit Sicherheit werden wir da was erfahren“, erwiderte Vlassi, „vielleicht sogar was über unbekannte Drogen.“
Die beiden gingen bis zur dritten Tür. Julia öffnete sie, und ein Obduktionsraum von etwa dreißig Quadratmetern lag vor ihnen. Dr. Silke Hauswaldt, eine Frau von Ende vierzig mit straff nach hinten gekämmten brünetten Haaren, kam eben im weißen Kittel aus dem Nachbarraum, grüßte kurz, musterte Julia und sagte: „Der Hut steht Ihnen.“
„Danke, mir steht fast jeder Hut.“
Während sich Dr. Hauswaldt Latexhandschuhe überstreifte, erklärte sie: „Dieser Tote im Weinberg ist nicht an seinen inneren Verletzungen gestorben.“
„So weit waren wir auch schon“, warf Vlassi ein, „und zwar am Tatort.“
„Man wird doch noch einen einführenden Satz sagen dürfen“, entgegnete die Rechtsmedizinerin. „Mit Ihrer Erlaubnis komme ich sofort zum Hauptteil.“
„Herr Spyridakis ist nun mal von der schnellen Truppe, auch wenn es nicht um Fußball geht“, nahm ihn seine Chefin in Schutz.
„Die Sache ist nicht ganz einfach“, fuhr Dr. Hauswaldt fort, „ich muss Sie zunächst etwas fragen: War der Tote depressiv?“
„Das wissen wir nicht“, antwortete Julia Wunder.
„Es gibt Antidepressiva, die zu Selbstmorden und Gewaltakten führen“, erläuterte Dr. Hauswaldt. „Das war lange Zeit nicht bekannt, und die Pharmafirmen haben es unter der Decke gehalten.“
„Meinen Sie so etwas wie den Fall Lubitz von Germanwings?“, fragte Vlassi.
„Ja, dieser Mann war depressiv, hat Medikamente genommen und hätte nie eine Maschine fliegen dürfen. Hier liegt ein Versagen der Ärzte vor, die ihn behandelten. Hätten sie nicht geschwiegen, wären hundertfünfzig Menschen nicht in den Tod gerissen worden.“
Dr. Silke Hauswaldt stellte diesen Umstand emotionslos fest wie einen Obduktionsbefund, an dem es nichts zu rütteln gab.
„Auf jeden Fall“, fuhr sie fort, „hat der Tote, soweit ich sehe, so etwas wie eine Droge zu sich genommen. In seinem Zustand muss das zum Herzstillstand geführt haben.“
„Spuren irgendwelcher Art gab es am Tatort keine“, erklärte Julia. „Wer nimmt eine Droge, wenn er verletzt und eingeklemmt hinterm Steuer sitzt?“
„Noch dazu eine, die tödlich wirkt“, ergänzte Vlassi.
„Man kann nie genau wissen, was Depressiven durch den Kopf geht. Er kann sie vorher genommen haben. Man könnte sie ihm in den Kaffee getan haben. Alles ist möglich. Ich habe eine Blutprobe genommen, sie untersucht und Partikel gefunden, die nicht ins Blut gehören.“
„Fremdkörper im Blut?“, ließ sich Kommissar Spyridakis hören.
„So könnte man sagen“, nickte Silke Hauswaldt. „Aber ich kann diese Partikel noch nicht bestimmen. Mir ist außerdem aufgefallen, dass seine Mundpartie merkwürdig riecht.“
„Na klar“, bestätigte Vlassi vorwitzig, „Leichengeruch!“
Frau Dr. Hauswaldt zog die Stirn kraus und deutete auf eine stählerne Liege. Unter einem Leinentuch erkannte man die Umrisse eines menschlichen Körpers.
„Bitte!“, forderte sie Kommissar Spyridakis auf. „Machen Sie selbst die Probe.“
„Eine Riechprobe?“, fragte Vlassi entsetzt.
Die Rechtsmedizinerin gab keine Antwort, schlug stattdessen das Tuch zurück und winkte Spyridakis mit dem Kopf herbei. Julia Wunder nickte ihm aufmunternd zu, sodass er vorsichtig näher heranging. Der Tote aus dem Weinberg lag mit dem Rücken auf dem Metallgestell und sah aus, als würde er ein Nickerchen machen. An der Stirn hatte er Schürfwunden, die Nase sah gebrochen aus, aber sonst wirkte er unverletzt und schien darüber nachzudenken, wie ihm das Malheur mit dem Tod passieren konnte. Vlassi schnüffelte in respektvollem Abstand in der Luft herum.
„Ich rieche nichts“, sagte er.
„Näher, näher, Herr Kommissar!“, forderte ihn Dr. Hauswaldt auf. „Vor den Toten brauchen Sie keine Angst zu haben. Vor den Lebendigen dafür umso mehr.“
Vlassi überwand sich, ging einen Schritt näher und senkte mutig sein Gesicht zum Kopf des Toten, um eine Geruchsfährte aufzunehmen.
„Ja“, murmelte er, „ich riech was.“
„Was denn?“, fragte Julia.
„Es riecht irgendwie verbrannt.“
Hauptkommissarin Wunder kam näher, beugte sich vor und roch ebenfalls.
„Stimmt“, stellte sie fest, „Ihre Nase hat Sie nicht im Stich gelassen.“
„Ich bin froh, dass Sie sich einig sind“, beendete Dr. Hauswaldt das Fachgespräch der Kommissare und fasste zusammen: „Es riecht wie verbrannt, auch an den Händen. Wenn man eine Pistole abfeuert, geht der Pulverdampf nach hinten weg und setzt sich in der Haut und den Kleidern fest. Aber ich habe keinerlei Schmauchspuren gefunden.“
„Eine Pistole war also nicht im Spiel“, ergänzte Vlassi. „Andererseits – Selbstmörder halten sich die Pistole gern vor den Mund.“
„Mir sind noch keine Waffen unter die Augen gekommen“, erklärte Dr. Hauswaldt in müder Resignation, „die beim Abfeuern nicht Schmauchspuren hinterlassen, und zwar nachweisbare.“
Vlassopolous Spyridakis setzte eine bedeutsame Miene auf. „Wär ja auch zu komisch. Der Mann hat einen Unfall, landet im Weinberg und feuert schnell noch einen Schuss auf sich ab, bevor er die Pistole zwischen die Weinreben wirft.“
*
Bruni Graf, die Freundin Julia Wunders, lag im Bett und hüstelte. Sie befand sich in einem Krankenhausbett der Eusebios-Klinik, schaute nach oben an die Decke und ihr ging durch den Kopf, wie sie in diese Lage gekommen war. Als sie eingeliefert wurde, ging es ihr schon mies. Ihre Bronchitis war über sie hergefallen wie selten zuvor. Ihr kleiner Hustenanfall beim Kaffeetrinken mit Julia war nur der Anfang gewesen. Aber danach wollten die Hustenanfälle kein Ende nehmen, sodass der behandelnde Arzt sie zur Beobachtung in die Klinik einwies. Und jetzt war sie froh, dass sie nur vor sich hin hüstelte und von keinem Hustenkrampf geschüttelt wurde.
Die Tür ging auf und der Assistenzarzt Dr. Sauer erschien. Er sah sehr jung aus, hatte das dreißigste Lebensjahr gerade erreicht, blieb am Bettrand stehen, schaute mit seinem jungenhaften Gesicht auf sie herab und fragte: „Wie fühlen Sie sich heute?“
„Schwach“, kam es von ihren Lippen.
„Das ist normal. Wenn Asthma und Bronchitis zusammenkommen, fühlt man sich miserabel. Bei Ihnen ist noch eine Lungenentzündung aufgetreten. Aber wir haben zum Glück heute die entsprechenden Mittel, um gegenzusteuern. Sie brauchen Ruhe, viel Ruhe. Nicht an Ihre Arbeit denken. Und brav die Medizin einnehmen. So kommen Sie am schnellsten wieder auf die Beine.“
Dr. Sauer nickte aufmunternd und drückte ihre Hand. Ihr schlaffes Pfötchen fühlte sich wie ein feuchter Lappen an. Kurze Zeit darauf erschien der Krankenpfleger Sborski im Zimmer. Er trug ein Tablett mit sich, auf dem sich zwei Pillen und ein Glas Wasser befanden.
„Ihre Arznei“, sagte er. Er schaute Bruni Graf mitfühlend an und wollte sie aufbauen. Aber womit? Natürlich mit einer Geschichte. Also fing er an zu erzählen: „Ein Onkel von mir in Krakau leidet auch an einer schlimmen Bronchitis. Er dachte schon häufig, es sei zu Ende, aber jedes Mal, wenn er nicht mehr ein noch aus wusste, geschah es, dass plötzlich ...“
Bruni schenkte ihm schon bei seinen ersten Worten einen dankbaren Blick, sie fühlte sich durch seine Erzählweise an ihre Kindertage erinnert und schlummerte schließlich dösig weg. So konnte sie natürlich nicht mitbekommen, dass der Pfleger Sborski, als er gerade das Krankenzimmer verließ, draußen auf dem Gang dem Oberarzt Dr. Bindel über den Weg lief. Der grüßte kurz, musterte ihn und fragte dann nach der Patientin, deren Zimmer Sborski gerade verlassen hatte – sie war schließlich privat versichert. Die Antwort des Pflegers, es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, nickte Dr. Bindel ab. Er war sich sicher, dass die Arznei, die sein Kollege Dr. Sauer verordnet hatte, helfen würde. Er hatte es ja sogar mit ihm abgesprochen. Nur eine andere Sache bereitete ihm Kopfzerbrechen, da war er sich gar nicht so sicher, und beim Weitergehen dachte er ans Uniklinikum Mainz, wo vor nicht allzu langer Zeit drei Säuglinge gestorben waren. Das war eine hochemotionale Angelegenheit, die die Öffentlichkeit enorm aufgescheucht hatte. Säuglinge sterben in einem deutschen Krankenhaus! Das durfte nicht sein.
Er kannte den Grund, und es musste um jeden Preis verhindert werden, dass es einen neuen Fall in dieser Richtung gab. So etwas würde eine öffentliche Diskussion auslösen, und öffentliche Diskussionen waren nie gut. Am Ende stand noch die Bild-Zeitung vor der Tür und machte die Klinik zum Gegenstand einer verzerrten Berichterstattung. Sogar die Kriminalpolizei hatte sie schon besucht. Das musste verhindert werden, derlei wirkte sich schädlich aus, nicht nur auf die Eusebios-Klinik, sondern auf alle Klinken. Die anderen konnten ihm eigentlich egal sein. Aber der Ruf der Ärzte, die in solchen Kliniken arbeiteten, stand auf dem Spiel. Also auch seiner. Und das war nicht nur bedauerlich, sondern äußerst unangenehm. Außerdem konnte es Folgen haben, die er sich gar nicht ausmalen wollte. Dr. Bindel fasste sich nachdenklich an die Nase. Er musste auf jeden Fall mit dem Chefarzt reden, und zwar schnell. Sehr schnell. Das Thema und seine möglichen Folgen vertrugen keinen Aufschub.