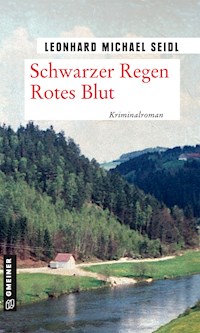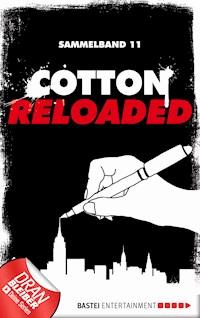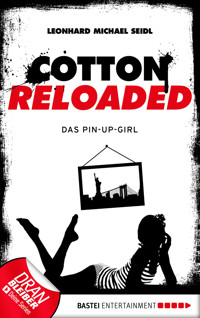Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Polizeikommissär Klemm
- Sprache: Deutsch
Regensburg 1945. Polizeikommissär Leo Klemm wird ins US-Militärgefängnis geschleust. Dort soll er etwas über den Aufenthaltsort des ehemaligen Gauleiters Ludwig Ruckdeschel herausfinden. Ruckdeschel war mitverantwortlich für den Tod des Dompredigers Dr. Johann Maier. Doch Klemms Mitgefangene schweigen. Dann macht ein Gerücht die Runde: Unter dem Gefängnis sollen sich Tausende Ampullen Senfgas befinden. Klemm steckt in der Falle. Flieht er, ist er seinen Job los. Bleibt er, stirbt er womöglich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leonhard Michael Seidl
Tod unter der Steinernen Brücke
Kriminalroman
Zum Buch
Riskantes Spiel Regensburg 1945. Polizeikommissär Leo Klemm wurden gefälschte Lebensmittelmarken untergeschoben. Er wird erwischt und in das Münchner Gefängnis Stadelheim gebracht. Dort treten Geheimdienstler auf ihn zu und stellen ihn vor die Wahl: Entweder er sitzt seine Strafe ab oder er erklärt sich zu einem Einsatz im provisorischen Regensburger US-Militärgefängnis bereit. Er soll den Aufenthaltsort des Gauleiters Ludwig Ruckdeschel ausfindig machen. Ruckdeschel hat unter anderem den Befehl zur Ermordung des Regensburger Dompredigers Dr. Maier gegeben und hält sich seitdem versteckt. Klemm willigt ein und erhält vier Wochen Zeit für dieses Unterfangen. Erledigt er seine Aufgabe, ist er frei und kann in den Polizeidienst zurückkehren. Andernfalls geht er ins Zuchthaus zurück. Klemm gerät zwischen die Fronten der Häftlingsgruppen und erfährt nichts. Plötzlich entsteht das Gerücht, dass sich unter dem Gefängnis Tausende Ampullen Senfgas befinden. Wie kann Klemm dieser tödlichen Falle entfliehen?
Leonhard Michael Seidl, geboren 1949 in München, ist Autor und Musiker. Seine Werke umfassen Romane und Theaterstücke, die mehrfach mit Preisen ausgezeichnet wurden. Seidl lebt mit seiner Familie bei München. Mehr Informationen zum Autor unter: www.dreamcompany.de
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © mauritius images / mauritius images Zeitgeschichte / Karl Heinrich Lämmel
ISBN 978-3-8392-7764-5
Vorbemerkung
Dieser Roman ist eine Fiktion, beruht jedoch auf echten Personen, Orten und Begebenheiten.
Karte
»Regensburg«, Leo Gestel, 1923 – Rijksmuseum Amsterdam (Public Domain)
Prolog
Am 7. März 1945 überschreiten amerikanische Verbände den Rhein über die Brücke von Remagen.
Am 17. April 1945 nähert sich die 3. amerikanische Armee der Stadt Regensburg.
Reichsverteidigungskommissar Ludwig Ruckdeschel lässt daraufhin am Montag, dem 23. April 1945, gegen 2:15 Uhr früh den Panzeralarm auslösen und in Regensburg bis auf die Steinerne Brücke alle anderen Brücken sprengen.
Ruckdeschel appelliert an die Bürger: »Je schlimmer die Not, umso fanatischer müssen wir sein, weil es immer um Deutschland geht. Die Parole für Regensburg lautet: nicht schwach sein, nicht feige werden, nicht kapitulieren.«
Die aufkommende Angst der Regensburger Bevölkerung steigert sich nach dieser Rede erheblich.
Die Verteidigung der Stadt durch die deutschen Truppen »bis zum letzten Stein« weckt bei den Leuten in der Stadt die schlimmsten Befürchtungen.
I. Sonntag, 22. April 1945
In der Nacht geht die 416. Infanterie-Division bei Kelheim sowie über die Eisenbahnbrücke bei Poikam über die Donau und wird in den Bereich Regensburg und Bad Abbach eingewiesen.
Luther Farell lehnte an der Seite des wuchtigen Sherman-Panzers, in dessen Besatzung er als Richtschütze eingeteilt war, und betrachtete das Foto der Schauspielerin Jane Russsell im YankMagazine – der Zeitschrift für die US-Boys an der Front.
Luther stammte aus Como, einem Kaff in Mississippi. Vor Kurzem war er vierundzwanzig Jahre alt geworden. In Como nistete die Langeweile in jedem Fenster. Die kaum achthundert Einwohner, zumeist Afroamerikaner, vertrieben sich die Abende mit Blues und Gospel-Songs in den zahlreichen Tingeltangel-Kneipen. Dort gab es günstiges Essen, schwarzgebrannten Whisky, billige Huren und hin und wieder eine Messerstecherei. Das Leben hatte Luther zu einem harten Burschen gemacht. Trotzdem sang er gern. Dennoch war es keine Stadt für den aufstrebenden jungen Mann, der unbedingt die Welt kennenlernen wollte.
Leise pfiff er die Melodie eines uralten Arbeiterliedes und schnippte die Asche von der Lucky Strike.
Luther war mit einem runden Gesicht gesegnet, das er aus der Heimat mitgebracht hatte. Der Junge war von Beruf Schreiner, hatte drei Jahre am Bau gearbeitet und war danach arbeitslos geworden. Am 23. September 1943, einem strahlend blauen Montag, unterschrieb er bei der Army. Sie bot ihm ausreichend Essen, Abwechslung und ein Dach über dem Kopf. Was wollte er mehr?
Inzwischen war er bei der 416. U. S. Infanterie-Division gelandet, die nun vor Regensburg stand. Heute Nacht sollte der Angriff auf die Stadt losgehen.
»Wir haben einen Job zu tun«, sagte Luther und warf die abgebrannte Zigarette ins Gras. Er sah zur Uhr. Gleich war Zeit fürs Abendessen.
In diesem Augenblick trat ihm Bill Hastings, der schmallippige Panzerkommandant, in den Weg. Hastings verehrte General Patton, den Chef der 3. U. S. Army. Sogar einen vernickelten Colt Single Action Revolver 1873, wie Patton ihn trug, hatte der besoffene Kerl aufgetrieben und protzte damit bei den Männern herum.
Hastings’ Gesicht war so grau wie eine Hauswand. Die Whiskyfahne konnte man bis zum Hudson River riechen. Er grinste dürr.
»Gib mal ’ne Kippe«, sagte Hastings mit schleppender Stimme. Billy Boy Hastings hasste alle dunkelhäutigen Kameraden – er würde jedem von ihnen zu gern und ohne Ausnahme den Weg von der Wiege bis zur Bahre weisen, denn in seinen Augen waren sie alle dumm wie Katzenpisse. Dies war Billys felsenfeste Überzeugung. Daran würde sich auch in hundert Jahren nichts ändern, vorausgesetzt, er überlebte diesen gottverdammten Krieg.
Zum Überleben gehörte allerdings auch, mit einem Kerl wie Luther Farell zusammenzuarbeiten. Das hatte bisher ganz gut geklappt, nur heute Nachmittag hatte Farell ihm, dem weißen Billy Boy Hastings, Absolvent der Landsford University Chicago, widersprochen.
Es war wie immer um Reinigungsarbeiten gegangen. Luther hätte den Sherman mit Eimern voll Wasser aus der Donau abspritzen sollen. Hatte er auch gemacht. Billy war im Gras gelegen und hatte zugesehen.
So weit, so gut.
Als Luther jedoch nach gefühlten zehn Stunden und sieben aufgerauchten Pall Mall noch immer nicht fertig war, hatte sich Kommandant Hastings aufgerappelt und war zu Luther getreten.
»Warum dauert das bei dir immer so lange?«, hatte er den schwitzenden Jungen gefragt.
»Weil du immer gegen den Tank kotzt!«, sagte Luther heftig.
»Was?«, entfuhr es Hastings. Was bildete sich dieses Sackgesicht ein? So sprach man nicht mit einem Vorgesetzten. Luther Farell knallte ihm den Eimer vor die Stiefel.
»Mach dein’ Scheiß allein!« Damit war er fortgegangen. Ohne sich noch einmal umzudrehen. Es hatte bloß gefehlt, dass er dem Vorgesetzten den Stinkefinger gezeigt hätte. Damit war jetzt Schluss.
»Gib mal ’ne Kippe«, wiederholte Hastings.
»Siehst du das?«, sagte Luther und deutete ins Gras. Dort lag die leere Packung.
»Du hast sicher noch irgendwo was gebunkert«, sagte Hastings.
Farell, kompakt und mindestens einen Kopf größer als Hastings, packte ihn am Arm.
»Jetzt hör mal zu, du versoffener Drecksack. Es reicht nicht, dass du die Kameraden ständig herumschikanierst. Es reicht nicht, dass du besoffen das Kommando führst. Es reicht auch nicht, dass du jede Nacht auf unseren Panzer kotzt. Aber dass du uns bei Kelheim im Suff beinah in die Donau gefahren hättest, das ist einfach zu viel.«
Hastings versuchte sich loszumachen, erreichte jedoch nur, dass Luther mit beiden Händen seinen Hals umklammerte.
»Bringst du das noch mal, Billy Boy Drecksack, reiß ich dir den Kopf ab und steck ihn dir in den Hintern, du Arschgeige!«
Hastings wollte sich losreißen. Luthers Hände drückten zu.
Später, in der Arrestzelle, gab Luther Farell zu Protokoll, er habe das auf keinen Fall so gewollt. Er habe Hastings gegenüber lediglich seine Zweifel an dessen Umgang mit den Kameraden nahebringen wollen. Dennoch war der neununddreißigjährige Captain Bill Hastings durch Luther Farell zu Tode gekommen. Das hieß für den jungen Mann mindestens ein Militärgerichtsverfahren – oder gleich den Stuhl. Seine Karriere bei der Army jedenfalls war mit diesem Tag beendet.
Während Luther Farell in seiner Zelle auf den Abtransport in irgendein verdammtes Gefängnis wartete, stimmte er einen uralten Song aus seiner fernen Heimat an; denn Luther war ein Bursche, der für sein Leben gern sang:
Sometimes I feel like a motherless child …
Darauf schlief er ein und schnarchte entsetzlich.
II. Montag, 23. April 1945
In Neustadt, Eining und Kapfelberg überqueren die Alliierten die Donau.
Der Tag, an dem es beginnt, entweicht der Nacht wie ein stinkender, mausgrauer Dieb.
Ein Bub streunt an diesem Morgen über den Regensburger Moltkeplatz.
»Guten Tag«, sagt freundlich der Tag. »Wie heißt du denn?«
»Ich bin der Gottfried«, sagt der Pimpf und verschluckt sich fast, weil der Tag mit ihm spricht. Bisher hat noch kein Tag mit ihm gesprochen. Vielleicht gibt es Tage, die mit einem reden, und andere, die lieber für sich bleiben. Manche Tage unterhalten sich nur am Sonntag mit den Leuten, an den Wochentagen hingegen mit Pflanzen, Wolken und Eseln. Heute jedoch ist der Sonntag vorbei, es ist Montag. Vielleicht hat der Tag verschlafen und ist zu spät wach geworden. Das muss es sein, denkt Gottfried und grinst: Der Tag hat verpennt.
Auf jeden Fall ist das für ihn ein gruseliges Abenteuer, das er unbedingt seinen Kameraden vom Jungvolk erzählen muss.
Gottfried fasst sich ein Herz und sagt: »Was wird’s denn heute für ein Tag?«
»Blutig wird’s«, sagt freundlich der Tag. »Die Wurd hat einen blutigen Tag gewürfelt.«
»Was ist die Wurd?«, fragt Gottfried.
»Die Wurd macht das Schicksal.«
»Aha«, sagt Gottfried und nestelt an der Koppel herum, die sein Braunhemd am mageren Körper hält. Der Bub ist stolz auf seine Uniform. Die Wurd aber ist bisher weder beim Schießdienst noch bei Fahnenappellen oder den Geländemärschen der Hitlerjugend vorgekommen.
Was sich so ein Tag alles zusammenreimt, denkt er, das geht auf keine Kuhhaut nicht.
»Jeder Tag hat seine Zeit«, sagt freundlich der Tag. »Ich hoffe, das stört dich nicht, Gottfried?«
»Meine Freunde sagen Friedl zu mir«, sagt der Pimpf.
»Meine Freunde«, sagt der Tag, »nennen mich den großen Luftschlucker.«
»Oh«, sagt Gottfried mit offenem Mund, »Grüß Gott, Herr großer Luftschlucker!«
»Servus, Friedl«, sagt freundlich der Tag.
Der Blondschopf, nicht älter als sechzehn, betrachtet den Tag neugierig.
»Dann wird es also heute richtig schön blutig?«, sagt er aufgeregt.
»Ja, so richtig schön blutig«, sagt der Tag. »Bleib daheim bei deiner Mama, Friedl, dann geschieht dir nichts.«
»So richtig blutig?«, will Gottfried noch mal wissen, bevor er zum Café Speiser eilt, um etwas Milch zu erbetteln. Milch gibt es momentan nicht oft, besonders wenn man keine Marken hat. Schuld sind die blöden Amerikaner, sagt die Mutter.
»Lass dich überraschen, Friedl, mein Freund«, sagt der Tag.
»Da bin ich ja mal gespannt«, sagt der Bursche und richtet das Käppi.
Der Tag scheint ihm freundlich zuzunicken. »Nun werde ich mir die Morgenröte als Mantel um die Schultern legen und weiterziehen.«
Eine Botschaft schickt ihm der Tag noch hinterdrein: »Widerstand ist Pflicht, Friedl … Widerstand!«
Das hört der Bub nicht mehr. Er trollt sich bereits zum Café Speiser.
»Wider…stand … Wider…stand!«, hallt es über den Moltkeplatz. Dann purzeln die Worte in die Donau.
III. Montag, 23. April 1945
Panzer-Alarm und Befehl zur Sprengung der meisten Donau-Brücken in Regensburg.
Es dröhnte gewaltig. In den Gebäuden an der Weinlände bröckelte der Putz von den Wänden. Die Menschen in den Betten schreckten auf, sahen zur Uhr: zwei Uhr fünfzehn. Viele traten ans Fenster. Der Eiserne Steg, der bisher über die Donau geführt hatte, glich jetzt einem rot glühenden, verbogenen Eisengeflecht, als hätte ein Riese ihn mit seinen Zähnen zerfetzt. Gauleiter Ruckdeschel hatte also wahr gemacht, was er in seiner Rundfunkansprache angedroht hatte: die Brücken der Stadt zu sprengen, um den feindlichen Vormarsch auf Regensburg zu stoppen.
Wann würde die Steinerne Brücke an der Reihe sein?, fragten sich bang die Menschen und krochen wieder in ihre Betten.
*
Vom Kirchturm schlug es zehn. Der Moltkeplatz lag unschuldig in der Morgensonne. Doch in der Bevölkerung hatten sich Angst und Grauen eingenistet. Brücken waren gesprengt worden. Es ging zu Ende. Die Amerikaner standen vor Regensburg.
Der Korpsbefehl des Generalkommandos war über die Dächer der Stadt geflogen: »Mit einer Fortsetzung des Vordrängens des Gegners sowie einem überraschenden Vorstoß feindlicher Panzergruppen gegen den Donauabschnitt zwischen Donauwörth und Regensburg muss gerechnet werden.«
Was das für die alte Dame Castra Regina, das ehrwürdige Regensburg bedeutete, konnten sich die Menschen nicht nur auf dem Moltkeplatz an allen zehn Fingern abzählen: Geschah kein Wunder, so würde die Stadt dem Erdboden gleichgemacht werden. Die Sherman-Panzer der Amerikaner leisteten in dieser Beziehung ganze Arbeit.
Nürnberg war am 20. April zerstört worden, ebenso davor Würzburg. Bereits am 17. April hatte ein taktischer US-Bomberverband bei einem Angriff auf Neumarkt sechshundert Häuser in Schutt und Asche gelegt.
Wunder jedoch waren keine in Sicht. In diesen Stunden hatte man nur die Wahl zwischen Teufel und Beelzebub, zwischen der kampflosen Übergabe an die Alliierten oder die Vernichtung der Stadt.
Mehr war nicht drin. Mehr war nicht zu bedenken. Wer aber trat vor und schwenkte das weiße Tuch der Kapitulation?
Man hatte gehört, dass mutige Männer, die das gewagt hatten, umgehend von der SS erschossen worden waren. Lieber blieb man in Deckung und wartete ab, was passierte.
Gottfried trat aus dem Café Speiser. Milch hatte er keine gekriegt. Stattdessen gab es hastig hingeworfene Bemerkungen, windige Gerüchte, wundersame Auskünfte.
»Die Amis vergewaltigen alle Frauen«, sagte die dreiundsiebzigjährige Frau Lederer.
»Ein Bajonett im Leib ist schlimmer«, meinte Adolf Herbst, was ihm einen bitterbösen Blick einbrachte.
Derselbe Adolf Herbst hatte schon vor Tagen gesagt, die sollten nur kommen, die Amerikaner, dann würde er sie mit seinem Schrotgewehr abmurksen, einen nach dem anderen.
Hingegen gab es von Ilse Herterich, einer feschen, mittelalten Blondine, die vieles wusste und manches ahnte und die selbst in Kriegszeiten gelbe Kleider trug und hohe Schuhe, eine Information, die aufhorchen ließ.
»Heut Nachmittag«, flüsterte sie, »heut Nachmittag treff ma uns aufm Moltkeplatz.«
»Wer?«, wollte Adolf Herbst wissen. Er hatte ein kaputtes Bein, das er sich bei Verdun geholt hatte.
»Alle Weiber, Männer und alle Kinder.«
»Für was soll denn das gut sein?«, fragte Frau Lederer aus dem Nachbarhaus, in dem es nach Rosenkohl roch – solange es welchen gab.
»Es geht um die kampflose Übergabe der Stadt an die Amis«, raunte die Herterich. »Oder wollt’s ihr, dass bei uns wia in Nürnberg oiss zsammschiassn?«
»Von wem hast du das gehört?«, sagte die Lederer.
»Koa Ahnung«, sagte die Herterich.
»Ob’s was hilft?«, sagte der alte Herbst und dachte an sein Schrotgewehr. Munition hatte er genug. Er brauchte den alten Schießprügel nur aus dem Versteck zu holen und einzuölen. Dann konnte die Hatz auf die Amis losgehen.
»Glaubst du wirklich, Ilse«, sagte Frau Lederer, »dass die auf uns hören werden?«
Einer Namensnennung bedurfte es nicht. Man wusste genau, wer gemeint war: Major Hüsson, der Regensburger Kampfkommandant, und sein Gehilfe Major Matzke. Denen und dem Gestapo-Chef Sowa durfte man unter keinen Umständen in die Quere kommen. Sonst war man geliefert. Von wegen weiße Fahnen aus dem Fenster hängen! Das gab es nicht in Regensburg. Das war Feigheit vor dem Feind und wurde auf der Stelle mit dem Tode durch Erschießen bestraft.
»Trotzdem müass ma’s probiern«, raunte Ilse Herterich.
»Aber es soll doch Entsatz kommen, Hilfe in der Not«, meinte Frau Lederer verzweifelt. »Wenn wir uns gegen den Hüsson auflehnen, stellt er uns alle an die Wand.«
Ilse Herterich grinste boshaft. »Alle? Naa, alle kann er net an d’Wand stellen. Alle Frauen mit den Kinderwagn? Alle Buabn und alle Madl? Alle oidn Männer? Nia! Das kann der Hüsson net macha.«
Adolf Herbst fühlte sich angesprochen. »Was schauen Sie da mich so an, Frau Herterich?«
»Koa Mensch schaut Ihnen an, Herr Herbst.«
»Doch. Sie haben mich angeschaut, wie Sie von den alten Männern gesprochen haben. Sie meinen wohl, ich kann nicht mehr kämpfen, weil ich zu alt bin dafür. Aber da täuschen Sie sich gewaltig, junge Frau. Ich war in der Champagne dabei. Ich stand vor Verdun. Ich hab den Einsatz von Giftgas in der Flandernschlacht erlebt. Gegen so was sind die Amis bloß ein aufgestellter Mausdreck. Und jetzt hol ich mein Gewehr!«
Ilse nickte müde. »Wia’s moana, Herr Herbst.« Sie machte eine Pause, blickte in die Runde. »Also: Heut Nachmittag um drei mach ma da auf’m Moltkeplatz eine Kundgebung. Thema: die kampflose Übergabe von unserer Stadt an die Amis. Sagt’s es weiter. Sagt’s es jedem, den wo ihr trefft. Jedm und alle. Je mehr mir san, desto weniger traut sich der Hüsson.«
»Wann geht’s los?«, sagte der alte Herbst. Er hörte schwer und steckte immer den kleinen Finger ins Ohr. Sein Erkennungszeichen.
»Um drei«, sagte die Herterich und ging davon.
Auch Gottfried verdrückte sich. Er hatte genug gehört. Der Mutter würde er alles erzählen. Vielleicht gingen sie dann alle zusammen um drei Uhr auf den Moltkeplatz. Gottlob, der Jüngste, Gottlieb, der Mittlere, und Gotthold, der gleich nach ihm kam. Nur Papa Godehard Pfrunz war noch draußen an der Front.
Der Vater hatte für den Jüngsten, Gottlob, zwar einen anderen Namen vorgesehen, doch Mutter Adelheid hatte gesagt: »Gottlob, dass es jetzt ein Ende hat mit der Fortpflanzung.« Und so blieb es bei Gottlob für den Knirps.
Jedenfalls würde es spannend werden. Ein richtiges Abenteuer. Wie hatte der Tag am Morgen gesagt: Die Wurd hat einen blutigen Tag gewürfelt. Einen blutigen Tag!
Wie Gottfried allerdings die Mutter kannte, würde sie den Kindern verbieten mitzukommen.
Gottfried überquerte den Platz, als drei Burschen aus dem Minoritenweg gelaufen kamen.
»Friedl, komm!«, rief Willy, der kleinste von ihnen, dem das Braunhemd wie ein Bug vor dem Bauch stand, weil er gerne Süßes naschte.
»Mag nicht«, sagte Friedl heftig.
»Du musst«, rief Willy erbost, »das ist ein Befehl.«
»Kannst dir deinen Befehl in den Hintern stecken«, schrie Gottfried zurück. »Ich geh nicht zum Volkssturm!« Er wollte schleunigst heim, doch Wilhelms Stimme hielt ihn zurück.
»Ich sag’s dem Sowa!«
Gottfried blieb stehen. »Sagst du nicht!«
»Sag ich doch!«, tönte Wilhelm mit erhobenen Fäusten. Wenn Wilhelm so drauf war, durfte man ihm nicht widersprechen. Er hatte immer irgendwo einen Prügel versteckt oder einen Stein in der Hosentasche.
»Hört auf zu streiten und kommt mit«, meldete sich aus dem Hintergrund Anton Kraus, seines Zeichens Volkssturm-Stabsführer und Befehlsgeber der kleinen Gruppe. Kraus trug ein dünnes Oberlippenbärtchen, lange schwarze Haare und eine Uniform, die aus verschiedenen Versatzstücken zusammengesetzt war. Er wusste genau, auf welche Stellen am Körper er sehr hart schlagen musste, damit es besonders wehtat. Es hieß, der Kraus, noch keine dreißig Jahre alt, sei wegen seiner Kurzsichtigkeit vom Dienst an der Front befreit. Dabei trug er nicht einmal eine Brille. Ilse Herterich hatte ein Auge auf ihn geworfen, was der Kraus aber nicht zur Kenntnis nahm. Denn Anton Kraus fühlte sich zu Höherem berufen. Die Arbeit als Ausbilder der Pimpfe an der Panzerfaust war erst der Anfang. Hoffentlich ging der Krieg noch recht lang, damit man sich für größere Aufgaben als für den Volkssturm empfehlen konnte.
Die Burschen trabten hinunter zur Eisernen Brücke. Gottfried musste wohl oder übel mit. Dort erwartete sie eine weitere Gruppe junger Kerle, die bereits bei den am Boden liegenden Panzerfäusten knieten.
Anton Kraus stellte sich in Positur.
»Was ihr hier seht, ist eine Panzerfaust. Eine Panzerfaust dient der Verteidigung. Die Verteidigung dient der Stadt Regensburg. Die Verteidigung dient unserer Heimat. Unsere Heimat wird vom Feind angegriffen. Diese gilt es zu verteidigen. Diese, alles, die ganze Heimat, ja … ist unsere Heimat … weil … ich …«
Anton Kraus stockte. Es war ihm nicht gegeben, lange Reden zu halten. Ansprachen mit mehr als zwei Sätzen waren für Anton Kraus, gelernter Bauhelfer, eine wacklige Sache, die schnell in der absoluten Sprachlosigkeit mündete. Aber anstatt es zu lassen oder es zu vermeiden, legte er es immer wieder darauf an, seinen Pimpfen ausufernde Vorträge zu halten. Was regelmäßig in die Hose ging.
Gottfried wusste das. Er mochte Kraus’ Blödsinn nicht mehr anhören. Der gesamte Volkssturm hing ihm längst zum Hals heraus. Was wollten eine Handvoll Pimpfe, Hausfrauen und alte Männer mit unzureichender Bewaffnung und zu wenig Munition gegen die Tanks der kampferprobten US-Army ausrichten? Gottfried hatte zwar noch keinen dieser Kolosse aus der Nähe gesehen, aber doch genug gehört, um stilles Grauen zu empfinden.
Er machte sich davon. Leise und unbemerkt. Während Anton Kraus verzweifelt Worte zusammenklaubte, um die Handhabung der Panzerfaust zu erklären, war Gottfried bereits auf dem Heimweg. Er musste der Mutter und den Brüdern von der Kundgebung auf dem Moltkeplatz berichten.
Vielleicht durften sie ja doch mitgehen.
IV. Montag, 23. April 1945, 17 Uhr
Sprengung von zwei Pfeilern der Steinernen Brücke.
Von der Hubertusstube in der Schäffnerstraße her kommend, in der sich die Lebensmittelausgabe befand, wälzte sich ein stummer Menschenstrom hin zum Moltkeplatz. Viele waren der Aufforderung gefolgt, aber nicht alle. Manche blieben zu Hause, weil sie weder an den Sinn noch an den Erfolg dieser Kundgebung glaubten. Andere versteckten sich in ihren Wohnungen, aus Angst, die Amerikaner würden schon bald vor der Tür stehen und verfängliche Fragen stellen, denen man nicht gewachsen war.
Eine dritte Gruppe – sie war nicht die geringste – marschierte aus Neugier mit. Vielleicht wurde jemand erschossen. Vielleicht konnte man zusehen, wie ein paar Kommunisten gehängt wurden. Vielleicht hielt Polizeidirektor Popp oder Kreisleiter Weigert eine zündende Rede, gegen die man im Schutze der Menge pfeifen und johlen konnte. Oder Bischof Buchberger zeigte sich. Insgeheim erwartete man den undurchsichtigen Gestapo-Chef Sowa zu sehen.
Alles war möglich.
Ilse Herterich trug einen grauen Staubmantel über dem geblümten Sommerkleid. Leichter Wind war aufgekommen. Frau Lederer schritt tapfer neben ihr dahin, den Spazierstock fest umklammert. Etwas weiter hinten folgte Adolf Herbst. Die Schrotflinte hatte er vorsorglich in eine alte Decke gehüllt. Die Amis mussten ja nicht sofort sehen, welche Bedrohung da auf sie zukam.
Nun sahen sie ihn. Kreisleiter Wolfgang Weigert stand auf einer Obstkiste und brüllte mit erhobener Faust: »Ich fordere Sie auf, vernünftig zu sein!«
»Buhhh!«
»Jeder, der diese Kundgebung besucht, wird Unannehmlichkeiten bekommen!«
»Buhuhuhuuu!«
»Es ist verboten, diese Kundgebung zu besuchen. Ich wiederhole, es ist …«
Der Rest seiner Worte versank in unbeschreiblichem Lärm. Ein paar Männer zerrten Weigert von seiner Obstkiste und stießen ihn zu Boden. Auf Händen und Knien machte er sich davon.
»Holt Dr. Ritter«, meldete sich eine Stimme.
»Genau! Der Ritter muss was sagen!«
Dr. Leo Ritter, Chefarzt am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, galt als eine unangefochtene Institution. Man hoffte, dass aufgrund der vielen Verwundeten Regensburg als Lazarettstadt anerkannt werden würde.
»Der Buchberger soll sprechen!«
»Bischof Buchberger heraus!«
Frau Lederer stand dicht bei Ilse Herterich. »Der Bischof Buchberger ist doch eine Respektsperson, oder? Dem tun sie nix, wenn er mit einer weißen Fahne daherkommt.«
Ilse Herterich schaute sie skeptisch an. »Der Buchberger, ich woass net … Der is doch vui z’feig für so was.«
»Also, ich finde«, sagte Frau Lederer, »der Bischof Buchberger ist ein gestandenes Mannsbild. Zumindest auf der Kanzel.«
»Ja freilich«, nickte die Herterich. »auf der Kanzel kann er redn wia ein Schernschleifa und über die Sündn von seine Schäflein herziehn. Aber da heruntn? Da schaut’s ganz anders aus.«
Die Menge wogte hin und her. Der Tumult wurde immer größer, nichts geschah. Gegen achtzehn Uhr war die Kundgebung dabei, sich aufzulösen. Enttäuschte Frauen schoben ihre Kinderwagen in Richtung Minoritenweg davon.
Plötzlich wurde es still. Wer gegangen war, kehrte zurück. Wer die Hoffnung aufgegeben hatte, hielt den Atem an. Eine Gruppe bahnte sich den Weg durch die Menge. Ein niedriger Tisch stand bereit, der als Podium dienen konnte. Vom Dom schlug es sechs Uhr.
Domprediger Dr. Johann Maier kletterte auf den Tisch. Er trug einen schwarzen Mantel und seinen schwarzen Hut. Die runde schwarze Brille saß fest auf seiner Nase. Ihm zur Seite stand Domkapitular Johann Baldauf.
Jeglicher Lärm hatte sich gelegt. Die Menschen auf dem Platz warteten sehnsüchtig auf Fürsprache, auf Worte des Trostes, auf Lösungen für die drängenden Probleme.
»Gelobt sei Jesus Christus«, begann Maier.
»In Ewigkeit. Amen«, kam es von der Menge.
»Meine lieben Brüder und Schwestern«, fuhr der Priester fort, »im Psalm neun spricht Gott: Du sollst die feindlichen Völker mit dem eisernen Zepter schlagen.«
Er machte eine kurze Pause.
»Ich frage euch, meine Mitbrüder und Mitschwestern: Wollen wir das? Wollen wir die feindlichen Völker mit einem eisernen Zepter schlagen?«
Adolf Herbst reckte seine Schrotflinte in die Höhe und brüllte mit kippender Stimme: »Abmurksen!« Worauf ein paar Betrunkene applaudierten.
»Gebt die Stadt frei«, schrien andere und »Gott schütze unser Regensburg« wieder andere. Der Domprediger hob die Hand. Stille kehrte ein.
»Was können wir tun?«, fuhr er fort. »Was müssen wir tun?«
Karl Fischer, ein stämmiger Oberoffiziant, verlangte, Kreisleiter Weigert und Gauleiter Ruckdeschel gehörten aufgehängt. Prompte Zustimmung in der Menge.
Wiederum hob Maier die Hand.
»Nein, meine Brüder und Schwestern. Das Aufhängen, wie ihr es wollt, ist der grausamste und schändlichste Tod, den ich keinem Menschen, nicht einmal dem ärgsten Widersacher, wünschen würde.«
»Den Teufel tät ich schon aufhängen. An einem Glockenseil«, schrie Volkssturmmann Kraus, der sich zu Ilse Herterich und Frau Lederer gesellt hatte.
»Regensburger und Regensburgerinnen aller Konfessionen«, rief Maier in die Menge. »Ich habe gestern im Dom die Worte des ersten Papstes zum Gegenstand meiner Ausführungen gemacht: Jede Obrigkeit ist von Gott. Wir sind daher jeder Obrigkeit untertan; denn es gibt keine Gewalt außer von Gott. Wir dürfen daher keinen Aufruhr machen. Wir sind doch nicht zusammengekommen, um zu demonstrieren und gegen die Regierung zu hetzen. Wir fordern nicht, wir wollen nur bitten.«
In diesem Augenblick, fast unbemerkt von den Kundgebungsteilnehmern, setzten sich, vom Menoritenweg her kommend, zwei Schutzpolizeigruppen mit je fünfzehn Mann in Bewegung.
»Wenn wir die Obrigkeit beeindrucken wollen, so können wir das am besten dadurch, dass wir mit Ruhe und sittlichem Ernst vor sie hintreten. Was wir erbitten wollen, die kampflose Übergabe unserer Stadt mit ihren vielen Lazaretten, ist ja gerechtfertigt, und zwar aus folgenden vier Gründen …«
Weiter kam er nicht. Ein Polizeibeamter in Zivil zerrte ihn von seinem erhöhten Standpunkt herunter. Obwohl die Leute lautstark protestierten und einige vergeblich versuchten, ihn der Polizeigewalt zu entreißen, wurde er von Kriminalkommissar Albert Jahreis zur Polizeidirektion am Minoritenweg abgeführt.
»Betet für mich!«, rief Maier, dann verschwand er in dem düsteren Gebäude.
V. Montag, 23. April 1945
Auflösung des KZ-Außenlagers Regensburg.
Kurz nach Mitternacht erfolgte ein Panzeralarm. Die meisten Donaubrücken in Regensburg seien zu sprengen: die Eiserne Brücke, der Eiserne Steg, die Adolf-Hitler-Brücke, genannt »Die Brücke des Teufels«, sowie am späteren Nachmittag die Sprengung von zwei Pfeilern der Steinernen Brücke.
Bereits am Vortag war durch Reichsverteidigungskommissar Ruckdeschel ein Appell zur unbedingten Verteidigung Regensburgs aus dem Kino Capitol am Arnulfplatz über den örtlichen Draht-Rundfunk gesendet worden: »Die Parole für Regensburg lautet: nicht schwach sein, nicht feige werden, nicht kapitulieren!«
*
Die Uhr an der kahlen Wand des düsteren Raumes in der Kreisleitung rückte auf neunzehn Uhr, als Kreisleiter Weigert reihum die Teilnehmer am Standgerichtsprozess gegen Domprediger Maier begrüßte.
Zunächst war da Herr Sowa, der Leiter der Regensburger Gestapo. Ihm gegenüber saß Hans Gebert, der stellvertretende Geschäftsführer der Milchwerke Regensburg. Neben ihm hatte Landgerichtsdirektor Johann Josef Schwarz seinen Platz eingenommen. Schwarz führte auch das Protokoll. Dazu kam Polizeipräsident Fritz Popp. Am anderen Ende, Weigert gegenüber, saß Staatsanwalt Alois Friedrich Then. Als Beisitzer fungierte Gendarmeriemajor Richard Pointner.
Auf dem Tisch erwartete sie eine Flasche Cognac samt Gläsern sowie ein silberner Aschenbecher.
Nach Erledigung des schlampig ausgeführten Hitlergrußes begann Weigert zu sprechen.
»Ich überbringe Nachrichten von Gauleiter Ruckdeschel.«
»Wo steckt denn der Kerl?«, sagte Schwarz ungehalten. »Wir brauchen ihn hier vor Ort!«
»Der hockt in Eglofsheim auf seinem Schloss«, sagte Then verstimmt.
Weigert wollte sich nicht auf eine Diskussion über den derzeitigen Aufenthaltsort des Reichsverteidigungskommissars Ruckdeschel einlassen. »Meine Herren, ich muss doch bitten. Die Lage ist ernst.«
»Eben«, knurrte Then.
»Jedenfalls zeigte sich der Gauleiter höchst empört darüber, dass in Regensburg, im Rücken der kämpfenden Truppe, Kundgebungen zur kampflosen Übergabe der Stadt an den Feind durchgeführt werden und dass Männer wie Domprediger Maier das Volk aufhetzen. Aus diesem Grunde wurde mir der Auftrag erteilt, die bei dieser illegalen Demonstration festgenommenen Personen, insbesondere Domprediger Dr. Johann Maier, vor der versammelten Menge auf dem Moltkeplatz aufzuhängen und anschließend Vollzug zu melden.«
Erschrockene Stille trat ein. Nach einer Weile meldete sich Gebert. »Der Maier hat doch nix getan«, sagte er vorsichtig.
Gestapo-Chef Sowa meldete sich: »Und das alles ohne ordentlichen Prozess? Nein, meine Herren, so geht das nicht.« Er schenkte sich einen Cognac ein und nahm einen Schluck. »Wenn wir von Erhängen oder Hinrichtung reden, dann gehört dazu ein ordentliches Standgericht.«
Weigert nickte bekräftigend. »Danke für das Stichwort. Laut der geltenden Standgerichtsverordnung vom Februar diesen Jahres erkläre ich das Verfahren gegen Maier und Konsorten hiermit für eröffnet.«
»Ich frage noch einmal«, sagte Gebert. »Was hat der Maier gemacht? Der hat doch nix gemacht. Warum wollt ihr einen Pfarrer aufhängen?«
Polizeipräsident Popp hob die Hand. »Tatsache ist, dass wir das Gehabe dieses Priesters nicht durchgehen lassen können. Wo kommen wir hin, wenn jeder auf eine Obstkiste hinaufsteigt und infame Hetzreden gegen unseren Führer Adolf Hitler und den bevorstehenden Endsieg führt? Das sind unflätige Reden, meine Herren. Da sind wir uns doch einig, oder?«
»Ich meinte ja bloß«, sagte Gebert. »Er hat doch nur darum gebeten, dass wir …«
»Papperlapapp«, sagte Sowa. »Der Maier muss weg.«
Kreisleiter Weigert nickte erneut. »Gut. Dann sind wir uns ja einig.«
Staatsanwalt Then wollte noch etwas wissen. »Wo ist der Maier im Moment?«
»Im Keller. Zum Verhör«, sagte Weigert.
Der Kreisleiter hob sein gefülltes Glas und prostete den Mitwirkenden dieser absurden Veranstaltung zu.
»Das Urteil steht. Die Sitzung ist geschlossen. Danke, meine Herren.«
*
Eine Treppe tiefer, in einem schmutzigen, fensterlosen Raum stand Domprediger Dr. Johann Maier vor dem Vernehmungsbeamten unter dem schummrigen Licht einer nackten Glühbirne. Zuvor hatten die Schergen dem Priester den Gürtel seiner Hose abgenommen, wie man es von Freisler kannte. Maier war barfuß und fror entsetzlich. Der Beamte hinter dem Schreibtisch entzündete eine Zigarette.
»Nun erzählen Sie mal, Maier.«
Der Domprediger wusste nicht, wie ihm geschah. Was sollte er erzählen? Und warum? Die Leute auf dem Moltkeplatz hatten doch alle seine flehenden Worte vernommen. Jeder, der wollte, hatte sie hören können.
»Wenn wir die Obrigkeit beeindrucken wollen, so können wir das am besten dadurch, dass wir mit Ruhe und sittlichem Ernst vor sie hintreten. Was wir erbitten wollen, die kampflose Übergabe unserer Stadt mit ihren vielen Lazaretten …«
»Halt!«, brüllte der Beamte, ein in graues Tuch gekleideter, kahlköpfiger Mann, mit einer Narbe am Kinn. »Was fällt dir überhaupt ein, du windiger Schwarzrock? In einem einzigen Satz redest du von Ruhe, von sittlichem Ernst und von der kampflosen Übergabe unserer Stadt! Und verärgerst dazu auch noch die armen Kameraden in den Lazaretten. Das ist reinster Defätismus, Mann! Das ist nichts anderes, als würde man zweifeln am Sieg. Zweifelst du am Sieg, Pfarrer?«
»Ich habe nur …«
»Steh stramm, Pfaffe, wenn ich mit dir rede.«
»Ich kann nur wiederholen, dass ich in keiner Weise …«
Der Vernehmungsbeamte fuhr auf. »In keiner Weise, sagst du, in keiner Weise? Was ist das für eine Weise, wenn man die Menschen in Regensburg zum Widerstand gegen die Regierung aufstachelt? Wenn man fordert, die Stadt dem Feind, den Barbaren zu überlassen, und in Kauf nimmt, dass unsere Frauen vergewaltigt und dass unsere Kinder am Lagerfeuer gebraten werden? Was ist das für eine Weise?«
Dr. Maier, der jetzt um sein Leben bangte, stellte sich gerade hin und sah dem Beamten furchtlos in die Augen. »Weder habe ich die Leute aufgestachelt, noch habe ich irgendjemanden zum Widerstand aufgerufen. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis.«
Der Vernehmungsbeamte lachte. »Was ich zur Kenntnis nehm oder nicht, geht dich einen Dreck an, du schmutziges Pfäfflein. Aber das ist ja alles kein Problem. Es gibt genügend Menschen, die bezeugen, dass du Leute aufgehetzt und zur widersinnigen Aufgabe der Stadt aufgerufen hast.«
Maier wollte etwas sagen. Der Beamte trat vor und rammte ihm die Faust in den Magen, sodass der Domprediger ächzend in sich zusammensank. Der Beamte hockte sich wieder an den Tisch und schrieb ein paar Zeilen auf ein schmutziges Blatt Papier. Dann reichte er Maier einen Stift. »Unterschreiben.«
»Was steht denn da?«
»Unterschreib oder ich erschlag dich!«
Es war Maiers Todesurteil.
*
Kurz vor einundzwanzig Uhr traf SS-Gruppenführer Hennicke am Ort des Geschehens ein. Er betrat das Büro und wandte sich sofort an den Kreisleiter.
»Warum ist der Befehl des Gauleiters noch nicht vollzogen?«, brüllte er Weigert an. Als dieser keine Antwort gab, fuhr er fort: »Warum sind die Rädelsführer noch nicht aufgehängt? Was ist da los?«
Betretenes Schweigen in der Runde. Nach einer peinlichen Pause sagte Weigert: »Der Platz wird gerade geräumt und der Galgen errichtet, Gruppenführer. Wir arbeiten so schnell, wie wir unter den gegebenen Umständen können.« Er reichte Hennicke den Zettel mit dem Urteil.
Das Standgericht verurteilt den achtunddreißigjährigen Domprediger Johann Maier wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode. Unterzeichnet: Weigert, Kreisleiter.
Der Gruppenführer knurrte zufrieden. Er wedelte mit dem Wisch und sagte: »Es geht doch. Und jetzt frisch ans Werk. Morgen ist ein neuer Tag für den Führer.«
Gemeinsam verließen sie die Kreisleitung und eilten zum Moltkeplatz, um den Aufbau des Galgens zu beobachten.
*
Friedl Pfrunz konnte nicht schlafen. Hin und her wälzte er sich in seinem Bett, dachte an die Worte des Großen Luftschluckers und leuchtete mit seiner alten Taschenlampe auf seinen Wecker. Schließlich hielt er es nicht mehr aus. Eilig schlüpfte er in seine Uniform. Weit nach Mitternacht schlich er auf Zehenspitzen aus dem Haus und rannte zum Moltkeplatz. Er wusste genau, was ihm blühte, wenn ihn die Mutter erwischte, doch die Neugier war stärker.
Etwas versteckt hockte er sich auf einen Randstein und schlief gleich darauf ein.
Gegen drei Uhr fünfzehn wurde er von einem Stoß in die Rippen wach. Anton Kraus hockte neben ihm.
»Das da ist der Weigert«, sagte Kraus leise. »Und da der Popp. Und der Sowa. Und daneben der Staatsanwalt Then. Und dort der Hennicke.«
Schweigend schauten sie auf die nächtliche Szenerie. Der Moltkeplatz war von Fackeln hell erleuchtet. Vor dem Dom stand der Galgen. Er bestand aus einer Querstange zwischen zwei Fahnenmasten.
Nun wurde Domprediger Dr. Johann Maier von einem vierköpfigen Gestapokommando unter Führung eines SS-Sturmbannführers zu der Querstange geführt, mit dem Gesicht zum Dom. Er trug Zivilkleidung. Um seinen Hals hing ein Pappschild. Lautlos buchstabierte Friedl die wenigen Worte: »Hier starb ein Saboteur.«
Der SS-Sturmbannführer gab eine zackige Order. Die Männer des Kommandos legten Maier die Schlinge um den Hals und hievten ihn hoch.
Als Friedl ein lautes Knacken vernahm, schloss er entsetzt die Augen. Anton Kraus hingegen applaudierte begeistert. Wenig später rückte das Gestapokommando in ruhiger Ordnung ab.
Der Kalender zeigte Dienstag, den 24. April 1945, vier Uhr früh. Domprediger Dr. Johann Maier war ermordet worden, und niemand hatte es verhindert.
Tatsache war, die Regensburger sollten einen Schock bekommen, wenn sie am nächsten Morgen über den Platz gingen. Jeder sollte das Pappschild sehen, das man dem Domprediger um den Hals gehängt hatte. Der Schock würde groß genug sein, dass sich kein Widerstand mehr regte.
Gottfried Pfrunz, der an diesem Morgen unausgeschlafen aus dem Bett gekrochen war, saß bei der Mutter am Tisch.
»Was is denn ein Saboteur, Mama?«, sagte er harmlos.