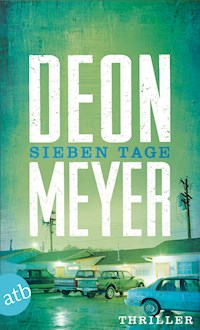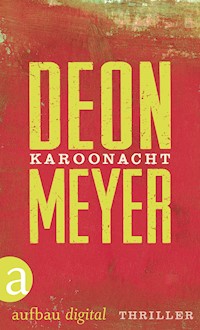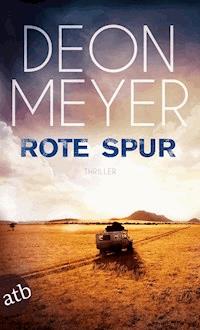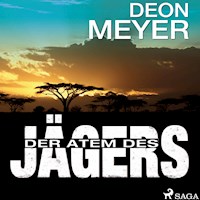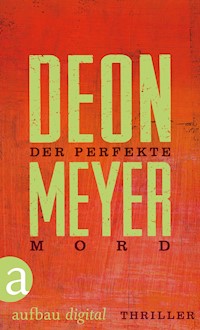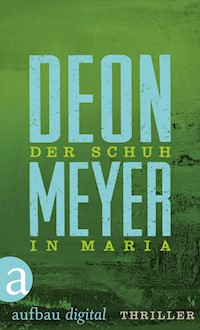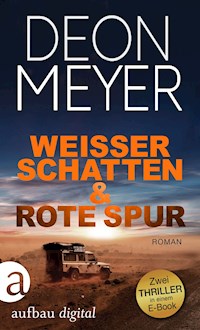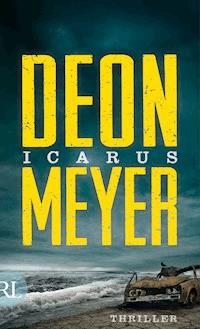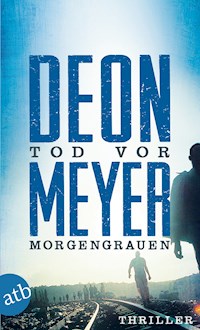
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Mörder mit Vergangenheit
Van Heerden, ein Ex-Polizist, findet sich im neuen Südafrika nicht zurecht. Nur widerwillig ermittelt er in einem Fall, der Jahre zurückliegt. Ein Antiquitätenhändler wurde ermordet, und nun soll sein Vermögen an den Staat fallen. Van Heerden hat sieben Tage Zeit, Licht in das Dunkel zu bringen – und was er findet, führt ihn tief in die Vergangenheit seines rätselhaften Landes.
Ein Roman voller Spannung und Atmosphäre – Deon Meyer beweist mit diesem Buch, dass er zu den besten Krimiautoren der Welt gehört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Über Deon Meyer
Deon Meyer wurde 1958 in Südafrika geboren. Zunächst arbeitete er als Reporter in Bloemfontein. 1994 erschien sein erster Roman. Mittlerweile ist er der erfolgreichste Krimiautor Südafrikas. Für »Das Herz des Jägers« erhielt er den Deutschen Krimipreis. Deon Meyer schreibt auf Afrikaans, übersetzt werden in der Regel seine autorisierten englischen Übersetzungen. Er lebt mit seiner Frau und vier Kindern in Melkbosstrand.
Im Aufbau Verlag liegen seine Romane »Der traurige Polizist«, »Tod vor Morgengrauen«, »Das Herz des Jägers«, »Der Atem des Jägers«, »Weißer Schatten« sowie der Story-Band »Schwarz – weiß – tot« vor.
Informationen zum Buch
DER BESTE KRIMIAUTOR SÜDAFRIKAS
Van Heerden, ein Ex-Polizist, findet sich im neuen Südafrika nicht zurecht. Nur widerwillig ermittelt er in einem Fall, der Jahre zurückliegt. Ein Antiquitätenhändler wurde ermordet, und nun soll sein Vermögen an den Staat fallen. Van Heerden hat sieben Tage Zeit, Licht in das Dunkel zu bringen – und was er findet, führt ihn tief in die Vergangenheit seines rätselhaften Landes.
Ein Roman voller Spannung und Atmosphäre – Deon Meyer beweist mit diesem Buch, daß er zu den besten Krimiautoren der Welt gehört.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Deon Meyer
Tod vor Morgengrauen
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet
Inhaltsübersicht
Über Deon Meyer
Informationen zum Buch
Newsletter
Donnerstag, 6. Juli – Noch sieben Tage
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Freitag, 7. Juli – Noch sechs Tage
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Samstag, 8. Juli – Noch fünf Tage
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Sonntag, 9. Juli – Noch vier Tage
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Montag, 10. Juli – Noch drei Tage
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Dienstag, 11. Juli – Noch zwei Tage
Kapitel 35
Kapitel 36
Mittwoch, 12. Juli – Noch ein Tag
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Donnerstag, 13. Juli – Tag der Entscheidung
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Impressum
Donnerstag, 6. Juli Noch sieben Tage
1
Noch schwer benebelt vom Alkohol schreckte er aus dem Schlaf hoch. Die Schmerzen in den Rippen waren das Erste, was er wahrnahm. Dann das geschwollene Auge und die geplatzte Oberlippe, den modrigen Mief der Zelle, die Desinfektionsmittel, den säuerlichen Geruch seines Körpers, den salzigen Geschmack von Blut und abgestandenem Bier im Mund.
Und die Erleichterung.
Puzzlestücke des vergangenen Abends trieben durch seine Erinnerung. Die Provokation, die pikierten Gesichter, die Wut — was waren sie doch für stinknormale, berechenbare Arschlöcher, diese kreuzbraven, ehernen Stützen der Gesellschaft.
Er wollte sich nicht bewegen, blieb auf der Seite liegen, die nicht schmerzte, der Kater pochte in seinem Körper wie eine Krankheit.
Draußen im Gang erklangen Schritte, im Schloss der grauen Stahltür wurde ein Schlüssel umgedreht, das schrille metallische Geräusch fräste sich durch seinen Kopf. Dann stand der Uniformierte vor ihm.
»Dein Anwalt ist hier«, sagte der Polizist.
Langsam drehte er sich auf der Pritsche um. Schlug ein Auge auf.
»Los!« Eine Stimme, die jeden Respekt vermissen ließ.
»Ich habe keinen Anwalt.« Seine Stimme klang sehr fern.
Der Polizist trat einen Schritt vor, packte ihn am Kragen und zog ihn hoch. »Los jetzt!«
Die Schmerzen in seinen Rippen. Er taumelte durch die Zellentür, durch den gefliesten Gang ins Dienstzimmer.
Der Uniformierte schritt voraus, mit einem Schlüssel wies er den Weg in den kleinen Vorführraum. Wieder die Schmerzen, als er eintrat. Kemp saß da, hatte die Stirn gerunzelt, neben ihm sein Aktenkoffer. Er setzte sich auf einen dunkelblauen Stuhl und stützte den Kopf in beide Hände. Hinter sich hörte er den Polizisten die Tür schließen und sich entfernen.
»Du bist ein Stück Dreck, van Heerden«, sagte Kemp.
Er antwortete nicht.
»Was machst du nur aus deinem Leben?«
»Spielt das eine Rolle?« Die S-Laute kamen ihm nur gelispelt über die geschwollenen Lippen.
Die Furchen auf Kemps Stirn wurden noch tiefer. Er schüttelte den Kopf. »Sie haben sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, Anzeige zu erstatten.«
Er wollte die Erleichterung auskosten, es genießen, wie der Druck von ihm abfiel, aber das alles entzog sich ihm. Kemp. Was zum Teufel hatte Kemp hier verloren?
»Sogar Zahnärzte können erkennen, wenn sie es mit einem Haufen Scheiße zu tun haben. Mein Gott, van Heerden, was ist los mit dir? Du wirfst dein Leben auf den Müll. Zahnärzte. Wie besoffen muss man sein, um sich mit fünf Zahnärzten anzulegen?«
»Zwei waren Allgemeinmediziner.«
Kemp musterte van Heerden. Dann erhob sich der Anwalt; er war ein großer Mann mit gepflegtem Äußeren, Sportjackett und grauer Hose, dazu, wunderbar passend, der neutrale Farbton der Krawatte. »Wo steht dein Wagen?«
Langsam stand er auf, er nuschelte leicht: »Vor der Kneipe.«
Kemp öffnete die Tür und trat hinaus. »Dann komm jetzt.« Van Heerden folgte ihm ins Dienstzimmer. Ein Sergeant schob seine Besitztümer über den Tresen, eine Plastiktüte mit seiner schlanken Brieftasche und seinen Schlüsseln. Er nahm sie entgegen, ohne dem anderen in die Augen zu sehen.
»Ich nehm ihn mit«, sagte Kemp.
»Er kommt wieder.«
Es war kalt. Der Wind strich durch seine dünne Jacke, er widerstand dem Impuls, sie enger um sich zu schlagen.
Kemp stieg in seinen großen Allrad-Geländewagen, beugte sich hinüber und öffnete die Beifahrertür. Langsam ging van Heerden um den Wagen herum, stieg ein, schloss die Tür und lehnte den Kopf dagegen. Kemp fuhr los.
»Welche Kneipe?«
»Das Sports Pub, gegenüber von Panarotti’s.«
»Was war los?«
»Warum hast du mich rausgeholt?«
»Weil du der gesamten Polizeidienststelle von Table View erzählt hast, ich würde sie samt den Zahnärzten der ganzen Palette zwischen tätlicher Beleidigung und Körperverletzung anklagen.«
Schemenhaft erinnerte er sich an seine Tirade in der Dienststelle. »Mein Anwalt.« Mit spöttischem Unterton.
»Ich bin nicht dein Anwalt, van Heerden.«
Das geschwollene Auge schmerzte, ihm verging das Lachen. »Warum hast du mich rausgeholt?«
Wütend wechselte Kemp den Gang. »Das weiß kein Schwein.«
Van Heerden drehte den Kopf zur Seite und betrachtete den Mann hinter dem Lenkrad. »Du willst was von mir.«
»Du schuldest mir noch was.«
»Ich schulde dir gar nichts.«
Kemp hielt nach dem Pub Ausschau. »Welcher Wagen gehört dir?«
Er zeigte auf den Corolla.
»Ich fahr dir nach. Ich brauch dich noch, sauber und vorzeigbar.«
»Wofür?«
»Das kommt später.«
Er stieg aus, ging über die Straße, sperrte nicht ohne Probleme mit zitternder Hand die Tür auf und setzte sich in den Toyota. Der Motor stotterte, ächzte und sprang schließlich an. Er fuhr zur Koeberg Road, bog nach Killarney auf die N7, der Wind trieb plötzlich Regen über die Straße. Links nach Morning Star und wieder links in die Einfahrt zum Anwesen. Kemps importierter amerikanischer Ford immer hinter ihm. Zwischen den Bäumen spähte er zum großen Haus, dann bog er zum kleinen, weiß getünchten Gebäude ab und hielt an.
Kemp kam neben ihm zum Stehen und öffnete das Fenster wegen des Regens nur einen Spaltbreit. »Ich warte auf dich.«
Er duschte sich ohne viel Begeisterung, ließ das heiße Wasser über den Körper laufen, automatisch seiften die Hände den schmalen Streifen zwischen Schultern, Brustkorb und Bauch ein — nur mit Seife, ohne Waschlappen, vorsichtig strich er über die verletzten Rippen. Methodisch reinigte er dann den restlichen Körper, lehnte mit dem Kopf gegen die Wand, um das Gleichgewicht zu halten, während er erst das eine, dann das andere Bein wusch, drehte schließlich die Wasserhähne zu und nahm sich das fadenscheinige, verwaschene weiße Handtuch vom Ständer. Früher oder später würde er sich ein neues Handtuch kaufen müssen. Er ließ das Warmwasser im Waschbecken laufen, hielt die Hände unter das dünne Rinnsal und spritzte Wasser gegen den Spiegel, um den Wasserdampf fortzuspülen. Drückte einen Tropfen Rasiercreme in die linke Hand, tauchte den Rasierpinsel ein, ließ die Creme aufschäumen und rieb sich das Gesicht ein.
Das Auge sah übel aus, rot und verquollen. Später würde es zu einem purpurfarbenen Blau werden. Der größte Teil des Schorfs auf der Lippe war weggewaschen. Nur ein dünner blutiger Schnitt war noch zu sehen.
Er zog den Rasierer vom linken Ohr nach unten, über die Kante des Kiefers bis zum Hals, dann begann er wieder von oben, ohne sich anzusehen. Zog die Haut um den Mund straff, dann machte er sich an die rechte Seite, spülte den Rasierer, säuberte das Waschbecken mit heißem Wasser und trocknete sich erneut ab. Bürstete sich das Haar. Musste die Bürste säubern, die voller schwarzer Haare steckte.
Musste neue Unterwäsche kaufen. Musste neue Hemden kaufen. Neue Socken. Hose und Jacken gingen noch. Scheiß auf die Krawatte. Im Zimmer war es dunkel und kalt. Regen schlug gegen die Fenster, es war zehn Minuten nach elf Uhr morgens.
Er ging hinaus. Kemp öffnete ihm die Tür des Geländewagens.
Das Schweigen hielt bis Milnerton.
»Wohin?«
»In die Innenstadt.«
»Du willst doch was.«
»Eine unserer Assistentinnen hat eine eigene Kanzlei aufgemacht. Sie braucht Hilfe.«
»Du schuldest ihr was.«
Kemp schnaubte nur. »Was war letzte Nacht los?«
»Ich war betrunken.«
»Was war letzte Nacht los, das anders war als sonst?«
In der Lagune gegenüber dem Golfplatz standen Pelikane und fischten; der Regen störte sie nicht.
»Sie waren so von ihren beschissenen Geländewagen eingenommen.«
»Und deshalb bist du auf sie losgegangen?«
»Der Dicke hat zuerst zugeschlagen.«
»Warum?«
Er wandte den Kopf ab.
»Ich versteh dich nicht.«
Er räusperte sich.
»Du könntest ein ganz normales Leben führen. Aber du hast eine so beschissene Meinung von dir selbst …«
Die Industrieanlagen von Paarden Eiland zogen vorüber.
»Was war los?«
Van Heerden betrachtete den Regen, die feinen Wassertropfen, die über die Windschutzscheibe schlierten. Er atmete tief ein, ein Seufzer, der die ganze Sinnlosigkeit verdeutlichte. »Wenn du einem Kerl erzählst, dass sein Schwanz mit einem Geländewagen auch nicht länger wird, stellt er sich taub. Aber kaum ziehst du seine Frau mit rein …«
»O Gott.«
Kurz spürte er wieder den Hass, die Erleichterung, den Augenblick der Erlösung: die fünf Männer mittleren Alters, ihre vor Wut verzerrten Gesichter, die Schläge, die auf ihn niederprasselten, bis es den drei Barkeepern gelang, sie zu trennen.
Sie sprachen nichts mehr, bis Kemp vor einem Gebäude an der Foreshore anhielt.
»Dritter Stock. Beneke, Olivier und Partner. Sag Beneke, ich schick dich.«
Er nickte, öffnete die Wagentür und stieg aus. Kemp sah ihn nachdenklich an.
Dann schloss van Heerden die Tür und betrat das Gebäude.
Er ließ sich auf den Stuhl fallen, seine Haltung ein Ausdruck mangelnden Respekts. »Kemp schickt mich«, war alles, was er sagte. Sie hatte genickt, sein geschwollenes Auge und die verletzte Lippe betrachtet, aber nicht weiter kommentiert.
»Ich denke, Sie und ich, wir können uns gegenseitig behilflich sein, Mr. van Heerden.« Sie strich den Rock am Hintern glatt, bevor sie sich setzte.
Mister. Und ihr rührender Versuch, eine Gemeinsamkeit herzustellen. Er kannte das. Aber er sagte nichts. Er sah sie an. Fragte sich, von wem sie ihre Nase und ihren Mund hatte. Die großen Augen und die kleinen Ohren. Die genetischen Würfel waren etwas seltsam gefallen, beinah hätte man sie als schön bezeichnen können.
Sie hatte die Hände auf die Schreibtischfläche gelegt, die Finger ordentlich verschränkt. »Mr. Kemp erzählte mir, Sie verfügen über Erfahrung bei Ermittlungstätigkeiten, sind im Moment aber nicht fest angestellt. Ich brauche die Hilfe eines guten Ermittlers.« Norman Vincent Peale. Ihre Stimme war geschmeidig. Vermutlich war sie intelligent. Vermutlich würde es länger dauern als sonst bei den anderen Frauen, bis sie mit den Nerven am Ende war.
Sie öffnete eine Schublade und nahm eine Akte heraus.
»Hat Kemp Ihnen gesagt, dass ich ein ziemliches Wrack bin?«
Ihre Hände zögerten kurz. Sie lächelte ihn steif an. »Mr. van Heerden, Ihre Persönlichkeit interessiert mich nicht. Ihr Privatleben interessiert mich nicht. Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor. Ich biete Ihnen die Möglichkeit, zeitweilig für mich tätig zu sein, wofür ich Ihnen ein professionelles Gehalt zahle.«
So beschissen kontrolliert. Als würde sie alles wissen. Als würde sie außer ihrem Handy und ihrem Diplom nichts brauchen, um sich zu schützen.
»Wie alt sind Sie?«
»Dreißig«, sagte sie, ohne zu zögern.
Er blickte zu ihrem vierten Finger an der linken Hand. Kein Ring.
»Sind Sie verfügbar, Mr. van Heerden?«
»Kommt drauf an, was Sie wollen.«
2
Meine Mutter war Künstlerin. Mein Vater war Bergmann.
Sie sah ihn zum ersten Mal an einem kalten Wintertag auf dem vom Frost überzogenen Rugbyfeld des Olien Park. Sein gestreiftes Vaal-Reef-Jersey hing in Fetzen an ihm herab, langsam ging er zur Außenlinie, um sich ein neues Trikot zu holen, bewegte sich geschmeidig, schweißüberströmt, Schultern, Bauch und Rippen zeichneten sich deutlich ab und schimmerten schwach in der fahlen Nachmittagssonne.
Sie hatte die Geschichte immer ganz genau erzählt, jedes Mal: der blassblaue Himmel, das ausgebleichte grau-weiße Gras im Stadion, die kleine Studentengruppe, die ihre Mannschaft lauthals gegen die Bergleute unterstützte, die purpurroten Narben der Spieler – leuchtende Farbflecken vor dem Mattgrau der Holzbänke. Jedes Mal, wenn ich die Geschichte hörte, schmückte ich sie mit weiteren Einzelheiten aus: ihrer schlanken Gestalt, wie ich sie von einem Schwarz-Weiß-Foto aus jener Zeit kannte, die Zigarette in der Hand, dunkles Haar, dunkle Augen, von gewisser tiefsinniger Schönheit. Wie sie ihn betrachtete, die Linien seines Gesichts und seines Körpers, die so unwiderstehlich makellos waren, als könnte sie darin bereits alles genau vor sich sehen.
»Genau in sein Herz«, sagte sie.
In diesem Augenblick wusste sie zwei Dinge mit absoluter Gewissheit. Eines davon war, dass sie ihn malen wollte.
Sie wartete nach dem Spiel draußen auf ihn, zwischen den Betreuern und Spielern der zweiten Mannschaft, bis er in Jackett und Krawatte, das Haar noch nass von der Dusche, herauskam. Und er erblickte sie im Licht der Dämmerung, spürte ihre Intensität, errötete und schritt auf sie zu, als wüsste er, dass sie ihn wollte.
Sie hatte den Zettel in der Hand.
»Ruf mich an«, sagte sie, als er vor ihr stand.
Seine Kumpel umringten ihn, also gab sie ihm den gefalteten Zettel mit ihrem Namen und ihrer Telefonnummer und ging zurück zu dem Haus in der Thom Street, wo sie zur Untermiete wohnte.
Er rief spätabends an.
»Ich heiße Emile.«
»Ich bin Künstlerin«, sagte sie. »Ich möchte dich malen.«
»Oh.« Enttäuschung in seiner Stimme. »Wie? Malen?«
»Dich.«
»Warum?«
»Weil du ein schöner Mann bist.«
Er lachte, glaubte ihr nicht und war verunsichert. (Später hatte er ihr erzählt, dass ihm das neu war, dass es ihm immer schwer gefallen sei, Mädchen zu bekommen. Worauf sie antwortete, das liege daran, dass er sich dämlich anstellte mit Frauen.)
»Ich weiß nicht«, murmelte er schließlich.
»Als Bezahlung kannst du mich dann zum Essen ausführen.«
Erneut lachte mein Vater nur. Und kaum eine Woche später, sonntags, an einem kalten Wintermorgen, fuhr er mit seinem Morris Minor von seiner Unterkunft in Stilfontein nach Potchefstroom. Sie, ausgerüstet mit Staffelei und Malutensilien, stieg ein und lotste ihn auf der Carletonville Road hinaus in die Nähe des Boskop Dam.
»Wohin fahren wir?«
»Ins Veld.«
»Ins Veld?«
Sie nickte.
»Macht man das nicht in … einem Kunstsaal?«
»Einem Atelier.«
»Ja.«
»Manchmal.«
»Oh.«
Sie waren auf einen Feldweg abgebogen und hatten an einer kleinen Kuppe angehalten. Er half ihr die Ausrüstung zu tragen, sah zu, wie sie die Leinwand auf der Staffelei befestigte, den Kasten öffnete und die Pinsel reinigte.
»Du kannst dich jetzt ausziehen.«
»Ich werde nicht alles ausziehen.«
Sie sah ihn nur schweigend an.
»Ich kenne noch nicht einmal deinen Vornamen.«
»Joan Kilian. Zieh dich jetzt aus.«
Er legte sein Hemd ab, dann die Schuhe.
»Das reicht«, widersetzte er sich.
Sie nickte.
»Was muss ich tun?«
»Stell dich auf den Felsen.«
Er kletterte auf einen großen Felsblock.
»Nicht so steif. Entspann dich. Lass die Hände baumeln. Schau dort hinüber, zum Damm.«
Und dann begann sie zu malen. Er stellte ihr Fragen, aber sie antwortete nicht, wies ihn nur einige Male an, still zu stehen, sah von ihm zur Leinwand, mischte und trug Farben auf, bis er es aufgab, mit ihr zu reden. Nach einer Stunde oder noch länger erlaubte sie ihm eine Pause. Wieder stellte er Fragen, erfuhr, dass sie die einzige Tochter einer Schauspielerin und eines Theaterdozenten in Pretoria war. Dunkel erinnerte er sich an die Namen aus Afrikaans-Filmen der vierziger Jahre.
Schließlich steckte sie sich eine Zigarette an und packte ihr Malzeug ein.
Er zog sich an. »Kann ich sehen, was du gezeichnet hast?«
»Gemalt. Nein.«
»Warum nicht?«
»Du kannst es sehen, wenn es fertig ist.«
Sie fuhren nach Potchefstroom zurück und tranken in einem Café heiße Schokolade. Er stellte Fragen zu ihrer Kunst, sie fragte ihn nach seiner Arbeit. Und irgendwann während des Spätnachmittags an jenem Wintertag im westlichen Transvaal sah er sie lange an und sagte dann: »Ich werde dich heiraten.« Sie nickte, denn das war der zweite Punkt gewesen, dessen sie sich absolut sicher gewesen war bei ihrer ersten Begegnung.
3
Die Anwältin sah auf ihren Ordner und atmete hörbar ein.
»Johannes Jacobus Smit wurde am 30. September letzten Jahres bei einem Einbruch in seinem Haus in der Morletta Street in Durbanville mit einer großkalibrigen Waffe tödlich verletzt. Der gesamte Inhalt seines begehbaren Safes ist verschwunden, darunter befindet sich auch ein Testament, in dem er angeblich seinen gesamten Besitz seiner Lebensgefährtin Wilhelmina Johanna van As vermacht hat. Wird dieses Testament nicht gefunden, fällt das Vermögen des verstorbenen Mr. Smit an den Staat.«
»Wie groß ist das Vermögen?«
»Nach allem, was bislang bekannt ist, etwas unter zwei Millionen.«
Er hatte es vermutet. »Van As ist Ihre Klientin.«
»Sie hat mit Mr. Smit elf Jahre zusammengelebt. Sie hat ihn bei seinen Geschäften unterstützt, ihm die Mahlzeiten zubereitet, das Haus sauber gehalten, sich um seine Wäsche gekümmert und auf sein Drängen hin ihr gemeinsames Kind abgetrieben.«
»Er hat ihr nie angeboten, sie zu heiraten?«
»Er hielt … nicht viel von der Ehe.«
»Wo war sie am Abend des …?«
»Dreißigsten? In Windhoek. Er hat sie dorthin geschickt. Geschäftlich. Sie kam am 1. Oktober zurück und fand ihn tot im Haus vor, an einen Küchenstuhl gefesselt.«
Er rutschte noch weiter auf seinem Stuhl nach unten. »Und ich soll das Testament aufspüren?«
Sie nickte. »Ich habe bereits alle Schlupflöcher, die das Gesetz lässt, ausgekundschaftet. Die abschließende Sitzung beim Obersten Gerichtshof findet in einer Woche statt. Wenn wir bis dahin kein rechtsgültiges Dokument vorlegen können, wird Wilna van As keinen Cent bekommen.«
»In einer Woche?«
Sie nickte.
»Es sind fast … zehn Monate vergangen. Seit dem Mord.«
Die Anwältin nickte erneut.
»Ich nehme an, die Polizei hat nichts gefunden.«
»Sie hat ihr Bestes getan.«
Er sah zu ihr, dann zu den beiden Diplomen an der Wand. Seine Rippen schmerzten. Er gab einen kurzen, ordinären Laut von sich, teils vor Schmerzen, teils aus Ungläubigkeit. »Eine Woche?«
»Ich …«
»Hat Ihnen Kemp das nicht gesagt? Für Wunder bin ich nicht mehr zuständig.«
»Mr. van …«
»Es sind fast zehn Monate vergangen, seitdem der Mann umgebracht wurde. Sie verschwenden das Geld Ihrer Klientin. Aber das kümmert Anwälte ja nicht.«
Er sah, wie sie die Augen zusammenkniff, auf einer ihrer Wangen erschien ein kleiner roter, halbmondförmiger Fleck. »Mein Berufsethos ist über alle Zweifel erhaben, Mr. van Heerden.«
»Nicht, wenn Sie bei Mrs. van As den Eindruck erwecken, es bestehe noch Hoffnung«, sagte er und wunderte sich, wie sehr sie sich unter Kontrolle hatte.
»Miss van As ist über die Bedeutung dieses Schritts eingehend unterrichtet worden. Ich habe sie auf die mögliche Zwecklosigkeit dieses Unterfangens hingewiesen. Aber sie ist bereit, Sie zu bezahlen, weil es ihre letzte Chance ist. Die einzige Möglichkeit, die ihr noch bleibt. Es sei denn, Sie wissen nicht, was Sie zu tun haben, Mr. van Heerden. Es gibt auch andere, die über die gleichen Fähigkeiten verfügen wie Sie …«
Der Halbmond glänzte nun leuchtend rot, ihre Stimme aber blieb gemessen und kontrolliert.
»Und die nichts lieber tun würden, als gemeinsam mit Ihnen das Geld der Miss van As einzustecken«, sagte er und fragte sich, ob der Fleck noch röter werden konnte. Zu seiner Überraschung lächelte sie.
»Es interessiert mich wirklich nicht, wie Sie sich Ihre Schrammen zugezogen haben.« Mit ihrer manikürten Hand deutete sie auf sein Gesicht. »Aber langsam verstehe ich den Grund dafür.«
Die halbmondförmige Rötung verblasste langsam. Enttäuscht dachte er einen Moment lang nach. »Was war noch im Safe?«
»Das weiß sie nicht.«
»Das weiß sie nicht? Sie schläft elf Jahre lang mit ihm, und sie weiß nicht, was er in seinem Safe aufbewahrt?«
»Wissen Sie, was sich im Kleiderschrank Ihrer Frau befindet, Mr. van Heerden?«
»Wie heißen Sie?«
Sie zögerte. »Hope.«
»Hope?«
»Meine Eltern waren irgendwie … romantisch veranlagt.«
Er ließ sich den Namen auf der Zunge zergehen. Hope. Beneke. Er betrachtete sie, fragte sich, wie eine Frau, die dreißig Jahre alt war, mit einem Namen wie Hope leben konnte. Er besah sich ihr kurzes Haar. Wie das eines Mannes. Flüchtig überlegte er, an welchen Gesichtszügen die Götter des Antlitzes bei ihr herumgefummelt hatten — ein altes Spiel, an das er sich nur noch dunkel erinnerte.
»Ich bin nicht verheiratet, Hope.«
»Das überrascht mich nicht … Wie heißen Sie mit Vornamen?«
»Mir gefällt das ›Mister‹ ganz gut.«
»Wollen Sie sich auf die Herausforderung einlassen, Mister van Heerden?«
Wilna van As befand sich irgendwo in der unbestimmten Spanne zwischen jung und alt, eine Frau mittleren Alters ohne scharfe Kanten, klein und rundlich, und sie sprach mit leiser Stimme, als sie im Wohnzimmer ihres Hauses in Durbanville saßen, während sie ihm und der Anwältin von Jan Smit erzählte.
Sie hatte ihn als »Mr. van Heerden, unseren Ermittler« vorgestellt. Unseren. Als würde er ihnen gehören. Er hatte um Kaffee gebeten, als ihnen etwas zu trinken angeboten wurde. Steif und förmlich saßen sie im Wohnzimmer, allesamt einander fremd.
»Ich weiß, es ist nahezu unmöglich, das Testament noch rechtzeitig zu finden«, sagte van As entschuldigend. Er sah zur Anwältin, die mit ausdrucksloser Miene seinem Blick begegnete.
Er nickte. »Aber Sie sind sich sicher, dass es das Dokument wirklich gibt?«
Hope Beneke atmete ein, als wollte sie Widerspruch einlegen.
»Ja. Jan hat es eines Abends mit nach Hause gebracht.« Sie zeigte in Richtung Küche. »Wir haben am Tisch gesessen, und er hat mir jeden Punkt erklärt. Es war kein besonders langes Schriftstück.«
»Und der Tenor lautete, dass Sie alles erben würden?«
»Ja.«
»Wer hat das Testament aufgesetzt?«
»Er hat es selbst verfasst. Es war seine Handschrift.«
»Hat es jemand beglaubigt?«
»Er hat es von der Polizeidienststelle hier in Durbanville beglaubigen lassen. Zwei der Beamten haben es unterschrieben.«
»Es gab nur dieses eine Exemplar?«
»Ja«, antwortete Wilna van As resigniert.
»Und es ist Ihnen nicht seltsam vorgekommen, dass er bei der Abfassung des Testaments keinen Anwalt zu Rate gezogen hat?«
»Jan war so.«
»Wie?«
»Sehr für sich.«
Die Worte hingen in der Luft. Van Heerden sagte nichts, er wartete, dass sie fortfuhr.
»Ich glaube, er hat anderen Menschen nicht sonderlich vertraut.«
»Oh?«
»Er … wir haben ein einfaches Leben geführt. Es gab die Arbeit und unser Zuhause. Manchmal hat er dieses Haus als sein Versteck bezeichnet. Er hatte keine Freunde …«
»Womit hat er sein Geld verdient?«
»Mit alten Möbeln. Was andere Antiquitäten nennen. Er sagte, in Südafrika gibt es eigentlich keine Antiquitäten, das Land sei dafür noch zu jung. Wir waren Großhändler. Wir haben die Möbel aufgetrieben und Händler beliefert, manchmal auch direkt an Sammler verkauft.«
»Was war Ihre Aufgabe dabei?«
»Vor etwa zwölf Jahren habe ich für ihn zu arbeiten begonnen. Als eine Art … Sekretärin. Er fuhr durch die Gegend, suchte nach Möbeln, auf dem Land, auf den Farmen. Ich hielt das Büro besetzt. Nach sechs Monaten …«
»Wo ist das Büro?«
»Hier. In der Wellington Street. Hinter dem Pick ’n Pay-Supermarkt. In einem kleinen alten Haus …«
»Es gab keinen Safe im Büro?«
»Nein.«
»Nach sechs Monaten …?«, erinnerte er sie.
»Ich fand mich schnell zurecht. Er war im Nordkap, als jemand aus Swellendam anrief. Es ging um eine jonkmanskas, eine Garderobe, wenn ich mich recht erinnere, neunzehntes Jahrhundert, ein schönes Stück mit Intarsien … Jedenfalls rief ich ihn an. Er sagte, ich müsse sie mir ansehen. Ich bin hingefahren und habe sie unglaublich billig erstanden. Er war beeindruckt, als er zurückkehrte. Und dann habe ich mehr und mehr gemacht …«
»Wer war dann im Büro?«
»Anfangs haben wir uns abgewechselt. Zum Schluss war nur noch er im Büro.«
»Das hat Ihnen nichts ausgemacht?«
»Es hat mir gefallen.«
»Wann sind Sie zusammengezogen?«
Van As zögerte.
»Miss van As …« Hope Beneke beugte sich vor, kurz suchte sie nach den richtigen Worten. »Mr. van Heerden muss leider Fragen stellen, die vielleicht … nicht immer angenehm sind. Aber es ist enorm wichtig, dass er so viele Informationen wie möglich erhält.«
Van As nickte. »Natürlich. Es ist nur … ich bin es nicht gewohnt, über unsere Beziehung zu sprechen. Jan war immer … Er sagte immer, das geht die anderen nichts an. Weil sie sich dann nur das Maul zerreißen.«
Sie bemerkte, dass er auf eine Antwort wartete. »Das war etwa ein Jahr, nachdem wir begonnen hatten, gemeinsam im Geschäft zu arbeiten.«
»Elf Jahre.« Eine Feststellung.
»Ja.«
»Hier in diesem Haus?«
»Ja.«
»Und Sie haben niemals den Safe betreten?«
»Nein.«
Er starrte sie nur an.
Van As machte eine hilflose Handbewegung. »So war es eben.«
»Wenn Jan Smit unter anderen Umständen ums Leben gekommen wäre, wie hätten Sie dann das Testament aus dem Safe geholt?«
»Ich kannte die Kombination.«
Er wartete.
»Jan hat sie auf mein Geburtsdatum eingestellt. Nachdem er mir das Testament gezeigt hat.«
»Er hat alle wichtigen Unterlagen im Safe aufbewahrt?«
»Ich weiß nicht, was sonst noch drin war. Weil alles verschwunden ist.«
»Darf ich ihn sehen? Den Safe?«
Sie nickte und stand auf. Wortlos folgten er und Hope Beneke ihr durch den Gang. Zwischen dem Bad und dem Schlafzimmer war rechts die große Stahltür des Safes zu erkennen, darin eingesetzt der Mechanismus mit dem Kombinationsschloss. Die Tür stand offen. Van As betätigte den Lichtschalter an der Wand, eine Neonröhre flackerte auf und leuchtete dann grell. Sie trat hinein.
»Ich denke, er hat ihn nachträglich einbauen lassen. Nachdem er das Haus gekauft hat.«
»Sie denken?«
»Er hat es nie erwähnt.«
»Und Sie haben nie gefragt?«
Sie schüttelte den Kopf. Er besah sich das Innere des Safes. An allen Seiten standen Holzregale, sie waren leer.
»Sie haben keine Ahnung, was hier drin war?«
Wieder schüttelte sie den Kopf. Im engen Raum wirkte sie klein neben ihm.
»Sie sind nie vorbeigekommen, wenn er drin zu tun hatte?«
»Er hat die Tür geschlossen.«
»Und die Geheimniskrämerei hat Sie nie gestört?«
Mit einem fast kindlichen Gesichtsausdruck sah sie ihn an. »Sie kannten ihn nicht, Mr. van Rendsburg.«
»Van Heerden.«
»Entschuldigen Sie mich.« Er sah die Frau erröten. »Gewöhnlich kann ich mir Namen sehr gut merken.«
Er nickte.
»Jan Smit war … ein Mensch, der sehr zurückgezogen gelebt hat.«
»Haben Sie hier sauber gemacht, nachdem …«
»Ja. Nachdem die Polizei fertig war.«
Er drehte sich um und ging, vorbei an Hope Beneke, die auf der Schwelle stand, zurück ins Wohnzimmer. Die Frauen folgten. Sie setzten sich wieder.
»Sie waren die Erste, die am Tatort war?«
Die Anwältin hob die Hände. »Könnten wir nicht eine kleine Pause einlegen?«
Van As nickte. Van Heerden sagte nichts.
»Ich hätte gern einen Tee«, sagte Beneke. »Wenn es nicht zu große Umstände macht.« Sie ließ der anderen Frau ein warmes Lächeln zukommen.
»Gern«, antwortete Wilna van As und ging in die Küche.
»Etwas mehr Mitgefühl würde nicht schaden, Mr. van Heerden.«
»Nennen Sie mich einfach van Heerden.«
Sie sah ihn an.
Er lehnte sich auf dem Stuhl zurück. Die Schmerzen um das Auge waren mittlerweile stärker als in den Rippen. Der Kater pochte dumpf im Schädel. »Sieben Tage, da bleibt nicht viel Zeit für Mitgefühl, Hope.« Dass er sie mit ihrem Vornamen ansprach, ärgerte sie. Das gefiel ihm.
»Ich glaube nicht, dass Sie sich Zeit oder Schwierigkeiten ersparen, wenn Sie kein Mitgefühl zeigen.«
Er zuckte mit den Schultern.
»Sie klingen gerade so, als würde sie zum Verdächtigenkreis gehören.«
Er schwieg kurz, dann fragte er bedächtig, müde: »Wie lange sind Sie schon Anwältin?«
»Fast vier Jahre.«
»Mit wie vielen Mordfällen hatten Sie in diesem Zeitraum zu tun?«
»Ich verstehe nicht, was das mit Ihrem mangelnden Taktgefühl zu tun hat?«
»Warum, glauben Sie, hat Kemp mich empfohlen? Weil ich so ein liebenswerter Bursche bin?«
»Was?«
»Ich weiß, was ich tue, Beneke. Ich weiß, was ich tue.«
4
Jahrelang hing das Gemälde meines Vaters an der Wand gegenüber ihrem Doppelbett — der geschmeidige Körper des Bergmanns mit seinem kupferroten Haar und dem muskulösen Oberkörper, im Hintergrund ein Höhenzug im vom Winter ausgebleichten westlichen Transvaal. Das Gemälde war das Symbol ihres einzigartigen Zusammentreffens, ihrer ungewöhnlichen Romanze, ihrer Liebe auf den ersten Blick, die es in jenen Tagen ganz offensichtlich häufiger gegeben hatte als heute.
Ich erzähle Emiles und Joans Liebesgeschichte nicht, weil sie einen amüsanten Prolog zu meiner eigenen Geschichte abgibt, sondern weil sie zu den wichtigen Faktoren gehört, die mein Leben bestimmt haben.
Denn im Schatten dieser ihrer Liebe habe ich den Großteil meines Lebens damit verbracht, ebenfalls diesen Augenblick zu finden und ebenfalls dieselbe unmittelbare Gewissheit der Liebe zu entdecken.
Was schließlich zu meinem Niedergang führte.
Mein Vater war ein ehrenwerter Mann. (Wie enttäuscht würde er sein, wenn er wüsste, was aus seinem erwachsenen Sohn geworden ist.) Dies — und sein Körper — bildeten wahrscheinlich das Fundament, auf dem die Ehe meiner Eltern gebaut war. Denn sie hatten nichts gemeinsam. Selbst nach ihrer Heirat, drei Jahre später, lebten sie in dem Bergmannshaus in Stilfontein in getrennten Welten.
Ich muss zugeben, dass ich mich an die ersten vier oder fünf Jahre meines Lebens kaum erinnere; ich weiß nur, dass meine Mutter, die Künstlerin, immer von ihren Künstlerfreunden umgeben war: von Malern, Bildhauern, Schauspielern, Musikern, seltsamen Leuten, die aus Johannesburg und Pretoria zu Besuch kamen, gelegentlich das dritte Schlafzimmer zum Bersten füllten und an manchen Wochenenden sogar im Wohnzimmer nächtigten. Sie führte die Unterhaltung an, hatte eine Zigarette in der Hand, ein aufgeschlagenes Buch in Reichweite, Musik kam von zerkratzten Schallplatten, vor allem Schubert, aber auch Beethoven und Haydn. (Mozart, sagte sie, besitze nicht genügend Leidenschaft.) Dem Haushalt oder dem Kochen konnte sie nichts abgewinnen, aber es gab immer eine Mahlzeit für meinen Vater, oft genug ein exotisches Gericht, das einer ihrer Freunde zubereitet hatte. Und er, er war eine Gestalt am Rande, der Mann, der mit seinem Helm und dem Henkelmann von der Schicht nach Hause kam und zum Rugby-Training ging. Oder im Sommer zum Joggen. Er war ein Fitness-Fanatiker, Jahre bevor es in Mode kam. Er nahm Jahr für Jahr am Comrades Ultra-Marathon teil und an anderen mittlerweile vergessenen Marathonveranstaltungen. Er war ein stiller Mann, dessen Leben sich um seine Liebe zu ihr und seiner Liebe zum Sport drehte — und später um seine Liebe zu mir.
Am 27. Januar 1960 wurde ich vom Schicksal in diesen Haushalt geworfen, ein Junge mit den dunklen Zügen seiner Mutter und der Wortkargheit seines Vaters.
Es war sein Vorschlag, dass sie mich »Zatopek« nennen sollten.
Er war ein großer Bewunderer des tschechischen Leichtathleten Emil Zatopek, und vielleicht spielte es auch eine Rolle, dass er den gleichen Vornamen trug, auch wenn sich die Schreibweise leicht unterschied. Für meine Mutter klang »Zatopek« anders, exotisch, bohemehaft. Keiner der beiden, die ganz gewöhnliche Namen besaßen, konnte sich vorstellen, was dies für einen Jungen bedeutete, der in einer Bergbaustadt aufwuchs. Dabei hinterließ weniger der mitleidlose Spott der anderen Kinder seine Narben. Doch keiner der beiden sah vorher, welchen Ärger und welche Wut sich im Lauf des Lebens aufstaute, wenn man bei jedem Formular, das auszufüllen war, seinen Namen buchstabieren musste; wenn andere die Augenbrauen hochzogen und ihr unvermeidliches »Wie bitte?« folgen ließen, wenn man sich vorstellte.
Es gab nur zwei Ereignisse in meinen ersten sechs Lebensjahren, die mich immer begleiten sollten.
Das erste war, als ich die Schönheit der Frauen entdeckte.
Dies hatte sehr vielfältige, facettenreiche Auswirkungen, und Sie müssen es ertragen, wenn ich hier von der Chronologie und dem Erzählfluss abweiche. Aber es war ein Thema, das mich faszinierte, verzauberte und letztendlich zu dem Puzzle beitrug, das meine Psyche darstellt.
Die genauen Einzelheiten dieses denkwürdigen Ereignisses habe ich längst vergessen. Ich glaube, ich war knapp sechs Jahre alt, wahrscheinlich spielte ich im Wohnzimmer des Bergmannshauses mit meinen Spielsachen, um mich herum die Erwachsenen, der weitläufige Künstlerkreis meiner Mutter, als ich aufsah und eine ihrer Freundinnen, eine Schauspielerin, anblickte. Und in diesem Moment erkannte ich ihre Schönheit, unbestimmt, vage nur, doch in dem festen Wissen, dass sie schön war, dass die Vollendung ihrer Gesichtszüge, ihres Körpers einen überwältigte. Ich muss zugeben, ich kann mich nicht mehr an ihr Gesicht erinnern, nur noch daran, dass sie klein und schlank gewesen war und wahrscheinlich braunes Haar gehabt hatte. Es war die erste von vielen ähnlichen Erfahrungen, von denen jede einzelne ein Meilenstein meiner wachsenden Bewunderung und meines besinnlichen Nachdenkens über die Schönheit der Frauen war.
Natürlich bestand die Gefahr, dass man darüber seine Objektivität verlor. Denn schließlich bewundern alle Männer schöne Frauen. Ich allerdings glaubte, dass mein Faible für die Schönheit, die Art und Weise, wie sie mich beeindruckte, weiter ging, als es gewöhnlich der Fall ist. Vielleicht, dachte ich damals, als ich noch über die nötige Energie und den Hunger nach Reflexion verfügte, vielleicht war dies das Einzige, was ich von den künstlerischen Genen meiner Mutter vererbt bekommt hatte: verzaubert zu sein von der Figur, den Formen, den einzelnen Bestandteilen, die das Gesamtbild einer Frau ergeben — so wie der Körper meines Vaters sie verzaubert hatte. Der Unterschied war nur: Sie wollte sie malen, wie sie so oft die Gesichter und Gesten anderer Menschen gemalt hatte. Ich aber gab mich immer damit zufrieden, sie betrachten und darüber nachsinnen zu können. Über die Ungerechtigkeit der Götter zu grübeln, die die Schönheit so willkürlich verteilten; über den Teufel des hohen Alters, der die Schönheit wieder wegnehmen konnte, sodass nur die dadurch geformte Persönlichkeit zurückblieb; über den Einfluss staunenswerter Schönheit auf den Charakter der Frau; über die sonderbaren Eigenheiten der Schönheit, die vielen wundervollen Facetten von Nase, Mund und Kinn, Wangenknochen und Augen. Und ich dachte über den Humor der Götter nach, deren Verschlagenheit und Boshaftigkeit, wenn sie einer Frau einen vollkommenen Körper verliehen, sich beim eigentlichen Epizentrum der Schönheit, dem Gesicht, aber zurückhielten. Oder wenn sie ein köstliches Gesicht mit einem hässlichen Körper verbanden. Oder allem ein kleines, unvollkommenes Detail anfügten, das dann plötzlich frei im Niemandsland hing.
Oh, und das Talent der Frauen, mittels Kleidung und Farbe, Lippenstift und Bürste und der kleinen Gesten der Hände und Finger den Geiz der Natur zu überlisten und ein verbessertes, verlockenderes Produkt entstehen zu lassen.
Von diesem Augenblick an in jenem Wohnzimmer in Stilfontein war ich ein Sklave der Schönheit.
Das zweite unvergessliche Ereignis während meiner ersten sechs Lebensjahre begann mit einem Erdbeben.
5
Ich kehrte aus Windhoek zurück, und Jan sollte mich eigentlich am Flughafen abholen. Doch er war nicht da. Ich rief zu Hause an, aber es ging niemand ran. Nachdem ich ungefähr zwei Stunden gewartet hatte, nahm ich ein Taxi. Es war schon spät, so gegen zehn Uhr abends. Im Haus war alles dunkel. Ich machte mir Sorgen, weil er sonst immer früh nach Hause kam. Und immer brannte in der Küche das Licht. Ich öffnete also die Haustür und ging rein, und dann sah ich ihn, hier in der Küche. Es war das Erste, was ich sah. Ich wusste sofort, dass er tot war. Alles war voller Blut. Sein Kopf hing nach unten auf die Brust. Sie hatten ihn an den Stuhl gefesselt, einen der Küchenstühle. Ich hab sie alle verkauft, ich konnte sie nicht mehr behalten. Seine Arme waren mit Draht auf den Rücken gebunden. Das hat mir die Polizei erzählt. Ich konnte nicht weitergehen, ich stand nur auf der Schwelle, und dann rannte ich zu den Nachbarn. Die riefen die Polizei, ich stand unter Schock. Sie riefen auch einen Arzt.«
Ihrer Stimme entnahm er, dass sie die Geschichte bereits mehr als einmal erzählt hatte: Es fehlte jede Intonation, Ergebnis der Wiederholung und unterdrückter Traumata.
»Später bat die Polizei Sie, sich das Haus anzusehen.«
»Ja. Sie wollten vieles wissen. Wie die Mörder in das Haus eingedrungen sind, was gestohlen wurde …«
»Konnten Sie ihnen helfen?«
»Man weiß nicht, wie sie ins Haus gelangen konnten. Die Polizei vermutet, sie haben ihm aufgelauert, als er nach Hause kam. Die Nachbarn aber haben nichts bemerkt.«
»Was ist aus dem Haus verschwunden?«
»Nur der Inhalt des Safes.«
»Seine Brieftasche? Der Fernseher? Stereoanlage?«
»Nichts, nur der Inhalt des Safes.«
»Wie lange waren Sie in Windhoek?«
»Ich war die ganze Woche in Namibia. Die meiste Zeit auf dem Land. Nur der Flug ging nach Windhoek.«
»Wie lange war er schon tot, als Sie zurückkamen?«
»Man sagte mir, es sei in der Nacht zuvor geschehen. Vor meiner Rückkehr.«
»Sie haben ihn an jenem Tag nicht angerufen?«
»Nein, aber zwei Tage zuvor, von Gobabis aus, um ihm zu sagen, was ich gefunden habe.«
»Wie hat er geklungen?«
»So wie immer. Er telefonierte nicht gern. Das Gespräch wurde fast ausschließlich von mir bestritten. Ich wollte sichergehen, dass die Preise, die ich bot, stimmten. Und ich gab ihm die Adressen für den Laster.«
»Er hat nichts gesagt, was Ihnen auffällig, sonderbar erschien?«
»Nein.«
»Laster. Welcher Laster?«
»Er gehört nicht uns. Manie Meiring Transport aus Kuilsriver holten einmal im Monat die Möbel ab. Wir nannten ihnen die Adressen und gaben ihnen die Schecks mit, die sie den Verkäufern aushändigten. Dann schickten sie jemanden mit einem Laster los.«
»Wer wusste, dass Sie die ganze Woche weg waren?«
»Ich habe keine Ahnung … eigentlich nur Jan.«
»Haben Sie eine Putzfrau? Einen Gärtner?«
»Nein. Ich … wir haben alles selbst gemacht.«
»Eine Reinigungskraft im Büro?«
»Das hat die Polizei auch alles gefragt. Vielleicht wusste jemand, dass ich die Woche über fort war, aber wir hatten keine Angestellten. Außerdem wollten sie wissen, ob ich regelmäßig die Stadt verließ. Ich war oft weg, aber immer an anderen Tagen. Manchmal nur für ein, zwei Tage, manchmal auch für zwei Wochen.«
»Und dann kümmerte sich Jan Smit selbst um die Wäsche und putzte das Haus?«
»Es gab nicht viel zu putzen, und in der Wellington Street gibt es eine Wäscherei mit Bügelservice.«
»Wer wusste noch vom Safe?«
»Nur Jan und ich.«
»Keine Freunde? Familienmitglieder?«
»Nein.«
»Mrs. van As, ist Ihnen irgendjemand bekannt, der möglicherweise auf ihn gewartet und ihn ermordet haben könnte, irgendjemand, der möglicherweise vom Safe gewusst hatte?«
Sie schüttelte den Kopf, und plötzlich, wie aus dem Nichts, liefen ihr lautlos Tränen über die Wange.
»Sie kenne ich doch«, sagte Mavis Peterson, als van Heerden das unansehnliche Backsteingebäude des Morddezernats in der Kasselsvlei Road, Bellville, betrat.
Er hatte seiner Rückkehr mit gemischten Gefühlen entgegengesehen. Wie viele Jahre waren vergangen, seit er genau durch diese Türen das Gebäude verlassen hatte. Es hatte sich kaum etwas verändert. Der gleiche modrige, trübselige Geruch, die gleichen Fliesen auf dem Boden, die gleiche Amtsstubeneinrichtung. Die gleiche Mavis. Älter, aber genauso herzlich.
»Hallo, Mavis.«
»Aber das ist doch der Captain«, sagte Mavis und klatschte in die Hände.
»Das bin ich nicht mehr, Mavis.«
»Und schau dir das Auge an! Was haben Sie angestellt? Wie lange ist es schon her? Was machen Sie jetzt so, Captain?«
»So wenig wie möglich«, antwortete er. Er fühlte sich unwohl, war nicht vorbereitet auf diesen Empfang und wollte die Frau nicht mit seiner Verbitterung behelligen. »Ist Tony O’Grady da?«
»Ich kann es noch gar nicht glauben, Captain! Sie haben abgenommen. Ja, der Inspector ist da, er ist jetzt im zweiten Stock. Soll ich Sie melden?«
»Nein danke, Mavis, ich geh einfach zu ihm hoch.«
Er schritt an ihrem Schreibtisch vorbei ins Innere des Gebäudes, Erinnerungen hämmerten an die Tür zu seinem Gedächtnis. Er hätte nicht hierher kommen sollen, ging ihm durch den Kopf. Er hätte sich mit O’Grady woanders treffen sollen. Polizeibeamte saßen in ihren Büros, gingen an ihm vorüber, fremde Gesichter, die er niemals zuvor gesehen hatte. Er ging die Treppe zum obersten Stock hinauf, passierte die Teeküche, entdeckte dort jemanden, ließ sich den Weg beschreiben. Und dann stand er vor O’Gradys Büro.
Der fette Kerl hinter dem Schreibtisch blickte auf, als er hörte, wie jemand gegen den Türrahmen klopfte.
»Hallo, Nougat.«
O’Grady blinzelte. »O Gott.«
»Nein, trotzdem danke …«
Er ging zum Schreibtisch, streckte die Hand aus. O’Grady wuchtete sich halb aus dem Stuhl, reichte ihm die Hand, setzte sich wieder, noch immer stand ihm der Mund halb offen.
Van Heerden zog einen importierten Nougatriegel aus seiner Jackentasche. »Isst du die noch?«
O’Grady blickte den Riegel noch nicht einmal an. »Ich kann’s einfach nicht glauben!«
Er legte die Süßigkeit auf den Schreibtisch.
»O Gott, van Heerden, das ist Jahre her. Das ist, als würde man ein Gespenst sehen.«
Er setzte sich auf einen der grauen Stahlstühle.
»Aber ich nehme an, Gespenster bekommen keine blauen Augen«, fuhr O’Grady fort und griff sich das Nougat. »Was ist das? Ein Bestechungsversuch?«
»So könntest du es nennen.«
Der dickleibige Mann fummelte an der Zellophanverpackung. »Wo hast du gesteckt? Wir reden schon gar nicht mehr über dich, weißt du das?«
»Ich war eine Weile in Gauteng«, erfand er.
»Bei der Polizei?«
»Nein.«
»O Gott, warte, bis ich das den anderen erzähle. Also, was ist mit deinem Auge passiert?«
Er zuckte mit den Schultern. »Kleiner Unfall. Ich brauche deine Hilfe, Tony.« Er wollte das Gespräch so kurz wie möglich halten.
O’Grady biss vom Nougat ab. »Du weißt ziemlich gut, wie du die bekommen kannst.«
»Du warst für den Smit-Fall zuständig. Letzten September. Johannes Jacobus Smit. Wurde in seinem Haus ermordet. Begehbarer Safe …«
»Du bist jetzt also Privatdetektiv.«
»So was Ähnliches.«
»O Gott, van Heerden, das ist doch ein beschissenes Leben. Warum kommst du nicht wieder zu uns?«
Er atmete tief ein, musste die Angst und die Wut unterdrücken.
»Erinnerst du dich an den Fall?«
O’Grady starrte ihn lange an, nur seine Kiefer bewegten sich, während er das Nougat mampfte, er kniff die Augen zusammen. Er sieht genauso aus wie immer, dachte van Heerden. Kein bisschen fetter, kein bisschen dünner. Noch immer der klobige Polizist, der seinen scharfen Verstand hinter seiner schillernden Persönlichkeit und seinem schweren Körper versteckte.
»Und welches Interesse hast du daran?«
»Seine Lebensgefährtin fahndet nach einem Testament, das im Safe gewesen ist.«
»Und du sollst es finden?«
»Ja.«
Er schüttelte den Kopf. »Ein Privatschwengel, heilige Scheiße! Du warst mal gut.«
Van Heerden atmete tief durch. »Das Testament«, sagte er.
O’Grady sah ihn über den Nougatriegel hinweg an. »Ach, das Testament.« Er legte die Süßigkeit auf den Schreibtisch und schob sie zur Seite. »Weißt du, das war das Einzige, was irgendwie nicht passte.« Er lehnte sich zurück, faltete die Arme über dem Bauch. »Dieses verdammte Testament. Zunächst war ich mir sicher, dass sie es war. Oder jemanden angeheuert hatte. Es hätte verdammt gut gepasst. Smit hatte keine Freunde, keine Geschäftspartner, keine Angestellten. Aber sie kamen rein, folterten ihn, bis er ihnen die Kombination verriet, räumten den Safe aus und brachten ihn um. Sonst nahmen sie nichts mit. Das war ein Insider-Job. Und sie war die Einzige, die sich auskannte. Sagte sie jedenfalls.«
»Folterten ihn?«
»Verbrannten ihm mit einem Schweißbrenner die Haut. Die Arme, Schultern, Brustkorb, Eier. Im Allgemeinen nennt man so etwas Mord.«
»Wusste sie davon?«
»Wir haben es weder ihr noch der Presse erzählt. Wir haben uns bedeckt gehalten, ich wollte sehen, ob sie sich vielleicht verrät.«
»Sie sagt, sie kennt die Kombination, Nougat.«
»Der Schweißbrenner könnte nur Show gewesen sein. Um den Verdacht von ihr abzulenken.«
»Welche Mordwaffe?«
»Nun, das ist der zweite seltsame Punkt. Bei der ballistischen Untersuchung kam heraus, dass es eine M16 war. Die Armeewaffe der Yankees. Von denen gibt’s nicht mehr so viele, oder?«
Van Heerden schüttelte bedächtig den Kopf. »Nur ein Schuss?«
»Ja. Wie bei einer Exekution. In den Hinterkopf.«
»Weil er ihre Gesichter gesehen hatte? Oder sie kannte?«
»Wer weiß das heutzutage schon? Vielleicht haben sie ihn auch nur aus Spaß erschossen.«
»Wie viele, glaubst du, waren es?«
»Das wissen wir nicht. Keine Fingerabdrücke drinnen, keine Fußspuren draußen, keine Zeugen in der Nachbarschaft. Smit war ein groß gewachsener Mann, noch gut in Form. Es muss mehr als einer gewesen sein.«
»Die Forensik?«
O’Grady beugte sich vor und zog das Nougat wieder zu sich heran. »Nichts, gar nichts. Keine Abdrücke, keine Haare, keine Hautfetzen. Nur ein beschissenes Stück Papier. Im Safe. Wir haben ein Stück Papier gefunden, etwa so groß wie zwei Streichholzschachteln. Die cleveren Jungs in Pretoria sagten, es gehöre zu einer Banderole. Womit man Geldstapel umwickelt. Du weißt schon, zehntausend in Fünfziger-Scheinen, so etwa …«
Van Heerden zog die Augenbrauen hoch.
»Aber das Komische ist, der Art und dem ganzen Mist nach sind sie sich ziemlich sicher, dass es sich um Dollar gehandelt hat. US-Dollar.«
»Scheiße«, sagte van Heerden.
»Ganz meine Meinung. Aber es kommt noch besser. Es war das Einzige, was ich hatte, also hab ich über den Colonel die in Pretoria ziemlich unter Druck gesetzt. Die Forensik hat dort einen Geldexperten, Claassen oder so ähnlich. Der setzte sich wieder an seine Bücher und sein Mikroskop und meinte, der Papierfetzen lasse auf altes Geld schließen. Die Amerikaner umwickeln ihr Geld heute nicht mehr so. Aber früher haben sie das getan. In den Siebzigern und Anfang der Achtziger.«
Van Heerden ließ sich die Information durch den Kopf gehen. »Und du hast Wilna van As danach gefragt?«
»Ja. Und die übliche Antwort zu hören bekommen. Sie weiß nichts. Hat niemals Dollar als Bezahlung für die furzalten Möbel eingesteckt, hat niemals damit gezahlt. Weiß noch nicht einmal, wie so ein verdammter Dollarschein aussieht. Ich meine … Scheiße, die Frau lebt ein Jahrzehnt oder noch länger mit dem Mann zusammen und benimmt sich wie diese drei Affen — hört nichts, sieht nichts, sagt nichts. Und jedes Mal, wenn ich ein paar direkte Fragen stellen wollte, fiel ihre kleine sexy Anwältin wie eine Sumo-Ringerin über mich her.« O’Grady nahm einen frustrierten Bissen vom Nougat und sank in seinen Schreibtischsessel zurück.
»Und keine amerikanischen Kunden oder Freunde.« Das war eine Feststellung. Er kannte die Antwort bereits.
Der fette Polizist sprach mit vollem Mund, trotzdem gelang es ihm, jedes Wort klar und deutlich zu artikulieren. »Keinen einzigen. Verstehst du, mit dem Gewehr und den Dollar würde es einfach Sinn ergeben, dass da irgendwie Yankees mit im Spiel sind.«
»Ihre Anwältin sagt, sie sei unschuldig.«
»Ist sie deine neue Arbeitgeberin?«
»Nur zurzeit.«
»Dann versuch wenigstens, sie ins Bett zu bekommen. Denn das ist alles, was bei ihr zu holen ist. Das ist eine Sackgasse. Ich meine, welches Motiv sollte Wilna van As haben? Ohne das Testament bekommt sie anscheinend überhaupt nichts.«
»Es sei denn, es gab eine Abmachung, dass sie die Hälfte der Beute erhält. In ein oder vielleicht zwei Jahren, wenn Gras über die Sache gewachsen ist.«
»Vielleicht …«
»Und neben ihr gab es keine weiteren Verdächtigen?«
»Nein, niemanden.«
Es war an der Zeit, zu Kreuze zu kriechen: »Ich würde sehr gern die Akte sehen, Nougat.«
O’Grady starrte ihn an.
»Ich weiß, du bist ein guter Polizist, Nougat. Ich muss mir den Tathergang vergegenwärtigen.«
»Mitnehmen kannst du sie aber nicht. Du wirst sie hier lesen müssen.«
6
Das Erdbeben weckte mich, es war spätnachts, als die dumpfen, rollenden Donner aus den Tiefen der Erde die Fenster erzittern und das Wellblechdach auf dem Bergmannshaus knarren ließen. Ich weinte, und mein Vater kam und tröstete mich, nahm mich in der Dunkelheit in die Arme und sagte, das sei nur die Erde, die sich in eine bequemere Position schiebe.
Ich war wieder eingeschlafen, als etwa eine Stunde später das Telefon klingelte. Um ihn zu holen.
Den Rest der Geschichte erfuhr ich von meiner Mutter, die sie aus den offiziellen Verlautbarungen, den Erzählungen von den Kollegen meines Vaters und ihrer eigenen Fantasie zusammensetzte.
Er führte eine der Rettungsmannschaften an. Sie sollten die vierzehn Männer herausholen, die einen Kilometer unter Tage eingeschlossen waren, nachdem einer der Stollen eingebrochen war.
Es war heiß und stickig dort unten. Andere Rettungsmannschaften waren bereits an der Arbeit, als sie eintrafen und im ratternden, schwankenden Förderkorb, mit ihren Schaufeln und Keilhauen, ihren Verbandskästen und Wasserflaschen in den Schacht einfuhren. Keiner trug den vorgeschriebenen Helm, er wäre nur hinderlich gewesen. Alle, Schwarze wie Weiße, krempelten den oberen Teil ihres Overalls nach unten und arbeiteten mit nacktem Oberkörper, sie schimmerten im grellen Schein der elektrischen Grubenlampen, die manche Stellen hell beleuchteten, andere in tiefe Schatten rückten. Der rhythmische Singsang der Schwarzen gab das Arbeitstempo vor — die Hauer, die Ausbringer, Seite an Seite nun, die sonst so rigide Trennung zwischen den Hautfarben und den einzelnen Berufen war plötzlich vergessen, denn vier der eingeschlossenen Männer waren Weiße und zehn Schwarze.
Stunde um Stunde in der ewigen Finsternis, um einen Berg zu versetzen.
Oben hatten sich die Verwandten der weißen Männer eingefunden, warteten auf Neuigkeiten, wie immer unterstützt von der Gemeinschaft, von Freunden und Kollegen sowie den Familienangehörigen der Rettungsmannschaften, die sich ebenfalls in Gefahr befanden.
Meine Mutter malte in diesen Stunden, blechern ertönten Schuberts Lieder aus der Musiktruhe. Ruhig und gefasst, denn sie hielt meinen Vater für unverwundbar. Ich wusste nichts von der Spannung, die eine ganze Stadt gefangen hielt.
Kurz bevor seine Mannschaft am Ende der Schicht an die Oberfläche zurückkehren sollte, hörten sie gedämpfte Hilferufe, erschöpftes Stöhnen, Schmerzens- und Angstschreie, und er ermutigte sie durchzuhalten, die dünne Kante des Keils kratzte Felsen und Geröll und Erde fort, um einen schmalen Durchgang zu graben. Kein Gedanke mehr daran, sich Ruhe zu gönnen, im Adrenalinhoch des Erfolgs, der zum Greifen nahe lag. Emile van Heerden war ganz vorn, sein geschmeidiger Körper schöpfte Kraft aus seinem lebenslangen Training, um die Eingeschlossenen zu erreichen.
Seine Mannschaft war zu der schmalen Öffnung durchgebrochen, die die Überlebenden mit bloßen Händen und blutenden Fingern gegraben hatten.
Die Nachricht, dass unten Stimmen zu hören waren, verbreitete sich schnell über Tage, die in der kleinen Kantine versammelten Menschen klatschten in die Hände und weinten.
Und dann bebte die Erde erneut.
Er hatte die ersten drei mit seinen kräftigen, sehnigen Armen herausgezogen und sie auf die Holz- und Leinwandtragen gepackt. Der Vierte steckte bis zur Brust hin fest, ein Schwarzer, mit zerschmetterten Beinen, der die Schmerzen mit übermenschlichen Kräften unterdrückte, nur der Schweiß lief in Strömen, sein Oberkörper zitterte. Emile van Heerden scharrte wie besessen, wühlte mit den Fingern in der Erde, in der die Beine des Mannes steckten, eine Schaufel wäre zu groß und zu unhandlich gewesen. Dann schob sich die Erde abermals in eine bequemere Position.
Er gehörte zu den vierundzwanzig Männern, die drei Tage später, in Decken gewickelt, aus dem Schacht geborgen wurden.
Meine Mutter weinte nur, als im Leichenschauhaus die Decke zurückgeschlagen wurde und sie sah, was eine Tonne Gestein mit dem schönen Körper ihres Ehemanns angerichtet hatte.
7
Van Heerden war nicht der Mann, den sie erwartet hatte. Kemp hatte ihr erzählt, er sei ein ehemaliger Polizist. »Was soll ich Ihnen sagen? Er ist ein wenig … anders? Aber ein verdammt guter Ermittler. Sie müssen nur standhaft bei ihm bleiben.«
Weiß Gott, sie brauchte einen »guten Ermittler«.
Sie hatte nicht gewusst, was sie erwarten sollte. Anders? Vielleicht mit Ohrring und Pferdeschwanz? Aber nicht diese … Spannung. Wie er mit Wilna van As geredet hatte. »Spannung« war nicht das richtige Wort. Der Umgang mit ihm war schwierig. Wie mit Sprengstoff.
Sie hatten sich auf 2000 Rand pro Woche geeinigt. Im Voraus. Sie würde die Summe zunächst aus ihrer eigenen Tasche zu zahlen haben, falls van Heerden nichts fand. Viel zu viel Geld. Selbst wenn Wilna van As es später in Raten abstotterte. Geld, das sich die Kanzlei nicht leisten konnte. Sie würde mit Kemp telefonieren müssen. Sie griff zum Hörer.
Er stand in der Tür.
»Ich muss noch mal mit van As reden.« Er lehnte am Türrahmen, schlanker Körper, blaues Auge, Leck-mich-am-Arsch-Haltung, einen braunen Umschlag in der Hand. Sie bemerkte, dass sie, die Hand zum Hörer ausgestreckt, zusammenschreckte, und er hatte es gesehen. Ihre Abneigung gegenüber diesem Mann war noch nicht sehr weit gediehen, aber sie war im Wachsen begriffen, wie ein austreibender Same.
»Das müssen wir erst besprechen«, sagte sie. »Und vielleicht sollten Sie das nächste Mal in Betracht ziehen anzuklopfen, bevor Sie eintreten.«
»Warum müssen wir das besprechen?« Er setzte sich erneut auf den Stuhl ihr gegenüber, diesmal aber beugte er sich vor; seine Körpersprache zeugte von Feindseligkeit.
Sie holte tief Luft, zwang sich zur Geduld – und Standhaftigkeit. »Wilna van As hat allein als Mensch ein Anrecht auf unsere Anteilnahme und unseren Respekt. Darüber hinaus hat sie in den letzten neun Monaten Dinge durchgemacht, wie sie die meisten von uns ihr ganzes Leben nicht erfahren. Auch wenn wir nur wenig Zeit hatten, fand ich Ihr Verhalten heute Morgen ihr gegenüber bestürzend und unerträglich.«
Er saß auf dem Bürostuhl, hatte den Blick auf den braunen Umschlag gerichtet, mit dem er rhythmisch gegen seinen Daumennagel klopfte.
»Sie sind nur zu zweit. Zwei Frauen.«
»Was?«
»Die Kanzlei. Anwältinnen.« Er sah auf und wies mit einer unbestimmten Handbewegung auf das Büro.
»Ja.« Sie verstand weder, warum er ablenkte, noch, worauf er hinauswollte.
»Warum?«, fragte er.
»Ich verstehe nicht, was das mit Ihrer Gefühllosigkeit zu tun hat.«
»Darauf komme ich gleich, Hope. Ist es Absicht, dass nur Frauen in dieser Kanzlei beschäftigt sind?«
»Ja.«
»Warum?«
»Weil das Rechtssystem fest in Männerhand ist. Aber dort draußen gibt es Tausende von Frauen, die ein Recht darauf haben, dass man ihnen mit Verständnis und Anteilnahme begegnet, wenn sie angeklagt sind oder sich scheiden lassen wollen. Oder nach einem Testament suchen.«
»Sie sind eine Idealistin«, sagte er.
»Sie nicht.« Eine Feststellung.
»Und das ist der Unterschied zwischen uns beiden, Hope. Sie glauben, Sie könnten sich durch Ihre Frauengruppen, durch Ihre Frauen-Kanzlei, durch Ihre regelmäßigen Beiträge zum Straßenkinderhilfsfonds und der Mission das Gewissen reinwaschen. Sie glauben, Sie und Ihresgleichen seien schon per se gute Menschen, wenn Sie nur in Ihren teuren BMW steigen und zum Fitness- und zum Tennisclub fahren, und dabei sind Sie so verdammt selbstzufrieden mit sich und der Welt. Weil Sie glauben, jeder sei von Grund auf ein guter Mensch. Aber ich will Ihnen was sagen: Wir sind schlechte Menschen. Sie, ich, wir alle.«
Er öffnete den Umschlag, nahm zwei postkartengroße Fotos heraus und schleuderte sie ihr über den Schreibtisch.
»Haben Sie die schon zu Gesicht bekommen? Der verstorbene Johannes Jacobus Smit. An seinen eigenen Küchenstuhl gefesselt. Erfüllt Sie das mit Anteilnahme und Verständnis? Oder welche politisch korrekten Begriffe wollen Sie mir hier noch auftischen? Jemand hat das mit ihm angestellt. Hat ihn mit Draht gefesselt und mit einem Schweißbrenner traktiert, bis er sich nur noch wünschen konnte, sie würden ihn erschießen. Irgendjemand. Irgendwelche Leute. Und Ihr unberührbarer Engel Wilna van As steckt mittendrin in dieser Scheiße. Der fette Inspector Tony O’Grady vom Morddezernat glaubt, sie sei daran beteiligt, weil viele kleine Dinge nicht zusammenpassen wollen. Und was Morde betrifft, gibt ihm die Statistik Recht. Gewöhnlich ist es der Ehemann, die Ehefrau, die oder der Geliebte. Vielleicht hat er Recht, vielleicht hat er Unrecht. Aber wenn er Recht haben sollte, was ist dann mit Ihrem Idealismus?«
Sie sah von den Fotos auf. Blass. »Und Sie wollen meine Vorstellungen wie eine Seifenblase zerplatzen lassen …«
»Sind Sie jemals einem Mörder begegnet, Hope?«
»Sie haben Ihr Ziel erreicht.«
»Oder jemandem, der Kinder missbraucht. Wir …«, und dann zögerte er ganz kurz, bevor er fortfuhr, sprach dann einfach weiter und war selbst ein wenig darüber überrascht: »Ich … habe einen Vergewaltiger festgenommen, der es auf Kinder abgesehen hatte. Ein sanfter, knubbeliger alter Mann, neunundfünfzig Jahre alt, der aussah wie das perfekte Double des Nikolaus. Der insgesamt siebzehn kleine Mädchen zwischen vier und neun Jahren mit Wilson’s Toffee in seinen Wagen gelockt und hinauf nach Constantiaberg …«
»Sie haben Ihr Ziel erreicht«, sagte sie leise.
Er ließ sich in seinen Bürostuhl zurückfallen.
»Dann lassen Sie mich verdammt noch mal meine Arbeit erledigen.«
Der Nordwestwind blies draußen die Dunkelheit gegen die Fensterscheiben, während drinnen Wilna van As redete und mit Worten nach Jan Smit suchte und die verschränkten Hände in ihrem Schoß niemals ganz zur Ruhe kamen. »Ich weiß nichts. Ich weiß nicht, ob ich ihn kannte. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich war, ihn zu kennen. Aber es hat mich nicht gestört. Ich habe ihn geliebt, er war … Es war, als hätte er eine Wunde, als hätte er … Manchmal, wenn ich nachts neben ihm lag, dachte ich, er sei wie ein Hund, der zu oft und zu brutal geschlagen worden war. Mir ging vieles durch den Kopf. Manchmal dachte ich, vielleicht hat er irgendwo noch eine Frau und Kinder. Denn als ich schwanger war, da sah er regelrecht verängstigt aus. Ich dachte, er hat vielleicht eine Frau und Kinder, die ihn verlassen haben. Oder dass er eine Waise war. Vielleicht gab es auch etwas anderes, aber er war durch irgendetwas so schwer verletzt worden, dass er es anderen nicht zeigen konnte. So viel wusste ich, aber ich habe ihn nie danach gefragt. Ich weiß nichts über ihn. Ich weiß nicht, wo er aufgewachsen ist, ich weiß nicht, was mit seinem Vater und seiner Mutter geschehen ist, und ich weiß nicht, wie er mit dem Geschäft begonnen hat. Aber ich weiß, dass er mich auf seine Weise geliebt hat, er war freundlich und gut zu mir, und manchmal lachten wir zusammen, nicht oft, aber hin und wieder, über andere Leute, ich wusste, er mochte keine selbstgefälligen Menschen. Und solche, die mit ihrem Geld angeben. Wahrscheinlich hat er schwere Zeiten durchmachen müssen. Er ist immer sehr sorgsam, sehr vorsichtig mit seinem Geld umgegangen. Ich glaube, er hatte Angst vor anderen Menschen. Vielleicht war er auch schüchtern … Es gab keine Freunde. Nur uns beide. Mehr brauchten wir nicht.«
Nur der Wind und der Regen, die gegen das Fenster schlugen. Sie sah auf, blickte zu Hope Beneke. »Es gab oft diese Momente, in denen ich fragen wollte. In denen ich ihm sagen wollte, er könne es mir erzählen, dass ich ihn immer lieben werde, ganz egal, wie groß der Schmerz sei. Es gab Momente, in denen ich fragen wollte, weil ich so fürchterlich neugierig war, weil ich ihn kennen wollte. Ich glaube, das lag daran, weil ich ihn einordnen wollte. Das machen wir mit allen Menschen, ordnen sie irgendwo in unserem Kopf ein, damit wir wissen, was wir ihnen das nächste Mal sagen oder was wir ihnen geben sollten, das macht das Leben etwas leichter.
Aber ich habe ihn nicht gefragt. Denn wenn ich gefragt hätte, dann hätte ich ihn vielleicht verloren.«
Sie sah zu van Heerden. »Ich hatte nichts. Manchmal fragte ich mich, ob sein Vater auch getrunken hat und seine Mutter auch geschieden war und er vielleicht auch aus zerrütteten Verhältnissen stammte. So wie ich. Aber wir hatten uns, und mehr brauchten wir nicht. Deshalb habe ich nicht gefragt. Noch nicht einmal, als ich schwanger war und er sagte, wir müssten was dagegen tun, weil Kinder das Böse dieser Welt nicht verdient hätten und wir sie davor nicht beschützen könnten. Damals habe ich ihn nicht gefragt, weil ich wusste, dass er geschlagen worden war. Wie ein Hund. Zu oft. Also ließ ich abtreiben. Und dabei auch gleich einen Eingriff vornehmen, damit ich nie wieder schwanger werden konnte.
Weil ich wusste, dass wir nur uns beide brauchten.«
Und dann wischte sie den Tropfen von der Nasenspitze und sah auf ihre Hände, und er wusste nicht, was er sagen sollte, und wusste, dass er seine anderen Fragen nicht mehr anbringen konnte.
Das Haus war eine Grabkammer.
»Ich denke, wir müssen los«, sagte die Anwältin schließlich und erhob sich. Sie ging zu van As und legte der Frau eine Hand auf die Schulter.