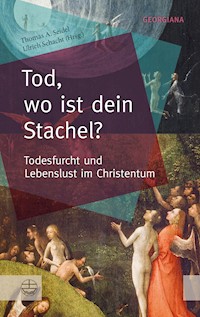
Tod, wo ist dein Stachel? E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: GEORGIANA / Neue theologische Perspektiven
- Sprache: Deutsch
Niemand kann ihm entkommen, dem großen Gleichmacher Tod. "Leben ist gefährlich. Wer lebt, stirbt", schrieb der polnische Aphoristiker Stanisław Jerzy Lec mit schwarzem Humor. "Tod ist … je der meine", pointierte Martin Heidegger diese situative Radikalität. Und für den Literaturnobelpreisträger Elias Canetti war der Tod ähnlich wie für sein Vorbild Johann Wolfgang Goethe nichts als ein Hassobjekt. In auffälligem Kontrast dazu bekennt das Christentum mit dem Apostel Paulus: "Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?" (1. Korintherbrief 15,55) Das meint mehr als nur die sokratische Unsterblichkeit der Seele, wie Platon sie im Phaidon entfaltet. Nach Christoph Markschies waren es nicht zuletzt die intensive Seelsorge an den trauernden Schwestern und Brüdern und die Erwartung der Auferstehung, die die schmerzhafte Endgültigkeit des irdischen Lebens keineswegs leugneten und doch durch heitere Gelassenheit dem Tod gegenüber den frühen Christengemeinden rasch Anhänger bescherten. Das anregende, auch existenziell spannende Buch fragt danach, wie der "in den Tod verschlungene" Sieg Christi heute theologisch zu interpretieren ist, angesichts eines exzessiven Materialismus, für den der Tod das möglichst zu verdrängende kalte Schlusswort ist. Mit Essays, praktischen Erfahrungsberichten und literarischen Fundstücken von George Alexander Albrecht, Michael Dorsch, Siegmar Faust, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Frank Hiddemann, Sebastian Kleinschmidt, Dieter Koch, Christian Lehnert, Martin Luther, Ulrich Schacht, Christine Schirrmacher, Cornelia Seidel, Thomas A. Seidel , Peter Zimmerlind. [O Death, Where is Your Sting? Fear of Death and Love of Life in Christianity] Nobody can escape him, the great leveller, Death. "Life is dangerous. Who lives, dies", wrote the Polish aphorist Stanisław Jerzy Lec with black humour. And for Elias Canetti as for Johann Wolfgang von Goethe death was nothing but an object of hate. But in marked contrast to that, Christianity with Paul confesses: "Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting?" (1. Corinthians 15:54–55). This means more than the Socratic immortality as developed by Platon in his Phaidon. According to Christoph Markschies it was not least the intense pastoral care for mourning sisters and brothers and the expectation of the resurrection, denying in no way the painful finality of earthly life, which because of its cheerful serenity contributed to the rapid growth of the early Christian communities. This stimulating book asks how the victory of Christ, swallowing up death, is to be interpreted today in view of an excessive materialism that sees death as the cold final word that it tries to repress if possible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tod, wo ist dein Stachel?
GEORGIANA
Neue theologische Perspektiven Bd. 2
Herausgegeben im Auftrag der
Ev. Bruderschaft St. Georgs-Orden (St.GO)
Tod, wo ist dein Stachel?
Todesfurcht und Lebenslust im Christentum
Herausgegeben von Thomas A. Seidel und Ulrich Schacht
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2017 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Coverbild: © akg-images / Mondadori Portfolio/Archivio Antonio
Quattrone/Antonio Quattrone
Gestaltung: FRUEHBEETGRAFIK, Thomas Puschmann · Leipzig
ISBN 9783374050383
www.eva-leipzig.de
Vorwort
Niemand kann ihm entkommen, dem großen Gleichmacher Tod, weder der Reiche noch der Arme, weder der Mächtige noch der Ohnmächtige, weder der Kluge noch der Dumme. Leben ist gefährlich. Wer lebt, stirbt, schrieb der polnische Aphoristiker Stanislaw Jerzy Lec mit schwarzem Humor. Tod ist … je der meine, pointierte Martin Heidegger, der Philosoph, die damit verbundene situative Radikalität. Und für den Literaturnobelpreisträger Elias Canetti war der Tod lebenslang nichts als ein Hass-Objekt, ähnlich seinem großen Vorbild Johann Wolfgang Goethe, der trotzig zu Protokoll gab: Den Tod aber statuiere ich nicht!
In auffälligem Kontrast dazu bekennt das Christentum mit dem Apostel Paulus: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? (1. Kor. 15,55). Das meint jedoch anderes und mehr als nur die sokratische Untersterblichkeit der Seele, wie Platon sie im »Phaidon« entfaltet. Nach Christoph Markschies war es jene intensive Seelsorge gegenüber den trauernden Schwestern und Brüdern, die die schmerzhafte Endgültigkeit des irdischen Lebens keineswegs leugnete, und doch in Verbindung mit einer staunenswerten heiteren Gelassenheit gegenüber dem Tod den frühen Christengemeinden rasch eine nicht geringe Schar an Anhängern aus allen gesellschaftlichen Schichte des Imperium Romanum bescherte, die auch Verfolgung und Martyrium nicht scheuten. Liegt hier ein wesentliches, »siegreiches Alleinstellungsmerkmal« sowohl gegenüber dem kraftlosen Stoizismus eines dekadenten römischen Bürgertums als auch gegenüber den weit verbreiteten, rauschhaften Kulten des Mithras, Dionysos oder der Demeter? Todesfurcht und Lebenslust stehen in frühchristlicher Praxis nicht trotzig gegeneinander, sondern vielmehr in ritueller, alltagspraktischer Verbundenheit. Dieser fromme Zauber des Anfangs hat in der Christentumsgeschichte des Ostens wie des Westens zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche starke Kraft entfaltet. Was war und was ist also mit dem »in den Tod verschlungenen« Sieg gemeint und wie steht es um seine Wirkkraft heute, insbesondere mit Blick auf die kirchliche Lage in Deutschland?
Nach Eberhard Jüngel bezeichnet das Paulus-Diktum einen spirituellen Machtkampf, den er so gedeutet hat: Der Tod hat seinen ›Stachel‹, das Instrument seiner Herrschaft, im Leben Gottes zurücklassen müssen. Die säkulare Gesellschaft von heute begegnet dieser »Entmächtigung« nicht nur mit Verdrängung und Unverständnis, sondern vor allem mit einem exzessiven Materialismus, der zuletzt aber auch nur in jene »totale Verhältnislosigkeit« mündet, die Natur und Geschichte als Einheit begreift und damit den Tod als das kalte Schlusswort. Doch auch in der praxis pietats vieler Pfarrerinnen und Pfarrer und (was nimmt es Wunder) in der Alltagsfrömmigkeit zahlreicher Christenmenschen ist diese Entmächtigung, […] die wir eine geistliche Verspottung des Todes nennen können (Jüngel), weitgehend aus der Übung gekommen. Aus den heute üblichen evangelischen Taufliturgien ist die Absage an Tod und Teufel verschwunden. In der Osternacht, so sie denn noch gefeiert wird, fehlt diese Widerrufung, der seit der alten Kirche über das christliche Mittelalter bis zu Reformation und an den Beginn der Aufklärung gemeinsam gesprochene, entschlossene Einspruch gegen die Todesmächte. Wo wird im sonntäglichen Gottesdienst, im Anschluss an die Fürbitte für die Verstorbenen, noch das memento mori aus Ps 90, 12 zitiert: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden? Und, Hand aufs Herz, in wessen Abend- oder Morgengebet findet sich ein solchermaßen todernster und lebensfroher Passus, wie ihn uns beispielsweise die Chassidim als tägliches Doppelmantra anempfehlen: Ich bin Staub und Asche! Und: Meinetwegen wurde die Welt erschaffen?
Dieser zweite Band in der Reihe GEORGIANA. Neue theologische Perspektiven1 will in unterschiedlicher Perspektive diesen Ein-spruch dokumentieren und inszenieren, um jene Entmächtigung des Todes kenntlich und lebbar zu machen. GEORGIANA 2 versammelt dazu die Beiträge des XXXVII. (Offenen) Konventes der Evangelischen Bruderschaft St. Georgs-Orden. Dieses 10. ErfurterGespräch zur geistigen Situation der Zeit, zu dem die Bruderschaft in Verbindung mit dem ihr angeschlossenen Bonhoeffer-Haus e.V. (neben den in unregelmäßiger Folge in der Georgenburse organisierten Bonhoeffer-Studienkreisen) einlädt, fand vom 12. bis zum 14. November 2010 im Augustinerkloster zu Erfurt statt. Leider ist es uns nicht gelungen, den Hauptvortrag des Theologen Klaus Berger, Heidelberg, zum Thema »Tod, wo ist dein Stachel? Der theo-logische Zugang« und auch nicht die Skizze des in Weimar lebenden Philosophen und Leiter des Nietzsche-Archivs Rüdiger Schmidt-Grépály »Ich brauche noch etwas Zeit…« Der philosophische Zugang« für die Drucklegung zu erhalten. Doch dafür konnten wir überreichlich Kompensation erlangen, die uns die Möglichkeit bot, diesen Band in eine didaktisch klare und leserfreundliche konzeptionelle Form zu bringen. Fünf Kapitel gliedern den Stoff: I. Theologische Zeitansagen, II. Vergleichende Perspektiven, III. Lutherische Seelsorge und die Kunst des Sterbens, IV. Praktische Erfahrungen und V. Literarische Fundstücke. Im Anhang sind, wie in GEORGIANA 1, ein Personenregister (für das wir unserem Georgsbruder Matthias Katze erneut zu Dank verpflichtet sind), wichtige biografische Angaben zu den Autoren und eine Kleine Geschichte der Ev. Bruderschaft St. Georgs-Orden zu finden.
Zu Beginn stehen die theologischen Zeitansagen, die in zweifacher Weise, von unterschiedlicher Warte aus, vorgenommen werden. Der renommierte Leipziger (praktische) Theologe Peter Zimmerling eröffnet den Reigen mit einer Bestandsaufnahme zum Umgang mit Sterben und Tod im deutschen Protestantismus heute. Im Kontrast dazu hebt er hervor, wie sich die Auseinandersetzung mit dem Tod durch die Reformation fundamental verän-derte und welche Rolle die Gesangbuchlieder, insbesondere die Paul-Gerhardt-Lieder, in der evangelischen Kirche im 17. Jahrhundert für Sterbende und ihre Begleiter spielten. In einem weiteren Schritt entwirft Zimmerling Grundzüge einer evangelischen Spiritualität angesichts des Todes und stellt abschließend, mit Verweis auf Dietrich Bonhoeffer, die Frage, welche Rolle die Bereitschaft zum Martyrium im Protestantismus gespielt hat bzw. in Zukunft spielen könnte. Siegmar Faust, langjähriges Mitglied der Bruderschaft St. Georg, verweist zunächst auf eine Einsicht der Paläoanthropologie, nach der mit der metaphysischen Entdeckung der Endlichkeit des Lebens, mit der »Erfindung« der Bestattungskultur vor ca. 100.000 Jahren, die menschliche Zivilisation ihren Ausgang nimmt. Darauf reflektierend fragt Faust, ob diese Zivilisation heute mit der insbesondere im »Westen« zu bemerkenden Verdrängung des Todes und einer Geringschätzung der Bestattungskultur ihrem Ende entgegen gehe? Vor diesem Hintergrund analysiert und meditiert Faust die These seines Hauptprotagonisten Wolfhart Pannenberg, dass die Verdrängung des Todes in der gesellschaftlichen Lebenswelt Hand in Hand gehe mit der Privatisierung der Individualität. Mit seinen geschichtstheologischen Reflexionen schlägt Faust nolens volens eine Brücke zum thematischen Fokus von GEORGIANA 1.
Das Kapitel II versammelt vier vergleichende Perspektiven. Dass Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, unsere Hauptreferentin von 2010, ihren Vortrag Ist Sterben ein Gewinn?Religiöse und kulturelle Überlieferungen in der Nahsicht für uns noch einmal überarbeitet hat, freut uns außerordentlich. Mit profundem Zugriff vergleicht sie nachtodliche Vorstellungen verschiedener Religionen, um zu dem Fazit zu gelangen, dass viele Religionen die Analyse des Menschen und seines zerbrechlichen rsp. zerbrochenen Glücks teilen. Ganz und gar nichttriumphalistisch bekennt sie am Ende ihres religionswissenschaftlichen Durchgangs: Keine davon ist kühner als die Botschaft Christi. Damit ist in einem zeitgeistigen Gelände, das Positionslosigkeit mit Toleranz verwechselt, Widerspruch aufgerufen und das positionelle interreligiöse Gespräch eröffnet. Durch den Vergleich zwischen Islam und Christentum erfährt dieses Religionsgespräch an Tiefe und Brisanz. Christine Schirrmacher, jene im christlich-islamischen Dialog ausgewiesene und gefragte Expertin, untersucht Tod und Leben in der Bibel und im Koran. Ausgangspunkt für diesen Text bildete der Streit (2009) um den angemaßten Märtyrer-Begriff im Zusammenhang der islamistischen Selbstmordanschläge, die Ende der 1990er Jahre im Irak ihren Ausgang nahmen. Mittlerweile hat sich dieses todund lebenverachtende Morden nicht nur weltweit ausgebreitet. Es vergeht kaum eine Woche ohne entsprechende Schreckensnachrichten über die Opfer jener pseudoreligiösen Selbstmordattentäter, seien es nun Angehörige der vermeintlich »falschen« muslimischen Glaubensrichtung, Kriegsgegner, Christen oder andere »Ungläubige«. Zwar wird, so Schirrmacher, Selbstmord im Koran eindeutig abgelehnt. Sie macht jedoch darauf aufmerksam, dass eine Mehrheit muslimischer Theologen Selbstmordattentäter sich nicht als Selbstmörder betrachten, auf die im Jenseits die Strafe Gottes wartet, sondern als Kämpfer und Verteidiger des Islam. Im Unterschied zu muslimischen Glaubensüberzeugungen könne man, so Schirrmacher, den Tod im christlichen Glauben nicht als großes Fragezeichen, nicht als permanente Aufforderung zu »werkgerechter« Besserung unserer »schwachen Existenz«, sondern als Komma betrachten, das zum ewigen Leben in der Gegenwart Gottes überleite. Die beiden das 2. Kapitel abschließenden Beiträge von Thomas A. Seidel und Sebastian Kleinschmidt wählen bekannte Schriftsteller als Vergleichspunkte ihrer geistesgeschichtlich-thanatologischen Spurensuche. Zunächst wird durch den Mitherausgeber dieses Bandes unter der Überschrift Schillers Schädel die sprichwörtliche Todesangst Johann Wolfgang Goethes untersucht, bevor in einem zweiten Schritt die »Kollateralschäden« der Selbstkonditionierung jenes »Alten von Weimar« in den kulturreligiösen Biotopen des deutschen Bildungsbürgertums, bis in die Phasen der »Bewältigung« der deutschen Katastrophe nach 1945 hinein, skizziert und kritisiert werden. Der vielseitige Essayist und langjährige Chefredakteur der Zeitschrift »Sinn und Form« Sebastian Kleinschmidt nimmt mit Elias Canetti und Ernst Jünger zwei Autoren in den Blick, die beide in ihrem Werk dem Thema »Tod« höchste Priorität eingeräumt haben. Beide sind sich persönlich nie begegnet. Ihre Verbundenheit ist thematischer Natur. Beide kreisen in ihrer Autorschaft um die Frage: Was ist der Mensch? Was ist die Aufgabe der Kunst? Während für Jünger die Überwindung des Todes zentrale Aufgabe des Autors und seines Werkes ist, sieht Canetti seine einsame Mission als Künstler darin, Todeshass zu schüren.
Ähnlich der gemeinsamen Publikation von Thomas A. Seidel und Ulrich Schacht, die beide im Auftrag der St. Georgsbruderschaft 2011 unter dem Titel Maria. Evangelisch herausgegeben haben, steht auch hier in der Mitte des Buches, unter der Kapitelüberschrift Lutherische Seelsorge und die Kunst des Sterbens ein Text von Martin Luther. Dieses recht frühe Werk des Reformators von 1519 handelt Von der Bereitung zum Sterben. Luther verfasst hier nicht, wie bis dato üblich, eine Art Beratungsbuch für die Sterbebegleitung durch Priester oder andere Kleriker bzw. Mediziner, sondern einen Sermon, eine Erbauungsschrift, für Menschen, die sich auf das Sterben vorbereiten wollen. Er traf damit einen Nerv. Das Büchlein wurde rasch zu einem Bestseller. Dieter Koch hat zu diesem Sermon eine sehr schöne, instruktive Einführung beigesteuert.
Diesen Gedanken einer zeit- und sachgemäßen Erbauungsschrift nimmt auch das 4. Kapitel unter der Überschrift Praktische Erfahrungen auf. Zunächst berichten drei in der Hospizarbeit engagierte Zeitgenossen von ihren Erfahrungen in und aus der ganz konkreten Begleitung Sterbender. George Alexander Albrecht, Cornelia Seidel und Heiner Sylvester (letzterer dient der Bruderschaft als Ordensmarschall) wissen von Wundern und Wandlungen zu erzählen, die Menschen an der Schwelle des Todes machen. So wurden die drei für uns zu Zeitzeugen der Ewigkeit. Aus einigen intensiven Gesprächen des langjährigen Jenaer Superintendenten und Direktors des Thüringer Predigerseminars Michael Dorsch, des vormaligen Studienleiters für Medien, Kunst und Kultur an der Ev. Akademie Thüringen und jetzigen Pfarrers in Gera Frank Hiddemann, der Trauerrednerin Cornelia Seidel und (zeitweise) des damaligen Referatsleiters des Gemeindedezernates des Landeskirchenamtes der Ev. Kirche in Mitteldeutschland (EKM) Christian Fuhrmann sowie des Herausgebers dieses Bandes Thomas A. Seidel ist in den Jahren 2005-2009 ein Text entstanden, der unter dem Titel Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden hier aufgenommen wird. Er darf als ein herzliches, einladendes Plädoyer für Kirchen als Orte gelebter Fürbitte gelesen werden und will, über die zugrundeliegende Frage hinaus, ob Kirchen auch für nicht-christliche Trauerfeiern zur Verfügung gestellt werden dürfen, einige Handlungsempfehlungen zur Zukunft kirchlicher Bestattung geben.
Bereits die Dramaturgie des Konventes 2010 lebte von der Einbeziehung poetischer Werke zum Generalthema Tod, wo ist dein Stachel? Mit Lesungen und zum Gespräch standen uns Eckart Kleßmann, Stephan Krawczyk, Jürgen K. Hultenreich, der der Bruderschaft seit den Gründertagen als Erster Landkomtur dient, und der Mitherausgeber Ulrich Schacht zur Verfügung. Schacht, der Großkomtur des Ordens, übernimmt nun für GEORGIANA 2 nicht nur eine eindrucksvolle Auswahl zeitgenössischer Lyrik zum Themenfeld, sondern vor allem eine bemerkenswerte, dichte Einleitung, die uns die enge Verwandtschaft von Gebet und Gedicht klar vor Augen führt. Das Schlusskapitel trägt die Überschrift Literarische Fundstücke. Wir danken an dieser Stelle ausdrücklich Christian Lehnert, der extra zwei bis dato unveröffentlichte Gedichte für unseren Band beigesteuert hat. Ulrich Schacht leiht sich als Motto für seinen finalen Introitus den Eingangssatz eines Gedichtes von Carl-Christian Elze: Vater im Luftraum, nimm uns die Angst. Von der Unabweisbarkeit des Todes, seiner existenziell christlichen Infragestellung durch den Apostel Paulus bis zu seiner Transformation, zu seiner radikalen Entmächtigung (Eberhard Jüngel) wird hier noch einmal genau jener Bogen geschlagen, den GEORGIANA 2 insgesamt spannt. Dieses kleine Werk sei hiermit unseren ebenso todesfürchtigen wie lebenslustigen Leserinnen und Lesern als ein geistig-geistliches Erbauungsbuch ganz eigener Art vorgelegt.
Thomas A. Seidel /Ulrich Schacht
Am Ramsebo bei Virserum (Schweden) und Weimar,
im Juli 2017
1 Band 1 erschien Ende 2015 unter dem Titel »… wenn Gott Geschichte macht! 1989 contra 1789« bei der EVANGELISCHEN VERLAGSANSTALT Leipzig, hg. v. Ulrich Schacht und Thomas A. Seidel.
Inhalt
I
THEOLOGISCHE ZEITANSAGEN
Peter Zimmerling
»Tod, wo ist dein Stachel?«
Todesfurcht und Lebenslust im deutschen Protestantismus. Eine Bestandsaufnahme
Siegmar Faust
Spaßgesellschaft bis zum Ende?
Geschichtstheologische Reflexionen im Anschluss an Wolfhart Pannenberg
II
VERGLEICHENDE PERSPEKTIVEN
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Ist Sterben ein Gewinn?
Religiöse und kulturelle Überlieferungen in der Nahsicht
Christine Schirrmacher
»Sünd’ und Hölle mag sich grämen …«
Tod und Leben im Koran und in der Bibel
Thomas A. Seidel
Schillers Schädel
Goethes Todesangst und einige kunstreligiöse Folgewirkungen
Sebastian Kleinschmidt
Probierstein des Todes
Autorschaft bei Elias Canetti und Ernst Jünger
III
LUTHERISCHE SEELSORGE UND DIE KUNST DES STERBENS
Dieter Koch
»Mitten im Leben vom Tod umfangen«
Eine Einführung in Martin Luthers Sermon »Von der Bereitung zum Sterben«
Martin Luther
Sermon »Von der Bereitung zum Sterben« (1519)
Nachdruck
IV
PRAKTISCHE ERFAHRUNGEN
George Alexander Albrecht/Cornelia Seidel/Heiner Sylvester
»Und plötzlich war da ein großes Licht …«
Erfahrungen aus der Sterbebegleitung
Michael Dorsch/ Frank Hiddemann/ Thomas A. Seidel
»Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden«
Kirchen als Orte gelebter Fürbitte – Beobachtungen und Handlungsempfehlungen zur Zukunft kirchlicher Bestattung
V
LITERARISCHE FUNDSTÜCKE
Ulrich Schacht
»Vater im Luftraum, nimm uns die Angst«
Zeitgenössische Poesie über Leben und Sterben
Friedhelm Mäker
Eckart Kleßmann
Uwe Kolbe
Erich Wolfgang Skwara
Kerstin Hensel
Siegmar Faust
Bernd Wagner
Matthias Buth
Jörg Bernig
Reiner Kunze
Ulrich Schacht
Jürgen K. Hultenreich
Christian Lehnert
Carl-Christian Elze
ANHANG
Personenregister
Quellennachweis
Die Autoren
Kleine Geschichte der Ev. Bruderschaft St. Georgs-Orden (St. GO)
Kapitel I
Theologische Zeitansagen
Peter Zimmerling
»Tod, wo ist dein Stachel?«
Todesfurcht und Lebenslust im deutschen Protestantismus. Eine Bestandsaufnahme
I
Die folgenden Überlegungen wollen exemplarische Einblicke in den Umgang mit Sterben und Tod im deutschen Protestantismus eröffnen. In einem ersten Schritt wird die Situation heute beschrieben: Sie scheint zwischen Verdrängung und Faszination merkwürdig zu changieren. In einem zweiten Schritt möchte ich darstellen, wie sich der Umgang mit dem Tod durch die Reformation fundamental veränderte. Im dritten Schritt geht es darum, zu zeigen, welche Rolle Paul-Gerhardt-Lieder in der evangelischen Kirche im 17. Jahrhundert für Sterbende und ihre Begleiter spielten. Im vierten Schritt werden Grundzüge einer evangelischen Spiritualität angesichts des Todes entwickelt. Am Ende steht die Frage, welche Rolle die Bereitschaft zum Martyrium im Protestantismus gespielt hat bzw. in Zukunft spielen könnte.
1.Zur Situation heute: Der Tod zwischen Verdrängung und Faszination1
1.1Merkwürdige Zwiespältigkeit
Beim Umgang mit Sterben und Tod lässt sich in Kirche und Gesellschaft derzeit eine merkwürdige Zwiespältigkeit beobachten.2Starb man früher meist zu Hause im Kreis der Menschen, mit denen man auch das Leben geteilt hatte, treten heute mehrheitlich spezialisierte Institutionen (Krankenhäuser, Kliniken, Altenheime und neuerdings Hospize) an dessen Stelle. Dadurch ist es zu einer »Institutionalisierung« des Sterbens gekommen. Eine Konsequenz dieses Vorgangs besteht darin, dass viele Menschen heute kaum noch lebenspraktische Erfahrung mit dem Sterben und in der Begleitung von Sterbenden haben. So kann es passieren, »dass das erste Sterben, mit dem jemand unmittelbar konfrontiert wird, sein eigenes ist«.3 Kein Wunder, dass viele Menschen völlig unvorbereitet dem eigenen Sterben oder dem naher Angehöriger gegenüberstehen, überfordert sind, wenn sie damit umgehen sollen, und deshalb zur Verdrängung neigen. Ein weiterer Grund für die fehlende Erfahrung mit Sterben und Tod ist die Entwicklung von der Klein- zur Kleinstfamilie. Viele Deutsche wachsen heute ohne Geschwister auf. Eine Vielzahl von Ehepaaren bleibt ganz ohne Kinder. Schließlich ist auch das grundsätzlich positive Phänomen der Langlebigkeit,4 ausgelöst durch technischen Fortschritt und die Errungenschaften der modernen Medizin, mitverantwortlich für die fehlende persönliche Erfahrung mit Tod und Sterben. Ein heutiger Lebenslauf mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 80 Jahren in den Industrienationen sieht anders aus als der Lebenslauf früherer Generationen, die eine ungleich niedrigere Lebenserwartung besaßen.
Gegenläufig zu diesem Prozess der Auslagerung von Sterben und Tod aus dem Alltag vollzieht sich eine andere Entwicklung: Seit einigen Jahren lässt sich eine vertiefte fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema beobachten. Das gilt für die mediale Öffentlichkeit genauso wie für Fachkreise. Dazu beigetragen hat das Bekanntwerden von Berichten über Nahtoderfahrungen,5 die z.T. heftigen öffentlichen Auseinandersetzungen rund um das Thema Sterbehilfe,6 die Ausbreitung des Hospiz-Gedankens und der Palliativ-Bewegung.7 Überdies entstand die wissenschaftliche Thanatologie, eine interdisziplinäre Forschungsrichtung.
Beide Entwicklungen – auf der einen Seite die Verdrängung von Sterben und Tod aus dem Alltag, auf der anderen Seite das verstärkte mediale Interesse an ihnen – sind charakteristisch für die Komplexität der heutigen Situation. An einer Stelle stimmen allerdings beide Entwicklungen überein: Sie lassen die existenztielle Dimension von Schmerz und Tod unberücksichtigt bzw. in den Hintergrund treten.8
1.2Sterben und Tod als Störung
Slogans wie »Anti-Aging« und »Forever young« sagen in unserer Gesellschaft dem Altern und Sterben den Kampf an und suggerieren damit häufig, dass beides kein grundlegender Bestandteil des menschlichen Lebens sei. Das ist deshalb fatal, weil die Langlebigkeit Krankheiten – wie etwa Demenz oder Alzheimer – hervortreten lässt, die in früheren Zeiten in dieser Intensität und Dauer kaum vorkamen. Die Einsicht, dass auch ein solches Schicksal zum menschlichen Leben gehören kann, würde bereits eine große Entlastung für alle Betroffenen darstellen – gleichermaßen für die Kranken wie für deren Angehörige und Freunde. Das Ideal der westlichen Gesellschaften ist jedoch der uneingeschränkt leistungs- und genussfähige Mensch.9 Welchen hohen Stellenwert dieses Ideal besitzt, zeigt sich an den ungeheuren Geldsummen, die der Staat und die Einzelnen sich die menschliche Gesundheit kosten lassen. Das Medizinstudium ist der am meisten nachgefragte Studiengang in Deutschland. Zweifellos brachte die moderne Medizin mit ihren vielfältigen Möglichkeiten ein vorher nicht gekanntes Mehr an Lebensqualität und Lebenserwartung.
Auf der anderen Seite stehen diesen Positiva auch Negativa gegenüber. Die westlichen Gesellschaften betrachten Tod und Sterben primär als Störung. Daraus rührt die Tendenz, Sterbende aus dem normalen Alltag auszugrenzen. Immer weniger Angehörige sind noch in der Lage, für sterbende Familienmitglieder bei sich zu Hause über einen längeren Zeitraum zu sorgen. Zwar liegt ein wesentlicher Grund dafür im modernen Lebenstempo und Lebensrhythmus. Das Sterben führt unweigerlich zu einer Verlangsamung dieses Tempos. Für eine solche Verlangsamung existieren im vom Beruf geprägten Alltag der meisten Menschen keinerlei Spielräume.
Aber es gibt noch einen anderen, subtileren Grund. Denn auch für außerhalb des Berufslebens stehende Angehörige ist es fast nicht möglich, einen sterbenden Menschen über eine längere Zeit rund um die Uhr zu begleiten. Verantwortlich dafür ist ein technisches, auf professionelle, hygienische und ökonomische Effizienz bedachtes Weltbild. Dahinter steht eine »bürger-lich-aufgeklärte Rationalität«.10 Die Folge ist die Unfähigkeit, das Sterben als integralen Bestandteil des Lebens zu betrachten. Jeder Sterbende stört diese Rationalität, entlarvt ihre Brüchigkeit. Das Sterben macht unübersehbar bewusst, dass das Leben trotz aller Anstrengungen letztlich nicht in den Griff zu bekommen ist. Diese Störung verkraften viele Angehörige aus psychischen Gründen nicht. Sterben und Tod schaffen für sie ein scheinbar unlösbares Problem, das durch Delegation an Fachleute professionell, ökonomisch, effizient und hygienisch gelöst wird.11 Es ist die Fähigkeit verloren gegangen, mit solchen Störungen des Alltags schöpferisch umzugehen, d.h. sie auf eine positive Nachricht hin – für alle Beteiligten – abzuhören, die das Leben zum Positiven verwandeln könnte. Damit wird die Chance vertan, einen schöpferischen Umgang mit Sterben und Tod zu erlernen, sie als Aufruf zur Übung von Barmherzigkeit und als Charismen, als Gaben, zu entdecken. Eine wichtige kirchliche und gesellschaftliche Aufgabe besteht heute darin, Sterben und Tod in den menschlichen Lebenslauf zu reintegrieren.
1.3Verlangsamung des Sterbeprozesses
Die moderne Medizin führte zu einer Verlangsamung des eigentlichen Sterbeprozesses.12 Mit dem verlangsamten Tod menschlich umzugehen, stellt derzeit eine der großen Herausforderungen der westlichen Menschheit dar. Die damit verbundenen Belastungen verlangen von den an der Sterbebegleitung Beteiligten ein Höchstmaß an seelischer Kraft. Die Angst vor übermenschlichen Lasten auf Grund der Verlangsamung des Sterbeprozesses hat zu einem weit verbreiteten Misstrauen gegenüber moderner Medizin und Krankenhauspraxis geführt. Bei vielen sitzt inzwischen das Vorurteil tief, dass Menschen am Lebensende in Krankenhäusern regelrecht gequält werden. Andererseits haben nicht wenige Menschen, Sterbende und vor allem ihre nahen Verwandten, Angst vor dem Sterben zu Hause. Keiner möchte sich vorwerfen lassen, nicht wirklich alles medizinisch Mögliche in Anspruch genommen zu haben. Angesichts dieser Situation erscheint einer zunehmenden Anzahl von Menschen die aktive Sterbehilfe als das »Zaubermittel«, mit dem sich alle Probleme lösen lassen.
Hier fehlt nicht viel, dass die Sehnsucht nach Schutz vor Belastungen im Sterben zu einer unbestimmten Tötungsbereitschaft wird, die von der Unfähigkeit und von der Unsicherheit geprägt ist, mit behinderten und vergehenden Lebensformen umzugehen, in ihnen noch irgendeinen Sinn zu suchen […].13
Die Furcht früherer Generationen vor einem unvorbereiteten schnellen Tod wurde abgelöst durch die Sehnsucht nach einem plötzlichen friedlichen Einschlafen. Solchen Entwicklungen sollte durch eine Haltung begegnet werden, die die Ängste vor einem langen qualvollen Tod ernstnimmt, aber gleichzeitig entschieden für die Würde des todkranken Menschen eintritt.
1.4Zwang zu permanenten therapeutischen Entscheidungen
Die Multioptionalität als Kennzeichen der gegenwärtigen Gesellschaft14 ist inzwischen bis auf die letzte Lebensphase mit ihren Alterungs- und Sterbeprozessen durchgeschlagen. Anders als in früheren Zeiten gehört zur Sterbebegleitung heute die Notwendigkeit ständiger Reflexion, d. h. bewusster Entscheidung und Gestaltung.15 »Die Kapazitäten der Therapie sind so differenziert, dass sich das schmale Spektrum ›nützliche Therapie / notwendiges Sterbenlassen‹ in eine Palette unterschiedlichster Nuancen differenziert hat.«16 Die Konsequenz ist zum einen häufig die Überforderung von Kranken, Ärzten und Begleitern. Zum anderen verdeckt der permanente Zwang zu therapeutischen Entscheidungen die Notwendigkeit einer bewussten existenziellen Auseinandersetzung mit Sterben und Tod. Weil trotz aller medizinischen Fortschritte die Endlichkeit des menschlichen Lebens unaufhebbar bleibt, geht es darum, der menschlichen Endlichkeit im gesellschaftlichen Diskurs und in sozialer Praxis zu ihrem Recht zu verhelfen.
1.5Zurücktreten der spirituellen Dimension im diakonischen Handeln
Als die moderne Krankenpflege im 19. Jahrhundert im Rahmen der »Inneren Mission«, der heutigen »Diakonie«, entstand, stellten die Pflege des Nächsten, der Dienst für Gott und die Heilkunst ihre integralen Bestandteile dar.17 Prozesse der Säkularisation, der Emanzipation und der Professionalisierung führten dazu, dass die spirituelle Dimension im diakonischen Handeln mehr und mehr in den Hintergrund trat. Das führte in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg z.B. dazu, dass das Moment der Berufung als Voraussetzung einer pflegerischen Tätigkeit sukzessive zurücktrat. Das ärztliche und pflegerische Handeln wurde nicht länger primär als Dienst und Hingabe am Kranken verstanden. Inzwischen gibt es neuere Ansätze, die sich darum bemühen, das ursprüngliche spirituelle Anliegen in der Diakonie wiederzugewinnen.18 Dies geschieht nicht zuletzt aus der Einsicht heraus, dass zur Ganzheit des Menschen eine spirituelle Komponente gehört; der Mensch also nicht auf seine Ratio und seine Körperlichkeit reduziert werden darf.
2.Reformation: Die Bedeutung der Lehre von der Rechtfertigung allein aus Gnaden für den Umgang mit Sterben und Tod
Das Mittelalter hatte eine regelrechte ars moriendi, eine Kunst des Sterbens, entwickelt, deren wesentliche Aufgabe darin bestand, zum Begleiten der Schwerkranken und Sterbenden und zum Trösten der Trauernden als einer vor Gott verdienstlichen Tat zu ermutigen.19 Bei den mittelalterlichen Sterbebüchlein handelte es sich um Beratungsbücher für die Sterbebegleitung: »Es ist kein Werk der Barmherzigkeit größer, als daß dem kranken Menschen in seinen letzten Nöten geistlich und sein Heil betreffend geholfen wird.«20
Martin Luther stand in der Tradition dieser Ars-moriendi-Literatur und hat selber entsprechende Bücher verfasst, deren bekanntestes im vorliegenden Buch abgedruckt wird: »Von der Bereitung zum Sterben« (1519). Im Unterschied zur Tradition schreibt Luther jedoch kein »Beratungsbuch für Sterbebegleitung, sondern sein Sermon wendet sich an denjenigen, der selbst sterben wird.«21
Dabei stellte er die ars moriendi auf ein völlig neues theologisches Fundament. Weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz die Schuld der Menschheit ein für alle Mal getragen hat, braucht kein Mensch länger – weder im Leben noch im Tod – für seine Sünden zu büßen. Er muss fortan die göttliche Strafe weder im Fegefeuer noch im Jüngsten Gericht fürchten. Dadurch kommt eine ganz neue Wärme in das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Der Glaube verleiht die Gewissheit, im Leben und im Sterben von der Liebe Gottes getragen zu sein. Das Bild Jesu Christi ist bei Luther nicht länger von der Vorstellung des rächenden Richters im Jüngsten Gericht geprägt (so die Darstellung im Tympanon vieler mittelalterlicher Dome). Vielmehr wird er wieder der gute Hirte wie in den frühen Darstellungen der Alten Kirche, der die Seinen zu den Quellen lebendigen Wassers leitet (so eindrucksvoll die Darstellung im Mausoleum der Galla Placidia in Ravenna). Der Sterbende soll lernen, sich im imaginierten Bild Jesu Christi zu sehen, der vor ihm durch Tod und Hölle hindurchgegangen und für ihn den Himmel gewonnen hat.
Luther verstand es, Jung und Alt Freude auf den Himmel zu vermitteln. Davon legt besonders eindrücklich ein Brief Zeugnis ab, den er am 19. Juni 1530 von der Veste Coburg an seinen Sohn »Hänsichen Luther« in Wittenberg geschrieben hat. Darin heißt es:
Ich weiß ein hubschen, schonen lustigen Garten. Da gehen viel Kinder innen, haben guldene Rocklin an und lesen schone Öpfel unter den Bäumen und Birnen, Kirschen, Spilling und Pflaumen, singen, springen und sind frohlich. Haben auch schone kleine Pferdlin mit gulden Zäumen und silbern Sätteln. Da fragt ich den Mann, des der Garten ist, wes die Kinder wären? Da sprach er: Es sind die Kinder, die gern beten, lernen und fromm sein. Da sprach ich: Lieber Mann, ich hab auch einen Sohn, heißt Hänsichen Luther, mocht er nicht auch in den Garten kommen, dass er auch solche schone Öpfel und Birne essen mochte und solche feine Pferdlin reiten und mit diesen Kindern spielen? Da sprach der Mann: Wenn er gerne betet, lernet und fromm ist, so soll er auch in den Garten kommen, Lippus und Jost auch. Und wenn sie all zusammen kommen, so werden sie auch Pfeiffen, Pauken, Lauten und allerlei andere Saitenspiel haben, auch tanzen und mit kleinen Armbrüsten schießen …22
Der Himmel, von Luther hier dargestellt in dem beliebten mittelalterlichen Bild des Gartens, des hortus conclusus, bedeutet nicht ein Weniger, sondern ein Mehr an Leben, also dessen Steigerung und Intensivierung.
Auch die reformatorische Ablehnung des Fegefeuers gehört in diesen Zusammenhang. Aus dem zeitlich ausgedehnten Fegefeuer als bedrohlichem Durchgangsort zum Himmel wird bei Luther der kurze Moment des Todesschlafs, was dem Sterbenden einen Großteil seiner Furcht vor dem Tod zu nehmen vermag. An seinen todkranken Vater schreibt er:
Denn unser Glaube ist gewiss, und wir zweifeln nicht, dass wir uns bei Christo wiederum sehen werden, sintemal der Abschied von diesem Leben vor Gott viel geringer ist, denn ob ich von Mansfeld hieher von euch, oder ihr von Wittenberg gen Mansfeld von mir zöget. Das ist gewisslich wahr, es ist um ein Stündlein Schlafs zu tun, so wird’s anders werden.23
So real ist für Luther das himmlische Leben bei Gott, dass von dort aus starke Kräfte der Hoffnung und des Trostes in das irdische Leben fließen. Dabei lässt ihn die vitale Ausrichtung des Glaubens auf den Himmel das Leben auf der Erde nicht vergessen. Nirgends bekommt man den Eindruck, dass er das irdische Leben überspringen würde. Im gleichen Brief an den Vater teilt Luther diesem mit, dass er einen Neffen nach Mansfeld geschickt hat, um zu prüfen, ob die alten Eltern noch reisefähig sind, um nach Wittenberg gebracht werden zu können:
Aber große Freud sollt mir’s sein, wo es möglich wär, dass ihr euch ließet samt der Mutter hieherführen zu uns, welch’s mein Käth mit Tränen auch begehrt, und wir alle. Ich hoffe, wir wollten euer aufs best warten.24
Dass Luther das irdische Leben ernst nimmt, zeigt sich auch in seiner Aufforderung, über den Verlust von Angehörigen zu trauern:
Gott will, dass wir unsere Kinder lieb haben, und dass wir trauern, wenn sie von uns genommen werden hinweg, doch soll die Traurigkeit mäßig und nicht zu heftig sein, sondern der Glaube der ewigen Seligkeit soll Trost in uns wirken.25
3.Der Umgang mit dem Tod in nachreformatorischer Zeit am Beispiel der Lieder Paul Gerhardts
Im Zeitalter der Orthodoxie übernimmt das evangelische Gesangbuch die Aufgabe, die früher die Literatur zur Ars moriendi erfüllte.26 Martin Moller (1547–1606), Kantor, Pfarrer und Liederdichter in Schlesien, war einer der Begründer der evangelischen Erbauungsliteratur. Er hat sich ausführlich mit der Rolle von Gesangbuchliedern für Kranke und Sterbende beschäftigt. So erkannte er bereits die besondere seelsorgerliche Wirkung des in der Kindheit bzw. Jugend auswendig gelernten Wortes. »Wenn man [als Sterbender] die Verse selber nicht mehr sprechen kann, so klingen sie dennoch in dem, der sie einmal gelernt hat, wider.«27 Auch wenn bestimmte Lieder in der Sterbebegleitung besonders geeignet sind, ist für Moller grundsätzlich jedes Gesangbuchlied zu gebrauchen. Bemerkenswerterweise soll der Sterbebegleiter die Lieblingslieder des Sterbenden berücksichtigen.
Es gibt die Erfahrung, dass man durch schöne Gesänge, wenn sie mit Andacht gesungen werden, viel Traurigkeit und Schwermut aus dem Herzen wegsingen, dagegen auch viel schönen Trostes hinein singen kann, dass die Herzen dabei fröhlich und gutes Muts werden, erinnern sich dadurch der himmlischen Engel Musica, welche wir dort werden halten helfen, und samt ihnen Gott preisen in ewigen Freuden. Man soll sich aber nach dem Patienten richten und ihm singen, was er haben will…28
Die Gesangbücher des 16. und 17. Jahrhunderts weisen einen hohen Anteil an Sterbeliedern auf. »So finden sich z.B. in Johann Crügers Praxis Pietatis Melica von 1656 unter 500 Liedern 49 Sterbegesänge, deren Zahl sich in weiteren Auflagen noch erhöht.«29 In dieser Zeit war der Tod allgegenwärtig: zahlreiche Frauen starben im Kindbett, viele Kinder erreichten nicht das Erwachsenenalter, immer wieder wüteten Kriege, Seuchen und Hungersnöte.
Aus der Bach-Zeit wissen wir, dass in Leipzig genau Buch geführt wurde, welche Gesangbuchlieder mit den Sterbenden gesungen wurden, ja, mit welchem Lied auf den Lippen jemand starb. Das wurde in den Traueransprachen, die meist auch gedruckt erschienen, ausdrücklich vermerkt. Paul-Gerhardt-Lieder wurden damals zum wichtigsten Mittel der Sterbebegleitung.30
Seine Lieder zählen bis heute zu den großen Tröstern der Menschheit.31 Meine These ist: Das hohe Trostpotentzial der Lieder hat seine Ursache darin, dass sie aus dem eigenen Trostbedürfnis des Dichters erwachsen sind. Er schrieb sie zur eigenen Vergewisserung und Ermutigung angesichts zahlreicher Bedrängnisse von Innen und Außen. Gerhardt ist Zeit seines Lebens von Kriegs-, Hungers-, Gewissensnöten und von Schwermut geplagt worden. Anschaulich heißt es auf dem Porträt Paul Gerhardts in der Kirche von Lübben: »Paulus Gerhardus, Theologus, in cribro Satanae versatus« – auf Deutsch: »Paul Gerhardt, Theologe, in Satans Sieb durchgeschüttelt«.32 Es wirkt, als ob Paul Gerhardt die Trostkraft seiner Lieder zuerst an sich selbst getestet hätte. Das macht sie so glaubwürdig.
Zur Kraft, trösten zu können, tritt das therapeutische Potenzial der Lieder. Es erwächst aus dem Grundton der Freude, der in der Bejahung der Schöpfung und des Lebens seine Ursache hat und die Lieder Paul Gerhardts prägt. Der lebensbejahende Klang hat frühere Interpreten dazu verführt, in Gerhardt »ein[en] Mensch[en] von köstlicher Unmittelbarkeit, ein[en] Jüngling von unbeschreiblicher Sonnigkeit des Gemütes« zu sehen.33 Nichts ist verkehrter als eine derartige Deutung. Dass Paul Gerhardt angesichts der Schrecken des Dreißigjährigen Krieges nicht wie sein Zeitgenosse Andreas Gryphius einem tiefen Pessimismus verfiel, ist einzig seinem Vertrauen auf Gott zu verdanken. Dieses trug ihn und zieht sich wie ein roter Faden durch seine Lieder. Gerhardts Zuversicht ist nicht Ausfluss einer sanguinischen Gemütsart, sondern schwer errungene Gabe Gottes. Das wird am Lied »Befiehl du deine Wege« deutlich, wenn es darin heißt: »Gott wird dich aus der Höhle, / da dich der Kummer plagt, / mit großen Gnaden rücken« oder: »Auf, auf, gib deinem Schmerze / und Sorgen gute Nacht, / lass fahren, was das Herze / betrübt und traurig macht« oder: »Er wird zwar eine Weile / mit seinem Trost verziehn«. Gerhardt beschönigt nichts, aber durch die Not hindurch gewinnen Hoffnung und Zuversicht Raum. Auf diese Weise können die Lieder ihre Trostkraft entfalten.
Das Lied »O Haupt voll Blut und Wunden« (EG 85) vermag unter den Dichtungen Paul Gerhardts besonders Sterbende am unmittelbarsten anzusprechen.34 Viele Generationen evangelischer Christen begleitete das Lied in ihrem Sterben. Es ist das bekannteste evangelische Passionslied.35 Durch Johann Sebastian Bach ist es überdies »zum Inbegriff [lutherischer] Kreuzesfrömmigkeit« geworden.36 »O Haupt voll Blut und Wunden« stellt die Nachdichtung eines mittelalterlichen Passionsliedes dar. Sein Dichter war Arnulf von Löwen (geb. um 1200), der in der Tradition der Christusmystik Bernhards von Clairvaux stand. Wie dieser war auch Arnulf Zisterzienserabt. Beim Vergleich der Dichtung Paul Gerhardts mit der Vorlage fällt auf, dass er diese gesteigert hat: Gerhardts Lied ist noch emotionaler, innerlicher und subjektiver. Ein Liebender führt darin ein meditatives Gespräch mit dem Gekreuzigten.37 Dem entspricht, dass »O Haupt voll Blut und Wunden« nach der Melodie eines Liebeslieds gesungen wird.
Indem das Lied den gekreuzigten Jesus Christus besingt, beschreibt es zunächst einen Menschen in seinem tiefsten Todesleid, ohne zu beschönigen:
O Haupt voll Blut und Wunden, / voll Schmerz und voller Hohn, /
o Haupt, zum Spott gebunden / mit einer Dornenkron, /
o Haupt, sonst schön gezieret / mit höchster Ehr und Zier, /
jetzt aber hoch schimpfieret: / Gegrüßet seist du mir! (Strophe 1)
Strophe 3 bietet noch eine Steigerung. Darin wird ein Sterbender vor Augen gemalt, ohne dass ein einziges frommes Wort fiele:
Die Farbe deiner Wangen, / der roten Lippen Pracht /
ist hin und ganz vergangen; / des blassen Todes Macht /
hat alles hingenommen, / hat alles hingerafft, /
und daher bist du kommen / von deines Leibes Kraft.
Bis hierher lautet die realistische Botschaft des Liedes: Jesus Christus hat wie jeder andere Mensch Sterben und Tod erlitten. Der Tod gehört untrennbar zum menschlichen Leben dazu.
In Strophe 4 erfolgt eine Identifikation des singenden Ich mit dem Sterbenden am Kreuz. Strophe 5 beschreibt die Gnade, die dem Menschen durch das Sterben Jesu am Kreuz zuteilwird.
Die Versenkung in die Passion Jesu ist für spätmittelalterliche Frömmigkeit zentral, erst recht wenn sie mystisch geprägt ist. Sie soll zur Vereinigung des Meditierenden mit dem leidenden Jesus Christus führen. In den Strophen 6 und 7 »verschmilzt die Zeit des Ich gänzlich mit der des sterbenden Jesus«:38
Ich will hier bei dir stehen, / verachte mich doch nicht; /
von dir will ich nicht gehen, / wenn dir dein Herze bricht; /
wenn dein Haupt wird erblassen / im letzten Todesstoß, /
alsdann will ich dich fassen / in meinen Arm und Schoß. (Strophe 6)
Es dient zu meinen Freuden / und tut mir herzlich wohl, /
wenn ich in deinem Leiden, / mein Heil, mich finden soll. /
Ach möcht ich, o mein Leben, / an deinem Kreuze hier /
mein Leben von mir geben, / wie wohl geschähe mir! (Strophe 7)
Paul Gerhardts Lied zeichnet sich gleichzeitig durch Aufnahme der spätmittelalterlichen, mystisch geprägten Passionsfrömmigkeit und ihre Überbietung in reformatorischem Sinne aus. Es kommt zu einer »Überbietung der imaginierten durch die geglaubte Nähe Jesu«.39 Aus der Nähe zu Jesus durch Anteilnahme an seinem Tod wird die Nähe zu ihm durch die Inanspruchnahme seines Todes im Glauben. »Mit der Strophe 8 beginnt der letzte Liedteil, in dem statt der gefühlsmäßigen Teilnahme des Menschen am Sterben Jesu nun Jesu Teilnahme am Sterben des Menschen thematisiert wird.«40
Ich danke dir von Herzen, / o Jesu, liebster Freund, /
für deines Todes Schmerzen, / da du’s so gut gemeint. /
Ach gib, dass ich mich halte / zu dir und deiner Treu /
und, wenn ich nun erkalte, / in dir mein Ende sei. (Strophe 8)
In Strophe 9 geht Gerhardt noch einen Schritt weiter. Johann Sebastian Bach hat die Strophe in der Matthäuspassion unmittelbar nach dem Sterben Jesu am Kreuz eingefügt.
Wenn ich einmal soll scheiden, / so scheide nicht von mir, /
wenn ich den Tod soll leiden, / so tritt du dann herfür; /
wenn mir am allerbängsten / wird um das Herze sein, /
so reiß mich aus den Ängsten / kraft deiner Angst und Pein.
Die Strophe macht dem Sterbenden Mut: Wenn er im Sterben alle anderen Menschen zurücklassen muss, wird Jesus ihn nicht verlassen, sondern bei ihm sein, ihm gerade dann begegnen. Warum gerade Jesus Christus? Weil er den Todesweg vorausgegangen ist, selbst Todesangst und Todespein erlitten hat und darum den Sterbenden versteht. Und das ist noch nicht alles: Weil der Tod Jesus wieder freigeben musste, weil Gott ihn von den Toten auferweckte, ihm Anteil gab an seinem göttlichen Leben, kann er den Sterbenden von dessen Ängsten befreien, aus dessen Ängsten herausreißen. »Das Zusammensprechen von ›Ich‹ und ›Du‹ zieht den Beter in die Gemeinschaft mit Christus und hilft ihm, sich wie in einer Kreuzesvision Christus als Überwinder zu vergegenwärtigen.«41 Der von Gerhardt verwendete Begriff des »Reißens« hat biblische Wurzeln (Ps. 116,8: »Du hast meine Seele aus dem Tode gerissen«) und nimmt gleichzeitig mystische Sprache auf. Der mystische Raptus bedeutet »ein ekstatisches Hingerissenwerden zu voller Gottesgemeinschaft«.42
Die letzte Strophe bildet den Höhepunkt des Liedes. Sie bringt die Unio mystica, die Vereinigung des Glaubenden mit Jesus Christus zum Ausdruck. Die visionäre Schau des Gekreuzigten in der eigenen Todesstunde geschieht zwar im Glauben, besitzt aber eine sinnliche Dimension, führt zu einer »liebenden Umarmung«.43
Erscheine mir zum Schilde, / zum Trost in meinem Tod, /
und lass mich sehn dein Bilde / in deiner Kreuzesnot. /
Da will ich nach dir blicken, / da will ich glaubensvoll /
dich fest an mein Herz drücken. / Wer so stirbt, der stirbt wohl. (Strophe 10)
4.Grundzüge einer evangelischen Spiritualität im Angesicht des Todes44
4.1Die Psalmen als Sprachhilfe
Zu allen Zeiten hat die Bibel fromme und unfromme Menschen angezogen, weil sie nichts – auch nicht um eines frommen Ideals willen – beschönigt, sondern die Wirklichkeit ungeschminkt zur Sprache bringt. Und zu allen Zeiten haben Frauen und Männer erlebt, dass bestimmte Bibelworte direkt zu ihnen sprachen, als ob es keine historische Distanz gäbe. Die Bibel enthält eine Fülle von Texten, die das Thema Sterben und Tod haben. Die Frage ist, ob es darunter Worte gibt, die unmittelbar, ohne große Erklärung, Sterbende und ihre Begleiter anzusprechen vermögen.
Tatsächlich gibt es solche Texte. Dazu gehören nicht zuletzt die Psalmen. In seiner zweiten Vorrede zum Psalter von 1528 schreibt Martin Luther:
… wo findest du tiefere, kläglichere, jämmerlichere Worte von Traurigkeit als die Klagepsalmen haben? Da siehest du abermal allen Heiligen ins Herz wie in den Tod, ja wie in die Hölle. Wie finster und dunkel ist’s da von allerlei betrübtem Anblick des Zorns Gottes! Also auch, wo sie von Furcht oder Hoffnung reden, brauchen sie solche Worte, daß dir kein Maler also könnte die Furcht oder Hoffnung abmalen, und kein Cicero oder Redekundiger also vorbilden.45
In Ps 22,15 etwa heißt es:46 »Ich versinke im tiefen Schlamm, wo kein Grund ist.« Menschen »erkennen in dem Schlamm ihre Angst [und ihren Schmerz] wieder, die sie zäh und klebrig umschlossen […] [halten], in die sie immer tiefer hineingeraten, je mehr sie sich dagegen zu wehren versuchen«.47 Indem Angst und Schmerz durch die Psalmen eine Sprache finden, werden sie ans Licht geholt. Damit verschwinden sie zwar nicht, aber sterbende Menschen können mit ihrer Hilfe lernen, mit ihnen umzugehen. Die Psalmen als Sprachhilfe angesichts von Sterben und Tod – so könnte man eine ihrer Wirkungen beschreiben.
Die Psalmen bleiben nicht bei der bloßen Beschreibung stehen. »Auch in den Worten, die der Verzweiflung am nächsten sind, sind sie noch ein Schrei um Hilfe.«48 Sie bringen die Angst und den Schmerz angesichts des Todes in einen Dialog, und zwar in den Dialog mit Gott. Dabei bleibt Gott für die Psalmbeter kein Abstraktum. Vielmehr nennen sie Namen für Gott, die in die Tiefe von Angst und Schmerz hinabreichen: »Meine Stärke, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Schild und mein Schutz […]« (Ps 18).49 »Was in der Angst noch trägt, ist nicht eine Lehre über Gott; die Angst sitzt tiefer und ist stärker als solche Lehren. Eine Sprache, die in der Angst ein Fenster öffnen soll, muß mir die Möglichkeit geben, Gegenerfahrungen zu machen.«50





























