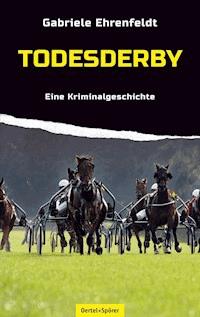
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Oertel u. Spörer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alma Pilic verbringt ein Auslandssemester in Dublin, um für ihre Dissertation am Trinity College über das „Book of Kells“ zu forschen. Dort trifft sie ihren Bekannten Khaled al-Haquim wieder, dessen Familie das zweitgrößte Gestüt im Oman besitzt. Als ihre Tübinger Freunde zu Besuch kommen, unter ihnen die Hobbydetektive Niels Wolgrath und Manuel Soares, verbringen sie ausgelassene Tage in Donegal. Bis John Kavanagh auftaucht. Er war kurz zuvor bei der Beerdigung eines Freundes, der Pferdezüchter war und einen Reitunfall hatte. Dessen Onkel und Raileys Vater, ebenfalls bekannte Züchter, waren auf ähnliche Weise von ihren millionenschweren Pferden gefallen und ums Leben gekommen. John sieht in diesen „Unfällen“ ein Komplott, und als sie dann auch noch al-Haquim in der Nähe treffen, erhärtet sich sein Verdacht, und die ganze Corona ermittelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
Alma Pilic, die Tübinger Kunsthistorikerin und Galeristin, ist für ein Semester in Dublin; sie trifft ihre Bekannten, den Iren John Kavanagh und den Omani Khaled al-Haquim, wieder. Khaled al-Haquim ist regelmäßig Gast am College und holt sich ebenfalls Rat bei Almas Zweit-Doktorvater Railey. Über Weihnachten kommen Almas Tübinger Freunde, u. a. die Hobbydetektive Niels Wolgrath und Manuel Soares, mit denen sie fröhliche Tage in Donegal verbringt.
Bis John bei ihnen auftaucht. Er war bei der Beerdigung eines Freundes, eines Pferdezüchters. Dieser hatte wie schon zuvor sein Onkel und Raileys Vater, beide ebenfalls bekannte Züchter, einen Reitunfall – einen tödlichen. John glaubt, dass bei diesen »Unfällen« etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Endgültig misstrauisch wird er, als sie bei einem Ausflug al-Haquim treffen, den John schon immer undurchsichtig fand.
Der Freundeskreis um Alma, Niels und Manuel beginnt, sich mit dem Pferdesport zu beschäftigen, und ermittelt. Dabei finden sie heraus, dass der echte al-Haquim ein entfernter Cousin des falschen ist. Wer also ist der Gaststudent wirklich und was hat er mit den »Unfällen« zu tun? Mithilfe des Tübinger Kommissars Peter Mehrfeldt, einem Freund von Alma, Niels und Manuel, führen die Spuren nach London, doch es dauert noch Monate, bis die Rätsel gelöst werden.
Gabriele Ehrenfeldt
ist gebürtige Stuttgarterin. Seit ihrem Studium der Sozial- und Sprachwissenschaften lebt sie in Tübingen. Sie ist seit 25 Jahren als literarische Übersetzerin, Redakteurin, Gutachterin, Herausgeberin und Autorin tätig, einige Jahre auch als Verlegerin. Offizielle Homepage www.gabriele-ehrenfeldt.de. »Todesderby« ist der sechste Fall der Wolgrath-Soares-Reihe und der zweite, der im Oertel + Spörer Verlag erscheint.
Gabriele Ehrenfeldt
Todesderby
Eine Kriminalgeschichte aus Tübingen und von den Britischen Inseln
Oertel+Spörer
Dieser Kriminalroman spielt an realen Schauplätzen. Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Sollten sich dennoch Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen ergeben, so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt.
© Oertel + Spörer Verlags-GmbH+Co. KG 2015Postfach 16 42 · 72706 ReutlingenAlle Rechte vorbehalten.
Titelbild: © Dziurek, FotoliaUmschlaggestaltung + Satz: Oertel + Spörer Verlag, Bettina MehmedbegovićISBN 978-3-88627-680-6
Besuchen Sie unsere Homepage und informieren Sie sich über unser vielfältiges Verlagsprogramm:www.oertel-spoerer.de
Pepitarock, lang, Pepitacape, kurz. Ledergeschnürte Taille. Schwarze Stöckelschuhe. Schmale, dünne Handschuhe, weiß. Eine Hand hält eine schwarze Kuverttasche, die andere ein paar Einkaufstaschen. Sehr Fünfzigerjahre ... Der kleine weiße Lederfinger, der linke, beringt. Den blonden Kopf, eine schwarze Schute obenauf, leicht geneigt. Runde, pennygroße opalschillernde Ohrstecker, samtrote Lippen, rasante Sonnenbrille gegen die flache Dezembersonne.
Eine auffällige Erscheinung in Dublins Straßen, selbst an einem Nachmittag in der üppig weihnachtlich geschmückten, glitzernden, funkelnden Grafton Street. Damals wie heute nach James Joyce »fröhlich mit ihren festgezurrten Markisen«.
Alma Pilic.
Sie war zurück in der Stadt, in der sie vor zwei Jahren als Studentin der Kunstgeschichte zwei Gastsemester am renommierten Trinity College verbracht hatte, war zurückgekommen, um ganz konzentriert an ihrer Dissertation über insulare, speziell über keltisch-frühirische Buchmalerei zu arbeiten. Um Licht in diesen Mix aus mediterranen, nordischen, germanischen, römischen und eisenzeitlichen Elementen zu bringen. Um ein gutes Stück weiterzukommen, damit sie diese interessante, wiewohl aufreibende Arbeit in absehbarer Zeit endlich abschließen könnte.
Zu Hause in Tübingen fehlte ihr wegen der kleinen Galerie, die sie dort in der Altstadt eröffnet hatte, und durch ihr umtriebiges Privatleben mit ihrem Freund Niels Wolgrath, dessen bestem Freund Manuel Soares, wiederum dessen Freundin – und Almas bester Freundin – Siggi Hertneck sowie wechselnden Assoziierten dieses Kreises dazu die Zeit, die Konzentration, das Sitzfleisch und vor allem die Lust.
Also war sie nun seit zwei Monaten hier in der irischen Hauptstadt, saß von morgens bis abends in der Bibliothek und schuftete. Es lohnte sich, war aber auch anstrengend. Doch ab jetzt wäre es erst einmal vorbei mit der Arbeit. Am Abend fand die Weihnachtsfeier von Kenneth Raileys Lehrstuhl statt, übermorgen wollten die drei Tübinger kommen, außerdem Almas jüngere Schwester Francesca und deren Freund Joachim Kull aus Stuttgart. Dann würden sie zusammen ins County Donegal fahren. Am Lough Eske ausspannen und die Tage genießen. Das Leben genießen, es sich schön machen. So einfach konnte es sein!
Alma Pilic, ganz in Gedanken, war mitten auf der Straße stehen geblieben. Als hätte sie eine plötzliche Erleuchtung gehabt, ja als hätte sie wahrlich der Blitz getroffen. Doch sehr viel mehr als um mittelalterliche Illuminationen schienen ihre Gedanken um James Joyces Ulysses zu kreisen.
Na klar – wer hatte Dublin, den Dubliner Alltag denn schon so, auf diese Weise durchwandert? Odysseehaft? Zürnend?
»Yup, enjoy yourself! Man … ich muss ganz einfach das Leben auch mal genießen!«, sagte sie so laut, dass die Leute sich nach ihr umdrehten, und steuerte sehr entschlossen in die Duke Street zum Davy Byrne’s. Der Pub mit der Einrichtung aus den Dreißigerjahren war mit James Joyce in die Weltliteratur eingegangen. »Für einen Schluck ist hier in Irland immer Zeit«, schob sie mit einem Lächeln für die ganze Welt nach.
One for the road, one for the walk, one for the courage, one for your love – einer oder auch zwei waren nie zu viel und immer richtig, zu jeder Tages- und Nachtzeit, an jedem Ort, in jeder Situation.
Schnell nahm Alma Pilic ihre Insektenaugen-Sonnenbrille ab, als sie den schummrig-heimeligen Raum betrat – nun, im Winter, war selbst die große Lichtkuppel kraftlos – und dem Publican, dem Wirt, gleich mit einem Handzeichen zu verstehen gab, dass sie ein Pint wollte. Guinness natürlich, was sonst?
Sie stellte sich an den langen, leicht geschwungenen Tresen und sah gedankenversunken zu, wie der cremige Schaum aus dem Fass langsam und leise aufstieg, bis das vollmundige, gemalzte Stout schließlich und gänzlich im Glas ruhte und der Publican es ihr reichte.
»Sláinte«, sagte er.
Alma zog den rechten Handschuh aus, nahm das Glas mit dem tiefschwarzen Bier und hob es mit einem dankenden »Auch dir und allen anderen zum Wohl«. Sie trank mit großem Durst und Genuss und fühlte sich gleich mit dem ersten Schluck gestärkt und schon sehr viel entspannter. Und zusammen mit der Vorfreude auf die Freunde und auf das Häuschen im wilden Nordwesten der grünen Insel breitete sich eine warme Leichtigkeit und Wohligkeit in ihr aus.
Sie atmete tief durch und sah sich um. Das Lokal war wie immer gut besucht, an beiden »gekurvten« Tresen standen Gäste. Alma meinte sogar, ein bekanntes Gesicht entdeckt zu haben: Khaled al-Haquim.
Er arbeitete an der Universität Masqat und versuchte seit einigen oder wohl schon seit vielen Jahren, sich über ein kalligrafisches Thema im europäisch-arabischen Vergleich zu habilitieren. Zu diesem Zweck konsultierte er in unregelmäßigen Abständen die Bibliothek des Trinity College und natürlich den Meister, Kenneth Railey, höchstpersönlich.
Der groß gewachsene, schlanke Mann mit dem schwarzen Haar, dem sauber getrimmten Bart, der dunklen Haut und mit schwarzen Augen, die glühten, als hätte er ständig erhöhte Temperatur, war zwar etwas undurchdringlich und undurchsichtig, aber ausnehmend höflich – um nicht zu sagen: aristokratisch.
Alma hatte ihn schon während ihres Gaststudiums in Dublin kennengelernt, nun hatten sie sich wiedergesehen und trafen sich hin und wieder auf eine Tasse Tee in der Cafeteria. Worüber genau er arbeitete, hatte sie nie so richtig durchschaut, sie verstand ja auch nicht viel von Kalligrafie, schon gar nicht von der orientalisch-islamischen, aber es gab andere Themen, über die man reden konnte, und dazuzulernen war ja durchaus auch immer eine Option. Oder etwa nicht? Das sagte jedenfalls Khaled.
So hatte er ihr zum Beispiel erklärt, dass die als typisch keltisch geltenden Knoten- und Rankenmuster unter anderem auf Einflüsse aus dem Nahen Osten und dem Vorderen Orient zurückzuführen seien, namentlich auf etwas, das sich »quadratisches Kufisch« nannte. Aber das wusste sie ja schon. Doch da war noch sein auffälliger Claddagh-Ring – zwei Hände, die ein Herz mit einer Krone hielten. Ein Herz, Hand in Hand. Der Fischer Richard Joyce war der Legende nach von kabylischen Korsaren entführt und einem Goldschmied als Sklave verkauft worden, dessen Handwerk er meisterhaft erlernt und nach seiner Freilassung mit in die Heimat zurückgebracht hatte. Das war jedoch nur eine Geschichte von vielen, die sich um diesen Ring rankten. Eine andere war die, dass der Ring immer von der Mutter auf die Tochter vererbt wurde … Aber wie war Khaled dann daran gekommen? Jedenfalls war er nach Almas Ansicht ein hochintelligenter, geistreicher und durchaus unterhaltsamer Bursche.
Lächelnd hob Alma die Hand, aber der Mann, der wie in gewichtige Gedanken vertieft mit gerunzelter Stirn vor sich hingestarrt und auf seiner Unterlippe gekaut hatte, stutzte nur kurz und blickte sie unverwandt an, dann widmete er sich wieder irgendwelchen Zetteln, die vor ihm lagen. Wettscheine, wie Alma unschwer aus seinem todernsten Blick, der auffälligen, bunten Tippzeitung neben ihm auf dem Tresen und dem zerkauten Stift in seiner Hand folgern konnte.
Ja, Wetten, vornehmlich Pferdewetten, waren natürlich ein ernstes, wichtiges Geschäft auf den Britischen Inseln. Aber wie kann man nur so neben sich stehen und seine Bekannten deswegen nicht mehr beachten, ja sie nicht einmal mehr erkennen, fragte sich Alma irritiert und erinnerte sich an den literarischen Publican Byrne, der nie auf Pferde setzte.
Sie nahm ihr Glas und wollte schon an den anderen Tresen zu Khaled gehen – da kam ein Mann aus der Tür zum Örtchen der Gents und blieb abrupt und wie angewurzelt stehen.
»Alma!«
Alma Pilic blickte völlig perplex von diesem zu dem anderen Mann am Tresen, der jedoch in seinem fiebrigen Wetteifer gar nichts mitzukriegen schien – die beiden glichen sich doch tatsächlich, zumindest auf den ersten Blick, wie ein Ei dem anderen.
»Khaled?«
Noch immer pendelte Almas verdutzt neugieriger Blick zwischen den Männern.
Khaled al-Haquim lächelte Alma an, auch wenn es ein wenig gezwungen wirkte.
»Was führt dich denn hierher?«, fragte al-Haquim nicht weniger verdutzt und ganz so, als interessiere es ihn nicht wirklich.
»Mich? Oh! Eine wohlverdiente Pause in der allfälligen Gelehrsamkeit und eine Stärkung zwischen nervtötenden jahresendzeitlichen Einkäufen, Besorgungen und Erledigungen«, sagte sie leichthin und nahm einen großen Schluck. »Ich dachte, ich esse kurz ein Gorgonzola-Sandwich und trinke ein Glas Burgunder dazu«, witzelte sie in Anspielung auf den Ulysses. »Aber ich Banausin bin beim Bier hängen geblieben. Und du? Bist du öfter hier an diesem fast schon historischen Ort? ›Anständiges Lokal. Kein Schwätzer, der Wirt. Gibt manchmal sogar einen aus …‹«
Sie hatte ihre Stimme Leopold-Bloom-mäßig tief und rauchig klingen lassen.
Khaled al-Haquim, dem das so gar nichts zu sagen schien, zog fragend die Augenbrauen nach oben und zögerte, bis Alma ihm zuzwinkerte und fast entschuldigend die Hand hob.
»Joyce.«
»Nein, ich bin nicht oft hier«, sagte er schließlich. »Ab und zu eben. Ja, gut, also! Dann bis heute Abend! Du kommst doch, oder?«
Al-Haquim schien schnell weitergehen, sie fast gar loswerden zu wollen. Und das fand Alma irgendwie seltsam, sagte aber nur:
»Ja, bis dann.« Sie wollte sich schon umdrehen, hielt dann aber in ihrer Bewegung inne und rief ihm nach: »Khaled? Hast du denn einen Zwillingsbruder?«
Er drehte den Kopf und Alma deutete mit dem Kinn auf den Mann am Tresen. Der wandte sich genau in diesem Augenblick um, lachte Khaled an und blickte fragend von ihm zu Alma. Doch als die beiden einfach nur stumm dastanden, fragte er noch immer lachend:
»Du kennst die Lady, Khaled? Hast sie mir ja noch gar nicht vorgestellt!«
Was für ein blöder Bauer, dachte Alma und sah den Kerl streng an.
»Normalerweise ist es andersherum!«, fuhr sie ihn schroff an.
Diesen Ton und diese Art fand sie doch ein wenig zu anmaßend. Als hätte dieser Doppelte »Lotterich« ein Recht darauf, dass Khaled al-Haquim ihm seine Bekannten vorstellte. Sicherlich ging es dabei vor allem um die weiblichen Bekanntschaften. Obwohl – wenn sie das richtig sah, trug dieser Typ auch einen Claddagh-Ring, und zwar in der Dubliner Version: zwei Hände, die zwei Herzen halten …
»Oh, ja, entschuldige.« Bei wem Khaled sich entschuldigte, blieb unklar. Nervös fuhr er sich durchs Haar. »Alma, das … das ist … Finn, Finn Flaherty«, stotterte er und fügte hinzu, allerdings kaum hörbar, »ein … ein guter Freund, ein alter Freund. Finn, das ist Alma vom Trinity, sie arbeitet auch bei Kenneth Railey.«
»Ts, ts. Railey. Der alte Kenneth Railey. Sieh mal einer an! Wie klein die Welt doch ist«, stichelte der andere. »Aber wen wundert das schon, hier auf der kleinen Insel Irland und der kleinen Hauptstadt Dublin?«
Alma wurde das alles langsam zu dumm. Sie hatte keine Lust, auf das oberflächliche Gewäsch von diesem Finn einzugehen, das sonst nicht gerade Khaled al-Haquims Niveau zu entsprechen schien.
Sie wusste nicht, warum, aber sie wollte nur noch weg von hier. Und zwar schnell.
»Gut, also, wie gesagt, ich muss los. Bis heute Abend dann, Khaled.«
Kenneth Railey war schlecht zu Fuß. Er hatte nie darüber gesprochen und klagte auch nie, aber wie bei den meisten hinkenden Männern in Irland vermutete Alma Pilic auch bei ihrem »Pflege«-Doktorvater, dass ein Pferd für seine orthopädische Hinfälligkeit zur Verantwortung zu ziehen war. Mit seinem unauffälligen Aussehen, gepaart mit seinem natürlichen Alter, wirkte er viel eher wie ein bescheidener Emeritus, der honoris et vetustas causa die Weihnachtsansprache im Trinity College halten durfte, als wie die Koryphäe, die er auf dem Gebiet der keltischen Grabkunst war. Aber das Feuer in seiner Stimme und seine blitzenden Augen verrieten einen wachen Geist und ein weises Gemüt.
»Mögt ihr warme Worte an einem kalten Abend haben, Vollmond in einer dunklen Nacht und eine sanfte Straße auf dem Weg nach Hause. Und mögt ihr längst im Himmel sein, wenn der Teufel merkt, dass ihr fort seid!«, schloss er seine Rede.
Das Auditorium dankte dem Professor mit frenetischem Beifall, Getrampel und schließlich stehenden Ovationen, sodass er sich bemüßigt fühlte noch ein Zitat von Seamus Heaney hinzuzusetzen:
»›Dangerous pavements. / But I face the ice this year / With the stick of my father.‹ Und mit einem Pint oder zwei, drei, vier rutscht es sich gleich viel besser. Fröhliche Weihnachten!«
»Ist das wirklich der Stock Ihres Vaters?«, fragte Alma, während sie zusammen das kurze Stück vom Trinity zum Shelbourne Hotel gingen.
»Aber natürlich! Warum denn nicht?«
»Vor zwei Jahren hatten Sie diesen Stock noch nicht«, bemerkte Alma.
»Sie sind sehr aufmerksam, Miss Pilic, und sehr scharfsinnig – was überflüssig ist zu bemerken, schließlich sind Sie nicht umsonst Stipendiatin der Republik Irland und meine Lieblingsgastdoktorandin«, sagte Railey und unterdrückte einen aufkommenden Lacher mit trockenem Hüsteln. »Da ich ja nun persönlich für Ihr wissenschaftliches Fortkommen verantwortlich bin, denke ich, dass Sie ein Recht darauf haben, über den Umstand in Kenntnis gesetzt zu werden, dass mein Vater vor zwei Jahren noch lebte und auf seinen Stock angewiesen war – wenn er nicht auf einem Pferd saß, das ihm denselben mehr als hinreichend ersetzte.«
Railey fuchtelte demonstrativ mit dem Gehstock, einem kunstvoll gearbeiteten Exemplar aus Steineiche mit silberbeschlagenem Knauf.
»Ich habe oft darüber nachgedacht und Versuche darüber angestellt – mit meinem Vater, am lebendem Objekt sozusagen –, inwieweit sich Pferde auch als Transportmittel und Mobilitätshilfen für extrem Gehbehinderte eignen, übrigens auch im Falle starker Intoxikation auf dem Barhocker. ›Trabstühle‹ sozusagen, die mitdenken und – ganz im Gegensatz zu Rollstühlen – selbst den Weg nach Hause finden, vorausgesetzt, der Pub ist nicht zu weit entfernt. Das Problem war nur die Höhe der Tiere, selbst Ponys erwiesen sich als unbrauchbar. Außerdem betrachtete mein Vater einen Transport im Schritt oder Trab eher als Tran-Sport – er hatte immer schon dem Galopp den Vorzug gegeben.«
Bei den Iren konnte man sich nie sicher sein, was nun ernst gemeint war und was nicht, allerdings waren die Grenzen fließend. Und eine Railey’sche Versuchsreihe mit »Trabstühlen« konnte durchaus nicht ungeprüft ins Reich der Märchen verwiesen werden.
Alma fühlte sich jedenfalls miserabel ob ihrer unangemessenen Neugier.
»Es … es tut mir leid, dass Ihr Vater gestorben ist«, sagte sie betreten.
»Keine Ursache! Es ist schließlich nicht Ihre Schuld. Außerdem hatte er einen wunderschönen Tod, zusammen mit seiner besten Freundin …«
Grundgütiger, dachte Alma und versuchte, sich das Alter von Railey senior vorzustellen.
»… Wonder Jump – seine eigene Züchtung«, schloss Railey junior zufrieden.
»Sie wollen doch nicht sagen …?«
»Oh, er hatte Glück – beide hatten großes, nahezu unermessliches Glück. Die Steinmauer hinter der Hecke hat den Sturz abgefangen, Gott sei Dank, sonst wären die beiden zusammen doch glattweg in die Unendlichkeit geflogen.« Der schwarzseidene irische Humor gab dem Überleben keine Chance.
Mit diesem Gedanken und flankiert von den Statuen zweier nubischer Prinzessinnen betrat Alma Pilic würdevollen, langsamen Schritts neben dem hinkenden Kenneth Railey die ehrwürdige Halle des historischen Hotels, in dem 1922 die Verfassung des irischen Freistaats ausgearbeitet worden war. Es stand auf dem Grund des Kerry House, eines ehemaligen Kerkers von Dublin, in dem zuvor die irischen Freiheitskämpfer festgehalten und gefoltert worden waren.
Als Alma am hufeisenförmigen Tresen der Horseshoe Bar Ausschau nach den Angehörigen des Lehrstuhls hielt, die zügig vorausgegangen waren und bereits einen Aperitif nahmen, begegnete ihr Blick dem seinen.
John Kavanagh.
O nein, dachte sie.
An seinem beharrlichen Starren sah sie, dass er sie schon am Eingang gesehen haben musste. Er erhob sich und ging auf Alma und Railey zu. Wortlos nahm er Almas Hand und küsste ihren Handrücken.
Alma war verlegen, sie sagte schnell zu Railey:
»Ich komme gleich.«
Kenneth Railey lächelte milde; schließlich war ihm John Kavanagh als Kustos der Old Library seines Colleges kein Unbekannter. Der Professor hatte inzwischen seine Schäfchen erspäht und sagte mit kaum hörbarem Amüsement in seiner weichen Stimme:
»Lassen Sie sich nur Zeit, Miss Pilic.«
»Hello, Al«, sagte John Kavanagh leise, nachdem er dem Professor zugenickt hatte.
Alma erwiderte seinen Gruß relativ kühl:
»Guten Abend, Johnny.«
»Ich habe dich schon beim Festakt gesehen.«
»Tatsächlich?«
»Ja. Du siehst großartig aus, einfach fantastisch. Du wirst immer schöner.«
»Ich wusste gar nicht, dass das noch möglich ist«, versetzte sie schnippisch.
John Kavanagh wollte ihr das lange schwarze Samtcape abnehmen, das sie über einem engen schwarzen Kleid trug, es klappte oberhalb des Knies auf und gab den Blick frei auf ein langes, schlankes Bein zwischen goldenem Seidenfutter.
»Nein, danke!« Alma hielt ihr Cape fest. »Ich muss zu den anderen.«
Seufzend heftete John Kavanagh einen skeptischen Blick auf die Gruppe, die Kenneth Railey erfreut in ihrer Mitte aufgenommen hatte.
»Ich weiß, dass ich eine nicht zu unterschätzende Konkurrenz habe – trotzdem möchte ich dich fragen, ob du mir wohl die Freude machen und mich morgen zum Abendessen begleiten würdest«, näselte er in gespielt-geschraubtem Oxford-Englisch und verbeugte sich leicht vor Alma. »Schön, dass du wieder hier bist und die Dubliner mit deinem Glanz erfreust. Die Stadt war trist und kalt ohne dich.«
»Lass den Quatsch!«, erwiderte Alma gereizt. »Ich habe keine Zeit. Ich fahre am Sonntag weg«, sagte sie kurz angebunden.
Als sie sah, dass die Kollegen von einem Kellner in den Speisesaal gebeten wurden, wollte sie schnell hinterhereilen, aber Kavanagh spielte den vollendeten Gentleman und bot ihr den Arm an.
»Darf ich dich … geleiten? Mach mir wenigstens diese Freude. Bitte.«
Das Dinner, zu dem der ehrenwerte Professor sich selbst, seine Helfer, Vertrauten und Anvertrauten jedes Jahr zu Weihnachten einlud, verlief wie immer in heiterer und lockerer Stimmung. Besonders Railey war bester Laune; er gab eine Anekdote nach der anderen aus seinem langen, bewegten und, wie er sagte, alles in allem erfüllten Leben zum Besten und unterhielt die ganze Gesellschaft mit Witz, Esprit und großem eigenem Spaß.
Wie ein wahrhaftiger König thronte er am Kopf der Tafel, zu seiner Rechten Alma Pilic, seine elegante Doktorandin aus dem Ausland, die er schon seit ihrem letzten Aufenthalt am Trinity kannte und mochte. Links von Railey saß Khaled al-Haquim, sein omanischer Gast.
Das sah John Kavanagh gar nicht gern – zum einen dass Railey diesen, wie er fand, windigen Wüstensohn wie einen Staatsgast behandelte. Immer wieder, vor allem in der kälteren Jahreszeit – wenn es in der Wüste doch sicherlich angenehmer sein dürfte, wie Kavanagh meinte – tauchte dieser Khaled auf, der sich seit weiß Gott wie vielen Jahren über weiß Gott welches Thema zu habilitieren versuchte. Seine Besuche in der Library waren jedoch äußerst rar gesät, dafür nahm er Railey umso mehr in Anspruch, und dieser schien sich nicht ungern von ihm beanspruchen zu lassen. Wie Kavanagh inzwischen wusste, war auch Khaled ein passionierter Liebhaber vierbeiniger Vollblute, aber weiß der Geier, worüber die beiden sonst immer quatschten …
Und zum anderen missfiel John Kavanagh natürlich, dass dieser al-Haquim so nah bei Alma saß. Ihm hatte es fast den Atem verschlagen, so schön war sie. Geschminkt hatte er sie noch nie gesehen. Überhaupt hatte sie sich sehr verändert – sie war so … damenhaft geworden, jedenfalls nach außen hin. Er erinnerte sich an das Mädchen, die Studentin, die vor zwei Jahren jeden Tag um die Mittagszeit mit einer alten, abgewetzten Aktenmappe ins Trinity College gekommen war, um das Book of Kells und andere illuminierte Evangeliare zu studieren, die Kavanagh als Kustos betreute und pflegte. Damals hatte Alma abgetretene Turnschuhe, ausgewaschene Jeans und eher unförmige T-Shirts unter ausgeleierten Pullovern getragen. Und über allem hatte ihr blondes, krauses Engelshaar gewallt wie flüssiges Gold. Damit hatte sie ihn eine Nacht lang bedeckt …
Als sein Handy klingelte, riss er sich von Almas Anblick los und ging in die Bar zurück. Zum Festmenü, bestehend aus geeister Steinbuttpastete an einem Salat aus Rogen und Algen, angemacht mit Heringsmilch, gefolgt von Gemüsesuppe mit Whiskey und dem obligatorischen Truthahn, alles getoppt von einem Weißkäsesoufflé, war er sowieso nicht eingeladen.
Alma Pilic wurde von der glockenhellen Klingel an der Wohnungstür geweckt. Sie schreckte irritiert auf, erstaunt darüber, dass sie einfach so eingeschlafen war – was andererseits auch wieder kein Wunder war in der molligen Wärme des Torffeuers im Kamin und im Dämmerlicht, das in ihre Atelierwohnung im Baggot Court gekrochen war, nachdem sie geputzt, gepackt, gebadet und sich einen doppelten Black Bush, einen Blend aus Malz und Korn, genehmigt hatte.
Sie knipste die Stehlampe an und ging zur Tür. Noch zu benommen, um sich zu fragen, wer das wohl sein mochte, stand auch schon ein üppiger Strauß hellroter Rosen mit Horsetoothtweed-behosten Beinen und handgenähten braunen Habbots vor ihr.
»Wer …?«
Der Strauß bewegte sich in ihre Hand, wobei kräftige, weiche Hände die ihren umschlossen, und gab den Blick frei auf sandfarbenes Haar, eine irische Nase und wasserblaue Augen, die in dem nur spärlich beleuchteten Hausflur atlantisch leuchteten. Der Hals kroch aus einem burgunderroten Paisley-Schal, die ganze Gestalt war verborgen in einem taillierten Mantel aus tiefblauem Kaschmir.
Es dauerte ein ganzes Weilchen, bis die optischen Signale durch die neuronalen Sperren in Almas Kopf gelassen wurden, die allem Unerwarteten und allem, was nicht ins Bild passte, noch immer energisch Widerstand bei der Verarbeitung leisteten.
Doch dann fiel das Codewort:
»Hi, Al.«
Al wie Alma.
»Alma. A-l-m-a! Nicht Älma! Alma, A-L-…«, hatte sie ihm damals eingetrichtert. – »Ist ja gut, Al! Al.« Er hatte es immerhin in einer Nacht gelernt …
Das Puzzle hatte sich zusammengefügt.
»John?!«
Die Affrikate entfuhr Almas Mund wie ein gedämpfter Schuss, der Rest hauchte fragend und ungläubig aus, denn sie konnte sich absolut keinen Reim darauf machen, wie John Kavanagh, das Puzzle, ihre Adresse herausgefunden hatte.
»Meine Güte, John!«
»Ich dachte, eine kleine Aufmerksamkeit würde dich versöhnlich stimmen. Schließlich werden wir uns, zumindest am College, ja öfter begegnen, nachdem du wieder hier bist.«
»Woher hast du meine Adresse?«
Die Frage klang wie ein scharfer Vorwurf. Verwettert und gereizt.
»Nun … ›Die einen stehn im Dunkeln, und die andern stehn im Licht. Und man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht‹«, bemerkte Kavanagh mit einem Hilfe suchenden Blick auf die Treppenhausbeleuchtung, die inzwischen ausgegangen war. »Du stehst im Licht, my dear.«
Alma bemerkte es nicht oder es scherte sie ganz einfach nicht. Noch immer stand sie in angewurzelter Verdrossenheit in der Tür.
»Ich will damit sagen, man kennt dich. Und man weiß auch, wo du wohnst«, schob Kavanagh nach.
»Wer ist ›man‹?«
Almas graue Augen zogen sich zu zwei gefährlichen Schlitzen zusammen, aus denen jederzeit – und so wie die Dinge standen: gleich – das Trommelfeuer eröffnet werden konnte.
»Nun, Raileys Leute, Kommilitonen …«
»Du hast sie nach mir gefragt?« Die erste Salve.
»Ja.« Kurz und schmerzlos.
Er räusperte sich. Und schluckte. Währenddessen ging er im Geiste über die Schwelle vom kalten, dunklen Flur in die warme, helle Wohnung.
»Bittest du mich herein, meine Liebe? Oder komme ich ungelegen?«





























