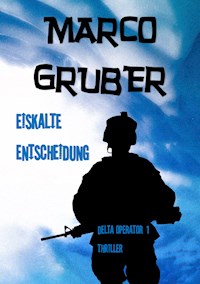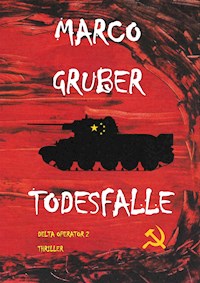
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Delta Operator
- Sprache: Deutsch
Drei Menschen in einer Verschmelzung von zwei Welten, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten.Wird es ihnen gelingen, den Wirren eines globalen Konflikts zu trotzen und ihr Schicksal selbst zu entscheiden?Oder wird die brutale Gewalt der Aggression aus dem Osten sie zerschmettern und sämtliche Träume unter rauchenden Trümmern vergraben?Mut, Liebe und unbändiger Überlebenswille treibt sie an, gemeinsam dem übermächtigen Feind zu trotzen.Stefan Bergers neuer Feind ist anders, er ist neu, er ist stark und er hat nur eines im Sinn: Alles und jeden vernichten, der sich ihm in den Weg stellen will. Und genau das hat Berger vor. Denn nur so kann er sich selbst und die Menschen, die er liebt, beschützen. Inhaltsangabe:Stefan Berger befreit mit Hilfe eines ehemaligen Navy-Seals und eines pensionierten Chiefs die entführte Marineoffizierin (und Bergers Vertraute) Nina Williams aus einem geheimen chinesischen Stützpunkt. Bei der anschließenden Flucht als blinde Passagiere auf einem chinesischen Zerstörer werden sie bei den Senkaku-Inseln durch ein unbekanntes Naturphänomen in eine Parallelwelt ins Jahr 1934 versetzt.Dort schmieden der chinesische Kaiser Zhang Akuma, sein sowjetischer Studienkollege Wanja Nikitin und der japanische Tenno ein unheilsames Bündnis. Gemeinsam wollen sie in einem brutalen Expansionskrieg die westliche Welt unterwerfen. Eine beispiellose Attentatsserie, deren Opfer die wichtigsten europäischen Staatsoberhäupter sind, erschüttert zur Sommersonnenwende den alten Kontinent.Stefan Berger, der in der Parallelwelt in den Händen der österreichischen Marine gelandet ist, und die Offizierin Anna Maria Hohenstein überleben den Anschlag eines Assassinen auf den Reichskanzler der jungen Republik Österreich dabei nur knapp.Nina Williams erlebt zur selben Zeit auf Island den brutalen Überfall der Sowjets hautnah mit. Auf der besetzten Insel kämpft sie verzweifelt um ihr Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marco Gruber
Todesfalle
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Epilog
Impressum neobooks
Vorwort
Marco Gruber
Todesfalle
Delta Operator 2
© Marco Gruber 2019
Umschlaggestaltung:
© Petra Maria Roilo 2019
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Im dritten Regierungsjahr des Ming-Kaisers Zhu Di verließ eine riesige Flotte die Mündung des Jangtse und nahm Kurs ins Südchinesische Meer hinaus. Über dreihundert Schiffe standen unter dem Kommando von Zhang He, darunter an die sechzig neunmastige Schatzschiffe, jedes 135 Meter lang und über 50 Meter breit. Eskortiert wurden diese Schatzschiffe, die Geschenke für ausländische Herrscher in ihren riesigen, mehrstöckigen Ladekammern mitführten, von über zweihundertfünfzig Begleitschiffen. Darunter achtmastige Pferdeschiffe, schwere Kriegsschiffe zum Schutz der wertvollen Ladung und schnelle Kriegsboote, die die Flotte vor Piraten schützen sollten. Knapp dreißigtausend Mann an Besatzungen und Kampftruppen segelten im Spätsommer des Jahres 1405 nach Süden. Ihr Auftrag: Die Thronbesteigung des Kaisers Zhu Di zu verkünden und den immensen Reichtum, sowie die alles beherrschende Macht des Kaisers zu demonstrieren. Die Flotte legte tausende Seemeilen zurück, besuchte dabei Länder wie Vietnam, Java, Malakka und Sumatra. Schließlich wurde sogar Indien erreicht, bevor die Schiffe vollbeladen mit exotischen Kostbarkeiten und Gesandten aller besuchten Reiche wieder die Heimreise antraten. Nachdem die Kampfschiffe auf der Rückfahrt durch die Straße von Malacca eine furchterregende Piratenflotte mit über fünftausend Freibeutern vernichtet hatten, erreichte man schließlich im Jahr 1407 wieder die heimatlichen Gewässer an der Mündung des Jangtse. Die Botschafter und Gesandten aus den besuchten Ländereien huldigten dem Kaiser und baten um Aufnahme in das höchst profitable und fortschrittliche Tributhandelssystem des Reichs der Mitte.
Es folgten dieser ersten Expedition noch fünf weitere Seereisen, die die Schiffe des Reiches unter anderem nach Siam, Quilon und Calicut, sowie Cochin und Ceylon führten. Es wurde gekämpft und unterworfen und dabei das Reich stetig vergrößert. Das Vasallentum unter dem unantastbaren Herrscher Zhu Di galt zudem als Erhöhung und nicht als Unterjochung. Der persische Golf wurde erreicht und Handel mit den dort so berühmten Edelsteinen und Korallen betrieben. Aden am Eingang des Roten Meeres wurde erkundet sowie die ostafrikanische Küste besucht. Dort lud man außergewöhnliche und bis dato unbekannte Tributfracht an Bord. Löwen, Zebras und Nashörner verfrachtete man unter Deck und sogar Giraffen, welche als Kostbarkeit sondergleichen galten. Bis 1421 hatte der Kaiser ein riesiges Reich geschaffen, das von Japan und Korea über Südostasien bis hin nach Südindien, den Persischen Golf und Ostafrika reichte. Dieses riesige Handelsreich erstreckte sich über das Ostchinesische und Japanische Meer im Norden, den gesamten Indischen Ozean und das Südchinesische Meer. Wollte man an diesem lukrativen Handelssystem teilnehmen, so musste man die Oberherrschaft des Universalherrschers anerkennen. Das chinesische Kaiserreich war auf dem Höhepunkt seiner Macht angekommen, das riesige Konglomerat aus unterschiedlichen Völkern und Ländern gedieh in Frieden und Wohlstand. Es war nur mehr eine Frage der Zeit, bis die fortschrittlichen Hochseeschiffe der chinesischen Flotte das Kap der Guten Hoffnung umfahren, entlang der westafrikanischen Küste nordwärts segeln und schließlich in den europäischen Häfen anlegen würden. Doch dazu kam es nie.
Im Jahre 1421 vernichtete ein Blitzschlag die neu erbaute Palastanlage in der nach Peking verlegten Hauptstadt. Der Kaiser fragte sich, warum ihm der Himmel so zürnte, und verstarb schließlich ahnungslos über die Gründe des Brandes kaum drei Jahre später. Sein Nachfolger, der allerdings nach nur sehr kurzer Amtszeit ebenfalls das Zeitliche segnete, stoppte den Bau der Hochseeschiffe, da er die Schifffahrt im Allgemeinen und die teuren Expeditionen im Besonderen als Grund allen Übels ansah, welches das Reich seit dem Brand des Kaiserpalastes heimsuchte. Es wurden keine Hochseeschiffe mehr gebaut, die Pläne wurden verbrannt und die letzten Schiffsbaumeister starben, ohne ihr immenses Wissen zu vererben. Ein konfuzianischer Beamter vernichtete das Archiv, in dem die letzten Aufzeichnungen über den Bau der riesigen Schiffe aufbewahrt wurden. Sogar die private Hochseeschifffahrt wurde untersagt und jeder, der sich nicht daran hielt, wurde verhaftet. Alle seetauglichen Schiffe wurden zerstört und neue durften nicht mehr gebaut werden. Im Jahr 1525 war von der Pracht und Herrlichkeit der chinesischen Flotte nichts mehr übrig. Die Gründe für diese radikale Änderung der Außenpolitik sind umfangreich und dabei doch kaum nachvollziehbar. Ein Grund mag die finanzielle Verschuldung des Reiches gewesen sein, verursacht durch die kostspieligen Seeexpeditionen, den Bau des riesigen Kaiserpalastes in der neuen Hauptstadt sowie den verlustreichen Krieg in Annam. Im Norden des Reiches machten sich überdies die Mongolen daran, die Grenzen erneut zu bedrohen. Dadurch zeigte sich, dass der Schutz der Nordgrenzen wieder vorrangig betrachtet werden musste.
Die neuen Kaiser glaubten aber auch, dass sich das agrarische China wieder zurück zu seinen Wurzeln entwickeln sollte. Man wollte wieder weg von den „Verirrungen“ der Expeditionsseefahrt mit allen Versuchungen und Reizen, die die Sitten und die Macht der Mandarine untergruben. Statt neuer Schiffe wurde nun die chinesische Mauer gebaut, man schottete sich von der Welt ab. Gerade zu jener Zeit, als Europa sich daran machte, die Weltmeere zu erobern, beschränkte sich das ehemalige Seeweltreich China darauf, mit kleinen flachen Koggen den Gelben Fluss zu befahren. Die Weltgeschichte nahm von nun an einen anderen Lauf, die Schwerpunkte der Macht verlagerten sich in den Westen. Der technische und soziale Vorsprung, den das Reich der Mitte gegenüber den Europäern stets besessen hatte, war dahin. 1492 entdeckte ein gewisser Christoph Kolumbus Amerika, sechs Jahre später war es Vasco da Gama, der das Kap der Guten Hoffnung nun in östlicher Richtung umschiffte und schließlich in Calicut landete. Jenes Calicut, das die chinesische Flotte schon fast hundert Jahre früher erkundete. Die Portugiesen stießen nach Malacca und Macao vor, es folgten die Holländer, Engländer und Spanier.
China hatte der fortschreitenden Kolonialisierung in seinem innersten Machtbereich nichts entgegenzusetzen und versteckte sich stattdessen innerhalb seiner Mauern. Das ehemals größte Seereich der Welt gab es längst nicht mehr. Dann, im 19. Jahrhundert, war es schließlich China selbst, das von den europäischen Kolonialisten angegriffen und unterjocht wurde, unfähig, sich zu verteidigen oder den Eindringlingen auch nur Widerstand zu leisten. Und all dies, weil ein Blitz im Mai 1421 in den neuen Kaiserpalast eingeschlagen hatte. Wie hätte sich der Lauf der Geschichte wohl verändert, wenn es dieses Gewitter damals nicht gegeben hätte…
Prolog
USS Stockdale DDG-106
Ostchinesisches Meer
18. Mai 2017
Der stromlinienförmige Rumpf des Zerstörers glitt seidig durch die leichte Dünung des Ostchinesischen Meeres. Silbern leuchteten Gischt und das brodelnde Fahrwasser im fahlen Mondlicht. Mit annähernd zwanzig Knoten machte die USS Stockdale zügig Fahrt und näherte sich durch vereinzelte Nebelschwaden, die wie weiche Wattebauschen auf dem Meer dahintrieben, den Senkaku-Inseln. Der Kurs führte das Schiff in nordöstlicher Richtung auf die umstrittene Inselgruppe zu, die sich momentan im Zentrum einer zunehmend angespannten Krisensituation wiederfand. Siebzehn Meter oberhalb des Wasserspiegels, auf der Brücke des neuntausendzweihunderttonnen schweren Zerstörers der Arleigh-Burke-Klasse, herrschte ebenso angespannte Ruhe, wie in der Gefechtszentrale im Rumpf des schweren Schiffes. Lieutenant Commander Nina Maria Williams sah durch die gepanzerten Scheiben der Brücke hinaus in die nebelige Dunkelheit und vernahm die Angaben des Sonaroperators. Die Tiefe unter dem Kiel der Stockdale verringerte sich mit jeder Meile, die sie sich dem Festlandsockel näherten. Sie hatten die über zweieinhalbtausend Meter tiefe Okinawarinne nun hinter sich gelassen und näherten sich den Untiefen des rohstoffreichen Gebiets, um das sich seit einem knappen halben Jahr China erneut vehement bemühte.
„Keine Kontakte, XO“, meldete der junge Nachrichtenoffizier, nachdem er sich an den Bildschirmen des Aegis-Systems nach möglichen Bedrohungen über, auf und unter dem Wasser umgesehen hatte. Er sah ihr bestätigendes Nicken und widmete sich wieder seinen Bildschirmen, während Nina als diensthabender Kommandant und Erster Offizier im Sessel des Captains Platz nahm. Sie hatte aus ihrer leicht erhöhten Position die gesamte Brücke im Auge. Verschiedene taktische Displays auf in ihrer unmittelbaren Nähe montierten Flachbildschirmen ermöglichten ihr einen Überblick über die wichtigsten Systeme des Schiffes. Hier konnte sie in wenigen Augenblicken verschiedene Parameter über Kurs, Position und Geschwindigkeit, elektronische Aufklärung mittels Radar und Sonar, Status der Waffen und der beiden Hubschrauber an Bord, sowie über eventuelle Schäden im Falle eines Gefechts erfassen. Williams trug die camouflagefarbene Einsatzuniform der US Navy mit schwarzen, schweren Stiefeln und der typischen dunkelblauen Baseballcap mit den goldenen Lettern: DDG-106 USS Stockdale. Ihr langes, brünettes Haar hatte sie zu einem dicken Zopf geflochten, da sie den sonst so gern gesehenen Dutt bei weiblichen Offizieren und Mannschaftsgraden abgrundtief hasste.
Sie beugte sich nach vorne, betrachtete die unauffällig leeren Bereiche auf den Bildschirmen und wandte sich an den Nachrichtenoffizier.
„Lieutenant Hood“, begann sie und hatte sofort die ungeteilte Aufmerksamkeit des schlaksigen Mannes aus Alaska, „es ist mir entschieden zu wenig Verkehr da draußen.“ Ein Blick aus dem Fenster der Brücke bestätigte die leeren Sensorpaneele auf den Bildschirmen.
„Ma’am?“, war die leicht verwirrte Antwort des jüngeren Offiziers. Ninas Blick hatte etwas Nachdenkliches an sich, sie sah nach wie vor aus dem Fenster.
„Weisung an Elektronische Aufklärung, Radar und Sonar: Ich will jede noch so kleine Nussschale hier auf meinem Bildschirm haben. Irgendwas muss da draußen sein.“ Nun sah sie Hood direkt in die Augen.
„Machen Sie mal ein bisschen Wirbel. Ich möchte, dass jeder weiß, dass wir hier sind.“ Nun, da er verstand, was der Erste Offizier meinte, grinste Hood.
„Aye, Ma’am.“ Nachdem Hood seine Befehle weitergegeben hatte, sandten die leistungsstarken aktiven Sensoren der Stockdale ihre Signale in die warme Nacht hinaus.
„So, jetzt bin ich mal gespannt, wer alles aus dem Busch hüpft, nachdem wir so sachte drauf geklopft haben“, murmelte Ltd. Cmdr. Williams und rief sich die Befehle wieder in Erinnerung, die sie und der Kapitän des Kreuzers vor dem Auslaufen im Hauptquartier der 7. Flotte in Okinawa erhalten hatten.
„Die verdammten Chinesen marschieren da unten mit Eiern so dick wie Basketbällen herum und scheuchen alles auf, was in ihre Nähe kommt“, hatte der Admiral schlecht gelaunt von sich gegeben. Dabei hatte er genüsslich seinen Tabak gekaut und abschließend nach Redneck-Art ein großen, schleimigen Klumpen in den Papiereimer gespuckt. Der Admiral gehörte einer aussterbenden Gattung unter den Flaggoffizieren an, hatte er doch den kalten Krieg noch auf einem Boomer, einem der großen strategischen Atom-Unterseeboote der Navy, miterlebt. Wochenlange Schleichfahrten im kalten Nordatlantik, pausenlos gesucht von schnellen Akulas und unter permanenter Anspannung stehend, da entwickelten sich solch schillernde Persönlichkeiten, von denen es mittlerweile nur mehr sehr wenige gab.
„Ich möchte, dass Sie mit der Stockdale da runter dampfen und ein bisschen Wind machen“, hatte er den beiden Offizieren erklärt, die in ihrer weißen Tropenuniform vor dem breiten, zerkratzten Schreibtisch des Zweisterne-Admirals Aufstellung genommen hatten.
„Fahren Sie da unten kreuz und quer durch die Gegend und lassen Sie jeden wissen, dass die US Navy da ist, und dass ihr das Säbelrasseln der Chinesen scheißegal ist. Wir werden nicht zulassen, dass diese Schlitzaugen sich in internationalen Gewässern breitmachen! Diese Inseln, diese trostlosen Felsbrocken am Arsch der Welt, gehören ihnen nun mal nicht und daran sollen Sie sie mit der Stockdale erinnern“, schloss er und übergab das Kuvert mit den detaillierten Befehlen. Viel mehr hatte der mürrische alte Seebär nicht zu erklären gehabt und die beiden Offiziere waren schließlich an Bord ihres Schiffes zurückgekehrt.
„Holen Sie den Captain“, befahl Nina ruhig und schlürfte an einer Tasse heißen, starken Kaffees, die ihr ein Petty Officer gebracht hatte.
„Ich denke, das wird ihn interessieren“, sagte sie zu Lieutenant Hood, der erste Anzeichen auf den Schirmen erkannte, dass sich Steuerbord voraus etwas rührte.
„Ma’am, sieht so aus, als ob wir bemerkt worden sind“, berichtete er, dann ging plötzlich alles ganz schnell.
„Aktives Sonar, Ma’am!“, vernahm Nina einen fast ungläubig übermittelten Befehl aus der Gefechtszentrale. Nina stand sofort auf und ging raschen Schrittes hinüber zum zuständigen Operator, der das bordeigene Sonarsystem überwachte.
„Wir werden angepingt, Ma’am“, meldete er mit angespannter Stimme, dann schrie er plötzlich laut auf und riss sich die Kopfhörer herunter, aus denen kreischender Lärm drang. Nina erschrak und fühlte, wie ihr Herz immer schneller schlug. Während der Operator sich immer noch seine schmerzenden Ohren zuhielt, sah sie sich rasch auf der Brücke um. Alle Bildschirme flackerten in rauschendem Schwarz-Weiß und zeigten nichts als dichtes Schneetreiben. Der zentrale große Schirm, der alle wichtigen Daten zur schnellen Information bereithielt, verzerrte sich und zeigte ein Stakkato aus weißen, grauen und schwarzen Pixeln.
„Was in aller Welt…“, murmelte Nina und schaute aus dem Panzerglas der Brücke in die warme Tropennacht. Sie entdeckte die Rauchspur der Rakete, die sich aus nördlicher Richtung direkt auf sie zu bewegte, und ihr Herz schien stillzustehen.
„Vampire, Vampire!!“, rief sie so laut sie konnte und zeigte zum Bug des stolzen, neuen Schiffes, auf die dünne, weiße Rauchspur, die sich dem Schiff unerbittlich näherte. Dann schnappte sie sich den Hörer des bordinternen Kommunikationssystems und brüllte hinein.
„Achtung, Achtung! Alles auf Gefechtsstation! Das ist keine Übung! Ich wiederhole: Alles auf Gefechtsstation, dies ist keine Übung, wir werden beschossen!“ Mit der Faust hämmerte sie auf den Auslöser des Alarms. Sofort ertönte lautes Sirenengeheul und überall an Bord begannen die orangen Drehlampen zu rotieren.
„Steuermann, Ausweichmanöver!“, brüllte sie, während sie wieder auf ihrem Sessel Platz nahm und sich anschnallte.
„Gefechtsstation, Gegenmaßnahmen ergreifen!“, befahl sie äußerlich nun völlig ruhig und setzte sich den Kevlarhelm auf. Ihr Blick glitt aus dem Brückenfenster und hinüber zu den Phalanx CIWS Gatlingkanonen, die jedoch untätig blieben. Nina beschlich ein tiefes, sehr schlechtes Gefühl, als sie erst auf die RIM-162 ESSM Flugabwehrraketen in ihren ebenfalls regungslosen MK 29-Startern und dann auf das bleiche Gesicht Lieutenant Hoods blickte, der sie beinahe panisch ansah.
„Was ist los?“, knurrte Nina und wusste eigentlich bereits, wie die Antwort lautete.
„Ich habe keine Ahnung, Ma’am“, gab der junge Offizier kleinlaut zurück.
„Alle Systeme scheinen tot zu sein“, erklärte er völlig überfordert von der Situation, auf die ihn kein Lehrgang und keine Simulation vorbereitet hatten.
Das Brückenschott sprang auf und Captain Peters platzte mit verschlafenem Gesichtsausdruck herein. Das Schiff beschleunigte nun auf volle Fahrt, änderte seinen Kurs und bot der anfliegenden Rakete ein möglichst kleines Ziel, doch der Flugkörper hielt unbeirrt auf sie zu.
„Meldung XO, was geht hier vor?“, brüllte Captain Peters, dessen massiger Körper auf dem vibrierenden und sich nach backbord neigenden Deck leicht schwankte. Er griff nach einem Nachtsichtglas und trat ans breite Panzerglasfenster.
„Sir, wir werden…“, fing Nina an, als ein blendend weißer Blitz die Brücke erhellte und das Schiff einen wilden Satz zur Seite machte. Beinahe gleichzeitig rollte die Druckwelle einer gewaltigen Explosion heran und traf die Brücke mit voller Wucht. Brütende Hitze drang durchs immer noch offene Schott ins Innere der engen Kommandozentrale, während Körper wild durch die Luft gewirbelt wurden, an Wände und Konsolen krachten und schließlich irgendwo auf den Stahlplanken zu liegen kamen.
Nina wurde unter dem fast einhundertzwanzig Kilo schweren Athletenkörper Captain Philips begraben, als dieser gegen sie geschleudert wurde und sie mit sich niederriss. Unfähig, sich zu bewegen, überfiel sie schlagartig Panik, da sie durch das Gewicht auf ihren Rippen und der unerträglichen Hitze in der Zentrale kaum Luft bekam. Ihre Gedanken rasten, sie versuchte zu verstehen, was hier passiert war. Die Rakete war zum Zeitpunkt der Explosion noch fast zwei Kilometer von der Stockdale entfernt gewesen, doch irgendetwas hatte sie trotzdem getroffen. Ihr fiel die Meldung ihres Sonaroperators wieder ein, dass sie mit Aktivsonar angepeilt worden waren. Ein Torpedo? Der Alarm plärrte eindringlich, die Sirene hämmerte unwirklich in ihr malträtiertes Gehör. Nur schwach vernahm sie vereinzeltes Stöhnen der Verwundeten, jemand hustete, ein anderer weinte. Dann hörte sie das Röhren der Raketentriebwerke, und schloss die Augen in Erwartung einer weiteren Explosion.
1. Kapitel
Kaiserlicher Palast
Peking, Chinesisches Kaiserreich
18. April 1934
Er trug einen schlichten, schwarzen Anzug in traditionellem Stil, dazu glänzend polierte, edle Lederschuhe aus den nördlichen Provinzen. Sein schwarzes Haar war ölig glatt nach hinten gekämmt, ein schmuckloses rotes Taschentuch steckte in seiner rechten Brusttasche. Den leichten Regen, der aus tiefhängenden, grauen Wolken unablässig auf die braunen Ziegeldächer der Hauptstadt fiel, spürte er kaum. Sein Blick durchdrang die Nebelschleier, die wie schmutzig weiße Wattefetzen unter ihm vorbeizogen, und verlor sich in der dunklen Ferne einer mondlosen Nacht. Seine Gedanken überschlugen sich, während er versuchte, sich zu entspannen. Er zwang sich, seine verkrampft hinter dem Rücken verschränkten Hände zu lösen, und atmete tief durch. Immer wieder hatte ihm diese alte Entspannungsmethode seiner ruhmreichen Vorfahren, die ihm seine geliebte Amme bereits im zarten Alter von fünf Jahren beigebracht hatte, Erleichterung verschafft. Doch heute gelang es ihm nicht, die Last und Schwere von seinen breiten Schultern abzuschütteln.
Zhang Akuma, Prinz und Thronfolger des Chinesischen Kaiserreiches, atmete ein letztes Mal tief durch, dann drehte er sich um und verließ den offenen Balkon, einhundertfünfzig Meter oberhalb des riesigen, mit rotem Marmor gepflasterten Platzes, den sein Volk den „Platz der eintausend Toten“ nannte. Ein Name, der der tatsächlichen Anzahl der dort unten niedergemetzelten Menschen nicht mal ansatzweise entsprach. Zhang wischte sich mit dem Taschentuch aus seiner Brusttasche die Feuchtigkeit aus dem Gesicht, während er sich vor einem wandhohen Kristallspiegel prüfend betrachtete. Er war tadellos frisiert und rasiert, sein dünner Oberlippenbart zierte symmetrisch gestutzt die ebenso dünnen Lippen. Sein kantiges Kinn und die an sich eher untypischen, offenen und wachsamen Augen verliehen ihm etwas Herrschaftliches, etwas Weltmännisches – etwas Kaiserliches.
Zufrieden damit, wie er sich präsentierte, wandte er sich vom Spiegel ab und marschierte durch den leeren Korridor, vorbei an Gemälden seiner unzähligen Vorfahren. Die Sohlen seiner bequemen Schuhe klapperten auf dem rosafarbenen, polierten Granit, seine Schritte hallten durch die dämmrige Weite der riesigen Palastanlage. Zwei Soldaten nahmen in ihrer Prachtuniform Haltung an, als er sich der breiten, doppelflügeligen Tür näherte. Die Tür war mit Blattgold belegt und mit Feinarbeiten aus Türkis, Rubin und Lapislazuli verziert. Beide Soldaten senkten ihr Haupt, als er sie erreichte, und traten zur Seite. Wie von Geisterhand geführt, öffnete sich ein Flügel der beinahe fünf Meter hohen Tür. Zhang trat ein und der Zugang schloss sich lautlos hinter ihm.
„Seine kaiserliche Hoheit, Prinz Zhang Akuma!“, vermeldete ein ebenfalls in schlichtem Schwarz gekleideter Lakai, der sich unter dem knappen Dutzend Personen befand, die sich in dem riesigen Zimmer aufhielten. Zhang empfand die stickige Wärme als beengend und erdrückend. Er hätte am liebsten die großen Fenster aufgerissen und kühle, frische Nachtluft den stinkenden Muff nach draußen wehen lassen. Doch die Fenster waren fest verriegelt und hinter schwerem Brokatstoff verborgen. Es roch nach Krankheit und Verfall, als er sich zu der Gruppe Männer gesellte, die am Bett seines Vaters Wache hielten. Sofort wandte sich einer der Männer, ein sehr alter, gebeugter Greis mit knotigen Händen, krummem Rücken und einem langen weißen Bart, an ihn.
„Prinz Akuma“, nannte er ihn, so wie er dies seit seiner Geburt vor beinahe fünfunddreißig Jahren tat, „es ist gut, dass Ihr hier seid.“ Zhang nickte dem greisen Leibarzt des Kaisers zu und versuchte, sich an den Gestank zu gewöhnen, der vom Bett her drang.
„Wie geht es meinem Vater heute?“, fragte er mit ausdruckslosem Gesicht. Er spürte, wie er zu schwitzen begann, ausgelöst durch die unerträgliche Schwüle der stinkenden Luft.
„Er spricht nicht mehr, Eure Hoheit“, antwortete der alte Mann.
„Sein Körper verfällt, seine Augen sind indes noch voller Leben, voller Kraft, seht selbst…“ Der Arzt deutete auf das große Bett, das inmitten des Raumes stand, überdacht von einem Baldachin aus goldener Seide.
Zhang zwang sich dazu, die paar Schritte zurückzulegen und sich dem Bett zu nähern. Der Kaiser wirkte unpassend winzig und zerbrechlich, wie er so vor ihm lag, gebettet auf weiße Seide, mit kränklich gelber, schweißnasser Haut, die ehemals feisten Wangen eingefallen, die knochigen Hände lagen kraftlos gefaltet auf seiner Brust, die sich kaum merkbar hob und wieder senkte. Als Kaiser Zhang Kibum seinen Sohn bemerkte, gewahrte man dies am Ausdruck seiner ungewöhnlich klaren Augen. Er blickte den Prinzen an und man konnte sehen, wie sich sein von Krankheit und Alter zerfressener Körper anspannte. Prinz Akuma spürte, dass der Kaiser etwas sagen wollte, doch er brachte nur ein unterdrücktes Röcheln zustande. Akuma ignorierte den stinkenden Todeshauch, der ihm entgegenwehte, und ließ sich auf der Bettkante nieder. Er fasste die kraftlose Hand des Kaisers. Die Haut des alten Mannes fühlte sich heiß und feucht an, dann war sie plötzlich wieder kalt.
„Sagen Sie mir, weiser Mann“, begann der Prinz, wobei er sich von den klaren Augen seines Vaters nicht zu lösen vermochte, „wie lange wird er noch leiden müssen?“ Der Arzt räusperte sich und wechselte ein paar Blicke mit seinen Kollegen der kaiserlichen Ärzteschaft, die vollzählig anwesend war, um über ihren Gebieter zu wachen.
„Nun, Eure Hoheit“, krächzte er, hustete und räusperte sich erneut, „wir können dies nicht mit Sicherheit sagen. Es gab Fälle, in denen der vom Fieber befallene Kranke über ein Jahr am Leben blieb, bis er schließlich verstarb. Andererseits…“
Der Arzt stockte und streichelte seinen langen Bart.
„Ja, andererseits, fahren Sie fort, Weiser Mann“, forderte ihn der Prinz auf.
„Es gab Fälle, in denen das Fieber einfach verschwand und sich der Kranke wieder erholte. Es wird sogar von vollständigen Genesungen in der Literatur der nördlichen Provinzen berichtet.“
Der Arzt blickte unglücklich zu seinen Kollegen, dann wieder zum Bett, auf dem der Prinz immer noch die Hand des Kaisers hielt.
„Ich habe mir erlaubt, nach einem Heiler aus dem Norden zu schicken. Es wird berichtet, dass dieser heilige Mann über größte Erfahrung in der Behandlung des Fiebers verfügt. Diese Art von Erfahrung und solch unschätzbares Wissen sind jetzt vonnöten, wenn wir das Leben des Kaisers retten wollen“, erklärte er. Prinz Zhang Akuma nahm die letzten Worte des Arztes scheinbar emotionslos entgegen, obwohl etwas in seinem Innersten sich vehement aufbäumte. Er nickte und blickte direkt in die Augen seines Vaters, als er seinen Entschluss fasste.
„Lasst uns allein, Weiser Mann“, befahl er mit ruhiger Stimme.
„Ich möchte mit meinem Vater alleine sein und gemeinsam mit ihm meditieren. Vielleicht kann ich einen kleinen Teil dazu beitragen, dass sein Leben gerettet wird.“
„Wie Seine Hoheit wünschen.“ Der Arzt verbeugte sich tief, drehte sich um, und verließ mit seinen Kollegen leise tuschelnd das Zimmer. Er konnte den Blick des alten Kaisers nicht mehr sehen, als dieser die Worte seines Sohnes vernommen hatte. Die Tür schloss sich leise und sie waren allein.
Zhang Akuma, Prinz des chinesischen Kaiserreiches und alleiniger Erbfolger des großen Kaisers Zhang Kibum, hatte lange gewartet. Er hatte studiert, hatte über seine Vorfahren alles erfahren, was es zu wissen gab, hatte sich in den Künsten der Astrologie und Mathematik geübt, hatte die militärische Denkweise aller berühmten Feldherren studiert, war in der Kunst des traditionellen Kampfes unterrichtet worden und hatte im Geheimen bei einem Meister die schwarze Kampfkunst erlernt. Sein Leben war voller Studien gewesen, er hatte sich ein Wissen angeeignet, über das kaum jemand in seinem riesigen Reich verfügte – mit Sicherheit niemand in seinem Alter. Der Prinz hatte Erfahrungen gesammelt, im Westen, in London und in Berlin, wo er die Kunst der Ingenieurwissenschaften und der Literatur wie ein trockener Schwamm förmlich in sich aufgesogen hatte. Er hatte mehrere Sprachen erlernt, hatte sich seinem übermächtigen Vater untergeordnet und stets nach dessen Vorstellungen und Anweisungen gehandelt. Der Prinz war nicht immer einer Meinung mit dem Kaiser gewesen, doch hatte er sich stets loyal und folgsam gezeigt. Nicht ein einziges Mal hatte er seinem mächtigen Vater widersprochen. Er wusste, was er wollte, und er wusste, dass jetzt die Zeit dazu gekommen war. Die Gelegenheit bot sich dem Kühnen und nur der Tapfere war dazu im Stande, sie auch zu nutzen.
Prinz Zhang Akuma war tapfer und kühn, seine persönlichen Ambitionen waren gewaltig. Doch manche Tugend hatte er noch nie besessen. Er war nicht sonderlich geduldig und es fehlte ihm an Mitleid und Menschlichkeit. Deshalb nahm er nun eines der dicken Seidendaunenkissen und hob es über den Kopf seines Vaters, des Kaisers von China. Ein letztes Mal begegnete er dem erschrockenen Blick des alten Mannes, dann senkte sich das Kissen.
Akuma betrachtete das in Gold eingefasste Bild seiner Mutter, der Kaiserin, die bei seiner Geburt gestorben war, ohne dem stattlichen Kaiser weitere Söhne und Töchter geschenkt zu haben. Er betrachtete ihr weiß geschminktes Gesicht, die traditionelle Tracht mit all den Verzierungen, die sie auf der Schwarzweißaufnahme trug. Er schaute in ihre kalten Augen, in die er nie persönlich geblickt hatte. Er drückte das Kissen etwas fester, spürte den ohnehin schwachen Widerstand erlahmen und dachte daran, dass er nie die Wärme einer Mutter, ihre Fürsorge und Liebe gespürt hatte.
Immer noch presste er das Kissen fest auf das Gesicht des alten Mannes, als er an seine Amme dachte, die ihn nährte und sich um ihn kümmerte, ihn zumindest mit ein wenig Wärme und Liebe versorgte. Sein Vater, der allmächtige Kaiser, war es schließlich gewesen, der die Amme dann entfernen ließ, um ihren verweichlichenden Einfluss auf den zukünftigen Herrscher zu eliminieren. Nun, dies war ihm wirklich aufs Treffendste gelungen. Verweichlicht war der Prinz mit Sicherheit nicht. Deshalb schockierte ihn auch der Anblick seines toten Vaters nicht, als er das Kissen hob und es zur Seite legte. Beinahe zärtlich betrachtete er den alten Mann, als er seine Lider mit einem sanften Streichen der rechten Hand schloss.
„Es ist gut, Vater“, flüsterte Akuma.
„Du kannst dich auf mich verlassen.“
Der Prinz spürte Erleichterung, fast Freude in seinem kalten Inneren, er entdeckte Gefühle, die seine Seele wärmten. Zumindest vorübergehend verdrängte er all den Hass, den er dem Kaiser gegenüber empfunden hatte, vergessen würde er dieses starke Gefühl nie. Denn für seine Pläne war sein Hass ein wichtiger Antrieb, auf den er nicht verzichten konnte und auch nicht wollte. Er würde ihn bündeln und dort entfesseln, wo es seine Feinde zu vernichten galt. Denn Feinde gab es zuhauf. Und Akuma kannte sie alle.
Prinz Zhang Akuma hatte also beschlossen, die Welt in der er aufgewachsen war, nun als Kaiser selbst nach seinen persönlichen Vorstellungen zu gestalten. Und an einem mangelte es ihm nicht: An Ideen und an der Fähigkeit, diese auch umzusetzen. So erhob er sich also vom Bett des toten Kaisers, straffte sich, bettete das Kissen so, wie er es vorgefunden hatte und wandte sich ab. Mit zielstrebigen Schritten näherte er sich der Tür, um dieses Zimmer mit seinem Gestank und den schlechten Erinnerungen zu verlassen. Kaiser Zhang Akuma sollte nie hierher zurückkehren.
Kaiserliches Hospital
Peking, Chinesisches Kaiserreich
19. April 1934
Der alte Mann atmete schwer, als er die lange dunkle Treppe erklommen hatte und oben, im sonnendurchfluteten Solar der mittelalterlichen Burg angekommen war, die das Kaiserliche Hospital beherbergte. Mönche in gelben und orangen Roben, die ihm begegneten, wunderten sich über die ungewöhnliche Hast, die der Leibarzt des Kaisers an den Tag legte – eine Hast, das wussten die weisen Mönche, die einem Dreiundachtzigjährigen nicht unbedingt guttat.
Doch der Weise Mann hatte es eilig. Das, was er herausgefunden hatte, konnte keinen Moment länger im Verborgenen bleiben. Der Rat musste informiert werden und dann würden sie gemeinsam entscheiden, was zu unternehmen sei. Bei allen Göttern, dachte der alte Arzt verzweifelt, er hatte ihn ermordet, einfach ermordet. Den Kaiser ermordet. Gute Götter, Prinz Akuma war ein hinterträchtiger Schlächter, sogar ein feiger Sippenmörder! Das durfte nicht ungesühnt und ohne Folgen bleiben. Schnaufend und nach Luft japsend öffnete er die schwere Holztür, die mit massiven Eisenbändern beschlagen war. Sie schwang langsam auf und warmes Licht aus dem Solar fiel auf die kalten Steinstufen.
Er betrat das Allerheiligste des Rates der Weisen und Heiler und strebte auf das Zentrum zu. Dort würde er seine Kollegen und Freunde finden und ihnen die Neuigkeiten berichten. Er würde ihnen von seiner Untersuchung der Leiche berichten, die er entgegen der ausdrücklichen Anordnung Prinz Akumas im Geheimen durchgeführt hatte. Er würde von den Verdachtsmomenten und den ersten Hinweisen erzählen. Er hatte die Fasern des Kissens untersucht, dieselben Fasern in Nase und Rachen des Toten entdeckt. Er hatte den Brustkorb geöffnet und sich die Lunge angesehen. Alle Hinweise hatten sich wie Teile eines kunstfertigen Mosaiks hübsch zusammengefügt und schließlich ein Bild ergeben, das unwiderlegbar vor ihm lag.
Es war ruhig im Solar. Viel zu ruhig. Er konnte das Getrappel und Geflatter der Raben in ihren Verschlägen hören, ihr Gekrächze und Geschnatter, und auch das Plätschern des Kristallbrunnens im Zentrum unterhalb der runden Kuppel. Der Wind wehte durch die geöffneten Fenster und befeuerte das Spiel der unzähligen Glocken und Klanghölzer. Doch er vernahm keine Stimmen, keine geflüsterten Unterhaltungen, die sonst aus dem Kreis des Rates immer durch das Atrium schwebten. Der Alte blickte nach links, nach rechts, sah sich um und fand sich schließlich nahe der runden Tafel wieder, die auf einer Ebene ein paar Steinstufen unter ihm um den ebenfalls tiefer liegenden Kristallbrunnen angeordnet war und an der die Sitzungen des Rates abgehalten wurden. Dann sah er die Becher, die umgekippt auf dem Tisch lagen, und den Wein, der vergossen worden war. Der Alte sah Porzellanteller und Tassen, die zerbrochen auf dem harten Steinboden lagen. Ein Regal mit alten Lehrbüchern war umgestürzt.
Er wusste, dass hier irgendetwas nicht stimmte, dann hörte er die Stimme in seinem Rücken.
„Ich weiß, wen du suchst, alter Mann.“
Erschrocken fuhr der alte Arzt herum und sah sich einem Mönch in einer orangen Robe gegenüber. Dieser hatte die Kapuze über seinen Kopf gezogen, sodass sein Gesicht nicht zu erkennen war. Die Hände des Mönchs waren in der weiten Robe verborgen, auch seine Füße konnte man nicht sehen. Der alte Mann spürte instinktiv die Gefahr, die von diesem Mönch ausging, und wich zurück. Schritt für Schritt entfernte er sich, stolperte aus dem Zentrum des Kreises heraus auf die Steinstufen zu.
„Wer seid Ihr?“, fragte er mit schwächlicher Stimme, obwohl irgendetwas tief in seinem Herzen die Antwort auf diese Frage bereits kannte. Der Mönch näherte sich lautlos, folgte dem alten Mann.
„Es ist nicht von Bedeutung, wer ich bin“, sagte er mit dunkler, ruhiger Stimme.
„Es ist nur wichtig, dass ich bin.“ Der Abstand hatte sich verkleinert, er betrug vielleicht ein Dutzend Meter oder weniger.
„Ihr seid es“, flüsterte der alte Leibarzt des Kaisers, der glaubte, die Stimme unter dem schweren Stoff der Kapuze erkannt zu haben.
„Ich kenne Euch.“ Mit zittrigen Fingern deutete er auf den Mönch, der sich unaufhaltsam näherte.
„Was wollt Ihr von mir? Wo sind all die anderen?“ Der Mönch, der bisher seine Hände unter der Robe verborgen gehalten hatte, ließ nun etwas Silbernes aufblitzen.
„Du weißt vermutlich, warum ich hier bin“, sagte der Mönch, „doch dieses Wissen wird dir nichts nützen.“
Immer näher kam er dem alten Mann, der nun einen Blutfleck am dunklen Boden des Solars entdeckte. Dann sah er noch einen und schließlich einen dritten.
„Was habt Ihr getan?“, flüsterte der alte Mann, „was bei allen Göttern habt Ihr, hast du getan, Akuma?“
Die Klinge schoss nach vorne und bohrte sich unterhalb des Brustbeins durch die Lunge des kaiserlichen Arztes, um am Rücken blutspritzend wieder auszutreten. Der alte Mann spürte, wie ihm die Beine versagten, doch er fiel nicht. Der Mönch hatte ihn mit Gewalt am Hals gepackt und hielt ihn aufrecht. Es schmerzte gar nicht mal so sehr, stellte er überrascht fest und hob seinen Arm an die Kapuze des Mönchs. Als er den schweren Stoff nach hinten schlug und in die Augen des jungen Kaisers sah, entdeckte er ein tödliches Glitzern, das ihn zutiefst schockierte.
„Deine Zeit ist vorbei, Weiser Mann“, flüsterte Akuma seinem nach Luft röchelnden Opfer zu.
„Für dich und deinesgleichen ist in meinem neuen Reich kein Platz mehr.“ Dann drehte Kaiser Zhang Akuma die Klinge des schlanken Schwertes und zerfetzte das Herz des alten Arztes.
Kaiserlicher Palast
Peking, Chinesisches Kaiserreich
21. April 1934
Für die Zusammenkunft war einer der kleineren Audienzsäle des Palastes ausgewählt worden. Der rund fünf Meter hohe, eher schlicht gehaltene Raum maß nur knappe vierzig mal zwanzig Meter und war damit rund fünf Mal kleiner als der Krönungssaal. Der Boden war mit grau geflammtem Granit gepflastert, die Wände zierten einfache Holzvertäfelungen aus hellem Bambus, unterbrochen durch eher schmucklose Wandteppiche aus der Provinz Mongolei. Die Teppiche zeigten Kampfszenen aus den Eroberungsfeldzügen des späten sechzehnten Jahrhunderts. Man konnte die riesigen kaiserlichen Heere erkennen, auch den ruhmreichen Feldherren, sowie den unterlegenen Khan der Mongolen, der seine Waffen dem Eroberer unterwürfig zu Füßen legte. Die wenigen Fenster des Raumes befanden sich an der Westseite. Im schwach rötlichen Glimmen der untergehenden Sonne tanzten Staubpartikel in der stickigen Luft des Saales. Gegenüber der großen zweiflügeligen Eingangstür, die noch verschlossen war, befand sich eine durch vier steinerne Stufen erhöhte Plattform, die etwa zehn Meter breit und in der Mitte des Saales situiert war. Ein einfacher Holzthron stand im Zentrum der Plattform. Lediglich das kaiserliche Siegel auf der Lehne des Throns sowie ein geschnitzter Holzdrache über dem Haupt des Kaisers schmückten den alten herrschaftlichen Stuhl. Ein aus dickem Garn gewebter Teppich, violett mit goldenen Einfassungen, führte von der Doppelflügeltür quer durch den langen Saal, über die vier Stufen nach oben zum Thron.
Auf diesem Teppich, knappe zehn Meter vor den steinernen Stufen des Podests, stand nun seit etwa zwanzig Minuten eine hochrangige Gruppe von Personen. In vorderster Reihe befand sich in makelloser schwarzer Uniform, mit Goldtressen und umfangreicher Ordensspange, der Oberkommandierende der Kaiserlichen Flotte, Großadmiral Lin Aang. Der große, korpulente Admiral hatte seine wenigen verbliebenen grauen Haare streng nach hinten gekämmt und hielt seine schwarze Offiziersmütze in der linken Hand. Die rechte Hand ruhte entspannt am Knauf des gekrümmten Offizierssäbels, der locker an seiner Seite hing. Direkt neben ihm, fast einen Kopf kleiner und etwa dreißig Kilo leichter, in olivgrüner Uniform, schwarzen Reiterstiefeln und ebenfalls mit Offizierssäbel, wartete der Stabschef der Armee, Marschall Hu Jonghyun. Der wesentlich jüngere Kommandant der Kaiserlichen Landstreitkräfte und damit Befehlshaber über knappe fünf Millionen Soldaten ließ keine Regung erkennen, seine Haltung war kerzengerade, sein Blick ruhte schon seit Minuten auf dem schlichten Holzthron. Zur Rechten des Marschalls schließlich wartete – wesentlich unruhiger und angespannter – Marschall Chen Shixin, Kommandant der Luftflotte, des modernsten und jüngsten Teils der gesamten Kaiserlichen Streitkräfte. Er trug die schneeweiße Paradeuniform mit schwarzer Hose und schwarzen Stiefeln, seine weiße Offiziersmütze trug er – wie alle anderen anwesenden Offiziere – in seiner linken Hand. Hinter den drei obersten Kommandanten der Streitkräfte wartete eine Gruppe von weiteren hochrangigen Offizieren.
Es waren verschiedene Adjutanten, Stabsoffiziere und Stellvertreter, allesamt hochdekorierte Kriegsveteranen, erfahren und kampferprobt. Schließlich räusperte sich der Chef der Luftflotte und wandte sich an seine beiden hochrangigen Kollegen.
„Wie lange will uns der Kaiser wohl noch warten lassen?“, flüsterte er, ohne seinen Kopf zur Seite zu drehen. Nur die neben ihm stehenden Männer und ein paar der weiter hinten wartenden Offiziere konnten seine Worte hören. Die Wachen der Kaiserlichen Garde standen in ihren traditionellen roten Uniformen und den überdimensional langen Zweihandschwertern wie gefährliche Boten aus längst vergangenen Tagen jeweils links und rechts der Offiziersgruppe. Ebenso waren sie vor dem erhöhten Podest und an der gegenüberliegenden Seite des Raumes, neben der Eingangstüre, von ihrem erfahrenen Kommandanten postiert worden. Keiner der elitären Wachsoldaten hörte die Worte des alten Offiziers. Wie als Antwort auf die Frage Marschall Chens, erschien ein kleiner, schwarz gekleideter Mann auf dem Podest. Eine unsichtbare Tür, die sich in der Wand hinter dem Thron befand, hatte sich lautlos geöffnet. Der kleine Mann pochte mit einem goldenen Stab auf die harten Steinfliesen des Podests und kündigte den Kaiser an.
„Offiziere der glorreichen Streitkräfte“, meldete er mit lauter, klarer Stimme, „Seine Kaiserliche Hoheit, Kaiser Zhang Akuma!“
Die Offiziere und ihr Gefolge strafften sich und nahmen Haltung an, als der Kaiser das Podest betrat. Mit schnellen, sicheren Schritten näherte er sich dem Thron und blieb schließlich davor stehen. Er trug einen schlichten, schwarzen Anzug ohne jegliche Insignien oder sonstigen Schmuck. Sein Gesicht war ausdruckslos, als er die Gruppe einige Augenblicke lang musterte. Schließlich nickte er den Anwesenden zu und wandte sich mit ruhiger, dunkler Stimme an die Offiziere.
„Kommandanten und Offiziere der Kaiserlichen Streitkräfte“, begann er, „ich habe Sie zu mir befohlen, da ich höchst unerfreuliche Neuigkeiten erfahren habe, die Sie alle betreffen.“
Der Kaiser blickte in die Runde und stellte zufrieden fest, dass einige der Offiziere doch einen etwas erschrockenen Ausdruck nicht unterdrücken konnten. Einige Augenblicke ließ er sie schmoren, bis er schließlich weitersprach.
„Sie haben meinem Vater lange und treu gedient, haben seine Befehle immer gewissenhaft und ohne Fehl und Tadel ausgeführt.“ Wieder wartete er einige Augenblicke, bevor er fortfuhr.
„Doch heute, kaum drei Tage nach dem traurigen Tod des Kaisers, heute gelang es mir, die Hintergründe des Komplotts aufzudecken, welches die schändliche Vergiftung und schließlich den qualvollen Tod meines Vaters, des großen Kaisers Zhang Kibum zur Folge hatte.“
Das erschrockene Raunen und die ungläubigen Blicke der Anwesenden nahm Kaiser Zhang Akuma zufrieden zur Kenntnis. Seine Gefühle ließ er sich jedoch überhaupt nicht anmerken.
„Im Zuge des Verhörs der Verschwörer, die sich unter den persönlichen Leibärzten des Kaisers befanden, gelang es mir, weitere eminent wichtige Informationen über den Umfang dieses tödlichen Komplotts, dieses schäbigen, hinterhältigen Staatsstreichs zu erfahren.“
Nun erhob sich seine vormals ruhige und beherrschte Stimme zu einem bedrohlichen Schwall anklagender Worte, die auf seine Zuhörer niederhagelten.
„Der oberste Leibarzt seiner Kaiserlichen Hoheit schwor bei der Seele seiner Mutter und seines Vaters, dass Sie“, mit einer umfassenden Bewegung seines rechten Armes deutete der Kaiser auf die anwesenden Offiziere unterhalb des Thronpodestes, „dass Sie, die obersten Führer der Kaiserlichen Streitkräfte, Teil dieses Komplotts, dieses Hochverrates, ja sogar der planende Kopf hinter dieser tödlichen Verschwörung sind!“
Die erschrockenen Blicke der Oberbefehlshaber wichen nun ungläubigem Staunen, doch bevor sich ein einziger der Offiziere zur Wehr setzen konnte, fuhr der Kaiser fort.
„Mir liegen eindeutige Beweise für die Wahrheit der Worte des Leibarztes vor. Beweise, die jeden einzelnen von Ihnen schwer belasten, und die es mir unmöglich machen, an Ihre Unschuld zu glauben.“
Der Kaiser nickte dem kleinen Mann neben ihm auf dem Podest zu, worauf dieser dem Hauptmann der Kaiserlichen Garde ein Zeichen gab.
„Im Namen meines Vaters“, knurrte Kaiser Zhang Akuma, während die Kaiserliche Garde ihre Schwerter zückte und auf die erschrockene Gruppe der Offiziere zumarschierte, „und im Namen der Gerechtigkeit beschuldige ich Sie alle des Hochverrats.“
„Das, das muss ein Irrtum sein, Eure Hoheit!“, stammelte Marschall Chen.
„Ich, wir… Wir würden nie etwas tun, was dem Kaiser…“
„Ich verlange eine unabhängige Untersuchung der Umstände, die den Tod des Kaisers zur Folge hatten“, rief nun Marschall Hu. Er war weniger eingeschüchtert als sein Kollege von den Luftstreitkräften, doch auch seine Stimme zitterte. Die Wachen der Garde hatten die Gruppe der Offiziere eingekreist, worauf sich weiterer Protest der jüngeren und niedrigeren Offiziere erhob. Schließlich war es der älteste Mann im Raum, der seine Kollegen zum Schweigen brachte.
„Schweigt, ihr Narren!“, brüllte Großadmiral Lin, woraufhin das nervöse Geschnatter abrupt abbrach.
„Seht ihr nicht, was hier vor sich geht?“, fragte der alte Seemann, während er kühl dem Blick des jungen Kaisers auf dem Podest begegnete.
„Ihr seid dazu auserkoren, wie Schachfiguren im Spiel der Macht nach dem Gutdünken des Kaisers eingesetzt und geopfert zu werden.“ Der Großadmiral glaubte so etwas wie den Ansatz eines leichten Grinsens auf dem Gesicht des jungen Kaisers zu entdecken.
„Ich für meinen Teil weiß, was ich nun zu tun habe“, schloss er, setzte sich seine Offiziersmütze auf und griff nach seinem Säbel.
„Das Urteil lautet…“, Kaiser Zhang Akumas Stimme war eine Nuance leiser geworden, doch noch bedrohlicher.
„Tod durch das Schwert!“
Großadmiral Lin Aang zog seinen Säbel und brüllte:
„Für den Kaiser, den wahren Kaiser Zhang Kibum!“
„Schützt den Kaiser!“, befahl der Hauptmann der Kaiserlichen Garde lautstark und zog sein Schwert. Dann krachte Stahl auf Stahl, und der ungleiche Kampf im kleinen Audienzsaal nahm seinen vorhersehbaren Lauf.
Kaiser Zhang Akuma, dem diese unvorhergesehene Entwicklung überhaupt nicht ungelegen kam, sah sich ungerührt das Gemetzel an und wartete, bis der letzte Mann der eingekreisten Offiziere leblos am Boden lag. Er blickte auf die blutüberströmten Toten und tödlich Verwundeten, von denen einige noch zuckten oder leise um Hilfe röchelten. Er sog jedes Detail in sein Innerstes auf, jeden Blick und jeden Ton, sogar den Geruch des Blutes, der in der stickigen Luft lag. Er nickte dem Hauptmann der Garde zu.
„Erlöst die Verräter“, befahl er ihm.
„Vollstreckt das kaiserliche Urteil.“ Dann drehte er sich wortlos um und verschwand in der kleinen Tür, die sich hinter ihm schloss. Das erstickte Kreischen der Sterbenden und das schmatzende Geräusch zerfetzenden Fleisches hörte er bereits nicht mehr. Blut tränkte die violetten Fasern des Teppichs und färbte ihn schwarz.
Kaiser Zhang Akuma hingegen bereitete schon seinen nächsten Schritt vor, sich von lästigen Anhängseln seines übermächtigen Vaters zu befreien. Diese alte Riege von Kommandanten, mit ihren alten Ansichten in Bezug auf Gefechtsführung, Taktik und Strategie, würde er nicht vermissen. Ganz im Gegenteil: Die neuen Offiziere, die an ihre Stelle treten sollten, würden jüngere Männer sein. Sie würden von ihm selbst ausgewählt werden und sie würden in seinem Namen dienen. Und was das Wichtigste war: Sie würden ihn fürchten. Und niemand würde es daher wagen, sich ihm zu widersetzen. Nicht nach diesem Exempel, das er soeben statuiert hatte.
Nun, da er alleine durch den dunklen Gang hinter dem Audienzsaal schritt, seine aufgewühlten Gedanken ordnend, gestattete er sich ein zufriedenes Lächeln.
2. Kapitel
Imst, Tirol
25. August 2017
Als das Mobiltelefon in der vorderen linken Tasche ihrer Jeans vibrierte, erschrak sie. Nicht schon wieder, dachte sie. Ich kann das nicht schon wieder ertragen. Doch dieses Mal musste sie es ertragen, sie musste stark sein. Vielleicht wäre es das letzte Mal. Sie spähte gegen das grelle Sonnenlicht des ungewöhnlich warmen Spätsommertages auf das matte Display des schmalen Telefons und ahnte, nein wusste, dass er es schon wieder war. Unbekannte Nummer. Dann wappnete sie sich, strich sich eine Strähne des langen, blonden Haars aus dem Gesicht und hob ab.
„Ja?“, sagte sie vorsichtig und hörte wieder das ihr mittlerweile nur allzu bekannte Atemgeräusch am anderen Ende der Leitung. Doch es blieb bei diesem Geräusch, rau und irgendwie animalisch.
„Was willst du schon wieder von mir, du krankes Arschloch?“, fauchte sie angewidert. Sie fühlte sich schwach und verletzlich, wie Freiwild. Sie schwitzte, ihr langes Haar klebte in ihrem Nacken, das weiße Shirt, das sie trug, fühlte sich viel zu eng an. Die kühle Brise des Westwindes verschaffte ihr kaum Linderung.
„Sag endlich, was du willst!“, forderte sie den Anrufer erneut heraus. Sie konnte nicht mehr sitzenbleiben und stand rasch auf.
Sie fühlte das kühle, frische Gras an ihren nackten Füßen, als er schließlich doch was sagte.
„Du siehst heute ganz besonders geil aus, meine Süße“, sagte die dunkle Stimme in ihrem Handy.
„Ich mag es, wenn du dein Haar offen trägst.“ Sie fühlte, wie eine einzelne Träne des Zorns und der Hilflosigkeit über ihre Wange lief.
„Ich sehe, du warst brav!“, lobte die Stimme des Mannes.
„Ich mag es, wenn du ein folgsames Mädchen bist.“ Ihr Blick wanderte mechanisch nach rechts und blieb an der Wäscheleine hängen, die sie zwischen den beiden alten Zwetschkenbäumen in ihrem Garten gespannt hatte. Auf einem der beiden Bäume hatte sie auch eine Schaukel aufgehängt, zum Spielen für die Kleine, die im Kindergarten war und nicht den Hauch einer Ahnung hatte, was ihre Mutter jetzt gerade und mittlerweile seit fast einem Jahr mitmachte.
„Ach, fick dich, du Perversling!“, ächzte sie müde.
„Ich möchte, dass du dein Shirt ausziehst“, sagte der Mann unbeeindruckt, während sie noch die Unterwäsche betrachtete, die sie auf der Wäscheleine aufgehängt hatte.
„Du weißt ja, Süße, sonst kümmere ich mich um deine Kleine, und das möchtest du doch nicht, oder?“ Sie konnte seine Atmung hören, die vor Erregung schneller geworden war und nun beinahe Ähnlichkeit mit einem leichten asthmatischen Keuchen hatte. Sie drehte sich langsam um und betrachtete die Häuser und Felder in ihrer Nachbarschaft, die sie über den Zaun sehen konnte, der ihren kleinen Garten und das unauffällige Wohnhaus umschloss.
„Nana, meine Süße, du kannst mich nicht sehen. Du wirst mich niemals entdecken können.“ Dann lachte der Mann schäbig und sie fühlte sich ertappt. Der Mann lachte immer noch, als sie eine zweite Stimme in ihrem linken Ohr hörte.
„Tun Sie, was er will, Sandra“, sagte Stefan Berger.
„Halten Sie ihn hin, ich brauche noch etwa zweieinhalb Minuten.“
Berger, der mit Sandra Bäumler über einen in ihrem Ohr versteckten Empfänger in Verbindung stand, betrachtete den kleinen Bildschirm auf seinem Schoß. Er trug ein Headset, durch das er die Unterhaltung zwischen Sandra und ihrem ungebetenen Verehrer mitverfolgen und gleichzeitig Instruktionen an seine Klientin weitergeben konnte.
„Nur Mut, Sie schaffen das schon“, munterte er sie auf, dann hörte der Mann am anderen Ende der Leitung zu lachen auf.
„Los jetzt!“, befahl er barsch.
„Runter mit dem Shirt. Ich will deine Titten sehen. Sofort!“ Sandra Bäumler, eine ausnehmend gut aussehende Frau Mitte dreißig, von ihrem Alkoholikergatten endlich geschieden und mit ihrem kleinen Mädchen Malena glücklich in trauter Zweisamkeit lebend, atmete tief durch, bevor sie den ersten Träger ihres Shirts langsam nach unten schob. Unbewusst tauchten wieder Erinnerungen und Gesprächsfetzen in ihren Gedanken auf, von den vielen Besuchen bei der Polizei. Niemand hatte sie wirklich ernst genommen und dann, als eine Fangschaltung auf ihrem Handy installiert worden war, hatte sich der Drecksack nicht mehr gemeldet. Als ob er gewusst hatte, dass sie ihn bei einem Anruf erwischen würden.
Sie hatte tatsächlich Ruhe gehabt, für einige wenige Monate, dann hatten die Anrufe wieder begonnen, kurz nachdem die Fangschaltung wieder entfernt worden war. Stets mit diesen Drohungen gegen die kleine Malena, die am schlimmsten für Sandra waren. Das Stöhnen und die Abartigkeiten dieses Perversen hätte sie wegstecken können, nicht jedoch das Gefühl der Verwundbarkeit ihrer kleinen Familie.
„Mach schon, verdammt. Zieh das verschissene Shirt aus und zeig mir deine großen Titten! Ich will sie sehen!“
Sandras Zorn wuchs, als sie den zweiten Träger des Shirts nach unten schob und sich langsam daran machte, den dünnen, weißen Stoff abzulegen. Sie würde jenem unbekannten Mann, der irgendwo in ihrer Nähe lauerte und sie beobachtete, ihre Brüste zeigen. Das Shirt landete im feuchten Gras und der Mann meldete sich wieder.
„Sehr schön, meine Süße. Und jetzt der BH. Ich mag diesen schwarzen. Den mag ich ganz besonders, weißt du? Ich will, dass du ihn jetzt aufknöpfst und dich dann ganz langsam zu mir drehst, damit ich deine großen Titten sehen kann.“
Sandras Finger fanden den Verschluss des BHs an ihrem Rücken, während ihre Gedanken wieder abschweiften.
Sie erinnerte sich daran, wie sie nach den unzähligen Enttäuschungen, die sie mit den Behörden erlebt hatte, schließlich auf jene Website gestoßen war, die sie wieder etwas hoffen ließ. Sie hatte das Kontaktformular ausgefüllt und keine zwei Tage später war ein Mann mit dunklem, etwas längerem Haar und braun gebranntem Gesicht freundlich lächelnd vor ihrer Tür gestanden. Stefan Berger, so war sein Name. Sie brauchen meine Hilfe?Ja, sie brauchte seine Hilfe. Und nun war hoffentlich bald alles vorbei, dachte sie, als der Verschluss ihres BHs aufsprang und der dünne schwarze Stoff nach unten rutschte. Instinktiv bedeckte sie ihre Brüste mit Armen und Händen und erntete dafür sofort wütenden Protest.
„Weg mit den scheiß Händen, ich kann nichts sehen. Und dreh dich verdammt noch mal nach rechts, Ich will alles sehen.“
„Tun Sie, was er sagt, um Gottes Willen, Sandra. Dieser Idiot hat gerade die Richtung bestätigt, die das Programm ermittelt hat. Ich glaube, ich hab ihn. Halten Sie ihn nur noch für eine Minute oder zwei bei Laune, dann erwisch ich ihn.“
Die unbeabsichtigte Richtungsbestätigung des durch seine fortgeschrittene Erregung offensichtlich leichtsinnig gewordenen Anrufers deckte sich mit Bergers ermittelter Position. Ausgehend von seinem Beobachtungspunkt im Dachstuhl hinter der löchrigen Giebelverschalung, aus Sandras Blickrichtung und den Wünschen des Anrufers kannte er nun die vermutliche Position des Perversen relativ genau. Er ließ alles stehen und liegen und verließ Sandras Haus durch die Vordertür.
„Jaa“, stöhnte der Anrufer, als Sandra all ihren Mut zusammennahm, ihren Ekel und ihr Schamgefühl überwand und ihre Arme sinken ließ. „Du hast so geile Titten, ich halt’s kaum aus“, keuchte der Anrufer an ihrem Ohr.
„Und jetzt“, keuchte er weiter, „runter mit der Hose. Ich will deinen Arsch sehen!“ Sandra schluckte und schloss die Augen. Sie zitterte, als sie dachte: Beeil dich, Stefan Berger. Ich halte das hier nicht mehr länger aus!
Berger trug einen schwarzen Trainingsanzug mit drei silbernen Streifen und einem großen Emblem des Herstellers in derselben Farbe auf dem Rücken. Die Kapuze des Anzuges hatte er sich über den Kopf gestülpt, eine schwarze Sonnenbrille verdeckte seine wachsamen Augen. Er war nach links abgebogen, als er Sandras Haus verlassen hatte, und lief nun über einen asphaltierten Weg auf eine Gruppe von kleinen Scheunen zu, die etwa dreißig Meter abseits des Weges standen. Berger begegnete einem anderen Jogger und einem Radfahrer, die er freundlich und unauffällig grüßte. Sein Blick wanderte nach links und blieb kurz auf der mittleren, der größten der drei Scheunen haften. Oben, etwa einen halben Meter unterhalb des Firstbalkens, befand sich ein Loch in der Verschalung, mehr oder weniger kunstvoll in einer Herzform ausgeschnitten. Und dahinter saß der Stalker, wusste Berger, dort musste er sein.
Er lief weiter, bis er sich auf Höhe der Scheunen befand und durch das Herzloch nicht mehr gesehen werden konnte. Durch sein Headset lauschte er dem einseitigen Gespräch und hörte den Stalker, wie er Sandras Brüste ein weiteres Mal enthusiastisch lobte. So wie er sich anhörte, rechnete er kaum mit unerwartetem Besuch. Das war sehr leichtsinnig, dachte Berger. Als er nach links abbog und durch das etwa zwanzig Zentimeter hohe Gras in Richtung Scheune huschte, lächelte er böse. Sandras Jeans befanden sich auf halber Höhe ihres Hinterns, sodass der Stalker bereits den kleinen, roten Tanga erkennen konnte, den sie trug.
„Zieh die Scheißhose endlich runter, du blöde Schlampe!“, kreischte er aufgeregt.
„Los, beeil dich! Sonst schneid ich deiner kleinen Göre die Finger ab!“ Sandras Wut über diese Drohung trieb ihr Zornestränen in die Augen. Sie hatte Angst um ihre Kleine und sie schämte sich. Sie wollte diesem Dreckschwein nicht noch mehr von sich zeigen.
„Mach schon, du blöde Kuh!“, kreischte der Mann. „Ich will deinen geilen…“, schrie er wie irrsinnig, dann krachte es ganz gewaltig und plötzlich war es still am anderen Ende der Leitung. Sandra blinzelte und hielt angespannt den Atem an. Sie drückte das Mobiltelefon fest an ihr Ohr. Während sie gespannt und hoffnungsvoll lauschte, zog sie ihre Jeans wieder nach oben und ging in die Knie, um nach ihrem BH zu tasten. Sie fand ihn, doch vergaß ihn augenblicklich, als sie die Stimme im Telefon hörte.
„Sandra?“, sagte Stefan Berger merkbar gelöst und kaum außer Atem, „Sie können sich jetzt wieder anziehen. Unser Freund ist gerade damit beschäftigt, seine Schneidezähne zu sortieren.“
Mein Gott, dachte Sandra, er hat ihn tatsächlich erwischt. „Danke“, stammelte sie, dann weinte sie hemmungslos vor Erleichterung und Freude. Sie setzte sich ins Gras, blickte nach oben in das tiefe Blau des wolkenlosen Himmels und fühlte, wie die tonnenschwere Last auf ihrer Seele ganz langsam von ihr abfiel.
Keine dreihundert Meter entfernt kniete Stefan Berger vor dem bewusstlosen Häufchen Mann, das er eben mit heruntergelassener Hose erwischt und mit einem einzigen knallharten Schlag, in dem etwa sechzig Prozent Professionalität und vierzig Prozent nackte Wut steckten, auf die harten Bretter des Zwischenbodens geschickt hatte. Der Staub, den Bergers Einschreiten aufgewirbelt hatte, schwebte unpassend friedlich im durch die schmalen Ritzen der Scheune scheinenden, warmen Sonnenlicht. Zufrieden betrachtete er sein Opfer, die blutende aufgeplatzte Lippe und die wirren, verklebten Haare auf der fortschreitenden Glatze des Mannes. Der Stalker war nicht mehr der Jüngste, erkannte Berger, doch die Spezialbehandlung, die er sich für dieses Schwein ausgedacht hatte, sollte er trotzdem durchstehen können.
Dieser kleine, dicke Haufen Abschaum würde so schnell niemanden mehr belästigen, das stand für Berger fest. Doch erst musste er hier abwarten, bis es dunkel war, dann konnte er ihn hier raus schaffen. Als er den Führerschein des Mannes betrachtete, seinen Namen las, hatte er schon eine ungefähre Idee, wie er mit dieser Evolutionsbremse zu verfahren hatte. Der zweite Ausweis, den er bei dem Mann fand, erklärte augenblicklich, warum sämtliche Versuche, ihn auszuforschen, erfolglos geblieben waren. Der Mann war ein verdammter Polizist.
Er fand sie in ihrem Wohnzimmer, wo sie auf der kleinen Ikea-Couch zusammengekauert auf ihn wartete. Als sie ihn erblickte, schluchzte sie in ihrem leisen Weinen auf und erhob sich. Sie fiel ihm erleichtert um den Hals. „Danke“, schniefte sie und vergrub ihr Gesicht an seiner Brust. Sie weinte und zitterte, ihre Tränen benetzten seine Haut dort, wo die obersten drei Knöpfe seines Ripshirts geöffnet waren. Stefan hielt sie fest und redete beruhigend auf sie ein.
„Und er wird mir nichts mehr tun?“, flüsterte sie leise. Sie hob ihren Kopf und sah ihn aus großen, blass grauen Augen an. Ihr Kajal war verschmiert und die Tränen hatten dunkle Bahnen auf geröteten Wangen hinterlassen.
„Ich denke, er wird die Motivation dazu verloren haben, wenn ich mit ihm fertig bin“, antwortete Berger vage. Sie nickte zufrieden und atmete erleichtert aus. Er hielt sie nur fest, flüsterte beruhigend auf sie ein und fragte sich, wie es Nina wohl gerade erging. Es befiel ihn ein urplötzliches Gefühl der Sorge, das ihn gleichermaßen überraschte wie verstörte. Ausgelöst durch dieses Gefühl der Nähe und den Duft einer Frau, die er in seinen Armen hielt, gefiel ihm der Gedanke überhaupt nicht, dass Nina etwas passiert sein könnte. Er verspannte sich, als er daran dachte, dass sie sich schon ewig nicht mehr gemeldet hatte und auch seine Mails nicht beantwortet wurden.
„Was ist los?“, fragte Sandra Bäumler, löste ihre Umarmung, trat einen Schritt zurück und sah ihn aus verweinten Augen an. Sie hatte seine Anspannung instinktiv gespürt.
„Es ist nichts“, log er und lächelte beruhigend.
„Sie müssen nun keine Angst mehr haben.“ Sandra erwiderte sein Lächeln zaghaft.
„Es ist vorbei“, flüsterte Stefan Berger.
3. Kapitel
Insel Daqin Dao
Golf von Bohai, Chinesisches Kaiserreich
29. April 1934
Die Insel war eine von mehreren einer kleinen Gruppe, situiert unmittelbar an der Engstelle, die den Golf von Bohai vom Gelben Meer trennte. Sie war nicht die größte der Inseln, auch nicht die schönste. Eigentlich ein massiver Felsblock, der sich im Zentrum fast zweihundert Meter über dem ruhigen Meer auftürmte, war sie wenigstens gesäumt von einigermaßen ansehnlichen Sandstränden.
Doch diese Insel war keine Urlaubsinsel für Naturliebhaber oder Angelausflügler, weshalb, anstatt von Palmen oder Kiosken für Fischereibedarf, am Strand Wächter der Kaiserlichen Garde zu finden waren, wenn man sie in ihrer Tarnuniform überhaupt zu entdecken vermochte. Die Soldaten versteckten sich im Unterholz des Dickichts am Rande des Strandes, patrouillierten in Zweiergruppen die schäumende Brandung entlang oder beobachteten aus getarnten Wachtürmen mit starken Feldstechern das nahe Meer bis zum Horizont. Die Wachhunde, die manche von ihnen an kurzen Leinen mitführten, bellten nur im Notfall und gaben ansonsten keinen Ton von sich. Die einzige Anlegestelle der Insel war ein langer Holzkai, der fast zweihundertfünfzig Meter weit ins Meer hinaus reichte, um dort auch tiefer liegenden Schiffen das Anlegen zu ermöglichen.
Zwei symmetrisch angeordnete Wachtürme mit Granatwerfern und MG-Nestern beleuchteten bereits bei beginnender Dämmerung mit Dutzenden starken Scheinwerfern die Landungszone und überwachten alles und jeden, der hier festmachte. Weiter draußen, stets in gegenseitigem Sicht- und Funkkontakt mit den Wachtürmen und den Patrouillen, umkreisten mehrere graue Schnellboote der Kaiserlichen Marine die Insel, stets wachsam und lauernd. Das leise Tuckern ihrer Dieselmotoren war noch am Strand zu hören.
Noch weiter draußen waren weitaus stärkere Diesel am Werk, als sich das Schlachtschiff Konowalow, flankiert von ortskundigen Wachbooten der Kaiserlichen Marine, langsam durch die schwache Dünung auf den vorgesehenen Ankerplatz zubewegte. Die Konowalow, ein fünfunddreißigtausend Tonnen schweres Schlachtschiff aus neuester sowjetischer Produktion, hatte ihre schweren Geschütze sorgsam unter Schutzhauben verborgen, als sie mit angetretener Ehrenformation im warmen Licht des Sonnenuntergangs ihren Liegeplatz erreichte. Die schweren Ankerketten lösten sich und schossen ratternd ins dunkelblaue Wasser, um bereits nach knappen vierzig Metern zum Stillstand zu kommen. Für einen Stahlkoloss wie die Konowalow waren die seichten Gewässer des Gelben Meeres stets mit Vorsicht zu genießen, wenn man nicht als Havarie auf einer der zahlreichen Sandbänke enden wollte. Der kleine Anlegesteg der Insel war für das riesige Schlachtschiff daher völlig ungeeignet.
In einigem Abstand zur Konowalow, vielleicht zweieinhalb Seemeilen westlich und nördlich, kreuzten die Ban Chao, eines der alten, schweren Schlachtschiffe, sowie der moderne Kreuzer Zhanshan. Die Kanonen dieser beiden schweren Einheiten der Kaiserlichen Marine waren im Gegensatz zur Konowalow nicht in Ruhestellung arretiert, sondern bemannt und einsatzbereit. So ganz ohne Aufsicht wollte man ein Schiff der Größe und Kampfkraft einer Konowalow nun doch nicht bis kurz vor die Haustür der chinesischen Hauptstadt dampfen lassen. Vorsicht war besser als Nachsicht und außerdem hielten sich die beiden Schiffe dezent im Hintergrund.
Kapitän Oleg Sidorow befahl das Aussetzen des Beiboots und übergab seinem Ersten Offizier das Kommando. Ein letzter Blick galt der riesigen Ban Chao, die er verschwommen durch das Panzerglas der Brücke erkennen konnte, dann verließ er den Kommandostand. Anschließend überzeugte er sich, dass seine Uniform makellos sauber war und auch gut saß. Schließlich begab er sich zur Admiralskajüte, um seinen Reisegast abzuholen. Er straffte sich und klopfte an das Stahlschott.
„Genosse Nikitin, wir liegen vor Anker und sind bereit, an Land zu gehen.“ Es dauerte einige Augenblicke, im Inneren der geräumigen Kajüte war nichts zu hören, sodass Kapitän Sidorow ein weiteres Mal anklopfte.
„Genosse Oberst?“, fragte er einen Augenblick, bevor sich das Schott schwungvoll öffnete. Im Rahmen der wasserdichten Tür stand ein großer Mann mit hellem, kurzgeschorenem Haar.
„Kapitän, ich bin soweit“, sagte Wanja Nikitin mit leichtem Lächeln, ältester Sohn von Dimitrij Nikitin, des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Der Kapitän nickte und verbeugte sich.
„Wenn Sie mir bitte folgen wollen, Genosse Oberst.“ Die beiden Männer folgten den schmalen Gängen, kletterten zwei Decks höher und traten schließlich an Backbord mittschiffs ins Freie. Dort, im letzten Licht der untergehenden Sonne, war beinahe die gesamte Besatzung angetreten. Nikitin hörte einen dieser patriotischen Märsche blechern aus den Lautsprechern des Schiffes plärren, eines jener Lieder, die momentan in Moskau so beliebt waren. Er nickte den salutierenden Offizieren zu, als er an ihnen vorbeischritt und sich der Reling näherte.
Es war immer wieder interessant, fand er, wie alle Welt sich bemühte, ihm zu Diensten zu sein und ihm zu gefallen. Ihm, dessen einzige Leistung bis dato darin bestanden hatte, Sohn des mächtigsten Mannes der Sowjetunion zu sein. Als Oberst der Infanterie hatte er noch an keinerlei Kampfhandlungen teilgenommen. Beim letzten Krieg gegen das britische Imperium war er noch ein grüner Junge mit Aknepickeln gewesen, der nichts von der Welt verstand. Doch das würde sich bald ändern, hoffte er. Bald würde auch er zeigen können, was in ihm steckte.
Er war aufgeregt, als er ins Beiboot kletterte und die kleine Insel betrachtete, hinter deren Silhouette die rot glühende Sonne langsam im Meer versank. Er war gespannt auf das, was ihn dort erwartete, und er freute sich darauf, seinen alten Freund wiederzusehen. Kapitän Sidorow befahl, die Leinen loszumachen, woraufhin der kleine Diesel des Beiboots zum Leben erwachte. Die Schrauben wühlten die See auf, das Heck des Bootes senkte sich tiefer, als es sich rasch beschleunigend der Insel auf westlichem Kurs näherte. Wanja Nikitin genoss das Aufstäuben der Gischt, die sein Gesicht benetzte und erfrischte. Er sog die frische Seeluft tief in seine Lungen und schloss zufrieden die Augen. Als er sie wieder öffnete, konnte er bereits den langen Landungssteg erkennen. Wenige Minuten später erkannte er auch seinen Freund, der bereits auf ihn wartete.
Das Beiboot hatte am Holzkai festgemacht und die beiden Passagiere gingen von Bord. Wanja Nikitin sprang elegant vom schaukelnden Deck des kleinen Bootes auf die verwitterten Planken des Kais, Kapitän Sidorow folgte ihm etwas behäbiger. Es waren nur wenige Personen erschienen, da es kein offizieller Staatsempfang war. Ganz im Gegenteil: Es sollte alles so unaufgeregt und entspannt wie möglich ablaufen.
„