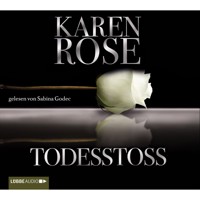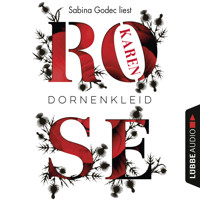Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Baltimore-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein knallharter Thriller mit einem Schuss Romantik– der Auftakt von Karen Roses Baltimore-Reihe im neuen Look! Die erfahrene Gerichtsmedizinerin Lucy Trask ist einiges gewöhnt. Doch der Anblick dieser verstümmelten Leiche schockiert selbst sie nachhaltig. Zunge und Herz wurden dem Toten fachmännisch entfernt. Nur wenige Tage später erhält Lucy ein grauenvolles Paket. Darin: ein blutendes Herz. Detective JD Fitzpatrick vermutet einen persönlich motivierten Rachefeldzug. Doch wer könnte solchen Hass auf die attraktive Gerichtsmedizinerin haben? Als die Polizei auf eine weitere brutal zugerichtete Leiche stößt, drehen sich Lucys Gedanken nur noch um zwei Fragen: Gibt es tatsächlich eine Verbindung zwischen ihr und dem kaltblütigen Killer? Und wer weiß von ihrem gefährlichen Doppelleben? Knallhart, verstörend, nervenzerreißend: Die Erfolgsserie von Thriller-Queen Karen Rose Die Baltimore-Thriller von Bestseller-Autorin Karen Rose sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Band 1: "Todesherz" - Band 2: "Todeskleid" - Band 3: "Todeskind" - Band 4: "Todesschuss" - Band 5: "Todesfalle" - Band 6: "Todesnächte"
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 40 min
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Karen Rose
Todesherz
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Winter
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
In liebevollem Gedenken an A. C. Barrett, der mir das Binärsystem erklärte, als ich sieben war, mir mit acht die erste Geschichte von Poe zu lesen gab und mit mir, als ich neun war, an einem Donald-Duck-Hüpfball Boxen trainierte, damit ich mich gegen gemeine Jungs auf dem Schulhof verteidigen konnte.
Er war sehr kreativ in der Auswahl seiner Mittel, als er mir beibrachte, rückwärts einzuparken, damit ich meine Führerscheinprüfung bestand. Er tippte meine letzte Arbeit für die Uni ab, als mein Computer am Abend vor dem Abgabetermin abstürzte, damit ich den dringend benötigten Schlaf und meinen Abschluss bekam, und schimpfte nur ein klein wenig, weil ich meine Dateien nicht vernünftig gesichert hatte.
Er hat dafür gesorgt, dass mir niemand jemals sagte, ich könnte nicht schaffen, was ich mir vorgenommen hatte.
Und vor allem hat er mich immer geliebt, jeden Tag, Jahr für Jahr.
Du fehlst mir, Dad.
Und für Martin, meinen Fels.
Prolog
Verzeihen Sie, Sir, aber dort haben Unbefugte keinen Zutritt.«
Malcolm Edwards ignorierte die Stimme des Jachthafenmanagers und konzentrierte sich auf das Ziel vor ihm. Sein geschwächter Körper wurde bereits müde. Die Carrie On schaukelte auf den Wellen der aufgewühlten Chesapeake Bay, und in der Ferne zog ein Unwetter auf. Es war ein guter Tag zum Sterben.
Nur noch ein paar Schritte, dann kann ich mich ausruhen. Da fing der Steg unter seinen Füßen heftig an zu vibrieren, als Daryl ihm hinterherlief.
»He, Sie da, stehen bleiben! Dies ist Privatbesitz! Hey, Freundchen, ich sagte …«
Malcolm fuhr zusammen, als eine kräftige Pranke seinen Oberarm packte und ihn herumriss. Stumm blickte er Daryl an und wartete, bis der ihn erkannt hatte.
Daryl blieb vor Schreck der Mund offen stehen, und aus seinem sonst stets geröteten Gesicht wich jegliche Farbe. »Mr. Edwards«, stammelte er und wich zurück. »Verzeihen Sie, Sir.«
»Schon gut«, erwiderte Malcolm freundlich. »Ich weiß, dass ich nicht mehr wie ich selbst aussehe.«
Er wusste, welchen Anblick er bot, und war überrascht, dass Daryl ihn überhaupt erkannt hatte. Dass seine sogenannten Freunde ihn noch erkennen würden, bezweifelte er stark – nicht, dass sie sich die Mühe gemacht hätten, ihn zu besuchen. Nur Carrie war bei ihm geblieben, und manchmal hatte sich Malcolm gewünscht, sie hätte es nicht getan. In guten wie in schlechten Zeiten. Dies waren definitiv letztere.
Wahrscheinlich glaubte sie, dass er es nicht hörte, wenn sie manchmal unter der Dusche stand und weinte, aber er tat es. Und er hätte alles dafür gegeben, ihr diese Hölle zu ersparen. Aber das konnte der Mensch nicht entscheiden, das war Gottes Wille. Carrie, die Malcolms Verfall hilflos hatte mit ansehen müssen, hatte Gott verflucht, aber Malcolm konnte sich diesen Luxus nicht erlauben. Es lagen schon genug dunkle Flecken auf seiner Seele.
Daryl schluckte sichtlich. »Kann ich etwas für Sie tun? Ihnen irgendwie helfen?«
»Nein danke, ich habe alles. Ich gehe angeln.« Er hielt den Ködereimer hoch, den er als Tarnung gekauft hatte. »Ich will einfach nur den Wind im Gesicht spüren.« Ein letztes Mal, fügte er in Gedanken hinzu. Er wandte sich zu seinem Boot um und setzte entschlossen einen Fuß vor den anderen. Wieder vibrierte der Steg unter seinen Füßen, als Daryl unschlüssig neben ihm herging. Der Mann schien nicht zu wissen, wie er aussprechen sollte, was er auf dem Herzen hatte.
»Sir, ein Sturm kommt auf. Sie sollten besser warten.«
»Ich habe keine Zeit zu warten.« Nichts entsprach mehr der Wahrheit.
Obwohl es Daryl offensichtlich unangenehm war, versuchte er es weiter. »Ich könnte ein paar Leute zusammentrommeln, die Sie rausbringen. Mein Enkel ist ein guter Bootsmann.«
»Das weiß ich zu schätzen, wirklich, aber manchmal muss man allein sein. Sie sorgen sich um mich, und dafür danke ich Ihnen.« Endlich war er an Bord, und sein Körper schien in sich zusammenzufallen, als seine Hände sich um das Ruder schlossen. Es war schon viel zu lange her, seit er zuletzt in die Bucht hinausgesegelt war. Aber er war beschäftigt gewesen. Arztbesuche, Therapien und … Er blickte in den düsteren Himmel hinauf.
Und Wiedergutmachung. Er hatte vieles wiedergutzumachen, besonders diese eine Sache, die seit einundzwanzig Jahren auf seiner Seele lastete.
Er dachte an den Brief, den er abgeschickt hatte. Blieb nur zu hoffen, dass er nicht zu spät kam. Blieb nur zu hoffen, dass er das Ruder lange genug auf Kurs halten konnte, um das zu tun, was getan werden musste. Blieb zu hoffen, dass Ertrinken wirklich wie Einschlafen war.
Die See wurde kabbeliger, der Wind heftiger, je weiter er hinausfuhr. Schließlich stellte er den Motor ab und lauschte mit geschlossenen Augen den Wellen. Tief atmete er die salzige Luft ein und genoss ihn, diesen letzten Tag. Carrie würde traurig, aber insgeheim auch ein wenig erleichtert sein. Sie hatte heute Morgen eine tapfere Miene aufgesetzt, als er ihr einen Abschiedskuss gegeben hatte. Wenn die Polizei an ihre Tür klopfte, um ihr die schlechte Nachricht zu überbringen, würde sie schwören, dass ihr Mann sich niemals selbst das Leben genommen hätte. Aber tief in ihrem Inneren würde sie die Wahrheit kennen.
Er trat an Deck und stellte die Angelausrüstung auf. Er musste den Schein wahren, falls man das Boot intakt fand, nachdem er von einer »Welle über Bord gespült« worden war. Er nahm einen Köder und befestigte ihn am Haken, als eine harsche Stimme ihn in seinen Gedanken unterbrach.
»Wer sind die anderen?«
Malcolm fuhr herum, und der Köder glitt ihm aus den Fingern. Etwa einen Meter hinter ihm stand breitbeinig ein Mann, die Arme vor der Brust gekreuzt. Hass glomm in seinen Augen. Malcolm fuhr ein Angstschauder über den Rücken. »Wer sind Sie?«
Der Mann trat so sicher einen Schritt vor, als würde das Boot nicht schwanken. »Wer sind die anderen?«
Die anderen. »Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen«, log Malcolm.
Der Mann zog einen Umschlag aus der Tasche, und Malcolms Magen verkrampfte sich, als er den Brief und seine eigene Handschrift erkannte. Seine Gedanken rasten einundzwanzig Jahre zurück, und er glaubte nun zu wissen, wer der Mann war. Auf jeden Fall wusste er, was der Mann wollte.
»Wer sind die anderen?«, fragte er erneut und überdeutlich.
Malcolm schüttelte den Kopf. »Nein. Ich werde nichts sagen.«
Der Mann griff in die Tasche und zog ein langes Filetiermesser hervor. Er hielt es hoch und betrachtete die scharfe Klinge. »Dann töte ich dich«, sagte er fast emotionslos.
»Na und? Ich werde ohnehin sterben. Ist Ihnen das etwa noch nicht aufgefallen?«
Das Boot bäumte sich auf, und Malcolm verlor den Halt, während der Mann kaum schwankte. Er hat Seemannsbeine. Wenn er derjenige war, für den Malcolm ihn hielt, konnte das gut sein. Der Vater des Mannes war Fischer gewesen und hatte sein eigenes Boot gehabt, aber auch das hatte er damals verloren.
Im Lauf der letzten Jahre waren Existenzen vernichtet und Menschen ruiniert worden. Und wir sind schuld. Ich bin schuld. Er wird mich umbringen, und ich habe es verdient. Aber Malcolm wollte weder die Identitäten der anderen preisgeben noch schmerzvoll sterben. Er tat einen Sprung zur Seite.
Aber der Mann war schnell. Er packte Malcolm am Arm, stieß ihn in einen Liegestuhl und band ihn an Händen und Füßen mit Stricken fest, die er aus seiner hinteren Hosentasche zog. Der Mann war gut vorbereitet an Bord gegangen.
Jetzt sterbe ich.
Der Mann richtete sich drohend auf. »Wer sind die anderen?«
Mit hämmerndem Herzen blickte Malcolm zu ihm auf.
Der Mann zuckte mit den Schultern. »Du wirst es mir ohnehin sagen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich all das mit dir machen, was ihr mit ihr gemacht habt.« Er sah Malcolm in die Augen. »Alles.«
Malcolm schluckte, als er daran dachte, was in jener Nacht vor so vielen Jahren geschehen war. »Es tut mir leid. Und das habe ich schon gesagt. Aber ich habe nichts mit ihr angestellt. Das schwöre ich.«
»Ich weiß«, sagte der Mann verbittert. »Das stand so in dem Brief. Obwohl du zu feige gewesen bist, das Geständnis mit deinem Namen zu unterschreiben.«
Er hatte recht. Er war damals feige gewesen, und er war es immer noch. »Woher wussten Sie, dass ich es war?«
»Mir war klar, dass es einer von euch gewesen sein musste. Ihr wart doch damals immer alle zusammen. Und ihr habt alle das Mannschaftsbild signiert.«
Malcolm schloss die Augen und sah es vor sich. Sie waren so jung gewesen, so verdammt arrogant, und sie hatten geglaubt, dass die Welt sich um sie drehte. »Das in der Pokal-Vitrine der Highschool.«
Er grinste höhnisch. »Ebendas. Und deine Handschrift hat sich in den zwanzig Jahren nicht besonders verändert. Das ›M‹ sieht noch immer gleich aus. Man muss kein Genie sein, um auf dich zu kommen. Was mich wieder zu dem Grund zurückführt, warum ich vorbeischaue. Du wirst mir sagen, was ich wissen will.«
»Nein. Wie ich schon im Brief sagte: Das ist eine Sache, die die anderen mit Gott ausmachen müssen. Tut mir leid.«
Das höhnische Grinsen wurde zu einem grausamen Lächeln. »Nun, das werden wir noch sehen.«
Er verschwand unter Deck. Sofort zerrte Malcolm an seinen Fesseln, obwohl er wusste, dass es keinen Sinn hatte. In seiner Erinnerung blitzten Bilder auf, kranke, scheußliche Szenen der Dinge, die man dem Mädchen damals angetan hatte, während er danebengestanden und zugesehen hatte. Tatenlos.
Ich hätte etwas tun müssen. Ich hätte dem Ganzen ein Ende bereiten müssen. Aber das hatte er nicht, und die anderen auch nicht. Und nun bezahlte er dafür.
Er hörte einen dumpfen Laut, als der Mann etwas aus der Luke zerrte. Eine Frau. Plötzlich brannte Säure in Malcolms Eingeweiden. Den Pullover, den sie trug, kannte er nur allzu gut. Seine Frau hatte ihn getragen, als er sich vor nur wenigen Stunden von ihr verabschiedet hatte.
»Carrie!« Malcolm versuchte aufzustehen, konnte es aber nicht. Carrie waren die Augen verbunden. Sie war gefesselt und geknebelt, und der Mann zerrte sie am Arm an Deck. »Lassen Sie sie laufen. Sie hat nichts getan.«
»Du auch nicht«, sagte der Mann spöttisch. »Das hast du selbst gesagt.« Er stieß Carrie auf einen Stuhl und hielt ihr das Messer an den Hals. »Jetzt sag schon, Malcolm. Wer. Sind. Die. Anderen?«
Verzweifelt sah Malcolm in die verengten Augen des Mannes, bevor sein Blick wieder von dem Messer an der Kehle seiner Frau angezogen wurde. Er konnte kaum atmen. Konnte nicht mehr denken. »Ich kann mich nicht erinnern.«
Ein Tropfen Blut rann über Carries Hals, als das Messer ihre Haut ritzte. »Wag es nicht, mich anzulügen«, sagte der Mann ruhig. »Wenn du weißt, wer ich bin, dann weißt du auch, dass ich nichts zu verlieren habe.«
Malcolm schloss die Augen. Er konnte nicht nachdenken, wenn er sie sah, er hatte zu große Angst. »Okay. Aber bringen Sie sie zuerst zurück an Land. Sonst sage ich kein Wort.«
Carries Schmerzensschrei wurde durch den Knebel gedämpft. Malcolm riss die Augen auf, und das Entsetzen packte ihn. Sein Magen hob sich, und er würgte heftig. Er schlug die Augen nieder, um den Finger nicht sehen zu müssen, den der Mann ihm hinhielt.
Ihren Finger. Abgetrennt. Er hat ihr den Finger abgeschnitten. »Okay, ich sag alles«, brachte er keuchend hervor. »Verdammt, ich rede ja!«
»Dachte mir doch, dass du dich überzeugen lässt.« Der Mann wich von Carrie zurück, die sich wimmernd so klein machte, wie ihre Fesseln es erlaubten. Aus der Brusttasche zog der Mann Notizblock und Stift. »Dann schieß los.«
Hastig spuckte Malcolm die Namen aus und verabscheute sich dafür, verabscheute sich für alles, was geschehen war. Dass er damals geblieben war und zugesehen hatte. Dass er den Brief geschrieben und seine Frau in Gefahr gebracht hatte. Der Mann ließ keinerlei Gefühlsregung erkennen, während er die Namen aufschrieb und den Block schließlich in seine Tasche zurückschob.
»Ich habe Ihnen alles gesagt«, presste Malcolm hervor. »Jetzt bringen Sie sie an Land. Sie braucht einen Arzt. Und bitte legen Sie den Finger auf Eis. Bitte, ich flehe Sie an!«
Der Mann musterte die Messerklinge, die rot von Carries Blut war. »Hat sie das auch gesagt?«
»Wer?«
Der Mann reckte aggressiv das Kinn vor. »Meine Schwester! Hat sie Sie angefleht?« Er packte Carries Haar, riss ihren Kopf zurück und hielt ihr das Messer an die entblößte Kehle. »Hat sie gebettelt?«
»Ja.« Malcolms Körper krampfte sich zusammen, als ein Schluchzer aus ihm herausbrach. »Bitte. Ich flehe Sie an. Sie hat nichts getan. Bitte! Ich habe Ihnen gegeben, was Sie wollten. Tun Sie ihr nichts mehr.«
Der Arm des Mannes zuckte, die Klinge durchtrennte Haut und Fleisch, und Malcolm schrie, als das Blut hervorsprudelte. O nein! Bitte, Gott, nein! Carrie war tot. Sie war tot.
Mit kaltem Blick zerschnitt der Mann die Stricke, mit denen er sie gefesselt hatte, und ihre Leiche landete vor Malcolms Füßen. »Es würde mir gefallen, wenn du zusehen müsstest, wie die Vögel sich über sie hermachen«, sagte der Mann, »aber vielleicht findet dich jemand, bevor du tot bist, und dann würdest du mich verraten. Natürlich könnte ich dir auch die Zunge herausschneiden, aber dir würde schon etwas einfallen. Also musst du sofort sterben.« Er hob Malcolms Kinn an, so dass er zu ihm aufschauen musste. »Aber ich schneide dir die Zunge trotzdem heraus. Irgendwelche letzten Worte?«
Der Mann stand nackt an Deck und sah zu, wie seine Sachen im grauen Wasser versanken und Malcolm und seiner Frau in die Tiefe folgten. Bei Einbruch der Nacht würden sie nur noch Fischfutter sein.
Der Sturm war über sie hinweggezogen und bereits abgeflaut, als er sich der Toten entledigt hatte. Es war ziemlich viel Blut geflossen, aber er hatte zum Glück an Wechselsachen gedacht. Er würde sich das Blut der Edwards’ abduschen, bevor er die Carrie On in den kleinen privaten Hafen fahren würde, dessen Besitzer keine dummen Fragen stellte. Dort konnte er auch das Deck abspritzen und alle Hinweise auf den Bootseigner entfernen.
Er ging hinunter und hielt an der Theke der Bordküche an, wo er den Notizblock zur Sicherheit deponiert hatte: Er hatte nicht riskieren wollen, dass er mit Blut beschmiert wurde. Nicht, dass er die Liste noch brauchte. Die Namen hatten sich bereits in sein Hirn gebrannt.
Einige hatte er erwartet. Andere waren eine Überraschung.
Aber alle würden sich wünschen, sie hätten vor einundzwanzig Jahren das Richtige getan.
Eins
Go get yourself some cheap sunglasses …«, schnaufte Lucy Trask im Duett mit ZZ Top, während sie den Weg entlangjoggte, der durch den Park hinter ihrem Wohnhaus führte. Dass sie hoffnungslos falsch sang, war ihr vollkommen egal. Gwyn war die Sängerin von ihnen, und niemand kümmerte es, wie Lucys Stimme klang, solange ihre E-Geige den richtigen Ton traf. Im Übrigen waren jetzt höchstens andere Läufer unterwegs, und die hatten genau wie sie Stöpsel in den Ohren.
Zu dieser frühen Stunde war niemand in der Nähe, den sie beeindrucken oder um dessen Meinung sie sich scheren musste. Das war einer von vielen Gründen, warum sie die Zeit vor Tagesanbruch so liebte.
Sie folgte der Kurve am Ende des Weges und lief locker aus, als ihre gute Laune plötzlich in sich zusammenfiel. »O nein«, murmelte sie betrübt. »Nicht schon wieder.« Mr. Pugh saß vornübergesunken am Schachtisch. Das Licht der Straßenlaterne fiel von hinten auf seinen Tweedhut.
Sie lief den Pfad zurück bis zu der Rasenfläche mit dem Tisch, an dem ihr alter Freund früher seine Gegner schachmatt gesetzt hatte. Diese Zeiten waren längst vorbei. Nun saß er in den Nächten mit gesenktem Kopf allein hier, den Mantelkragen gegen die Kälte hochgeschlagen.
Sie seufzte. Er war also wieder einmal mitten in der Nacht aus seiner Wohnung spaziert. Sie wurde langsamer, als sie sich ihm näherte. »Mr. Pugh?« Sanft berührte sie ihn an der Schulter, um ihn nicht zu erschrecken. Er hasste nichts mehr, als wenn er erschreckt wurde. »Mr. Pugh? Wollen Sie nicht lieber nach Hause gehen?«
Nichts. Lucy runzelte die Stirn. Normalerweise hätte er nun aufgeschaut und sie verwirrt angesehen, und sie hätte ihn zurück zu Barb bringen können, die mit seiner Rundum-Betreuung nicht mehr fertig wurde. Doch nun hob er den Kopf nicht, er regte sich nicht einmal. Ihr wurde mulmig zumute. O nein. Bitte nicht.
Sie legte ihm zwei Finger an den Hals, schlug sich jedoch gleich darauf die Hand vor den Mund, um den aufkommenden Schrei zu ersticken, als sein Körper zur Seite sackte und ihm der Hut vom Kopf fiel. Einen Augenblick lang starrte sie ihn voller Entsetzen an. Sein Kopf war deformiert und mit Blut verklebt, und sein Gesicht … Sie taumelte zurück, als ihr bittere Galle in die Kehle stieg.
O Gott. Oh, mein Gott. Sein Gesicht war fort. Und seine Augen auch.
Blind taumelte sie einen Schritt zurück, hörte ein Wimmern und begriff, dass es aus ihrer Kehle kam. Die Luft blieb ihr im Hals stecken, und sie zwang sich zu atmen.
Tu was. Mit zitternden Händen tastete sie nach dem Handy in ihren Laufshorts, gab 9-1-1 ein und fuhr zusammen, als sich eine forsche Stimme meldete.
»Hier ist die Notrufzentrale. Welchen Notfall möchten Sie melden?«
»Hier spricht …« Lucys Stimme brach, als sie die Leiche fixierte. Sie schloss die Augen. Leiche? Das ist Mr. Pugh. Und jemand hat ihn umgebracht. O Gott.
»Hier …« Sie konnte nicht sprechen. Nicht atmen.
»Miss?«, fragte der Mann drängend. »Was möchten Sie melden?«
Lucy räusperte sich. Riss sich zusammen. Griff auf viele Jahre Training zurück. Zwang sich zu einer ruhigen Stimme. »Hier spricht Dr. Trask von der Rechtsmedizin. Ich muss einen Mord melden.«
Detective J. D. Fitzpatrick betrachtete die kleine Menschenmenge, die sich hinter dem Absperrband versammelt hatte. Nachbarn, dachte er. Einige in Morgenmänteln und Pantoffeln. Einige waren alt, andere noch nicht so sehr. Manche weinten. Manche fluchten. Manche taten beides.
Er trat unauffällig näher. Es war klug zu lauschen, wenn der Schock den Menschen unbedachte Bemerkungen entlockte.
»Was für eine Bestie tut einem alten Mann so etwas Grausames an?« Die Stimme der jungen Frau war wütend. Sie hatte die Hände zu Fäusten geballt.
»Er hat doch keiner Fliege etwas zuleide getan«, sagte ein Mann neben ihr.
»Verdammte Gangs«, murmelte ein alter Mann, ohne sich an jemand Bestimmten zu wenden. »Man traut sich kaum noch aus dem Haus.«
J. D. fiel auf, wie gepflegt der Rasen des kleinen Parks aussah. Hier hatten die üblichen Gangs keine Spuren hinterlassen, aber auf der Fahrt waren sie unübersehbar gewesen. Wahrscheinlich war die Grünanlage eine Art unberührter Schutzraum inmitten der hässlichen Umgebung für die Anwohner gewesen. Was für eine Illusion. Das Hässliche war überall.
Und das wurde nun auch den Nachbarn des Toten bewusst. Es bedurfte keiner Gang, um einen Mord zu begehen. Ein Verbrecher allein reichte, vor allem wenn das Opfer alt, schwach und verwundbar war.
»Das wird Barb umbringen«, jammerte eine ältere Frau, die sich schwer an einen Mann lehnte. »Wie oft habe ich ihr gesagt, dass sie ihn in ein Heim geben soll? Herrgott, wie oft habe ich es ihr gesagt?«
»Ich weiß, Liebes«, murmelte der Mann. Er zog ihren Kopf an seine Schulter und hielt seine Hand so, dass ihr Blick vom Tatort abgeschirmt wurde. »Aber wenigstens ist Lucy hier.«
Die alte Frau nickte schniefend. »Sie weiß, was zu tun ist.«
Barb war vermutlich Frau oder Tochter des Opfers, aber J. D. fragte sich, wer Lucy war und in welcher Hinsicht sie wusste, was zu tun war.
Zwei uniformierte Polizisten standen Schulter an Schulter innerhalb des mit gelbem Band abgesperrten Bereichs. Der eine hatte sich den Nachbarn zugewandt, der andere dem Tatort. Gemeinsam bildeten sie eine Barriere, mit der sie das Opfer so gut wie möglich vor Blicken schützten. Auch das Team der Spurensicherung war bereits anwesend, schoss Fotos und sammelte Beweise. Nun würde es nicht mehr viel zu sehen geben, aber J. D. wusste, dass die gaffende Menge bereits zu viel gesehen hatte, bevor der Tatort gesichert worden war.
Auf J. D.s Frage deuteten zwei Uniformierte auf einen dritten Polizisten, der bei Drew Peterson, dem Leiter der Spurensicherung, stand. Er hieß Hopper, wie man J. D. mitteilte, und war als Erster am Tatort gewesen.
»Danke.« J. D. ging an den Polizisten vorbei und wappnete sich innerlich gegen das Bild, das ihn erwartete. Trotzdem musste er sich zusammenreißen, um nicht das Gesicht zu verziehen. Das Opfer saß auf einem im Boden verankerten Stuhl und war über einem steinernen Schachtisch zusammengesunken. Sein Gesicht war so schlimm zerschlagen worden, dass nicht mehr viel zu erkennen war. Wer hat dem alten Mann das angetan? Und warum?
Das Opfer trug einen beigefarbenen Trenchcoat, der bis zum Hals zugeknöpft und in der Taille gegürtet war. Die Hände steckten in den Taschen. Weder auf dem Mantel noch dem Stuhl war Blut zu sehen. Nur der Schädel und das Gesicht waren blutverschmiert.
Mit ernster Miene trat Officer Hopper auf ihn zu. »Ich bin Hopper.«
»Fitzpatrick, Morddezernat.« Auch nach drei Wochen in der Abteilung kam es J. D. noch immer seltsam vor, sich mit diesen Worten vorzustellen. »Sie haben auf den Notruf reagiert?«
Hopper nickte. »Das hier ist mein Revier. Das Opfer heißt Jerry Pugh. Achtundsechzig, weiß, männlich.«
»Sie kannten ihn also. Es tut mir leid«, murmelte J. D.
Wieder nickte Hopper. »Ja, mir auch. Jerry war harmlos. Und krank.«
»Er war dement, richtig?«, fragte J. D., und Hopper verengte überrascht die Augen.
»Ja. Woher wissen Sie das?«
»Eine Lady dort an der Absperrung erwähnte, sie hätte einer gewissen Barb immer wieder geraten, ihn in ein Heim einzuweisen.«
»Das war wahrscheinlich Mrs. Korbel, und sie hatte recht mit ihrem Rat. Ich war ebenfalls der Meinung. Aber Mrs. Pugh – Barb – wollte nichts davon wissen. Wahrscheinlich brachte sie es nicht übers Herz. Sie waren schon ewig miteinander verheiratet.«
»Wer hat die Leiche gefunden?«
Wieder blickte Hopper überrascht drein. »Sie.« Er deutete auf die andere Seite des abgesperrten Bereichs, wo eine Frau etwas abseits stand. Sie hielt mit undurchdringlicher Miene die Arme vor der Brust verschränkt, doch es ging eine deutlich spürbare Spannung von ihr aus. J. D. kam es vor, als könnte sie sich nur mühsam beherrschen.
Sie war groß, mindestens eins fünfundsiebzig, vielleicht sogar etwas größer. Das lange Haar, das sie zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, leuchtete rotgolden unter den hellen Scheinwerfern der Spurensicherung, und ihr Gesicht war hübsch und so klassisch konturiert, dass es als Modell für eine Statue hätte herhalten können. Aber vielleicht kam ihm dieser Gedanke bloß, weil sie so reglos dastand.
Sie trug eine Windjacke, enge Laufshorts und Hightech-Sportschuhe. Dass man ihr zugestand, so nah am Ort des Geschehens zu bleiben, ließ vermuten, dass sie mehr als nur eine Schaulustige war, aber er hatte sie noch nie gesehen. An dieses Gesicht hätte er sich erinnert.
Und an die Beine erst recht.
»Wer ist …«, setzte er an, doch in diesem Augenblick wandte sie den Kopf und begegnete seinem Blick.
Und als die schmerzliche Erinnerung aufblitzte, wusste J. D. genau, wer sie war. »Dr. Trask«, sagte er leise. Lucy Trask, die Pathologin. Lucy weiß, was zu tun ist. »Sie hat ihn gefunden?«
»Ja. Kurz vor Tagesanbruch«, sagte Hopper. »Dr. Trask ist … na ja, sie ist eine nette Lady, das ist alles.«
J. D. stellte fest, dass er sich räuspern musste. »Ja, ich weiß. Wo finde ich Mrs. Pugh?«
»Mein Partner, Rico, ist auf der Suche nach ihr. Wir haben an die Wohnungstür geklopft, aber sie hat nicht aufgemacht. Der Hausmeister hat mit dem Schlüssel gewartet, und kurz darauf war das ganze Haus hier unten auf der Straße. Alle, bis auf Mrs. Pugh. Rico hat die Wohnung durchsucht, aber sie war nicht da. Und ihr Wagen steht auch nicht auf dem Parkplatz.«
»Nichts in der Wohnung, das auf Gewaltanwendung hindeutet?«
»Nein. Rico meinte, es sähe aus, als sei sie verreist. In der Küche standen mehrere Näpfe mit Katzenfutter, und sämtliche Küchengeräte waren ausgestöpselt. Der Hausmeister versucht gerade, die Verwaltung zu erreichen, um in Erfahrung zu bringen, welche Notfalladressen angegeben sind.«
J. D. hatte Hopper zugehört, aber den Blick nicht von Dr. Lucy Trask genommen. Sie hatte sich abgewandt, aber er hatte den tiefen Kummer in ihren Augen gesehen.
»Holen Sie mir Rico ans Funkgerät«, wies er Hopper an. »Er soll den Notfallkontakt nicht anrufen. Geben Sie mir die Adresse. Ich will nicht, dass die Ehefrau schon informiert wird.«
Hopper zog die Brauen zusammen. »Barb Pugh hat nichts damit zu tun. Sie ist fast siebzig.«
»Sehe ich ein.« Es war unwahrscheinlich, dass eine Frau in dem Alter jemandem so verheerende Verletzungen zufügen konnte. »Ich muss zunächst jeden als potenziellen Verdächtigen behandeln, bis ich etwas anderes weiß.«
Die tiefe Falte zwischen Hoppers Brauen glättete sich. »Also gut. Ich rufe Rico über Funk.«
»Danke.« J. D. ging neben dem Opfer in die Hocke, um sich einen Eindruck aus der Nähe zu verschaffen. Der Täter hatte sich an Jerry Pugh regelrecht ausgetobt. Mit einem harten, stumpfen Gegenstand war unbarmherzig auf den Mann eingeschlagen worden, so dass von seinen Gesichtszügen nichts mehr zu erkennen war.
Zorn, dachte er. Vielleicht ein Drogenrausch. Was Menschen unter Einfluss von Betäubungsmitteln tun konnten, hatte er bei der Drogenfahndung zur Genüge erlebt. Das hier war kein gewöhnlicher Raubüberfall gewesen. Hier hatte jemand die Beherrschung verloren.
Drew Peterson von der Spurensicherung hockte sich neben ihn. »Hey, J. D., du bist aber schnell hergekommen. Bist du dein Haus draußen endlich losgeworden?«
J. D. und Drew waren direkt nach der Akademie demselben Revier zugewiesen worden, aber seit Maya gestorben war, hatten sie sich nicht mehr oft gesehen. J. D. hatte seitdem so gut wie niemanden mehr gesehen. Seine Arbeit beim Drogendezernat hatte ihn glücklicherweise stark beansprucht. Doch der Wechsel zur Mordkommission war ein deutlicher Einschnitt gewesen, ein Neustart, und sosehr er den alten Mann vor ihm auf dem Schachtisch auch bemitleidete, er freute sich auf die Veränderung.
»Von wegen.« Nachdem er ein frustrierendes Jahr lang versucht hatte, das Haus, das er mit seiner Frau geteilt hatte, zu verkaufen, stand er kurz davor, aufzugeben. »Hast du schon etwas herausgefunden?«
»Bisher nicht viel. Wir haben gerade erst die Fotos gemacht. Wir müssen erst die Leute von der Rechtsmedizin ihre Arbeit machen lassen, dann sind wir an der Reihe. Wo ist Stevie?«
»Unterwegs.« Sobald sie jemanden gefunden hatte, der auf ihre kleine Tochter aufpasste. J. D.s Partnerin Stevie Mazzetti war normalerweise für alle Fälle gewappnet, wenn sie Bereitschaftsdienst hatte, doch heute hatte ihr Babysitternetzwerk versagt. Aber J. D. machte es nichts aus, Stevie zu entschuldigen. Es war ausgesprochen selten nötig, denn normalerweise versah sie ihren Dienst tadellos. Ohnehin verdankte J. D. ihr viel.
J. D. deutete auf das Gras am Fuß des Tisches. »Er ist auf jeden Fall nicht hier getötet worden. Kein Blut auf dem Boden oder auf dem Mantel. Hast du schon eine Idee, wie man ihn hergebracht haben könnte?«
»Da fällt mir nur ein Rollstuhl ein. Wir haben Spuren im Gras gefunden und nehmen einen Abdruck, sobald wir können. Allerdings ist kein Rollstuhl gefunden worden. Wer immer ihn hier abgelegt hat, hat das Ding wieder mitgenommen.«
»Und keine Radspuren vom Weg bis hierher«, sagte J. D. »Er muss also getragen oder hergeschleift worden sein, so dass später jemand einen leeren Rollstuhl weggeschoben haben muss. Und wenn man das Opfer hergezerrt hat, dann müsste etwas an den Schuhen zu finden sein.«
»Falls ja, dann unter den Sohlen. Hast du dir die Schuhe schon angesehen?«, fragte Drew.
J. D. blickte unter den Schachtisch. Die Schuhe des Opfers waren blitzblank und poliert. »Keine Abschürfungen. Sieht nicht so aus, als hätte man ihn hergeschleift.«
»Weißt du, was solche Schuhe kosten?«
»Viel, nehme ich an.« Teuer sahen sie jedenfalls aus. Vielleicht waren sie sogar handgemacht. J. D. warf einen Blick über die Schulter zum Haus hinüber. Das Gebäude war zwar kein Sozialbau, aber das Ritz war es gewiss auch nicht. »Was er an Miete gespart hat, scheint er für Schuhe ausgegeben zu haben. Es wäre interessant herauszufinden, womit Mr. Pugh sein Geld verdient hat, bevor er demenzkrank geworden ist.«
»Der Doc wird’s wissen«, sagte Drew. »Sie wohnt auch in dem Haus.«
»Sie kannte ihn also persönlich?«, fragte er, und wieder nickte Drew. Das erklärte sowohl ihren Kummer als auch, warum sie ausgerechnet hier in diesem Park joggen ging. Sie stand noch immer reglos am Rand des Geschehens und starrte auf die Leiche. In ihm regte sich Mitgefühl. »Das muss ein ziemlicher Schock gewesen sein. Dann wird sie die Untersuchung also nicht machen?«
»Nein. Sie hat ein anderes Team angefordert. Aber sie scheint es mit Fassung zu tragen.«
»Gerade eben so«, murmelte J. D. »Ich werde Dr. Trask befragen und dann zusehen, dass ich die Witwe des Opfers und vielleicht Zeugen ausfindig machen kann. Ruf mich an, wenn ihr etwas findet.«
»Mach ich.«
Lucy Trask straffte sich, als er auf sie zukam. Ihre Augen waren zwar trocken geblieben, aber sie war sehr blass. Noch immer hielt sie den Blick auf den Toten gerichtet und sah nicht auf.
»Dr. Trask? Ich bin Detective Fitzpatrick.«
»Ich weiß«, sagte sie tonlos. »Sie sind Mazzettis neuer Partner. Wo ist Stevie?«
»Auf dem Weg. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen?«
»Sicher.« Ihre Lippen bewegten sich kaum, als sie sprach.
»Sollen wir uns in meinen Wagen setzen? Dort ist es bequemer.«
Ihre Kiefermuskeln verspannten sich. »Nein, ich möchte hier bleiben. Stellen Sie bitte einfach Ihre Fragen, Detective.«
Ihre Antwort klang ein wenig verärgert. Er konnte einen leichten Dialekt hören, nicht wirklich Südstaaten, aber aus der Stadt kam sie auch nicht. Zumindest nicht ursprünglich. »Okay. Sie kannten das Opfer?«
Sie nickte knapp, schwieg aber.
»Tut mir leid, Dr. Trask. Mir ist klar, wie schwierig das für Sie ist. Sie haben ihn gefunden?« Wieder nickte sie. »Wann?«
»Gegen halb sechs. Ich war laufen und sah Mr. Pugh hier auf dem Platz.« Sie sprach so emotionslos, als erstattete sie offiziell Bericht. »Ich dachte, er sei wieder einmal draußen herumgeirrt.«
»Er war dement«, sagte J. D., und endlich sah sie zu ihm auf. Ihre Augen waren von einem durchdringenden Blau, das man nicht leicht vergaß. Im Augenblick brannten sie vor Kummer, Zorn und Schock, aber er wusste, dass sie voller Wärme und Mitgefühl sein konnten. An diese Augen hatte er sich noch lange erinnert, nachdem er ihr zum ersten – und bis heute auch einzigen – Mal begegnet war.
Und damals hatte er nur ihre Augen gesehen. Der Rest von ihr war unter Maske und Kittel verborgen gewesen.
»Mr. Pugh hatte Alzheimer«, bestätigte sie.
»Wie oft verließ er seine Wohnung?«
Sie schien resigniert in sich zusammenzusacken. »In letzter Zeit drei- bis viermal die Woche. Barb musste auch irgendwann schlafen. Gewöhnlich war ich diejenige, die ihn fand, wenn er nachts unterwegs war.«
»Und Sie haben ihn dann nach Hause gebracht?«
»Ja.« Sie antwortete so leise, dass er sie kaum hören konnte.
»Ließ er sich immer anstandslos nach Hause bringen?«
»Ja. Er war nicht gewalttätig.«
»Aber es gibt Alzheimer-Patienten, die es sind«, bemerkte J. D.
Ihr Kinn hob sich fast unmerklich. »Ja, die gibt es. Aber er gehörte nicht dazu. Wir konnten ihn immer beruhigen.«
Sie hatte das Opfer also nicht nur einfach gekannt, dachte J. D. Sie hatte ihm nahegestanden. »Sie waren früh unterwegs heute Morgen.«
»Ja. Ich laufe immer vor Tagesanbruch.«
»Haben Sie das Opfer bereits hier sitzen sehen, als Sie losgelaufen sind?«
Sie warf ihm einen gereizten Blick zu. »Nein. Dann hätte ich ihn sofort nach Hause gebracht.«
»Er war also noch nicht da, als Sie Ihre Runde begonnen haben?«
Ihr Blick flackerte. Offenbar hatte sie erst jetzt verstanden, worauf er hinauswollte. »Oh. Das wäre möglich, aber ich hätte ihn ohnehin nicht gesehen. Ich fange auf der anderen Seite des Hauses an und umrunde einmal das ganze Viertel, bevor ich auf dem Rückweg durch den Park komme.«
»Haben Sie andere Personen gesehen?«
»Nur die anderen Läufer. Die Namen kenne ich aber nicht. Vielleicht weiß Officer Hopper mehr.« Sie warf ihrem Haus einen Blick zu. »Wo bleibt Officer Rico denn? Er wollte nach Barb sehen.«
»Es sieht so aus, als sei sie nicht mehr da.«
Entsetzt blickte Trask zu ihm auf. Ihre schmale Hand umklammerte seinen Arm. »Nicht mehr da? Was soll das heißen? Tot?«
Augenblicklich bereute er seine Wortwahl. »Nein, nein«, beruhigte er sie und legte seine Hand über ihre. Ihre Haut war eiskalt. Automatisch nahm er ihre Finger von seinem Ärmel und rieb sie, um sie zu wärmen. »Alles deutet darauf hin, dass sie fort ist. Verreist. Die Wohnung ist leer, ihr Auto steht nicht auf dem Parkplatz.«
Die Furcht verwandelte sich in Unglauben. Ihre Hand lag noch immer in seiner. »Nein. Barb würde ihn niemals allein lassen.«
»Aber sie ist fort.«
Nun befreite sie mit einem Ruck ihre Hand und trat einen Schritt zurück. Sie schien noch blasser zu werden. »Nein. Unmöglich! Sie würde ihn niemals freiwillig im Stich lassen. Jemand muss sie weggebracht haben. Oh, mein Gott!«
»Sie hat alle Küchengeräte ausgestöpselt«, sagte J. D. und beobachtete, wie seine Worte ihren Unglauben durchdrangen. »War das ihr übliches Vorgehen, wenn sie längere Zeit wegfuhr?«
Trask nickte betäubt. »Ja. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie ihn einfach allein gelassen hat. Sie hatte ihr ganzes Leben auf ihn ausgerichtet.«
»Manchmal tun Menschen unter Stress Dinge, die sie gewöhnlich nicht tun würden«, sagte J. D. vorsichtig. »Sich rund um die Uhr um einen Partner mit Alzheimer zu kümmern …«
»Nein!«, fuhr sie ihm ins Wort. Ihr Zorn verlieh ihrer Stimme Autorität. »Herrgott, nein, Detective. Mr. Pugh konnte sich nicht einmal selbst anziehen oder auch nur die Schuhe zu-« Sie hielt inne und zog die Brauen zusammen.
J. D. beugte sich leicht vor. »Auch nur die Schuhe?«, wiederholte er, um sie zum Weiterreden zu bewegen.
Aber sie ging bereits auf den Toten zu. »Seine Schuhe!«, sagte sie mit einem Blick über die Schulter zu ihm. »Mr. Pugh trägt Schuhe mit Senkeln.«
J. D. hastete ihr hinterher, um sie zurückzuziehen, falls sie der Leiche zu nahe kam, aber sie blieb stehen und ging genau an der gleichen Stelle in die Hocke wie er zuvor. Etwas war mit ihr geschehen, und sie wirkte nicht mehr länger wie betäubt. Nun umgab sie eine Energie, die die Luft zum Sirren zu bringen schien.
Fasziniert hockte er sich neben sie und musterte ihr Profil, während sie auf die Füße des Opfers starrte. Das Blut kehrte in ihr Gesicht zurück, und ihre Wangen färbten sich vor seinen Augen rosa.
Nein, dieses Gesicht hätte er niemals vergessen können.
»Mr. Pugh hat seit fünf Jahren keine normalen Schuhe mehr getragen«, murmelte sie und lenkte seine Aufmerksamkeit wieder zu dem Toten auf dem Stuhl. »Er trägt orthopädische Schuhe mit Klettverschlüssen. Barbs Finger sind zu steif, um Schleifen zu binden.«
»Vielleicht besitzt er mehrere Paar«, gab J. D. zu bedenken, aber sie schüttelte den Kopf.
»Das sind Ferragamos. So viel Geld hat Mr. Pugh nie gehabt, und wenn, dann hätte er es nicht für Schuhe ausgegeben.«
»Welchen Beruf hat er ausgeübt? Ich meine, vor … seiner Alzheimer-Erkrankung.«
Sie sah zu ihm auf, und ihr Blick war wachsam. Und hellwach. »Er war Musiklehrer an der Highschool und hat seine Schuhe bei J. C. Penney’s gekauft. Das hier ist nicht Jerry Pugh.«
Sie klang durch und durch überzeugt. »Was macht Sie da so sicher?«
»Die Schuhe haben außerdem die falsche Größe«, sagte sie. »Diese hier sind Größe zehn. Mr. Pugh hatte Größe zwölf.« Sie schloss die Augen. »O Gott. O Gott. Hat. Hat Größe zwölf. Er lebt. Das ist er nicht. Das hier ist er nicht!«
»Alles okay mit Ihnen, Dr. Trask?«
Sie nickte, aber sie zitterte und ballte die Hände zu Fäusten. »Ja, es geht mir gut.«
Dessen war er sich nicht so sicher, aber er konnte nur hoffen, dass sie wusste, wann sie in Ohnmacht fallen würde. »Woher kennen Sie Mr. Pughs Schuhgröße?«, fragte er.
»In meinem Beruf sieht man eine Menge Füße, Detective. Ich kann Größen einschätzen.«
Vor seinem geistigen Auge sah er die mit weißen Tüchern bedeckten Toten im Kühlraum des Leichenschauhauses, von denen nur die Füße mit den Kennkarten an den Zehen hervorlugten. »Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber woher kennen Sie ausgerechnet seine?«
Sie rollte in einer Geste des Unbehagens die Schultern. »Im Februar fand ich Mr. Pugh hier, genau auf diesem Stuhl. Er hatte ohne Schuhe das Haus verlassen, und seine Füße waren fast erfroren. Ich rief die Polizei, massierte ihm die Füße und versuchte, sie mit meinem Mantel zu wärmen. Daher weiß ich, welche Größe er hatte. Die Füße dieses Mannes hier sind zu klein. Der Tote ist nicht Mr. Pugh.«
»Was für eine nette Geste. Dem Mann die Füße zu massieren«, murmelte er.
»Das hätte jeder andere auch getan.«
Daran zweifelte er stark. »Sie nennen ihn Mr. Pugh, sagen aber ›Barb‹ zu seiner Frau. Warum?«
Sie stutzte. »Macht der Gewohnheit, nehme ich an. Das ist mir gar nicht aufgefallen.«
»Wie lange kennen Sie Mr. Pugh schon?«
»Zwanzig Jahre. Er war mein Lehrer. Auf der Highschool.«
Sie hatte zögernd geantwortet, als würde sie diese Information nur ungern preisgeben. Abrupt erhob sie sich, und er tat es ihr etwas gemächlicher nach. »Dieser Mann ist auch keine siebzig. Wäre ich nicht so abgelenkt gewesen, hätte mir das sofort auffallen müssen.«
»Deswegen dürfen Sie sich keine Vorwürfe machen«, sagte er, aber sie winkte ab.
»Er ist vielleicht fünfzig, wenn überhaupt, außerdem mindestens fünf Zentimeter größer.« Sie beugte sich über den Kopf des Toten. Getrocknetes Blut bedeckte seine Kopfhaut. »Immerhin ist er kahl wie Mr. Pugh – oder hat sich rasiert. Das weiß ich, sobald ich ihn auf meinem Untersuchungstisch liegen habe.«
»Okay. Nehmen wir an, Sie haben recht, und dieser Mann ist nicht Jerry Pugh. Wieso sind Sie zunächst davon ausgegangen?«
»Zum einen, weil er auf Mr. Pughs Stuhl saß.«
»Mr. Pughs Stuhl? Warum bezeichnen Sie ihn als ›seinen‹ Stuhl?«
»Wenn er die Wohnung verlässt, kommt er meistens hierher. Bevor er an Alzheimer erkrankt ist, war er ein ziemlich guter Schachspieler. Jeden Tag kam er nach der Schule her, und immer warteten schon Leute darauf, ihn vielleicht endlich einmal schlagen zu können.« Sie schüttelte sich leicht und deutete auf einen Tweedhut am Boden. »Und außerdem habe ich den da gesehen. Mr. Pugh hat so einen Hut. Als ich den Mann entdeckte, war ihm der Hut tief ins Gesicht gezogen. Er fiel ihm vom Kopf, als ich ihn an der Schulter berührte.« Sie hielt inne und biss sich auf die Unterlippe. »Mr. Pugh hat auch so einen Trenchcoat.«
J. D. runzelte die Stirn. Das gefiel ihm nicht. »Wer weiß, dass Mr. Pugh sich öfter hier aufhält?«
Langsam wandte sie den Kopf, bis sie seinem Blick begegnete. »Jeder aus unserem Haus. Jeder in jedem angrenzenden Haus. Er ist zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten durch die Gegend geirrt. Warum?« Auch wenn sie ihm die Frage stellte, war er sich sicher, dass sie die Antwort bereits wusste.
»Wer weiß, dass Sie morgens laufen?«
»Andere Läufer. Jeder, der um diese Zeit schon auf den Beinen ist. Warum?«, wiederholte sie.
»Weil er nicht hier umgebracht wurde. Drew glaubt, er sei mit einem Rollstuhl von Ihrem Haus aus hergefahren worden. Da hat sich jemand viel Mühe gemacht, damit er hier gefunden werden kann.«
»Sie meinen, jemand wollte, dass ich ihn finde.«
Genau das meinte er, aber er wollte nicht vorgreifen. »Bleiben wir zunächst einmal dabei, dass jemand sich viel Mühe gemacht hat, damit er gefunden wird.«
»Er hat die Hände in den Taschen«, hielt sie ruhig fest. »Sein Gesicht ist unkenntlich gemacht worden. Jemand wollte, dass er gefunden, aber nicht identifiziert wird. Ich schätze, dass die Fingerspitzen … verändert worden sind.«
»Oder nicht mehr vorhanden«, sagte J. D. grimmig.
»Oder das«, bestätigte sie ruhig. »Die Leichenstarre ist bereits vorbei. Er ist seit mindestens zwei Tagen tot. Nach der Untersuchung kann ich Genaueres sagen.« Sie beugte sich vor und betrachtete die Verletzungen im Gesicht des Toten. »Das hier wurde mit einem stumpfen Gegenstand ausgeführt. Ich kann Ihnen mehr sagen …«
»Wenn Sie ihn untersucht haben«, beendete er den Satz. »Dann sollten wir ihn abtransportieren. Ich würde gerne seine Taschen nach Papieren durchsuchen, aber ich befürchte, dass etwas ins Gras fallen könnte, das ein Beweis wäre. Können wir es tun, sobald Sie ihn im Leichenschauhaus auf dem Tisch haben?«
Einen Moment lang maß sie ihn mit Blicken. »Entweder hat Stevie Sie ausgebildet, oder Sie besitzen einfach eine gehörige Portion gesunden Menschenverstand. Eine Menge Cops würden von mir verlangen, dass ich ihn hier ablege.«
Ihre Anerkennung … tat ihm gut. Genau wie damals, als sie sich begegnet waren. Er glaubte nicht, dass sie sich daran erinnerte, und er hatte keine Eile, das Thema aufzubringen.
Eine Autotür schlug hinter ihnen zu, und sie blickten sich gleichzeitig um. Die Sanitäter schoben eine Bahre auf Rädern heran, auf der ein gefalteter Leichensack lag. »Ich war zwei Wochen lang nicht im Büro«, sagte Trask. »Wahrscheinlich hat sich ziemlich viel Arbeit angesammelt, so dass ich die Autopsie nicht gleich heute machen kann. Aber wenn Sie zum Leichenschauhaus kommen, können wir eine erste Untersuchung vornehmen und seine Taschen leeren.«
»Das wäre großartig. Wir versuchen in der Zwischenzeit, die Pughs ausfindig zu machen. Ich will mich vergewissern, dass es beiden gutgeht.«
»Danke. Ich ziehe mich um und mache mich an die Arbeit.« Sie warf noch einen Blick auf die zusammengesunkene Gestalt an dem Schachtisch. »Ich würde gerne glauben, dass ich nur zufällig vorbeigekommen bin. Dass dieser Mann, der dort liegt, wo ich ihn gefunden habe, nichts mit mir zu tun hat.«
»Aber das tun Sie nicht.«
»Sie?«
Er hätte sie gerne beruhigt, aber er wollte sie nicht anlügen. »Nein.«
Sie seufzte. »Ich auch nicht.«
Zwei
Nun, das war doch weit besser gelaufen, als er zu hoffen gewagt hatte. Er hatte den Atem angehalten und innerlich gebetet, dass Trask auch wirklich vorbeikommen, dass sie ihre übliche Strecke laufen würde.
Aber er hätte sich nicht sorgen müssen. Lucy Trask war so vorhersehbar wie die Sonne, die sie so verabscheute. Und so hatte sie den Schwanzlutscher gefunden, ganz wie er es geplant hatte.
Die Minuten, die sie im Glauben verbracht hatte, dass es sich um den alten Mann handelte, waren ein echter Genuss für ihn gewesen. Schade, dass sie schon bald begriffen hatte. Ich hätte ihm andere Schuhe anziehen müssen. Dummer Fehler. Gerne hätte ich ihre Seelenqual länger ausgekostet. Sie hängt also an diesem Alten, Mr. Pugh. Gut zu wissen.
Er musterte die beiden Detectives, die sich unterhielten. Der Mann war recht schnell am Tatort angekommen, die Frau war gerade erst eingetroffen. Nun, da er wusste, wer in diesem Fall ermittelte, konnte er einen Plan B ausarbeiten – indem er eine Ablenkung für den unwahrscheinlichen Fall inszenierte, dass er rasch verschwinden musste. Cops hatten Familien, und er hatte keinerlei Bedenken, diese für seine Zwecke zu nutzen. Wie sie es mit meiner getan haben.
Er würde seine Rache bekommen, Leiche für Leiche. Seine Lippen verzogen sich zu einem zufriedenen Lächeln. Der nächste Name auf seiner Liste war bereits abgehakt. Er konnte es nicht erwarten.
Lucy holte tief Luft, um sich zu beruhigen. Sie lehnte sich gegen den Transporter der Rechtsmedizin und schlüpfte in einen Overall. Ihr Herz hämmerte immer noch heftig. Es war nicht Mr. Pugh.
Aber wer dann? Und warum saß er dort auf Mr. Pughs Platz?
Damit ich ihn finde? Ein Schauder rann ihr den Rücken herab, als sie den Overall über ihre Laufkleidung zog und den Reißverschluss schloss. Es waren bereits einundzwanzig Grad, aber sie fror entsetzlich. Der Schock, dachte sie. Sie hatte am Fundort der Leiche fast hyperventiliert, vor allem gegen Ende hin.
Als sie die Hände gegeneinanderrieb, dachte sie daran, wie Detective Fitzpatrick sie zu wärmen versucht hatte. Eine sehr nette Geste war das gewesen. Und nützlich. Der Mann hatte Hände wie kleine Öfen.
Vielleicht war es ja seine Angewohnheit, Frauen, die Leichen gefunden hatten, die Hände zu reiben. Allerdings hatte er vermutlich noch nicht viele Gelegenheiten dazu gehabt. Stevie Mazzettis ehemaliger Partner war erst vor drei Wochen in Rente gegangen, und ihr neuer hatte bisher in einer anderen Abteilung gearbeitet. Er kam von der … Oh.
»Drogenfahndung«, sagte sie laut. Das kleine Mädchen. Vor zwei Jahren. Er war damals gekommen, um der Autopsie eines Kindes beizuwohnen, das im Kugelhagel eines Drogenkriegs gestorben war.
Und da habe ich ihn gesehen. Als er sie vorhin eindringlich gemustert hatte, während sie wiederum auf die Schuhe des Opfers gestarrt hatte, hatte sie versucht, sich zu erinnern. Und er ganz offensichtlich auch.
»Ganz recht«, murmelte eine weibliche Stimme zu ihrer Rechten. »Bei mir dürfte der Mann auch mal auf Fahndung gehen. Der ist ja ein echtes Rauschmittel.«
Lucy blickte auf und verdrehte die Augen. Ruby Gomez von der Rechtsmedizin glotzte Detective Fitzpatrick unverhohlen an. Er stand ein paar Autos weiter und unterhielt sich mit Stevie Mazzetti, die gerade eingetroffen war.
»Ruby«, zischte Lucy. »Starr den Mann doch nicht so an.«
Ruby regte sich nicht. »Und wieso nicht? Du hast doch damit angefangen.«
»Ich wollte ja auch nur feststellen, dass er vorher beim Drogendezernat gearbeitet hat.«
»Weiß ich. Eigentlich weiß ich alles über den Mann, was sich zu wissen lohnt.«
»Aha? Und was zum Beispiel?« Lucy wusste selbst, wie gereizt sie klang.
»Zum Beispiel, dass er scharf ist«, sagte Ruby und warf ihr einen amüsierten Seitenblick zu. »Was muss man denn noch wissen?«
»Zum Beispiel, dass wir jetzt arbeiten müssen. Da liegt ein Toter auf einem Schachtisch. Also konzentriere dich.«
»Das tue ich. Auf den lebendigen scharfen Typen, der einen wirklich netten Hintern hat«, erwiderte Ruby süffisant, dann seufzte sie. »Okay. Holen wir uns den Toten.« Sie schloss die Tür des Transporters und warf Fitzpatrick noch einen letzten Blick zu. »Aber der Bursche sieht wirklich gut aus.«
Lucy schüttelte den Kopf, obwohl sie innerlich zustimmte. J. D. Fitzpatrick war groß, dunkel und gutaussehend und bewegte sich auf faszinierende Art geschmeidig. Er war schlank, wo andere Polizisten behäbig waren, und strahlte großes Selbstbewusstsein aus. Fast wirkte er gefährlich, und dass er so freundlich war, machte ihn umso gefährlicher. Die attraktiven, arroganten Kerle waren leicht zu erkennen und zu umgehen. Die Netten dagegen huschten unter dem Radar durch und – pamm! Schon war’s geschehen. Sie hob ihren Instrumentenkoffer auf und setzte sich in Bewegung. »Männer, die so aussehen, machen immer mehr Ärger, als sie wert sind.«
»Auf lange Sicht gesehen, stimme ich dir absolut zu«, sagte Ruby, und ihre roten Lippen zuckten. »So einen würde ich nie und nimmer heiraten. Aber der direkte Nutzen macht den Ärger allemal wieder wett.«
Rot war Rubys Markenzeichen, denn sie war alles andere als dezent. Sie trug Rot auf den Lippen und auf den langen Fingernägeln, die sie am Ende jeder Schicht wieder aufklebte. Die Männer umschwirrten sie wie Drohnen ihre Bienenkönigin, und Ruby hielt nur allzu gerne Hof.
Lucy mochte sie. Sie hatten ein kameradschaftliches Arbeitsverhältnis, über das die meisten Leute in ihrem Umfeld den Kopf schüttelten. Öl und Wasser, hieß es. Es bedurfte keiner höheren Mathematik, um sich auszurechnen, wer von beiden was war. Ruby war grell, lebendig, quirlig. Lucy war zurückhaltend und still. Farblos.
Das dachten zumindest alle. Nicht einmal Ruby wusste, was Lucy tat, wenn sie das Büro verließ. Keiner wusste es. Und wenn es nach Lucy ginge, dann würde es auch niemand erfahren.
»Verschaff dir Ärger in deiner Freizeit«, sagte Lucy barsch. »Ich habe Detective Fitzpatrick versprochen, dass wir uns um den Burschen kümmern, sobald wir ihn im Kühlhaus haben. Wie viele Fälle habe ich heute überhaupt?«
»Vielleicht vier?«, antwortete Lucy geistesabwesend, während sie immer wieder über die Schulter schaute. »Er kommt. Detective Superscharf. Mit Stevie Mazzetti im Schlepptau.«
»Ruby!«, fauchte Lucy, und Ruby seufzte wieder.
»Das ist der Unterschied zwischen uns«, sagte sie.
»Was – dass ich professionell arbeite?«, fragte Lucy beißend.
Ruby grinste. »Das auch. Du musst mal unter Leute gehen, Kleines. Nicht alle Männer haben Schildchen am Zeh, weißt du?«
»Im Augenblick ist das Opfer meine Hauptsorge.«
Ruby schürzte die Lippen. »Jetzt sei doch nicht gleich so zimperlich.«
Lucy hielt inne. »Jemand wollte, dass ich den Toten finde«, erklärte sie leise. »Hat ihn so angezogen, dass ich denken musste, es handelte sich um jemanden, der mir etwas bedeutet. Herauszufinden, wer der Mann war und wie er gestorben ist, damit die Polizei den Täter findet, hat für mich deshalb Priorität.«
Ruby wurde sofort ernst. »Tut mir leid. Wie wär’s, wenn du schon ins Labor fährst? Alan und ich können ihn zum Transport fertig machen.«
»Wenn es ein Freund gewesen wäre, dann hätte ich dich darum gebeten, aber er ist keiner, und die Cops brauchen rasche Antworten.«
Ruby nickte. »Dann an die Arbeit.«
»Danke.«
Also gesellte sich Ruby zu Alan Dunbar, ihrem Kriminaltechniker, konnte sich aber nicht verkneifen, immer wieder zu Fitzpatrick hinüberzublicken. Auch Lucy war versucht, einen letzten Blick zu riskieren, beherrschte sich aber. Sie hatte zu arbeiten.
»Lucy? Was ist hier los? Geht’s dir gut?«
Die Stimme hinter ihr war ihr so vertraut wie ihre eigene, und als Lucy sich umwandte, senkte sie ihren Blick automatisch. Mit ihren knapp über eins fünfzig war Gwyn Weaver mindestens fünfundzwanzig Zentimeter kleiner als Lucy – ohne Schuhe. Mit Arbeitsstiefeln überragte Lucy sie um einiges mehr.
Lucy war überrascht, dass ihre beste Freundin so lange gebraucht hatte, um hier aufzutauchen. Gwyn drängte sich normalerweise immer in die erste Reihe. Nun klang ihre sonst so weiche Stimme schrill und panisch, und instinktiv begann Lucy, sie zu beruhigen.
»Alles okay. Ich …« Überrascht unterbrach sie sich, als sie sah, wer neben Gwyn stand. »Royce.« Royce, der auf ihren Overall starrte, auf dessen Rücken groß die Buchstaben ME für Medical Examiner prangten. Royce, der sie nur aus dem Club kannte. »Ihr … ihr seid beide hier.«
Mist. Als Gwyn in die gleiche Apartmentanlage gezogen war wie sie, war Lucy klar gewesen, dass dieser Tag kommen, dass Gwyns Freund sie irgendwann in ihrer Arbeitskleidung sehen würde. Aber sie hatte erwartet, dass er sie in ihrem adretten Kostüm sehen würde, nicht in Schutzkleidung. Und ganz sicher hatte sie nicht erwartet, dass das heute Morgen geschehen würde.
Obwohl sie es hätte ahnen können. Die beiden hatten sie gestern Abend so spät vom Flughafen abgeholt, dass es für Royce natürlich praktischer gewesen war, bei Gwyn zu übernachten. An jedem anderen Morgen hätte es nichts ausgemacht. Heute schon.
»Er weiß es, Lucy«, flüsterte Gwyn. Sie blickte Lucy fragend an, während die Sorge aus ihrer Miene wich. »Ich musste es ihm sagen. Aber er wird nichts verraten.«
»Versprochen«, sagte Royce, der ihren Beruf anscheinend locker sah. »Ich gehe also davon aus, dass du nicht wegen einer Verkäufertagung in Kalifornien warst.«
»Nein«, gab Lucy zu. »Es war ein Symposium zur forensischen Pathologie.«
»Aber warum die Lüge?«, fragte er, eher neugierig als verärgert.
»Weil manche Leute nicht mit dem umgehen können, was ich mache. So ist es einfacher.«
»Das kann ich allerdings verstehen«, sagte er mit einem aufmunternden Lächeln. »Was ist hier passiert?«
Gwyn versuchte, an Lucy vorbeizublicken. »Die Nachbarn behaupten, es handele sich um Mr. Pugh. Aber du stehst hier im Arbeitsoverall und wirkst nicht traurig, also kann er es nicht sein.«
»Zuerst dachte ich, er sei es, aber dem ist nicht so. Wir wissen nicht, um wen es sich handelt.«
»Aber du bist sicher, dass es nicht Mr. P. ist?«, fragte Gwyn so aufrichtig besorgt, dass sich Lucys Missmut in nichts auflöste.
»Ganz sicher. Schaut mal, Leute, ich muss jetzt arbeiten. Wir sprechen uns später, okay?«
»Heute Abend«, sagte Gwyn und warf ihr einen vielsagenden Blick zu. »Wir haben dich alle vermisst.«
Und sie hatte die anderen vermisst. Lucy war noch nie so lange fort gewesen, und jeden Abend hatte sie sich gefragt, wie es wohl den anderen ging. »Ich versuch’s. Aber vielleicht muss ich Überstunden machen.«
»Weswegen wir sie jetzt arbeiten lassen sollten«, sagte Royce zu Gwyn. »Komm schon. Du hast gesehen, was los ist, also kannst du auch wieder zurück ins Bett gehen.« Er schenkte Lucy ein freundliches Lächeln und drückte ihre Schulter. »Wenn du etwas brauchst, sag Bescheid. Ich bin froh, dass es nicht dein Bekannter war.«
»Danke.« Sie sah ihnen nach, als sie davongingen. Royce hatte einen Arm um sie gelegt, und Gwyn wirkte klein und puppenhaft an seiner Seite. Der Anblick versetzte Lucy einen Stich. Bei jedem Mann hoffte Gwyn, dass es der Richtige war, aber bisher hatte es nicht funktioniert. Diesmal jedoch mochte sie recht haben. Aber dann bin ich wieder allein.
Worüber ich mir später Sorgen machen kann. Jetzt los!
Als sie bei der Leiche angekommen war, stellte sie ihren Koffer neben der Bahre ab, auf der Alan bereits den Sack ausgebreitet hatte. Er stand abwartend da, betrachtete den Toten und wirkte etwas grünlich im Gesicht. »Da war aber jemand richtig mies drauf.«
»Allerdings.« Lucy hatte ein schlechtes Gewissen. Alan war noch nicht lange bei ihnen und hatte bisher keine derart schlimm zugerichtete Leiche sehen müssen. »Ich hätte dich vorwarnen sollen.«
»Schon gut. Ich habe gehört, dass du ihn zuerst für einen Freund gehalten hast. Zum Glück war er das ja nicht.«
»Ja, zum Glück«, murmelte sie. Sie streifte ein Paar Handschuhe über und bedeutete Alan und Ruby, es ihr nachzutun. »Die Totenstarre hat sich bereits gelöst, also wird er schlaff sein. Passt auf, dass die Hände in den Taschen bleiben.«
»Warum?«, wollte Alan wissen.
»Sein Gesicht ist hinüber, Schätzchen«, erklärte Ruby. »Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass seine Hände es ebenfalls sind.«
»Oh.« Alan schluckte hart. »Okay.«
Lucy berührte behutsam den Kopf des Opfers und musterte das getrocknete Blut stirnrunzelnd.
»Was ist?«, fragte Fitzpatrick.
Lucy sah auf. Er und Mazzetti standen ein paar Schritte entfernt. »Etwas stimmt nicht mit der Konsistenz des getrockneten Blutes. Aber ich kann Ihnen bereits sagen, dass der Schädel rasiert wurde.«
Stevie beugte sich vor, um besser zu sehen. Sie war eine zart gebaute Brünette, die mit ihren vierunddreißig ein Jahr jünger als Lucy war, aber sehr viel älter wirkte. »Alles okay mit Ihnen?«, fragte sie Lucy. »Ich habe gehört, dass Sie das Opfer für einen Bekannten gehalten haben. Wir können einen anderen Pathologen anfordern.«
»Nein, nicht nötig.« Lucy brachte ein Lächeln zustande. Sie hatte einen Höllenrespekt vor Stevie, aber ihr gruselte vor der ehrenamtlichen Nebenbeschäftigung der Frau, die trauernden Menschen half, ihre Gefühle zu bewältigen. Der Gedanke ließ sie stets schaudern. Immer dieser Fokus auf den Tod. Wenn jemand tot war, war er tot. Wer wusste das besser als sie? Aber Woche um Woche darüber zu reden, brachte nichts und war einfach nur unheimlich. »Aber danke.«
Stevie lächelte, dann straffte sie sich und war wieder ganz Detective. »Hatte er Papiere dabei?«
Lucy klopfte die Taschen des Mantels ab und schnitt ein Gesicht, als sie nichts spürte, wo Knochen hätten sein müssen. »Keine Brieftasche. Und auch keine Finger.«
»Gar keine?«, fragte Fitzpatrick.
»An der linken Hand fehlen sie ab dem zweiten Knöchel. Rechts auch. Außer …« Sie fühlte einen einzelnen Finger durch den Mantel. »Er hat seinen Ringfinger noch.« Sie sah auf und stellte fest, dass Fitzpatrick sie eindringlich anblickte. Sie hielt den Atem an. Detective Superscharf hatte Ruby ihn genannt. Und ob. Leise atmete sie aus. »Und er trägt einen Ring.«
Drew Peterson hockte sich neben sie, und sie konnte sich wieder konzentrieren. »Können wir ihn abmachen, sobald er im Sack liegt?«
»Wir können es versuchen.« Sie betastete die Beine des Opfers durch den Stoff der Hose und verzog erneut das Gesicht. »Mehrfach gebrochen. Die Knie fühlen sich zertrümmert an. Anscheinend hat man den Kerl gefoltert.«
»Ich hasse Folter«, murmelte Stevie.
»Ich könnte mir vorstellen, dass er sie noch mehr gehasst hat«, sagte Fitzpatrick trocken.
Lucy trat von der Leiche zurück. »Alan, Ruby, er gehört euch.«
Ruby war Profi, aber Alan wirkte angeschlagen, was Lucy ein wenig Sorgen bereitete. Mit Argusaugen passte sie auf, dass nichts zu Boden fiel, als sie die Leiche anhoben. Plötzlich rann ihr wieder ein Schauder über den Rücken. Doch dieses Mal war ihr nicht kalt – ganz im Gegenteil. Fitzpatrick stand hinter ihr und strahlte Wärme aus.
»Ich habe die Pughs ausfindig gemacht«, sagte er leise. Er hatte sich vorgebeugt, um ihr ins Ohr zu flüstern, und sein Atem kitzelte sie. »Es geht ihnen gut.«
Die Kombination aus Erleichterung und seiner Nähe brachte ihre Knie zum Zittern, aber sie ließ sich nichts anmerken und hielt den Blick stur auf Ruby und Alan gerichtet. »Vielen Dank. Wo sind sie?«
»Die Notrufnummer, die der Hausverwalter hatte, gehörte Mrs. Pughs Schwester. Sie sind seit zwei Tagen dort. Ich schicke einen Streifenwagen hin. Sie sollen sich vergewissern, dass alles seine Ordnung hat.«
»Danke. Ich war selbst zwei Wochen nicht in der Stadt, und als ich gestern Abend nach Hause kam, war es zu spät, um nach ihnen zu sehen. Mir war nicht klar, dass sie verreist sind, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Barb besucht ihre Schwester häufig.«
Er schwieg einen Moment. Noch immer stand er zu dicht bei ihr. »Wer wusste, dass Sie unterwegs waren?«
Sie dachte darüber nach, dass ihre Nachbarn die zwei Wochen Stille während ihrer Abwesenheit genossen hatten. »Alle im Haus und alle bei der Arbeit. Ich war zuerst auf einem Symposium und habe dann an einer Universität in L.A. Vorlesungen gehalten.«
»Sie haben nicht zufällig bei Facebook oder anderswo etwas zu Ihrer Reise gepostet?«
Indigniert sah sie sich halb nach ihm um. »Natürlich nicht.«
Seine Nase war nur ein paar Zentimeter von ihrer entfernt. Aus dieser Nähe konnte sie sehen, dass seine Augen dunkelblau waren, nicht schwarz, wie sie bisher gedacht hatte. »Das kommt oft genug vor«, sagte er.
»Es gibt genug dumme Leute. Ich gehöre nicht dazu.«
»Argh!« Alans Grunzen ließ alle Köpfe herumfahren. Die Hände des Opfers waren beim Anheben aus den Taschen gerutscht, aber zum Glück nur auf den geöffneten Leichensack gefallen, so dass keine potenziellen Beweisstücke im Gras gelandet waren.
»Wie Sie gesagt haben«, sagte Fitzpatrick grimmig, als alle näher an die Bahre herantraten. »Nur noch der Ringfinger inklusive Ring. Ohne die Fingerspitze.«
»Die Zähne sehen ebenfalls zertrümmert aus«, sagte Lucy. »Ich fürchte, wir werden ihn nicht identifizieren können.«
»Der Ring am Finger verweist auf seine Identität«, sagte Stevie. »Wer immer das hier getan hat, hat ihn aus einem bestimmten Grund am Finger gelassen. Können Sie ihn abnehmen?«
Lucy zog den Ring ab und hielt ihn ins erste Licht des Morgens. »University of Maryland Medical School«, las sie.
Fitzpatrick runzelte die Stirn. »Jetzt wüsste ich nur gern, was der Doc getan hat, dass man ihm die Knie zu Brei geschlagen hat.«
Lucy ließ den Ring in die Beweistüte fallen, die Drew ihr hinhielt, dann zupfte sie vorsichtig am Ärmel des Opfers und enthüllte eine goldene Armbanduhr. »Eine Rolex.« Sie zog auch sie ab und legte sie in Fitzpatricks mittlerweile latexbewehrte Hand.
»Auf jeden Fall kein Raubüberfall«, sagte er und betrachtete die Rückseite. »Hier steht: ›Danke für die Büste.‹ Aber das Wort ist … Moment mal.« Er blinzelte und musterte die Gravierung eingehend. Plötzlich verdrehte er die Augen. »Okay, wohl eher ›Danke für die Brüste‹.«
»Ich würde sagen, wir suchen nach einem Schönheitschirurgen«, stellte Ruby trocken fest, und Lucy hatte das schreckliche Bedürfnis, laut loszuprusten. Zum Glück gelang es ihr, sich zu beherrschen. Das war einfach nicht lustig.
»Ein Schönheitschirurg, der jemandem mächtig auf die Zehen getreten ist«, sagte Fitzpatrick.
»Dr. Trask«, meldete Alan sich zu Wort. »Er hat etwas im Mund.«
Der Gegenstand war schmutzig und weiß und sah aus wie ein altes Taschentuch. Stevie und Fitzpatrick beugten sich vor, aber Lucy hielt eine Hand zwischen sie und den Toten. »Ich muss das unter Schutzatmosphäre entfernen.«
Fitzpatrick richtete sich mit finsterer Miene auf. »Ich weiß, ich weiß – im Leichenschauhaus. Hören Sie, wir finden zwar wahrscheinlich nichts, aber sehen Sie doch bitte nach, ob nicht vielleicht doch eine Brieftasche in der Brusttasche steckt.«
»Das kann ich machen.« Lucy tastete die Brust des Mannes mit den Fingerspitzen ab, verharrte aber, als sich alles daran fürchterlich falsch anfühlte.
»Was jetzt?«, fragte Stevie in einem Tonfall, der besagte, dass sie es eigentlich gar nicht wissen wollte.
Lucy drückte etwas fester gegen den beigefarbenen Mantel, um sich noch einmal zu vergewissern. Doch wieder fand sie keinen Widerstand dort, wo die Rippen hätten sein müssen. Das ist wirklich gar nicht gut.
»Das sollte eigentlich nicht so sein, nicht wahr?«, fragte Fitzpatrick unumwunden. »Ich meine, dass Ihre Finger so tief einsinken.«
»Nein, sollte es nicht.« Sie schaute auf. »Ich weiß nicht, ob das die Todesursache war oder nicht, aber da, wo sein Herz sein sollte, ist nur noch ein großes Loch.«
Stevie stieß geräuschvoll den Atem aus. »Tja, wie mir scheint, ist der Bursche gerade auf Ihrer Prioritätenliste nach ganz oben gerutscht.«
Lucy nickte. »So ist es.«
Clay Maynard legte mit finsterer Miene auf. Er hatte eine höllische Nacht hinter sich, und der Morgen schien nicht wesentlich besser zu werden.
»Und?«, fragte seine Assistentin von der Bürotür aus.