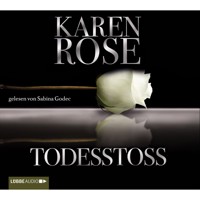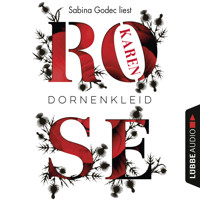9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Baltimore-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Vergangenheit vergibt nicht: Teil 6 der furiosen Thriller-Reihe aus Baltimore von Bestseller-Autorin Karen Rose Ein Mordanschlag, dem sie nur knapp entkommen ist, hat Strafverteidigerin Gwyn Weaver zu einer toughen Frau werden lassen. Trotzdem ist sie kurz davor, ihrem Freund und Kollegen Thomas Thorne ihre Gefühle zu offenbaren. Doch dann findet man den Anwalt neben der Leiche einer Frau, ihr Blut an seinen Händen. Thomas kann sich an nichts erinnern. Gwyn, die an seine Unschuld glaubt, setzt alles daran, ihrem Freund zu helfen. Keiner von beiden ahnt, dass dies erst der Anfang eines gnadenlosen Rachefeldzugs ist: Jemand ist gekommen, um Thomas alles zu nehmen – vor allem jene, die er liebt ... Der Abschluss der Baltimore-Reihe – ein echter Blockbuster Auch in »Todesnächte«, dem 6. Thriller ihrer Baltimore-Reihe, besticht Karen Rose mit einer spektakulären Mischung aus rasanter Action, hartem Thrill und einem wohl dosierten Schuss Romantik. Karen Roses Thriller-Reihe aus Baltimore umfasst die folgenden Bände: - Band 1: "Todesherz" - Band 2: "Todeskleid" - Band 3: "Todeskind" - Band 4: "Todesschuss" - Band 5: "Todesfalle" - Band 6: "Todesnächte"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 945
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Karen Rose
Todesnächte
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Brandl
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Vergangenheit vergibt nicht
Teil 6 der furiosen Thriller-Reihe aus Baltimore von Bestseller-Autorin Karen Rose
Ein Mordanschlag, den sie nur knapp überlebt hat, hat Strafverteidigerin Gwyn Weaver zu einer toughen Frau werden lassen. Trotzdem ist sie kurz davor, ihrem Freund und Kollegen Thomas Thorne ihre Gefühle zu offenbaren. Doch dann findet man den Anwalt neben der Leiche einer Frau, ihr Blut an seinen Händen. Thomas kann sich an nichts erinnern.
Gwyn, die an seine Unschuld glaubt, setzt alles daran, ihrem Freund zu helfen. Keiner von beiden ahnt, dass dies erst der Anfang eines gnadenlosen Rachefeldzugs ist: Jemand ist gekommen, um Thomas alles zu nehmen – vor allem jene, die er liebt …
Auch in »Todesnächte«, dem 6. Thriller ihrer Baltimore-Reihe, besticht Karen Rose mit einer spektakulären Mischung aus rasanter Action, hartem Thrill und einem wohl dosierten Schuss Romantik.
»Die Charaktere sind überzeugend, die Mordfälle spektakulär und es gibt sogar ein bisschen Romantik – eine perfekte Mischung!«
Radio Euroherz über »Todeskleid«
Die Thriller der Baltimore-Reihe sind in folgender Reihenfolge erschienen:
• Todesherz• Todeskleid• Todeskind• Todesschuss• Todesfalle• Todesnächte
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Epilog
Dank
Karen Rose bei Knaur
Eine Liste aller Karen-Rose-Romane in chronologischer Reihenfolge:
Verzeichnis der auftretenden Figuren in den Romanen von Karen Rose
Für Robin Rue, die an mich glaubt, wenn ich an mir zweifle.
Und, wie immer, für Martin.
Ich liebe dich.
Prolog
Neunzehn Jahre zuvor
»Gib mir endlich den verdammten Schlüssel, Sherri«, sagte Thomas.
Sherri Douglas verdrehte die Augen, schloss die Fahrertür ihres alten Ford Escort ab und warf ihm den Schlüssel über den zerschrammten Lack des Wagendachs hinweg zu. »Hier.«
Plötzlicher Schmerz verzerrte Thomas’ finsteres, von violetten Malen übersätes Gesicht, als er reflexartig den Arm hob und den Schlüssel auffing. Er erstarrte kurz, dann ließ er den Arm mit einem scharfen Atemzug sinken. »Scheiße!«
»Oh, tut mir leid, Tommy. Das war echt blöd von mir.« Sherri bereute ihre Gedankenlosigkeit sofort.
Thomas setzte eine neutrale Miene auf und schürzte die Lippen, entspannte sie jedoch sofort wieder, denn auch sie hatten einiges abbekommen.
Sherri wäre am liebsten in Tränen ausgebrochen. Sein wunderschönes Gesicht war … immer noch eine Augenweide. Aber übel zugerichtet. Der Anblick seiner Verletzungen ließ ihr das Herz bluten. Sie wünschte, sie könnte auf irgendetwas einschlagen. Auf jemanden. Genauer gesagt, auf vier Typen. Mit zusammengekniffenen Augen rief sie sich die Gesichter der Jungen ins Gedächtnis, denen er all das hier zu verdanken hatte. Sie hasste sie, alle miteinander. Sie rammte ihre zu Fäusten geballten Hände in die Jackentaschen. Sie zu verprügeln würde Thomas auch nicht weiterhelfen.
Und ihr Vater würde sie umbringen, wenn auch sie noch Ärger bekäme, zumal er ohnehin alles andere als begeistert darüber war, dass sie mit einem weißen Jungen zusammen war. Ha! Ein weißer Junge. Wäre es nicht so traurig und frustrierend, könnte man sich glatt totlachen. Thomas war zu schwarz, um in der Schule akzeptiert zu werden, aber eindeutig nicht schwarz genug für ihren Vater. Wenigstens hatte er ihr nicht verboten, sich mit ihm zu treffen – falls doch, hätte Sherri sich sowieso nicht daran gehalten. Aber was, wenn auch sie jetzt vom Unterricht suspendiert wurde, so wie Thomas? Sollte es dazu kommen, würde ihr Vater dafür sorgen, dass sie sich niemals wiedersahen.
Suspendiert. Sie hatten ihn suspendiert! Sie konnte es immer noch nicht fassen. Wie unfair!
»Hör sofort auf, dich als blöd zu bezeichnen!«, sagte Thomas leise.
Sie blinzelte verwirrt, ehe der Groschen fiel. Dabei war es tatsächlich dämlich gewesen, das abrupte Auffangen von ihm zu erzwingen. »Ich hätte daran denken müssen«, erwiderte sie. Denn nicht nur sein Gesicht war in Mitleidenschaft gezogen worden, sondern sie hatten auch auf seine Arme und Beine eingeprügelt. Mit zusammengebissenen Zähnen kämpfte sie erneut gegen ihre aufsteigenden Tränen an.
Sie hatten ihm wehgetan. Diese elenden Dreckschweine. Sie hatten ihn verletzt.
Thomas schüttelte den Kopf. »Ist schon gut, ich werd’s überleben.« Er trat um den Wagen herum und streckte ihr resigniert die Schlüssel hin. »Bitte, Sherri, gib mir den richtigen Schlüssel. Ich bin zu fertig für diese Spielchen. Ich will nur da rein, meinen Bass holen und dann abhauen. Steig ein und lass den Motor laufen, damit du nicht auskühlst.«
Wieder füllten sich ihre Augen mit Tränen, und diesmal konnte sie sie nicht zurückhalten. »Ich gehe mit dir rein«, flüsterte sie eindringlich.
Er zog die Brauen hoch und presste seine aufgeplatzten Lippen aufeinander. »Vergiss es!«
»Ich …« Ihre Stimme brach. Hilflos sah sie ihn an. Er war so groß und kräftig und so … anständig. So viel anständiger als diese verdammten Mistkerle. Hätte er nur einem Gegner gegenübergestanden, wäre die Sache anders ausgegangen. Mit seinen über ein Meter neunzig war er der Größte und auch der Stärkste in seiner Klasse. Aber sie waren zu viert auf ihn losgegangen. Zu viert! Sie hatten ihn zusammengeschlagen, aber ihm hatte man die Schuld gegeben. Er hatte die Strafe aufgebrummt bekommen und die Suspendierung kassiert.
Weil Richard Linden – selbst im Geist kam der verhasste Name nur zischend über ihre Lippen – sich einbildete, er könne die Stipendiatinnen befummeln, wann immer es ihm in den Kram passte. Nur weil wir arm sind und er nicht. Und weil Thomas den Anblick der völlig verängstigten Angie nicht ertragen hatte, als Richard sie gegen die Wand gedrückt und betatscht hatte. Er hatte ihn von ihr weggerissen, woraufhin sich Richard und seine Vollidioten von Kumpels auf ihn gestürzt und ihm die Seele aus dem Leib geprügelt hatten.
Und am Ende hatte der Rektor Thomas die Schuld gegeben. Was für ein Schock! Dr. Green tanzte nach der Pfeife der Lindens, weil die vor Geld stanken. Und weiß waren. Und Thomas, Angie und ich eben nicht. Und um alles noch schlimmer zu machen, war es Richard oder einem seiner Jungs gelungen, Angie am Ende auch noch einzuschüchtern, denn sie behauptete plötzlich steif und fest, Richard hätte sie nie angerührt.
Und deshalb war Thomas bestraft worden. Dabei hatte er sich so angestrengt, um sich die besten Voraussetzungen fürs College zu erarbeiten. Er war auf ein Stipendium angewiesen gewesen. Aber jetzt? Ihm blieb nichts anderes übrig, als die Highschool in seinem Viertel zu besuchen, weil der Schulverweis für immer in seiner Akte verzeichnet bleiben würde. Und damit war keineswegs gewährleistet, dass eines der renommierten Colleges ihn überhaupt noch nehmen würde.
Richard und seine beschissenen Freunde hatten Thomas’ Zukunft zerstört, doch sie, Sherri, würde dafür sorgen, dass sie nicht noch größeren Schaden anrichteten. Sie blinzelte, woraufhin sich eine Träne aus ihrem Augenwinkel löste und ihr über die Wange kullerte. »Ich gehe mit dir rein«, sagte sie. »Wir müssen ja nur in den Übungsraum, alles halb so wild.«
»Wenn sie dich erwischen, suspendieren sie dich auch noch«, sagte er, legte seine Pranke um ihr Kinn und wischte ihr zärtlich die Tränen ab. »Das lasse ich nicht zu.«
»Dir hätte es genauso wenig passieren dürfen. Es ist so unfair, Tommy.« Sie biss sich auf die Lippen, um ihre Tränen zurückzuhalten, weil sie wusste, dass es ihn fertigmachte, sie weinen zu sehen.
Er holte tief Luft. »Stimmt.«
»Wir müssen uns wehren. Du musst dich wehren. Was du getan hast, war richtig. Du hast Angie beschützt. Du warst ein Held.«
»Aber sich zu wehren, ist doch sinnlos.«
Sie sah ihn eindringlich an. »Wir könnten sie verklagen.«
Er stieß ein ungläubiges Lachen aus. »Was? Vergiss es!«
Sie verschränkte ihre Finger mit seinen und blickte auf ihrer beider Hände, ihre eigene dunkel, seine ein paar Töne heller. »Wir könnten uns einen Anwalt nehmen.«
»Wovon denn?«, spottete er. »Willy zählt jeden verdammten Bissen, den ich mir in den Mund schiebe. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass er mir einen Anwalt bezahlen würde.«
Thomas’ Stiefvater war ein brutales Schwein, ein Dreckskerl, der keinen Hehl daraus machte, dass er seinen Stiefsohn für den letzten Loser hielt. Allein beim Gedanken an ihn stellten sich Sherri sämtliche Nackenhaare auf.
Dabei war Thomas besser als alle zusammen – genau deshalb liebte sie ihn von ganzem Herzen.
»Wir könnten uns auch an die Bürgerrechtsunion wenden.«
»Vergiss es«, wiegelte Thomas ab. »Ich verklage niemanden. Vor Gericht lässt sich sowieso nichts lösen.«
»Das stimmt nicht.« Wieder hatte sich ein verräterisches Zittern in ihre Stimme geschlichen. »Tommy, wir reden hier von deinem Leben.«
Erschöpft beugte er sich herunter, bis sich ihre Stirnen und Nasen berührten – eine Maori-Geste, die er von seinem leiblichen, lange verstorbenen Vater gelernt hatte, dessen Andenken er bis heute im Herzen trug.
Mit ihren gerade mal ein Meter zweiundfünfzig musste Sherri sich auf die Zehenspitzen stellen, um zu hören, was Tommy ihr ins Ohr flüsterte. »Mit den Lindens kann ich es nicht aufnehmen, Sher, das weißt du genauso gut wie ich. Keiner würde mir jemals den Rücken stärken. Keiner außer dir.«
»Aber vielleicht einige Lehrer. Coach Marion oder Mr Woods …« Der Fußballtrainer mochte Thomas, ebenso wie ihr Geschichtslehrer.
Er schloss die Augen und schüttelte den Kopf, sodass seine Stirn gegen ihre rieb. »Das kannst du vergessen.«
»Woher willst du das wissen?«
Er sog gequält den Atem ein. »Weil es eben so ist«, stieß er barsch hervor und seufzte dann. »Sie hatten die Gelegenheit ja schon am Donnerstag.«
»Sie haben die Jungs von dir weggezogen«, murmelte sie. »Und dann sind sie mit dir zum Direktor gegangen.«
Wobei Thomas den Weg nicht auf seinen Füßen zurückgelegt hatte – ihm war schwindlig von all den Tritten gewesen, außerdem hatte er gehumpelt, weil einer der Jungs ihm mit dem Stiefel wieder und wieder aufs Knie getreten hatte. Coach Marion und Mr Woods hatten ihn förmlich hinschleifen müssen.
»Sie hatten die Gelegenheit gehabt, Dr. Green zu sagen, was passiert ist, haben es aber nicht getan.« Thomas zuckte die Achseln. »Woods wollte es auch, aber Green hat ihn beiseitegenommen und ihm etwas von wegen Vertragsverlängerung erzählt.«
Sherri riss die Augen auf. »Er hat Mr Woods mit Kündigung gedroht?«
»Ja. Und ich nehme an, dasselbe hat er mit Coach Marion getan, denn er hat genauso wenig Partei für mich ergriffen. Und die beiden waren meine einzigen Verbündeten.« Wieder schüttelte er niedergeschlagen den Kopf. »Miss Franklin hätte erlauben können, dass du meinen Bass schon am Freitag mitnimmst, verdammt noch mal. Jetzt müssen wir auch noch ins Schulgebäude einbrechen, um ihn zu holen. Dr. Green hat sie bestimmt auch unter Druck gesetzt, jede Wette.«
So paranoid es auch klingen mochte, es entsprach leider den Tatsachen.
Miss Franklin hatte es sogar zugegeben, als sie Sherri am Freitagnachmittag drei Schlüssel in die Hand gedrückt hatte – einen für die Eingangstür des Schulgebäudes, die sich am nächsten zum Probenraum befand, einen für den Übungsraum selbst und den dritten für den Schrank mit den Instrumenten.
Ich kann ihm seinen Bass nicht selbst geben. Aber wenn jemand einbricht und ihn mitnimmt … Miss Franklin hatte die Achseln gezuckt. Das wäre wirklich sehr bedauerlich. Vor allem, wenn es an einem Sonntagabend passieren würde, wenn keiner da wäre, um einen Einbrecher am Diebstahl zu hindern.
Miss Franklin wollte zwar helfen, konnte sich aber auch nicht durchringen, Thomas in Schutz zu nehmen – eine niederschmetternde Erkenntnis.
»Tommy …«
Er legte ihr den Finger auf die Lippen. »Keiner wird für mich einstehen, Sher, so sieht es nun mal aus. Dann gehe ich eben auf die Highschool bei mir in der Nähe. Ist schon gut. Viel größere Sorgen macht mir, wie du hier ohne mich klarkommst.«
Am liebsten hätte sie gesagt, dass sie diese schicke Schule mit all den reichen verwöhnten Fratzen verlassen und ihm folgen würde, ganz egal, wohin. Aber ihr Vater würde das nie im Leben erlauben. Ihre Eltern bestanden darauf, ihr eine goldene Zukunft bieten zu wollen, und die Ridgewell Academy war ihre Eintrittskarte dafür. Es musste eine Lösung für Thomas gefunden werden, aber die würde ihr bestimmt nicht hier einfallen, in der Kälte und mitten auf diesem Parkplatz.
Sie straffte die Schultern und reckte das Kinn. »Los, holen wir deinen Bass.« Eigentlich gehörte das Instrument seinem Vater, seinem leiblichen, nicht diesem elenden Mistkerl von Stiefvater. Er war gestorben, als Thomas fünf gewesen war, und das Instrument war das einzige Erinnerungsstück, das er von ihm hatte.
Es war nicht besonders viel wert, für Thomas jedoch bedeutete es die Welt. Normalerweise würde er den Bass niemals über Nacht in der Schule lassen, aber der Rektor hatte ihm am Donnerstag nach dem Vorfall nicht erlaubt, noch einmal zurückzugehen und ihn zu holen. Und Sherri auch nicht. Dieser verdammte Arsch.
Sie verfiel halb in Trab, wohl wissend, dass sie sonst nicht mit ihm mithalten konnte – zumindest normalerweise. Doch nun hatte sie bereits die Hintertür erreicht, während er noch darauf zuhinkte. Sie schloss auf, schlüpfte hinein und hielt ihm die Tür auf.
»Verdammt, Sherri, geh zurück zum Wagen. Wir treffen uns dort.« Er starrte sie finster an.
»Vergiss es«, sagte sie, weil sie nicht sicher war, was sie im Instrumentenschrank vorfinden würde. Zwar hatte sie die Schlüssel, allerdings waren achtundvierzig Stunden vergangen, seit sie den Bass zuletzt gesehen hatte. Deshalb wollte sie an Thomas’ Seite sein, falls jemand – Richard Linden oder einer seiner beschissenen Kumpels – schneller gewesen sein sollte. Falls sie den Bass gestohlen … oder, was noch viel schlimmer wäre, zerstört hätten.
Thomas würde durchdrehen.
Die schwere Tür fiel hinter ihnen ins Schloss. Das Klicken der Verriegelung hallte in der Stille wider. »Los, komm.« Sherri hörte Thomas’ schwere Schritte hinter sich, als sie auf den Übungsraum zulief. Normalerweise bewegte er sich mit der geräuschlosen Geschmeidigkeit eines Panthers, doch Richard und seine Gefolgschaft hatte seinem Knie übel zugesetzt.
Abrupt kam er zum Stehen. »Sherri«, zischte er. »Warte.«
Sie drosselte ihr Schritttempo und drehte sich um. »Ich werde nicht zum …«
Thomas humpelte nun einen der Seitenflure entlang und hielt auf die Treppe am Ende zu, wo Sherri ihn einholte. »Sherri!« Panik schwang in seiner Stimme mit.
»Ich bin hier«, sagte sie ein wenig atemlos. »Was ist denn los?« Eine Sekunde später hatten sich ihre Augen an die Finsternis gewöhnt … und sie sah es. Entsetzt wich sie zurück. »O mein Gott. Wer ist das?«, fragte sie – denn jemand hatte so gewaltsam auf den Jungen am Boden eingeprügelt, dass sein Gesicht nichts als eine breiige, blutige Masse war.
Thomas kroch unter den Treppenabsatz und legte dem Jungen zwei Finger an den Hals. »Er … er lebt noch, aber … o Gott, Sher, ich weiß nicht … es sieht aus, als hätte ihn jemand erstochen.«
»Was machen wir jetzt?«
»Ich versuche, die Blutung zu stoppen. Los, ruf den Notarzt.«
»Ich habe keine Münzen.«
»Für den Notruf brauchst du keine. Los, mach schon!« Er zog seine Jacke aus, wobei er das Gesicht verzog, als ein scharfer Schmerz durch seinen Arm schoss. Sie wandte sich ab, sah ihn jedoch aus dem Augenwinkel erstarren.
»Scheiße«, stieß er hervor und sah sie an. »Das ist Richard.«
»O nein«, stöhnte sie. »O nein.«
Thomas’ Kiefer spannte sich an. »Los, ruf den Notarzt. Er hat viel Blut verloren. Schnell!«
Sie wandte sich ab, hielt jedoch inne, als sie ihren Namen ein weiteres Mal hörte. Er hatte seine Jacke ausgezogen und zerrte sich den Pulli, den sie ihm zu Weihnachten geschenkt hatte, über den Kopf. »Was ist?« Unter dem Pulli kam ein langärmeliges Poloshirt zum Vorschein, das er ebenfalls auszog, zusammenknüllte und auf Richards Bauch presste. »Wenn du fertig bist, verschwindest du von hier. Ich will nicht, dass du da reingezogen wirst.«
»Aber –«
»Still jetzt!«, schrie er. »Bitte …« Seine Stimme brach, und er blinzelte eine einzelne Träne weg, die ihm über seine violett verfärbte Wange lief. »Geh einfach«, krächzte er.
Erst jetzt begriff sie. Sobald Hilfe eintraf, saß Thomas in der Schule fest. Mit dem sterbenden Richard Linden.
»Sie werden dir die Schuld in die Schuhe schieben«, presste sie erstickt hervor, ließ sich auf die Knie sinken und packte seinen Arm, doch er schüttelte sie ab. »Komm mit mir, Thomas. Wir rufen Hilfe, aber dann verschwinden wir. Zusammen.«
Kopfschüttelnd presste Thomas sein Shirt auf Richards blutende Wunde. »Jemand muss die Blutung stoppen, sonst stirbt er. Er hat schon das Bewusstsein verloren. Ich kann ihn nicht einfach liegen und sterben lassen.«
Sie sah ihn hilflos an. »Tommy …«
Er sah sie gequält an. »Los, mach schon! Bitte! Und komm nicht zurück!«
Sie erhob sich, wandte sich um und rannte zum Telefon. Sie würde diesen verdammten Anruf erledigen und dann zurückkehren, um gemeinsam mit ihm zu warten, bis Hilfe kam. Sie würde nicht zulassen, dass man ihm noch etwas vorwarf, was er gar nicht getan hatte. Unter keinen Umständen.
Der öffentliche Münzfernsprecher befand sich direkt neben dem Büro des Rektors. Mit zitternden Fingern wählte sie die 911.
»Notrufzentrale. Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Wir …« Sherri holte tief Luft, in der Hoffnung, dass sich ihr rasender Herzschlag verlangsamen würde. »Wir brauchen Hilfe. Da ist ein Junge …«
In diesem Moment wurden die Türen aufgerissen, und mehrere Männer kamen hereingestürmt. Männer in Uniformen.
Bullen.
Bullen? Aber wie …
Ein stämmiger Typ packte sie am Arm und drückte fest zu. »Finger weg vom Telefon!«
»Aber …«
Sie schrie vor Schmerz auf, als er ihr anderes Handgelenk packte. »Ich habe gesagt, weg vom Telefon!«
Er löste ihre Finger vom Hörer, sodass er ihr aus der Hand fiel und an der metallenen Schnur baumelte. Erschüttert starrte sie den Mann an, der sie grob herumriss und mit dem Gesicht an die Wand drückte. Sekunden später schlossen sich klickend Handschellen um ihre Handgelenke.
»Sherri, lauf!«, schrie Thomas vom anderen Ende des Flurs.
Sie verzog das Gesicht, spürte den Schmerz in ihrer Schläfe, als ihr Kopf mit aller Kraft gegen die Wand gepresst wurde. Dafür war es jetzt zu spät.
Thomas schloss die Augen und ließ den Kopf auf den kalten Metalltisch des Befragungsraums sinken. Er war zu erschöpft, um sich zu fragen, wer hinter dem Einwegspiegel stehen mochte und worum es hier überhaupt ging. Er hatte kein Auge mehr zugetan, seit er vor drei Tagen hergebracht worden war.
Ins Gefängnis.
Ich bin im Gefängnis. Worte, von denen er niemals gedacht hätte, dass er sie je aussprechen würde. Richard! Dieser elende Scheißkerl war gestorben. Ich habe mir mein ganzes Leben versaut, und er ist trotzdem tot. Verblutet. Als Resultat einer Stichwunde in den Bauch. Thomas’ Hilfe war zu spät gekommen, hatte nicht ausgereicht.
Mord. So lautete der Vorwurf.
Er war beinahe zu müde, um Angst zu haben. Beinahe.
Seit er hier war, hatte er Sherri nicht mehr gesehen. Und auch sonst niemanden. Nicht mal seine Mutter. Dafür hatte sie ihm geschrieben. Er lachte bitter. Genau. Einen Brief, in dem sie ihn wissen ließ, wie enttäuscht sie von ihm war. Wie hatte er bloß den netten Richard Linden töten können? Und, ach ja, glaub bloß nicht, dass wir die Kaution für dich hinterlegen oder einen Anwalt bezahlen.
Thomas war also völlig auf sich gestellt.
Die Tür ging auf, doch er war zu erschöpft, um den Kopf zu heben.
»Danke«, sagte eine Männerstimme. »Den Rest schaffe ich dann schon.«
»Gut.«
Die zweite Stimme kannte Thomas. Sie gehörte dem Wärter, der ihn vorhin in den Befragungsraum gebracht und allein zurückgelassen hatte. Mit auf dem Rücken gefesselten Händen. »Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie einfach Bescheid«, sagte der Wärter.
»Moment noch«, sagte der Unbekannte. »Nehmen Sie ihm bitte die Handschellen ab.«
Thomas hob den Kopf, gerade weit genug, um den dunklen Anzug und die Krawatte des Mannes zu erkennen. Und einen Rollstuhl. Er fuhr abrupt hoch.
Der Mann war nicht alt, sondern ziemlich jung, dreißig Jahre vielleicht, schwer zu sagen. Er trug sein Haar kurz geschnitten, sein Anzug sah teuer aus. Er musterte Thomas forschend.
»Thomas White?«
Nicht mehr lange. Er würde den Nachnamen seines Stiefvaters so schnell ablegen, wie es nur ging. Bestimmt hatte er es ihm zu verdanken, dass seine Mutter sich von ihm abwandte. Womöglich hatte er sie sogar gezwungen, diesen Brief zu schreiben. Ein Anflug von Besorgnis stieg in ihm auf. Aber er war zu erschöpft, um sich jetzt darüber Gedanken zu machen.
»Wer sind Sie?«, fragte er.
»Ihr Anwalt«, antwortete der Unbekannte ohne Umschweife und wandte sich ein weiteres Mal an den Wärter. »Nehmen Sie ihm die Handschellen ab. Bitte.«
Das »Bitte« klang keineswegs höflich, sondern … autoritär. Ohne die Möglichkeit einer Widerrede.
»Wenn Sie sicher sind«, gab der Wärter achselzuckend zurück.
»Bin ich«, entgegnete der Anwalt.
Thomas biss die Zähne zusammen, als der Wärter seine Arme hochriss, um die Handschellen zu lösen. »Ein Mucks, Bürschchen, dann …«, knurrte er.
Thomas rieb sich nur wortlos die wunden Handgelenke.
»Das wäre dann alles«, sagte der Anwalt und wartete, bis sie allein im Raum waren, ehe er die Augen verdrehte. »Also gut, Mr White, dann wollen wir mal …«
»Thomas«, unterbrach Thomas ihn. »Nicht White. Nur Thomas.«
»In Ordnung. Zumindest für den Moment.« Der Anwalt rollte zum Tisch und musterte Thomas von oben bis unten. »Haben Sie etwas gegessen?«
»Nein.«
»Das habe ich mir fast gedacht. Ob Sie schlafen, brauche ich gar nicht erst zu fragen. Dass Sie es nicht tun, sagen mir die Ringe unter Ihren Augen.«
Als würde es dich in deinem teuren Anzug und deinem Gutsherren-Getue interessieren. »Wer sind Sie?«, wiederholte er, diesmal eine Spur barscher.
Der Mann zog ein silbernes Etui aus der Innentasche seines Jacketts und reichte Thomas eine Visitenkarte. »Ich heiße James Maslow.«
Die Karte bestand aus solidem, hochwertigem Karton, keines dieser Billigdinger. Maslow and Woods, Anwälte.
Den Typen kann ich mir nie im Leben leisten. »Ich habe schon einen Anwalt.«
»Weiß ich. Den Pflichtverteidiger. Falls Sie sich lieber von ihm vertreten lassen wollen, respektiere ich das natürlich, aber vorher sollte ich Ihnen erklären, wieso ich hier bin. Mein Kanzleipartner ist der Bruder Ihres Geschichtslehrers. Er hat mich gebeten, ihm den Gefallen zu tun und mit Ihnen zu reden, weil er Sie für unschuldig hält. Ich habe mir Ihre Akte angesehen und denke, er könnte recht haben.«
Mr Woods hat mit diesem Anwalt geredet? Wegen mir? Wieso? Er stieß den Atem aus. »Sie glauben mir?«, fragte er leise. Bisher hatte das keiner getan.
Maslow nickte knapp. »Ja.«
»Wieso?«, krächzte Thomas.
Maslow lächelte. »Erstens hat Ihr Lehrer mir erzählt, was wirklich an dem Tag passiert ist, als Sie versucht haben, das Mädchen vor Richard Linden zu beschützen.«
»Aber Mr Woods wird seine Stellung verlieren«, flüsterte Thomas, als ihm die kaum verhohlene Drohung des Rektors wieder in den Sinn kam. Waren seitdem tatsächlich erst sechs Tage vergangen?
»Er hat beschlossen, das Risiko einzugehen.« Ein Fünkchen Stolz glomm in Maslows Augen auf. »Mr Woods hat einen Brief an das Schulamt geschrieben, in dem er sich für Sie einsetzt.«
»Wow.« Thomas räusperte sich. »Das ist … sehr nett von ihm.«
»Na ja, er ist auch ein netter Kerl. Und Sie auch, wenn ich es richtig sehe.«
Thomas sah Maslow in die Augen. »Ich habe Richard Linden nicht getötet.«
»Ich glaube Ihnen, aber der Staatsanwalt denkt, er könnte eine Verurteilung erwirken. Ich soll Ihnen von ihm ausrichten, dass er Totschlag anbietet. Acht bis zehn Jahre.«
Thomas schob abrupt seinen Stuhl zurück und sprang auf. »Was? Acht bis zehn Jahre?«
Maslow klopfte auf den Tisch. »Setzen Sie sich wieder hin, bevor der Wärter zurückkommt.«
Thomas zitterte am ganzen Leib, gehorchte jedoch. Tränen brannten in seinen Augen. »Aber ich war’s nicht.«
»Ich weiß«, sagte Maslow beruhigend. »Trotzdem bin ich verpflichtet, Ihnen das Angebot der Staatsanwaltschaft mitzuteilen. Wir besprechen jetzt Ihren Fall, und dann können Sie eine Entscheidung treffen, wer Sie weiter vertreten soll.«
Unwirsch wischte Thomas sich die Tränen ab. »Ich kann Sie nicht bezahlen. Ich kriege ja noch nicht mal das Geld für die Kaution zusammen.«
»Machen Sie sich wegen meines Honorars keine Gedanken. Wenn Sie mich haben wollen, übernehme ich den Fall pro bono. Das bedeutet, ohne Kosten für Sie.«
Thomas runzelte die Stirn. »Ich weiß, was das heißt. Im Sprachteil habe ich fast die volle Punktzahl für den Abschluss.« Nicht dass seine Noten jetzt noch irgendeine Rolle spielen würden, weil er ohnehin an keinem anständigen College mehr einen Stipendienplatz kriegen würde, aber trotzdem. Andererseits konnte der Anwalt nichts dafür. Er holte tief Luft. »Bitte entschuldigen Sie, Sir. Ich bin einfach nur … müde.«
»Das sehe ich«, erwiderte Maslow mitfühlend. »Die Kaution ist ebenfalls hinterlegt.«
Thomas blieb der Mund offen stehen. »Was? Woher hat meine Mutter das Geld bekommen?«
»Es kam nicht von Ihrer Mutter. Tut mir leid.«
Sein Magen verkrampfte sich. Also nicht von Mom. »Dann hat sie mich also doch abgeschrieben.«
Maslow zog die Brauen zusammen. »Sieht ganz so aus, fürchte ich.«
»Deshalb will ich auch den Namen loswerden. White. So heißt der Mann, mit dem sie verheiratet ist. Aber ich will den Namen nicht mehr, sondern den meines richtigen Vaters.«
»Und wie lautet der?«
»Thorne. Ich will Thomas Thorne heißen.«
1. Kapitel
Gegenwart
Er lehnte sich auf seinem Stuhl nach hinten und wartete geduldig, während einer seiner zuverlässigsten Mitarbeiter mit einem leuchtend gelben Aktendeckel in der Hand das Büro betrat. Er hoffte inbrünstig, dass Ramirez ihn nicht enttäuschen würde, allerdings bezweifelte er es. Was ziemlich übel wäre.
»Hier ist die Information, die Sie haben wollten«, sagte Ramirez und legte die Akte auf den Tisch. Er wirkte wie immer völlig gelassen und entspannt.
Dass Ramirez ihn so lange hintergangen hatte …
Hätte er die Beweise nicht mit eigenen Augen gesehen, hätte er sich schlicht geweigert, es zu glauben. Ramirez war wie ein Sohn für ihn gewesen. Ein Sohn, der sein vollstes Vertrauen genoss.
»Setzen Sie sich«, forderte er ihn auf, sorgsam darauf bedacht, dass sein Tonfall ihn nicht verriet, schlug die Akte auf und blätterte darin. Und seufzte. »Die Unterlagen sind unvollständig.«
Ramirez runzelte die Stirn. »Das kann nicht sein. Ich habe die Daten eigenhändig zusammengestellt. Das ist alles, was über Thomas Thorne bekannt ist.«
»Das kann nicht sein«, erwiderte er, wobei er mit Absicht dieselbe Formulierung wie sein Mitarbeiter wählte. »Das weiß ich deshalb, weil ich Patton mit derselben Suche beauftragt habe. Seine Akte war doppelt so dick. Ihre hingegen liefert nichts, was ich nicht auch über Google hätte herausfinden können.« Er klappte die Akte zu und faltete die Hände darauf. »Wie sollte ich Ihrer Ansicht nach darauf reagieren?«
Ramirez fuhr sich mit der Zunge über die Unterlippe. Seine Nerven schienen zu versagen. »Reagieren? Inwiefern?«
»Was Sie betrifft, mein Freund.« Er öffnete seine Schreibtischschublade und nahm die Fotos heraus, die Patton von Ramirez geschossen hatte. Und von Thomas Thorne. Bei einem heimlichen Treffen. »Möchten Sie mir das vielleicht erklären?«
Ramirez sog den Atem ein. »Sie haben jemanden auf mich angesetzt?«
»Ja. Thorne scheint eine ganze Menge über meine Operationen zu wissen, und ich habe mich gefragt, wie das möglich ist. Ich habe jeden aus meinem unmittelbaren Umfeld überwachen lassen – von dem Mann, der den Job desjenigen bekommt, der sich als der Verräter entpuppt.« Er lächelte. »Patton ist extrem gründlich vorgegangen. Er wird einen erstklassigen leitenden Angestellten abgeben.«
Ramirez schluckte. »Ich habe Sie niemals verraten.«
»Ich glaube Ihnen kein Wort.«
»Patton hat die Aufnahmen mittels Photoshop manipuliert.«
Er schaltete sein Handy ein und scrollte durch die Fotos. »Ah, hier ist es ja. Sie mit Thorne.« Er hielt das Telefon so hin, dass Ramirez das Foto sehen konnte. »Das hier habe ich selbst aufgenommen.«
Ramirez wurde blass, doch dann drückte er die Schultern durch, reckte das Kinn und sah ihn an, fügte sich in sein Schicksal. »Meine Frau hatte nichts damit zu tun.«
Er zuckte die Achseln. »In dem Fall ist es bedauerlich, dass auch sie sterben muss.«
»Nein!« Ramirez sprang auf und riss die Hände vor, als wollte er ihm an die Gurgel gehen, erstarrte jedoch, als er die auf ihn gerichtete Waffe sah. Sein Atem kam stoßweise.
»Wieso?«, fragte er seinen Angestellten nur, ohne den Blick von ihm zu wenden. »Wieso haben Sie Thorne die Informationen gegeben?«
»Das habe ich nicht«, erwiderte Ramirez beharrlich.
»Sie werden sowieso sterben, alter Freund, egal was Sie sagen. Ich kann dafür sorgen, dass es schnell geht, oder es aber in die Länge ziehen. Und dasselbe gilt für Ihre reizende Frau. Schnell oder lieber langsam und qualvoll? Also – warum?«
Ramirez schloss die Augen. »Sie haben meinen Neffen ermordet.«
Er zog die Brauen hoch. »Tatsächlich?«
»Ihre Leute. Er war erst sechzehn, noch ein Junge. Vor zwei Jahren geriet er ins Kreuzfeuer, als Sie Ihre Leute zu einem Ihrer Feinde geschickt haben, damit sie ihn im Vorbeifahren abknallen. Das Problem war nur, dass sie das falsche Haus ins Visier nahmen und den Sohn meiner Schwester mit Kugeln vollgepumpt haben.« Wut und Trauer spiegelten sich in Ramirez’ Augen. »Und es hat Ihnen noch nicht mal leidgetan. Seit zwanzig Jahren arbeite ich für Sie, und es hat Ihnen nicht mal leidgetan.«
»Tut es auch jetzt nicht«, erwiderte er, richtete die Waffe auf Ramirez’ Bauch und feuerte in rascher Folge drei Schüsse in einem Radius von nur wenigen Zentimetern ab. Mit einem Stöhnen ging Ramirez zu Boden.
Er erhob sich und blickte auf den Mann, der sich auf dem Fußboden wand. Zu der Wut und dem Kummer in seinen Augen gesellten sich nun der Schock der Erkenntnis, unsägliche Schmerzen und abgrundtiefer Hass, als Ramirez ihn ansah. »Sie haben gesagt, es würde schnell gehen«, presste er hervor. »Sie haben gelogen.«
»Genauso wie Sie.«
»Nein. Nein«, stöhnte Ramirez. »Ich habe die Wahrheit gesagt. Ich habe Ihnen gesagt, wieso ich Thorne die Informationen gegeben habe.«
»Zu wenig und zu spät, mein alter Freund.« Das letzte Wort kam voll höhnischem Abscheu über seine Lippen. »Sie haben mich jeden Tag belogen, den Sie zur Arbeit gekommen sind, haben Gehalt kassiert und mich gleichzeitig die ganze Zeit verraten.«
Ramirez’ glasige Augen wurden schmal. »Und wieder mal geht es bloß um Sie, was? Mein alter Freund?«
Er blinzelte. »Natürlich. Das tut es doch immer.« Er starrte Ramirez eine volle Minute lang an. Wie hatte er diese Trauer übersehen können? Diese Wut? Diesen tiefschürfenden Hass?
Schließlich setzte er sich wieder hin. Die Antwort lag auf der Hand: Er hatte all das in Ramirez’ Augen nicht erkannt, weil er es von sich so gut kannte, es jeden gottverdammten Tag aufs Neue im Spiegel sah. Seit ihm das Gefängnis seinen Sohn in einem Leichensack überbracht hatte, nur ohne seine Eingeweide. Die hatten sich auf den Schmutz des Gefängnishofs ergossen, wo man ihn aufgeschlitzt und förmlich ausgeweidet hatte, schnell und fachgerecht. Und qualvoll.
Er schloss die Augen, als eine neuerliche Woge des Schmerzes über ihn hinwegwusch und sich wie ein Schraubstock um seine Brust legte, die ihm den Atem abschnürte. Sein Sohn hatte Höllenqualen leiden müssen, bis zum letzten Atemzug.
Ramirez kam noch viel zu gut weg, dachte er kalt.
Er drückte die Taste der Gegensprechanlage. »Jeanne, schick mir bitte Patton rein. Und sag ihm, er soll Mrs Ramirez mitbringen. Und zwei Leichensäcke. Mr Ramirez ist noch nicht tot, aber lange wird es nicht mehr dauern. Und in ein paar Minuten schick jemanden mit einem Wischmopp herein. Mein Fußboden ist voller Blut.«
»Natürlich, Sir«, erwiderte Jeanne mit bewundernswerter Gelassenheit. Seine Büroleiterin ging stramm auf die sechzig zu, und schon heute graute ihm vor dem Tag ihrer Pensionierung. Immerhin brachte sie bereits ihre Nachfolgerin in Stellung, die zugegebenermaßen über dasselbe Organisationstalent verfügte wie ihre Mutter: Margo, die Jüngere von Jeannes zwei Mädchen, war wie eine Tochter für ihn.
Ihre Ältere dagegen, Kathryn, war zu einer Seelenverwandten für ihn geworden, in einer Art, wie er es nicht mehr für möglich gehalten hatte. Kathryn wärmte ihm nicht nur das Herz, sondern auch das Bett, obwohl sie beide wussten, dass er für den Rest seines Lebens um Madeline trauern würde. Sie selbst hatte Kathryn zu ihrer Nachfolgerin auserkoren, was zwar den Übergang ein wenig leichter gemacht hatte, trotzdem würde er sie niemals in den Status seiner Ehefrau erheben. Zum Glück erwartete sie das auch gar nicht, sondern gab sich damit zufrieden, die Geliebte eines sehr mächtigen Mannes zu sein.
»Noch etwas?«, fragte Jeanne.
»Ja. Sag Margo, dass ich sie in einer halben Stunde sprechen muss.« Sein Enkel Benny und dessen Mutter waren alles, was ihm von seinem Sohn Colin geblieben war. Er registrierte den neuerlichen Schmerz, der ihn erfasste, hieß ihn willkommen. Den Tod seines Sohnes zu rächen, war die Motivation, die ihn jeden Morgen aus dem Bett aufstehen ließ. »Ich habe eine Aufgabe für sie.«
»Sie elendes Schwein«, stöhnte Ramirez, als die Tür aufging und seine weinende gefesselte Frau hereingebracht wurde.
Er lächelte. »Wie lautet noch mal das Sprichwort über den Topf und den Deckel? Ziemlich mutig von Ihnen, Mr Ramirez. Ihr Verrat zieht weite Kreise. Sie können uns jetzt entschuldigen, Mr Patton, aber bleiben Sie in der Nähe. Wir werden die Leichensäcke bald brauchen.«
Er erhob sich wieder, zog seine Sachen aus und legte sie sorgsam gefaltet in den Wandschrank. Er mochte seinen Anzug und wollte nicht, dass er Blutflecke bekam. Vorsichtig streifte er das Lederband mit der kleinen Phiole über den Hals. Sie enthielt Madelines Asche, und bald würde er etwas von Colins dazugeben.
Wieder flammte die Wut in ihm auf, als er das Band auf seine Sachen legte und die Schranktür schloss. »Also, Mrs Ramirez. Ich entschuldige mich im Voraus für die Schmerzen, die ich Ihnen gleich zufügen werde. Sollten Sie jemanden verfluchen wollen, nehmen Sie Ihren Ehemann. Sein Verrat ist der Grund, weshalb Sie hier sind.«
»Nein«, erwiderte Mrs Ramirez fest. »Ich würde meinen Mann niemals verfluchen.«
Aber genau das tat sie. Am Ende verfluchten sie immer denjenigen, dessen Verfehlungen sie ihm ans Messer – oder in diesem Fall den Bohrer – geliefert hatten. Alle. Mrs Ramirez musste entsetzlich leiden, ehe er Gnade walten ließ und sie mit einer Kugel in den Kopf erlöste.
Dann erledigte er seinen einstigen Mitarbeiter mit einer letzten Kugel ins Herz, ging unter die Dusche, um die Schweinerei abzuwaschen, und zog sich an. Schließlich rief er Patton herein, damit er die Leichen wegschaffte, setzte sich an seinen Schreibtisch und zog die deutlich dickere Akte seines neuen leitenden Angestellten zu sich heran.
Patton war in der Tat mit großer Sorgfalt vorgegangen und hatte im Grunde alles herausgefunden, was er selbst bereits ausgegraben hatte. Nichts Neues. Schon seit Monaten arbeitete er an seinem Plan, Thomas Thorne in die Knie zu zwingen.
Thorne würde ebenso um Gnade winseln wie Ramirez’ Frau gerade – vergeblich, genauso wie in ihrem Fall.
»Ich bin raus«, schnaubte J.D. und warf die Spielkarten auf den Tisch. »Verdammt, Thorne, musst du eigentlich immer gewinnen?«
Mit einem selbstzufriedenen Grinsen in die Runde stapelte Thomas Thorne die Chips vor sich auf. »Ja.«
Meuternd zückten die fünf Männer am Pokertisch ihre Brieftaschen.
»Ganz schön viel Glück für einen einzigen Abend«, murmelte Sam und warf einen Zehner auf den Tisch. Die Regel lautete, dass keiner von ihnen mehr als zehn Dollar an einem Abend verlor. Sie spielten aus reinem Spaß. Und aus Freude am Gewinnen, natürlich. Keiner hier verlor gern.
Grayson verdrehte die Augen. »Wenn ihr mich fragt, hat er viel zu viel Glück für einen Abend. Vielleicht sollten wir den Fall mal genauer untersuchen. Sam? J.D.?«
»Möglichkeiten der Veruntreuung gibt es massenhaft«, meinte J.D.
Grayson Smith, Oberstaatsanwalt, J.D. Fitzpatrick, hochdekorierter Detective des Morddezernats, und Sam Hudson, ehemaliger Officer beim Baltimore PD, kannten sich damit definitiv aus, aber Thorne wusste, dass keiner von ihnen wirklich verärgert war. Oder dass sie ernstlich glaubten, er ziehe sie über den Tisch.
Er hatte sich ihr Vertrauen erarbeitet. Und umgekehrt galt dasselbe.
»Tut euch keinen Zwang an, Jungs«, meinte er lässig, ehe er betont auf seine Uhr sah. »Aber gebt Gas. Bald ist Zapfenstreich, und ihr armen Ehemänner müsst brav nach Hause gehen.«
J.D. schnaubte. »Blödmann«, brummte er gutmütig. J.D. war mit Lucy verheiratet, einer Rechtsmedizinerin, die nach Ende ihrer Elternzeit auf Teilzeitbasis wieder in der Gerichtsmedizin von Baltimore arbeitete, doch sie und Thorne waren bereits Freunde gewesen, noch bevor J.D. in Lucys Leben getreten war. Seit acht Jahren betrieb sie gemeinsam mit ihm und Gwyn Weaver einen Nachtklub namens Sheidalin.
Gwyn Weaver. An die Thorne bewusst den ganzen Abend keinen Gedanken verschwendet hatte.
Lügner.
Na gut. Ja, er hatte den ganzen Abend an sie gedacht und sich gefragt, ob sie tatsächlich zu dem Date gegangen war, von dem sie so geschwärmt hatte. Falls der Kerl auch nur einen Funken Vernunft im Leib hatte, lautete die Antwort Nein. Aber Thorne würde wohl oder übel bis morgen warten müssen, um es zu erfahren.
»Er ist kein Blödmann«, widersprach Sam. »Zumindest kein völliger.« Sam war im Jahr zuvor aus dem Dienst bei der Polizei von Baltimore ausgeschieden, um als Privatermittler in Thornes Anwaltskanzlei zu arbeiten. Thorne selbst bezeichnete dies als seinen »Tagesjob«, da Gwyn hauptsächlich mit der Leitung des Nachtklubs betraut war, wohingegen seine und Lucys Beteiligung sich mittlerweile auf gelegentliche Auftritte beschränkte.
Aber auch dafür hatte Thorne in letzter Zeit wenig Gelegenheit gehabt. Genauer gesagt, seit sechs Jahren. Dabei vermisste er seine Auftritte als Bassist vor Live-Publikum. Aber er hatte so viel anderes zu tun gehabt. Zum Beispiel, sich um seinen Patensohn Jeremiah zu kümmern, Lucys und J.D.s Sprössling, den er heiß und innig liebte.
Und um Gwyn, zumindest soweit sie es zuließ – was nicht allzu häufig vorkam.
Sein Hauptaugenmerk lag auf seiner Kanzlei, die er zunächst im Alleingang betrieben hatte und die mittlerweile zu einem kleinen Unternehmen mit zwei weiteren Anwälten, einer Anwaltsgehilfin, einer Büroleiterin für alles Administrative und einer Forensikerin angewachsen war. Und Sam, der sich als überaus fähiger Ermittler entpuppt hatte. Thorne war heilfroh, ihn im Team zu haben.
Sam lachte leise. »Thorne ist doch bloß neidisch, weil er keinen hat, der die Schweinerei für ihn aufräumt.«
Genau, dachte Thorne insgeheim. Er war eifersüchtig auf die verheirateten Männer, in deren Leben es jemanden gab, zu dem sie abends gerne heimkehrten, wohingegen es in seinem Haus viel zu still wäre, wenn seine Gäste erst gegangen waren. Aber das würde er ihnen natürlich nicht auf die Nase binden, weil sie sonst bloß versuchen würden, ihn zu verkuppeln. Die Jungs waren schlimmer als ein Damenkränzchen.
»Ruby räumt also hinter dir her?«, fragte er stattdessen und zog eine Braue hoch, während er sein Handy herauszog. »Soll ich sie das vielleicht mal fragen?« Sams Frau Ruby, Lucys einstige Pathologieassistentin, arbeitete inzwischen als Forensikerin ebenfalls für Thorne, und er bezweifelte stark, dass sie Sam hinterherputzen würde.
Sam lachte. »Bitte nicht, ich hänge an meinem Leben.«
»Wir Unverheirateten sollten jetzt auch aufbrechen.« Seufzend schob Jamie mit routinierter Beiläufigkeit seinen Rollstuhl zurück – aufgrund seiner angeborenen Spina-bifida-Erkrankung war er seit der Kindheit auf das Hilfsmittel angewiesen. »Ich werde allmählich zu alt für diese langen Abende.«
Jamies Bewegungen hatten sich in den neunzehn Jahren, seit er und Thorne sich kannten, kaum nennenswert verlangsamt. Anfangs war Jamie Maslow sein Anwalt gewesen, hatte sich jedoch sehr schnell zu einem engen Freund und Mentor entwickelt. Und zu einer Art Ersatzvater, da sein leiblicher Vater verstorben war, als Thorne noch ein kleiner Junge gewesen war. Inzwischen hatte Jamie sich aus seiner eigenen Kanzlei in den Ruhestand zurückgezogen und übernahm Thornes Pro-bono-Fälle.
»Das müsstest du nicht sein, wenn du Phil endlich heiraten und zu einem ehrbaren Mann machen würdest«, erklärte Thorne rundheraus. In den ersten Monaten, als die beiden Männer ihn als völlig verstörten Teenager aufgenommen hatten, war es schlicht unmöglich gewesen, seinen ehemaligen Geschichtslehrer mit »Phil« statt mit »Mr Woods« anzusprechen.
Phil hatte die Schule in dem Nobelvorort verlassen, die Thorne damals besucht hatte, um stattdessen Kinder aus ärmeren innerstädtischen Vierteln zu unterrichten. Thorne bewunderte die beiden Männer aus tiefstem Herzen – sie waren die Vorbilder gewesen, die er damals so dringend gebraucht hatte, als er sonst niemanden mehr auf der Welt gehabt hatte, der sich um ihn kümmerte.
»Ich mache ihm einen Antrag nach dem anderen«, erwiderte Jamie mit einem verschmitzten Funkeln in den Augen. »Er meint, wenn er in den Ruhestand geht, hauen wir nach Vegas ab und lassen uns von Elvis persönlich trauen.«
Frederick schnaubte. »Das gäbe einen Riesenaufstand, wenn ihr es heimlich machen würdet.« Frederick Dawson, hochkarätiger Strafverteidiger und jüngster Zuwachs ihrer Pokerrunde, war erst kürzlich aus Kalifornien hergezogen, hatte sich hier anwaltlich registrieren lassen und unterstützte Jamie und Thorne ebenfalls auf Pro-bono-Basis. Er deutete auf die leeren Bierflaschen und Chipstüten. »Ernsthaft. Du brauchst doch bestimmt Hilfe, oder?«
»Nein, nein, das geht ganz schnell.« Thorne war bewusst, wie dankbar er für so loyale und anständige Freunde sein konnte. Es hatte eine Zeit gegeben, als ihn anständige Leute noch nicht mal zur Kenntnis genommen hätten. Aber selbst die besten Freunde kehrten irgendwann einmal in die eigenen vier Wände zurück.
Und dann bin ich allein. Wie immer.
Es klopfte an der Eingangstür, und sie wurde aufgerissen, noch bevor er Gelegenheit hatte, sie zu öffnen. »Darf ich reinkommen?« Es war Lucy.
J.D.s Züge erhellten sich beim Anblick seiner Frau. »Ich dachte, du hast Bürodienst.«
Thorne, Lucy und Gwyn hatten zwar Mitarbeiter, die das Sheidalin für sie schmissen, trotzdem bemühten sie sich, dass an den Haupttagen, freitags und samstags, abends einer von ihnen im Büro war. Normalerweise übernahm Gwyn das, aber Lucy war eingesprungen, damit sie ihre Verabredung wahrnehmen konnte.
Da Lucy hier war, konnte Thorne davon ausgehen, dass Gwyns Date nicht aufgetaucht war. Erleichterung durchströmte ihn.
»Gwyn hat übernommen«, sagte sie und lachte, als J.D. sie packte, hintenüberkippte und ihr einen feuchten Schmatzer auf den Mund drückte. »Ich soll nach Hause gehen, mich aber auf keinen Fall amüsieren, hat sie gemeint.«
J.D. zog die Brauen hoch. »Wieso das denn?«
»Sie ist mies drauf.« Lucy seufzte.
»Und wir hören auf sie und amüsieren uns nicht?«, fragte J.D.
Lucy schüttelte den Kopf. »Nein, verdammt.« Sie wackelte vielsagend mit ihren rotblonden Brauen. »Die Kinder übernachten heute bei Stevie und Clay, deshalb genießen wir unsere sturmfreie Bude in vollen Zügen und erzählen Gwyn, wir hätten uns beinahe zu Tode gelangweilt.«
»Ich hole nur meine Waffe aus Thornes Safe, dann können wir los.« Beschwingten Schrittes verließ J.D. den Raum.
»Angeber.« Thorne umarmte Lucy. »Ich habe noch eine Schüssel von dir in der Küche. Komm mit, ich suche sie.« Er ging voran, außer Hörweite seiner Freunde, die fürchterliche Klatschbasen waren. »Wieso ist Gwyn schon zurück?«, fragte er, in der Hoffnung, dass sich seine Vermutung bestätigte. »Ich dachte, sie hätte eine Verabredung?«
Lucy verzog das Gesicht. »Hatte sie auch, aber sie wurde versetzt. Schon wieder.«
Ja! Der Typ hatte also doch Verstand. »Das ist ja übel«, bemerkte er nüchtern. Bei jedem anderen hätte diese Tour funktioniert, aber Lucy und er waren seit fast zehn Jahren Freunde, und sie kannte ihn viel zu gut.
»Stimmt«, bestätigte sie und sah ihn nachdenklich an. »Das ist schon der dritte Mann, der kurzfristig abgesagt hat. Sie hatte gerade mal ein Date, seit sie beschlossen hat, sich wieder auf den Markt zu werfen, und auch der Typ hat sie danach nicht wieder angerufen.«
Weil auch er kapiert hat, dachte Thorne beschämt. »Vielleicht taugt ja die Dating-Seite nichts, bei der sie sich angemeldet hat.«
Lucy kniff die Augen zusammen. »Sie hat sich nirgendwo angemeldet, sondern ihre Freundinnen fädeln diese Dates ein. Das weißt du ganz genau. Der Typ von heute Abend ist ein netter Kerl, der keiner Fliege etwas zuleide tun würde. Und schon gar nicht kurzfristig kneifen. Ich würde die Hand für ihn ins Feuer legen. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun, Thorne?«
Absolut, verdammt noch mal! Thorne sah sie ungläubig an. »Was? Wie kommst du denn darauf?«
»Weil du dich genauso ärgern müsstest wie ich, tust du aber nicht. Was ist hier los? Sie war so lange allein und fängt gerade an, die Fühler ein bisschen auszustrecken und du … was treibst du da?«
Ich gebe den Burschen zu verstehen, dass sie die Finger von ihr lassen sollen. Natürlich nicht explizit. Aber mit seinen knapp zwei Metern und rund hundert Kilo Kampfgewicht kamen selbst indirekte Ansagen glasklar rüber. »Gar nichts.«
Lucy sah ihn an. »Du lügst mich doch an!«
Er zuckte zurück. »Äh … nein, eigentlich nicht.« Er brauchte einfach noch etwas Zeit, um Gwyn zu erklären, wie er empfand. Sie gehört mir.
Lucy musterte ihn forschend, ehe sie die Augen aufriss. »O Gott. Du …« Sie suchte nach dem richtigen Wort. »Du willst sie für dich haben?«
Thorne spürte, wie ihm die Hitze ins Gesicht stieg. Einen Gerichtssaal konnte er problemlos an der Nase herumführen, aber nicht Lucy, die, wie es aussah, mehr mitbekommen hatte als Gwyn selbst. Seit Wochen machte er Andeutungen, flirtete sogar ganz offen mit ihr, doch sie merkte es offenbar nicht.
Wortlos wandte er sich um, nahm die Glasschüssel aus dem Schrank und drückte sie Lucy in die Hand. »Ich habe sie gespült.«
»O nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Du servierst mich nicht einfach ab. Verdammt, Thorne, was soll das? Willst du sie nun oder nicht?«
Mit jeder Faser meines Herzens, dachte Thorne. Seit Jahren, aber sie waren nie zur selben Zeit Single gewesen. Und dann … Gwyn war von einem brutalen Killer überfallen worden, der ihr nicht nur etliche Knochen gebrochen, sondern auch jegliches Selbstvertrauen geraubt hatte. Sechs Jahre war das her. Danach hatte sie sich in ihr Schneckenhaus zurückgezogen und ihre körperlichen und seelischen Wunden geleckt. Er hatte gewartet. Geduldig. Bis sie endlich herausgekommen war und er ab und zu einen Blick auf die Frau erhascht hatte, die sie einst gewesen war.
Die Frau, die das Leben und die Musik liebte, die so gern gelacht hatte. Sie war immer noch da, stärker noch als zuvor. Schöner. Eine Frau, die wusste, wie man überlebte.
Wenn sie die Fühler ausstreckte, dann gefälligst in seine Richtung, verdammt noch mal!
Dir ist schon klar, wie das klingt, oder? Bei diesem Thema meldete sich die leise Stimme in seinem Kopf durchaus hörbar zu Wort … um nicht zu sagen, ganz, ganz laut. Du bist ein beschissener Stalker!, trompetete sie.
Wenn ich sie frage, ob sie mit mir ausgehen will, und sie Nein sagt, werde ich die Finger von ihr lassen, beschwichtigte er die Stimme so vernünftig, wie er nur konnte. Er musste sich nur ein Herz fassen und fragen. Am besten irgendwann in diesem Jahrhundert. Das Problem war nur … sollte sie ihm einen Korb geben, wäre er am Boden zerstört, und er wusste nicht, ob er sich von dem Schlag je wieder erholen würde.
»Das geht dich leider nichts an, Luce«, sagte er leise.
»Schwachsinn«, konterte Lucy ebenso leise. »Was du da treibst, verletzt sie, Thorne, auch wenn du es noch so gut meinst. Und das willst du doch nicht.«
»Stimmt«, räumte er ein. »Ich brauche nur noch ein bisschen Zeit.«
Sie warf ihm einen finsteren Blick zu. »Morgen. Länger nicht.«
»Und wenn ich es nicht schaffe, den Mut aufzubringen?«, fragte er gereizt.
»Lassen wir es lieber nicht so weit kommen«, erwiderte Lucy. »Sie hat geweint, Thorne. Du weißt selbst, wie selten das vorkommt. Logischerweise zerbricht sie sich den Kopf darüber, wieso all die Männer sie zurückweisen, bevor sie auch nur Gelegenheit hatte, sie persönlich kennenzulernen. Ich musste sie trösten. Also sieh zu, dass du es auf die Reihe kriegst.«
Thorne ließ den Kopf hängen, während Lucys Worte sich tief in sein Herz schnitten. Sie hatte recht. Vollkommen. »Das werde ich. Versprochen.«
»Also spätestens morgen?«
»Ja.«
Lucy seufzte. »Gut.« Sie packte ihn am Kragen und zog ihn herunter, um ihm einen Kuss auf die Wange zu geben. »Ich habe euch beide lieb«, raunte sie. »Aber wenn du ihr weiter wehtust, schneide ich dir die Eier ab. Ich schwör’s.«
Thorne zuckte zusammen. »Ich glaube dir. Und jetzt geh nach Hause und mach J.D. glücklich.«
»Das werde ich.« Sie ließ von ihm ab und strich sein Hemd glatt. »Und ich wünsche mir, dass du auch glücklich wirst. Wie gesagt, ich habe euch beide lieb.«
Thorne begleitete sie zur Tür, wo seine Freunde bereits mit klimpernden Wagenschlüsseln warteten, verabschiedete sich und schloss die Tür hinter ihnen, ehe er sich mit einem Seufzer dem Chaos zuwandte, das sie hinterlassen hatten. Normalerweise würde er sofort mit dem Aufräumen anfangen, aber heute war er zu müde dafür.
Nein, das war nicht der Grund. Er hatte Liebeskummer. Schon lange. Aber er konnte etwas dagegen tun. Vielleicht. Sollte er jemals den Mut aufbringen, Gwyn zu gestehen, wie er empfand.
Sag es ihr endlich, du elender Feigling. Du weißt doch, wo du sie findest. Im Büro im Sheidalin. Dort ist sie mindestens bis zwei Uhr früh. Warte nicht bis morgen. Sie leidet, und zwar jetzt.
Er musste seinen Mann stehen. Er schnappte die Wagenschlüssel, zog seine Schuhe an, schloss sämtliche Türen ab und stieg in seinen Audi SUV.
Nur wenige Minuten vom Sheidalin entfernt läutete sein Handy. Sein Telefonnachrichtendienst. »Thorne.«
»Hallo, Mr Thorne, hier ist Brooke vom Anrufdienst. Ich habe eine Frau in der Leitung, die Sie dringend sprechen möchte. Sie sagt, sie heißt Bernice Brown.«
»Ich kenne sie.« Mrs Brown war eine Mandantin, die er erst seit Kurzem vertrat. Sie war fünfundvierzig Jahre alt und wurde des versuchten Mordes an ihrem Ehemann verdächtigt. Noch war er unschlüssig, was er glauben sollte – ob sie es wirklich getan hatte oder nicht, tendierte aber zu Letzterem. Gerade versuchten sie, den Vorfall aufzuarbeiten und die Verteidigungsstrategie zu entwickeln. Mrs Brown schien kein Mensch zu sein, der ihn aus einer Laune heraus anrufen würde. »Sie können sie durchstellen.«
»Mr Thorne?« Mrs Browns Stimme klang unsicher, war kaum mehr als ein Flüstern. »Können wir uns treffen? Heute noch? Es ist wichtig. Sonst hätte ich Sie nicht angerufen.«
»Was ist passiert?«
»Jemand hat vorhin versucht, mich von der Straße abzudrängen.«
Thorne runzelte die Stirn. »Ist alles in Ordnung?«
»Ja. Ich … ich konnte ausweichen. Aber ich habe Angst.« Ihre Stimme brach. »Große Angst.«
»Wo genau sind Sie jetzt?«, fragte Thorne mit einem Blick auf die Uhr am Armaturenbrett.
»In einer Bar. Das Barney’s. Es war das Erstbeste, was offen hatte.«
»Diese Bar kenne ich. Ich bin gleich da. Bleiben Sie, wo Sie sind, und nehmen Sie nichts zu sich, was andere Ihnen hinstellen.«
»Aber ich habe schon einen Whiskey getrunken.«
»Gut. Aber lassen Sie es dabei bewenden. Sie müssen nüchtern bleiben. Bitten Sie den Barkeeper um etwas zu schreiben und notieren Sie alles, woran Sie sich erinnern können … wie der Wagen aussah, dergleichen. Ich bin auf dem Weg.«
»Ich bringe ihn um. Eigenhändig, verdammt noch mal!«
Gwyn Weaver umfasste das Steuer so fest, dass ihre Finger schmerzten, was ihr zumindest dabei half, nicht in Tränen auszubrechen. »Ich werde …« Sie schluckte. »Wie konnte er nur, Lucy?«, flüsterte sie. »Wieso?«
Wieso hatte Thorne absichtlich ihr Date verhindert? Das war … grausam.
Ihre beste Freundin seufzte am anderen Ende der Leitung. »Das wirst du ihn selbst fragen müssen«, sagte sie mit leiser, fast besänftigend säuselnder Stimme. Lucy war bereits wach, um ihre einjährige Tochter und Gwyns Patenkind Bronwynne zu stillen. In den letzten Monaten hatte es so einige dieser Säusel-Telefonate gegeben, meistens in den frühen Morgenstunden.
Lucy war schon immer Frühaufsteherin gewesen, und Gwyn schlief nicht sonderlich viel. Nicht mehr. Seit sechs Jahren schon. Obwohl es in letzter Zeit besser geworden war. Bis jetzt.
Thorne … Warum bloß? Sie biss sich auf die Innenseite ihrer Wange, um die Tränen zurückzuhalten. Nein, sie würde nicht weinen. Würde nicht zulassen, dass er sah, wie sehr er ihr wehtat. Denn genau das tat es. Verdammt weh.
»Ich dachte, wir sind …« Gerade als das Wort »Freunde« über ihre Lippen drang, fiel der Groschen. »Moment mal … Du wusstest Bescheid?«
Wieder seufzte Lucy. »Erst seit gestern Abend. Ich habe ihm gesagt, er soll das in Ordnung bringen, sonst …« Ihr Tonfall veränderte sich unvermittelt. »Danke, Taylor«, sagte sie freundlich.
Gwyn runzelte die Stirn. »Wo steckst du denn?«
»Bei Stevie und Clay. Taylor hat gestern Abend auf die Kinder aufgepasst. Ich bin wach geworden und …« Sie lachte verlegen. »Ich habe meine Süße vermisst, außerdem haben sich meine Brüste angefühlt, als würden sie gleich platzen, deshalb bin ich rübergefahren. Taylor war so nett, mir eine Tasse Tee zu machen.«
Klang einleuchtend. Taylor war Anfang zwanzig und die leibliche Tochter ihres gemeinsamen Freundes Clay Maynard. Und ein echter Glücksfall – seit Lucys Rückkehr in die Rechtsmedizin kümmerte sie sich mit Hingabe um Baby Wynnie und Jeremiah, Lucys und J.D.s zweijährigen Sohn, wenn sie Hilfe brauchte. Gwyn war regelmäßig als Babysitter eingesprungen, bevor Taylor vergangenen Sommer zu ihnen gestoßen war, und trotz all der neu gewonnenen Freizeit vermisste sie die beiden Kinder, die sie liebte, als wären es ihre eigenen.
Sie hatte ein einziges Mal die Gelegenheit bekommen, Mutter zu werden, und es gründlich vermasselt. Nein, dachte sie, das stimmt so nicht. Du hast es nicht vermasselt, sondern deinem Sohn die Chance für ein normales Leben geschenkt. Mit zwei Elternteilen, die ihn liebten und umsorgten. Das war die Wahrheit. Zumindest sagte das ihr Verstand. Doch ihr Herz blutete, wann immer sie Lucys Babys in den Armen hielt. Im Lauf der Zeit war es wenigstens leichter geworden und …
Und ich werde jetzt nicht darüber nachdenken. Nein. Nicht jetzt. Es war nicht der richtige Zeitpunkt, über Fehler in der Vergangenheit nachzugrübeln. Sondern um ihre Wut auf Thorne zu kultivieren, damit sie den Schmerz übertönte, den er ihr zugefügt hatte. Denn was er getan hatte, war sehr schmerzhaft gewesen. Verdammt!
»Also …?«, nahm sie den Faden wieder auf. »Du hast es gestern Abend erfahren?«
»Ich habe J.D. vom Pokern abgeholt, und Thorne wollte wissen, wie dein Date gelaufen ist.«
»Das er sabotiert hat?«
»Ich … denke schon.« Wieder hatte sich dieser Säuselton in ihre Stimme geschlichen, dessen besänftigende Wirkung normalerweise bei Gwyn ebenso seine Wirkung zeigte wie bei Bronwynne, aber nicht heute. »Und wie bist du draufgekommen?«
»Ich bin sauer geworden, als Jase abgesagt hat, und habe mich gefragt, wieso die Typen einen Rückzieher machen, bevor ich sie auch nur einmal getroffen habe. Allmählich kriege ich schon Komplexe.«
»Verständlich«, sagte Lucy leise. »Und dann?«
»Bin ich stundenlang in der Wohnung herumgetigert, bis ich irgendwann meine Laufsachen angezogen habe und zur Highschool gefahren bin, wo du auch immer läufst, weil ich dachte, dass Jase auf kurz oder lang dort auftauchen würde.« Jase war Lucys Jogging-Kumpel. Und Arzt, verdammt noch mal.
Immerhin hätte meine Mutter ausnahmsweise mal keinen Grund zum Meckern gehabt. Wobei ihr problemlos eine Million andere Kritikpunkte einfallen würden. Das hieß, sofern sie in Kontakt stünden, was sie seit Gwyns sechzehntem Lebensjahr nicht mehr taten.
»Du bist allein losgefahren?« Ein Anflug von Besorgnis schwang in Lucys Stimme mit.
»Nein.« Auch dieses Eingeständnis schmerzte. Sechs Jahre waren seitdem vergangen, verdammt noch mal. Trotzdem verließ sie nur selten allein das Haus, schon gar nicht nach Einbruch der Dunkelheit. »Ich habe Tweety mitgenommen.« Denn mit einer siebzig Kilogramm schweren Dogge legt sich so schnell keiner an.
»Sehr klug von dir. Und ich nehme an, Jase hat auch heute Morgen seine Runde gedreht?«
»Ja. Ich hatte Glück«, erwiderte Gwyn bitter. »Ich brauchte nicht lange zu warten, weil er loswollte, solange die Sonne noch nicht aufgegangen war und es zu heiß wurde. Er meinte, Thorne hätte ihn aufgesucht. Persönlich. Und ihm gedroht.«
Lucy schnappte nach Luft. »Was? Nie im Leben. Thorne hätte ihm gedroht? Das hat er gesagt?«
»Na ja, nicht explizit. Aber er hätte ihm ›ans Herz gelegt‹, sich jemand anderen zu suchen, und zwar unmissverständlich. So nett es ja sein mag, aber in meinem Leben ist kein Platz für noch ein Drama.«
Lucy gab einen erstickten Laut von sich. »Thorne!«, zischte sie, als stünde er vor ihr. »Was hat er sich bloß dabei gedacht?«
»Das wüsste ich auch gerne.« Und genau das machte es ja so schwer. Sie war völlig schockiert. »Was hat er dir erzählt?«
»Dass es nicht meine Angelegenheit ist.«
»Einen Scheißdreck ist es! Moment mal, du hast doch nicht etwa auf Lautsprecher geschaltet?«
Lucy lachte leise. »Wenn ich mit dir rede, niemals, Süße. Ich denke …« Sie zögerte. »Du solltest ihn fragen. Aber …«
Inzwischen war Gwyn nur noch ein kleines Stück von Thornes Haus entfernt. »Aber was?«
»Lieber Gott.« Lucy sog hörbar den Atem ein. »Hast du Thorne jemals … na ja, so gesehen?«
Gwyn blinzelte. »Wie gesehen?« Erst jetzt begriff sie. »Als Mann, meinst du? Im Sinne einer Liebesgeschichte?«
»Oder vielleicht auch nur körperlich.« Der Anflug eines Zögerns lag in Lucys Stimme.
Das Nein lag Gwyn bereits auf der Zunge, doch sie schluckte es hinunter. Weil es eine Lüge gewesen wäre. Eine glatte.
»Oh«, flüsterte Lucy. »Gut zu wissen.«
»Ein, zwei Mal vielleicht.« Lügnerin. »Vor langer Zeit.« Dreckige Lügnerin. »Wir sind Kollegen.« Zumindest das stimmte. »Es … es hätte niemals funktioniert.« Selbst in ihren eigenen Ohren klang ihr Protest lahm.
»Okay«, erwiderte Lucy gedehnt und räusperte sich. »Vielleicht warst du ja nicht allein … mit dem, was du damals empfunden hast … oder auch nicht … ein, zwei Mal … vor langer Zeit.«
Der Gedanke war ein Schock. »Ehrlich?«
»Könnte sein. Aber … nur die Ruhe. Hör dir an, was er zu sagen hat. Und wenn du ihn danach immer noch umbringen willst, ruf mich an. Ich hole dich ab, und du kannst dich so lange an J.D.s Boxsack im Keller abreagieren.«
Gwyn atmete zittrig aus. »Geht klar.« Sie beendete das Gespräch, als sie in Thornes Einfahrt bog. Sie schaltete den Motor aus und zog Thornes Haustürschlüssel aus ihrer Tasche, den sie schon seit einer Ewigkeit hatte. Wann immer einer von ihnen unterwegs war, goss der andere die Blumen, nahm die Post aus dem Briefkasten, fütterte die Haustiere.
Sie warf im Rückspiegel einen Blick auf Tweety, der in seinem Geschirr auf dem Rücksitz hockte. »Du kennst dich aus, Kumpel.« Thorne hatte in seinem Garten eigens einen Bereich für ihn abgeteilt, da sein Kater üblicherweise die Flucht ergriff, wenn er kam.
Tweety hatte seinen Namen Thornes kleinem zweifarbigen Kater Sylvester zu verdanken, was ihr damals als eine niedliche Idee erschienen war. Ironischerweise liebte die Dogge Sylvester heiß und innig, da diese Zuneigung jedoch nicht auf Gegenseitigkeit beruhte, mussten sie die beiden voneinander getrennt halten.
Noch ein weiterer Grund, weshalb es zwischen ihnen niemals funktioniert hätte.
Allerdings … Gwyn schloss die Augen und rief sich Thomas Thorne ins Gedächtnis, jeden einzelnen seiner prachtvollen, fast zweihundert Zentimeter, das dunkle Haar, den markanten Kiefer und das gerade richtige Maß an Bartstoppeln. Und die Muskeln. Viele Muskeln. Der Mann war der reinste Gott. Ernsthaft. Er könnte es problemlos mit jedem Hollywoodstar aufnehmen. Wo er auftauchte, gerieten die Frauen reihenweise ins Schwärmen. Aber er ließ sich auf niemanden ein. Grundsätzlich nicht.
Zumindest nicht in jüngerer Vergangenheit.
Nicht in den letzten sechs Jahren. Gwyn schluckte. Nicht mehr seit … Evan, dem Mörder, den sie in ihr Bett eingeladen hatte. Der völlig besessen von Lucy gewesen war. Der so viele Menschen getötet hatte … der mich benutzt hat.Um an Lucy heranzukommen. Damit er sie töten kann. Nachdem er mich getötet hat.
Was schon schlimm genug gewesen wäre. Aber er hatte mehr getan, als sich nur an Gwyn heranzumachen. Er hatte …
Sie riss die Augen auf und blinzelte rasch, um die Bilder zu verjagen, die sich in ihr Gedächtnis geschlichen hatten. Bilder, die ihr immer noch das Blut in den Adern gefrieren ließen.
Er hatte so viel mehr getan. Dinge, die sie niemals jemandem anvertraut hatte – nicht einmal Lucy. Und schon gar nicht Thorne. Sie hatte keinen Sinn darin gesehen, nachdem alles vorüber gewesen war.
Evan war tot. Über Monate hinweg hatte er sie belogen, sie glauben lassen, sie sei »die Richtige«. Er hat mir erzählt, er liebt mich. Damit er an Lucy herankommt. Und jeder, der einen Internetzugang besaß, wusste von ihrer Blamage.
Aber dass sie auch vergewaltigt worden war? Nein, sie wollte nicht noch mitleidigere Blicke hervorrufen. Deshalb hatte sie dieses grauenvolle Detail für sich behalten. Bis sie vor sechzehn Monaten eine Therapeutin gefunden hatte, die ihr half, allmählich zu genesen.
Sie hatte ihre Stimme im Ohr. Es passiert nicht jetzt. Wiederholen Sie, was ich sage, Gwyn. Es passiert nicht jetzt. Gwyn hatte gehorcht und sich den Satz wieder und wieder vorgesagt. Es passiert nicht jetzt. Und irgendwann, nach Monaten, hatte sie endlich angefangen, es auch zu glauben.
Mit zitternden Händen rief sie die Fotos auf ihrem Handy auf und ging sie durch, um den Albtraum von damals mit Gesichtern echter Menschen zu verjagen, so wie die Therapeutin es ihr gezeigt hatte. Echte Menschen. Die sie liebten.
Lucy. J.D. Ihre beiden Kinder Jeremiah und Bronwynne. Die nach mir benannt ist, nach meinem zweiten Vornamen