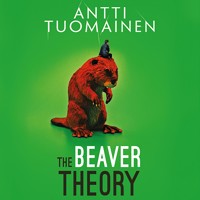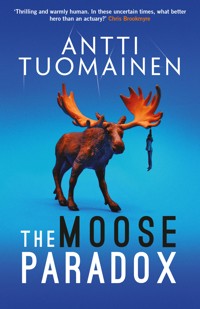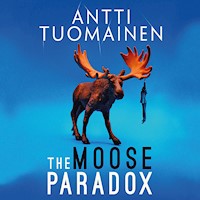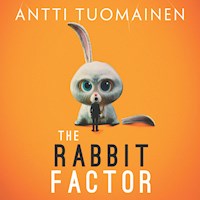8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Vor zwanzig Jahren verschwand Sonja Merivaara spurlos. Seit zwanzig Jahren ist die Polizei ahnungslos. Aber ihr Sohn Aleksi ist besessen vom Schicksal seiner Mutter. Jetzt begibt er sich selbst auf die Suche nach ihr. Eine Spur führt ihn in das Haus eines Millionärs. Doch seine Ermittlungen geraten schnell aus dem Ruder. Denn er verfällt der Tochter des Hausherren sofort. Etwas stimmt nicht mit der schönen Frau. Schon bald begreift Aleksi, dass sie ihn nur benutzt. Und dass sie ihn für eine besonders grausame Aufgabe braucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
An einem regnerischen Herbsttag verschwindet die Mutter des dreizehnjährigen Aleksi spurlos. Die Polizei ermittelt jahrelang, findet aber nie heraus, was geschehen ist. Aleksi wächst einsam auf und kann sich nicht damit abfinden, dass der Fall nie gelöst wurde. Er ist besessen vom Schicksal seiner Mutter, all seine persönlichen Beziehungen scheitern.
Zwanzig Jahre später: Aleksi ist sich sicher, den Schuldigen endlich gefunden zu haben. Er verdächtigt den Millionär Henrik Saarinen – denn zehn Jahre nach Verschwinden von Aleksis Mutter gab es einen ähnlichen Fall im Umfeld des Millionärs. Leider glaubt ihm die Polizei nicht. Aleksi will endlich die Wahrheit herausfinden und beginnt, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen. Er nimmt einen Job im Herrenhaus von Henrik Saarinen an. Dazu trennt er sich sogar von Miia, seiner großen Liebe – ohne ihr zu sagen, warum. Doch seine Ermittlungen geraten schnell aus dem Ruder, als er der Tochter des Millionärs begegnet und ihr sofort verfällt. In dem idyllisch gelegenen Herrenhaus herrscht eine merkwürdig düstere Stimmung. Jemand durchwühlt Zimmer und greift Aleksi an. Wer steckt dahinter?
Der Autor
Antti Tuomainen wurde 1971 geboren und war früher als Werbetexter tätig. Heute arbeitet er als Autor und freier Journalist. Sein Thriller »Der Heiler« wurde mit dem Preis für den besten finnischen Krimi des Jahres 2010 ausgezeichnet. Antti Tuomainen lebt mit seiner Frau in Helsinki.
Von Antti Tuomainen ist in unserem Hause bereits erschienen:
Der Heiler
Antti Tuomainen
Todesschlaf
Thriller
Aus dem Finnischen
von Anke Michler-Janhunen
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Der Verlag dankt FILI für die Förderung der Übersetzung.
Die Verse im Text entstammen dem Gedicht »Lächelnder Apollo« (fi. Hymyı̊levä Apollo) von Eino Leino (1878–1926) – (S. 7, 121) sowie dem finnischen Kirchenlied »Kiitos sulle, Jumalani« – (S. 330), übersetzt von Anke Michler-Janhunen
Deutsche Erstausgabe im List Taschenbuch
List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.
1. Auflage Oktober 2014
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014
© 2013 by Antti Tuomainen
Titel der finnischen Originalausgabe: Synkkä Niin Kuin
Sydämeni (Like Kustannus Oy, Helsinki, 2013)
Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, München
ISBN 978-3-8437-0939-2
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Für meine Mutter
Dies’ Lied sang ich an Mutters Grab,
was sie sogleich verstand.
Ein’ Kuss sie auf die Stirn mir gab
und nahm mich bei der Hand:
»Der eine glaubt dem Traume, der andere dem Wort –
allein ein fühlend’ Herz ist wahren Glaubens Ort!
Dein Glaub’ allein ist Wahrheit schon.
D’rum glaube deinem Traum, mein Sohn!«
EINO LEINO, Lächelnder Apollo
PROLOG
Sie hatte einen Mann getroffen, und jetzt füllte sich ihr Mund mit Blut. Diese Dinge hingen zusammen, und auch wieder nicht.
Was hatte sie falsch gemacht?
Ihrer Meinung nach nichts.
Und dennoch …
Ihr Kiefer hing schmerzhaft aus dem Gelenk, die zwei äußeren Finger der linken Hand waren gebrochen und schrien vor Schmerzen, und es schien noch schlimmer zu kommen.
Unglaublich, wie schnell ein Gedanke fliegen konnte, woran er hängenblieb, was er sah und woran er sich erinnerte.
Im letzten Jahr hatte sich alles in ihrem Leben von Grund auf verändert. Oder nicht alles. Alles hatte sich vor dreizehn Jahren verändert, als ihr Sohn geboren wurde. Aber im letzten Jahr hatte sich das Leben entfaltet wie ein zerknülltes Stück Papier, das glattgestrichen wurde. Wie eine Pflanze nach einem Sturm, wenn die jahrelang hinterm Horizont verborgene Sonne wieder aufging.
Sie hatte gehört, dass es im Moment der größten Not kein Leid mehr gibt: Entweder man stirbt sofort, oder man verfällt in so große Panik oder Schockstarre, dass man nicht mehr mitkriegt, wie man stirbt.
Das stimmte natürlich nicht. Sie dachte mit so vollkommener Klarheit wie selten zuvor.
Und so sah sie, wie schön alles war. Alles, was das lange und glänzende Messer durchtrennte. Sie sah ihren Sohn. Ihr Leben. In dieser Reihenfolge.
Der Gedanke war so hell und klar, dass er das Innere des Autos erleuchtete, diesen engen luftleeren Raum, in dem das künstlich leuchtende Grün des Armaturenbrettes schimmerte, als ob sie in ein U-Boot gestiegen und damit kilometerweit in die Tiefe gesunken wären. Und der Gedanke breitete sich aus. Er durchdrang den Oktobernachmittag, der draußen hing wie ein grauer, dicker Vorhang, und den Regen, der dicht war wie Nebel, aber Wasser eben und eisig kalt. Der Gedanke durchdrang ihre zweiunddreißig Jahre, und sie wusste genau, was von Bedeutung war und was nicht.
Wenn Zeit gewesen wäre, hätte sie vielleicht gelacht. Wenn Zeit gewesen wäre, hätte sie – praktisch veranlagt und lebensbejahend wie sie war – gedacht, dass die Dinge auch hätten schlimmer kommen können. Vielleicht hätte sie im Eilschritt ihr Leben durchlaufen, ohne seine Schönheit zu verstehen und ohne die Wunder vor ihr und um sie herum wahrzunehmen. Oder sie hätte sich wieder einmal in etwas Nebensächliches vertieft.
Stattdessen wehrte sie mit der Hand die Angriffe des Messers ab. Das lange, stählerne Messer stach ein weiteres Mal zu. Ihre zarte, schmale Hand. Das breite, kalte Messer. Es durchschnitt ihre Handfläche von den Fingerknöcheln bis zum Handgelenk.
Sie sagte sich erneut, dass alles nur passierte, weil sie einen Mann getroffen und sich auf ihn eingelassen hatte. Sie sagte es sich immer wieder. Die Wahrheit ließ sie aufschrecken. Sie hatte einen Mann getroffen, sie wehrte mit der Hand Messerstiche ab. Zwischen zwei Dingen konnte kaum ein größerer Unterschied bestehen. Und dennoch hatte das eine zum anderen geführt. Sie erinnerte sich an einen amerikanischen Film, in dem ein müder Polizist gegenüber einem jüngeren Kollegen den Sinn des Lebens mit den Worten auf den Punkt brachte: Jedem kann jederzeit alles passieren.
So war es wohl.
Aber trotzdem.
Sie dachte erneut an ihren Sohn. Plötzlich gab es so viele Dinge, die sie hätte sagen sollen. Und sofort traten sich die Dinge gegenseitig auf die Füße, überrannten sich, stolperten und wurden von immer neuen, noch drängender hervorstürzenden zerquetscht.
Ihr Sohn. Ihr Sohn sollte zumindest wissen …
Wie sehr sie ihn geliebt hatte …
Das kostete Opfer.
Sie musste den Arm weit ausstrecken. Das hieß, Brustkorb und Bauch waren dem rasend auf und ab schwingenden Messer schutzlos ausgeliefert.
Sie beugte sich mit aller Anstrengung so weit zur Seite, wie es der Sicherheitsgurt zuließ. Wie ironisch, von einem Sicherheitsgurt zu sprechen.
Ihre Hand bekam etwas zu fassen, ihre Nägel krallten sich fest. Sie bohrte ihre Nägel in den Nacken ihres Gegenübers und versenkte sie so tief, wie sie es mit der ihr noch verbliebenen Kraft vermochte. Sie war sich sicher, dass ihre Nagelspitzen bis in die untersten Hautschichten eindrangen. Sie war sich sicher, dass sie Blut und Fleisch an ihren Fingern spürte.
Das hatte seinen Preis. Sie hatte ihren Oberkörper nicht geschützt. Das Messer bohrte sich ihr in die Brust.
Ihre Kräfte schwanden. Sie fühlte ihre Arme nicht mehr. Einen Augenblick später begriff sie, dass ihre Hände in ihrem Schoß lagen. Unter ihren Fingernägeln, ausgenommen den abgebrochenen und den an den zuvor gebrochenen Fingern, sah sie jede Menge Haut und Blut. Blut, das eine andere Farbe hatte als ihr eigenes.
Das war doch was.
Das Messer stieß nicht mehr zu.
Das Auto fuhr.
Sie begriff, dass sie den Atem nicht anhielt. Es war vielmehr so, dass sie nicht mehr atmen konnte.
Sie wollte raus aus dem Auto. Sie dachte – klar und deutlich –, dass sie fliehen, irgendwie wegkommen musste.
Gleichzeitig spürte sie, dass sie flog, dass sie auf die warme, freundliche Sonne zueilte.
Ihr Wunsch schien wahr zu werden.
Sie würde zu ihrem Sohn fliegen.
ZWANZIG JAHRE SPÄTER
September 2013
Unter anderen Umständen, zu einer anderen Zeit hätte ich mich sofort entschieden gehabt.
Ich wusste, wer ich war.
Ihr Haar fiel dicht und glänzend schwarz auf die Schultern und den Rücken, der kurze Pony ließ die scharf nachgezogenen Augenbrauen frei. Auf ihrer hellen, fast weißen Haut sahen die Haare aus wie Rabenfedern auf frischem Schnee. Das gleiche undurchdringliche Schwarz fand sich auch in den langen, vollen Wimpern. Blaugraue Augen blickten mich unverwandt an.
Der Gesamteindruck war eine Mischung aus Gelassenheit, sicherer Überlegenheit und noch etwas anderem, aus dem ich zumindest beim ersten Treffen nicht gleich schlau wurde. Um dieses Etwas zu erkunden, hätte ich zunächst einmal von meinem dunkelbraunen Ledersessel aufstehen, den antiken, ovalen Tisch aus Nussbaumholz umrunden und mich neben die zierliche Frau auf das hellgelbe, verschnörkelte Sofa setzen müssen. Das zu tun, hatte ich nicht vor. Aus verschiedenen Gründen.
Der erste Grund hatte natürlich etwas damit zu tun, wer die Frau war. Ihr Name war Amanda Saarinen. Sie stellte das Weinglas zurück auf den Tisch. Am Glasrand blieb der Abdruck ihres dunkelroten Lippenstiftes zurück, so breit und lang wie ein kleiner Finger.
»Du bist der neue Hausmeister.«
An ihrer schwarzen Bluse mit dem breiten Kragen standen die obersten drei Knöpfe offen. Mir war schon vorher aufgefallen, dass die schlanke Frau auf plastische Chirurgie gesetzt hatte. Das Ergebnis erinnerte ein bisschen an die auf antik gemachten, aufgepolsterten Möbel, auf denen wir saßen. Auf dem Tisch standen kunstvoll arrangierte, gelbe und orangefarbene Blumen, die Ton in Ton mit den Blumen und Wappen auf der Tapete an der Wand links und rechts hinter ihr harmonierten. Die Frau dazwischen wirkte, als ob sie mitten in einem Gemälde säße.
»Du siehst nicht aus wie ein Hausmeister«, fuhr die Frau fort und reichte mir die Hand über den Tisch. »Ich vergaß, mich vorzustellen: Amanda Saarinen.«
»Aleksi Kivi. Macht nichts«, sagte ich, drückte ihr die Hand und setzte mich wieder auf meinen Platz. »Ich dachte mir schon, dass du Amanda bist. Ich bin erst seit einer Woche hier. Vielleicht sehe ich ja bald aus wie ein richtiger Hausmeister.«
Amanda lächelte unmerklich. Sie war zwei Jahre jünger als ich, 31 Jahre alt. Sie griff wieder nach ihrem Weinglas. Es war halb zwölf, vormittags.
»Hausmeister sind klein, behäbig und um die fünfzig. Sie haben Hosen mit Oberschenkeltaschen und am Gürtel hundertfuffzig Schlüssel, einen Leatherman und so ein unkaputtbares Handy. Unter ihren Fingernägeln sind schwarze Ränder. Und wenn man mit ihnen redet, hören sie nicht zu. Du scheinst aber zuzuhören. Oder etwa nicht?«
»Klar höre ich zu.«
»Und deine Fingernägel sind sauber. Absolut unhausmeisterlich.«
Amanda nahm einen Schluck aus ihrem Weinglas.
»Und du wolltest ausgerechnet hierher?«
»Ja.«
»Warum?«
»Ich wollte Abwechslung.«
Amanda schaute mich mit ihren blaugrauen Augen an.
»Ja, sicher. Aber Abwechslung wovon?«
»Na, vom Renovieren zum Beispiel. Ich bin Zimmermann von Beruf und habe diese Arbeit jetzt fast zehn Jahre lang gemacht. Hauptsächlich Wohnungsrenovierungen. Zur Abwechslung wollte ich mich mal in Ruhe auf ein Objekt konzentrieren, nur in einem Objekt arbeiten und alles tipptopp in Ordnung halten.«
Das Letzte stimmte. Es war zwar nicht die ganze Wahrheit, aber das zumindest stimmte.
»Ich würde auch gern etwas finden, das ich machen will.«
»Ich denke, es wird sich etwas finden, wenn die Zeit reif dafür ist.«
»Ich glaube, die Zeit dafür ist schon vorüber.«
Ich schwieg.
»Was sonst noch?«, fragte Amanda schließlich. »Du bist Zimmermann, und was hast du sonst noch gemacht?«
»Nicht viel. Anderthalb Jahre lang hatte ich ein Antiquariat in der Nähe vom Karhupuisto-Park im Helsinkier Stadtteil Kallio. Das lief überhaupt nicht. Ich habe die Bücher zu einem viel zu niedrigen Preis verkauft, weil ich wollte, dass sie gelesen werden.«
»Interessant«, erwiderte Amanda mit überraschend aufrichtig klingender Stimme.
Amanda trank einen Schluck Wein. Auf dem Boden des Glases war nur noch eine Pfütze.
»Was erzählt man sich über dieses Anwesen hier?«, fragte sie.
»Dass es sehr wichtig für die Familie ist und eher ein Ort zum Zurückziehen als zum Wohnen.«
»So kann man das wohl auch sagen. Und, hat man dir erzählt, dass hier eine dreißigjährige Frau wohnt, die eigentlich keinen einzigen Freund mehr hat?«
Ich sah Amanda an.
»Das kann ich mir kaum vorstellen.«
»Was kannst du dir nicht vorstellen, dass sich hier jemand verkriecht oder dass jemand keinen einzigen Freund hat?«
»Beides. Aber es geht mich eigentlich auch gar nichts an.«
»Wohl nicht«, erwiderte Amanda mit leiser Stimme.
Wir saßen vor einer verglasten Flügeltür. Der Rahmen und die Fensterleisten waren frisch gestrichen. Durch das Fenster sah man draußen einen hellen, wolkenlosen und windigen Frühherbsttag, der die gelb, golden und tiefrot gefärbten Blätter der Eichen und Ahornbäume tanzen ließ. Hinter den Bäumen erstreckte sich das schimmernde Meer endlos bis zum Horizont. Darüber strahlte der unendlich weite, kobaltblaue Septemberhimmel, und es fiel schwer, sich hinter dieser Helle und Klarheit den dunklen, kalten Weltraum vorzustellen. Dennoch war er dort. Selbstverständlich war er dort.
Amanda schien meine Anwesenheit vergessen zu haben. Sie starrte mit unbeweglicher Miene in den Garten oder auch aufs Meer hinaus. Ich dachte wieder einmal an Miia. Ich erinnerte mich an das Gute, das endlich in mein Leben gekommen war und das ich hinter mir gelassen hatte, um hierher zu kommen und zu tun, was ich tun musste.
Ich schaute mich um. Der Raum, in dem wir waren, wurde Saal genannt. Ein passender Name für den mit schätzungsweise siebzig Quadratmetern größten Raum des Gutshauses. Eine dezente, goldgelbe Tapete bedeckte die Wände oberhalb der hüfthohen, grauen Wandvertäfelung. An der Decke hingen zwei identisch aussehende, kristallene Kronleuchter, die in der Woche, seit ich hier im Haus war, noch nicht angezündet worden waren.
Genau genommen wohnte ich gar nicht im Haus. Ich hatte ein kleines Zimmer mit Küche in einem Seitenflügel des Wirtschaftsgebäudes.
»Hast du den Alten schon getroffen?«, fragte Amanda unvermittelt.
»Wen?«
»Na, Vater natürlich!«
Ach so.
»Nein, habe ich nicht.«
In ihren Augen blitzte es auf.
»Und Markus?«
»Meinst du Markus …«
»Ja, Markus Harmala, Vaters Chauffeur.«
»Nein, auch nicht. Wenn Henrik nicht da ist, dann kann er doch auch nicht hier sein, oder?«
Amanda machte keine Anstalten, auf meine Bemerkung einzugehen. Sie schaute mir gerade in die Augen und fragte:
»Wie viele Vorstellungsgespräche haben sie mit dir geführt?«
»Drei.«
»Inklusive der albernen psychologischen Tests?«
»So witzig fand ich die gar nicht. Also vier, wenn man den Test mitzählt.«
»Vater möchte wohl ganz sichergehen«, ließ Amanda verlauten, ohne allzu überzeugend zu klingen. Sie nahm ihr leeres Weinglas in die Hand, betrachtete es einen Augenblick und hob dann erneut ihren Blick.
»Was hast du gerade gemacht, als ich dich hierher gerufen habe?«
»Ich war auf dem Weg ins Untergeschoss, um den Wasserverbrauch zu kontrollieren. Nach der Installation der neuen …«
»Genau. Und jetzt musst du weitermachen. Natürlich. Ich muss auf jeden Fall jetzt los. Habe ich mein Auto vor dem Haus stehenlassen?«
»Ja«, sagte ich, »falls der schwarze Range Rover dein Auto ist. Er steht direkt vor der Tür.«
Amanda erriet meine Gedanken.
»Ein Glas Wein«, sagte sie und lächelte. »Ich bin fahrtüchtig.«
Ich sah keinen Grund, mit ihr darüber zu diskutieren. Amanda erhob sich vom Sofa und zog sich die Jacke über. Ich tat es ihr gleich und folgte ihr nach draußen. Der Wind fuhr mir in die Haare und fühlte sich auf meiner Haut, die drinnen warm, ja fast heiß geworden war, angenehm kühl an. Amanda lief mit energischen Schritten voran. Irgendwo ganz in der Nähe war der Gesang einer der letzten Schwarzdrosseln dieses Jahres zu hören. Wir kamen zum Auto.
»Ich wollte dich kennenlernen«, sagte Amanda. »Mir ist es nicht egal, wer hier alles in Ordnung hält. Aus verschiedensten Gründen.«
»Verstehe ich«, erwiderte ich.
Der Abstand zwischen uns betrug weniger als einen Meter. Aus der Nähe betrachtet waren Amandas Augen glänzend und hart. Der Wind blies ihr die schwarzen Haare ins Gesicht. Einen Windhauch lang glaubte ich den Geruch von Alkohol in der Nase zu spüren.
»Bis bald«, sagte Amanda zum Abschied und setzte sich mit einer einzigen geschmeidigen Bewegung ins Auto.
Der davonbrausende Geländewagen hinterließ dunkelbraune Spuren im Schotter und verschwand in der Birkenallee und aus meinem Blickfeld. Ich tat einen tiefen Atemzug und sog die frische Septemberluft genüsslich ein. Buchstäblich vor Erleichterung.
Unter anderen Umständen, zu einer anderen Zeit.
Vielleicht.
Aber auf keinen Fall jetzt.
Ich aß gerade vor dem Fernseher stehend einen Weetabix-Riegel, als zwei Polizisten an der Tür klingelten. Der Fernseher lief, aber ich schaute nicht hin.
Sie nannten ihre Namen und dass sie von der Kriminalpolizei seien und fragten, ob sie reinkommen könnten. Ich sagte nichts, ich war dreizehn und mein Mund voll mit Brei und kalter, fettarmer Milch. Die Polizisten warteten nicht, bis ich runtergeschluckt hatte. Sie kamen in die Wohnung und gingen weiter bis ins Wohnzimmer. Sie sagten, ich solle mich setzen.
Die Polizisten trugen Uniform und hatten ihre schmalen Krawatten gelockert. Sie sahen mich mit traurigen Gesichtern an. Unter ihren Augen waren blauviolette Augenringe und schwere, geschwollene Tränensäcke. Nachdem wir eine Weile schweigend gesessen hatten, fragten sie, ob es einen nahen Verwandten gäbe, den sie anrufen und herbitten könnten.
»Meine Mutter«, sagte ich.
»Noch jemand anderen?«, fragte einer der beiden, seine Zähne waren gelblich verfärbt.
Ich schüttelte den Kopf.
»Deinen Vater vielleicht«, schlug der andere vor. Er hatte eine unglaublich hohe und sehr glänzende Stirn.
Ich schüttelte den Kopf.
»Tante? Onkel? Oma? Opa?«
Ich schüttelte wieder den Kopf. Meine Mutter und ich lebten zu zweit, und es fehlte uns an nichts.
»Ich rufe beim Sozialen Dienst an«, sagte der mit den gelben Zähnen zu dem mit der hohen Stirn, stand auf und ging in die Küche, um zu telefonieren.
Der mit der hohen Stirn und ich warteten schweigend. Durch die Wand war das undeutliche Gemurmel des Polizisten mit den gelben Zähnen zu hören. Er kam wieder rein und nickte in Richtung seines Kollegen. Der mit der glänzenden Stirn räusperte sich nervös.
»Deine Mutter ist verschwunden«, sagte er.
»Ist sie nicht«, sagte ich.
Plötzlich musste ich sauer aufstoßen und hatte den Geschmack von ekelhaft warmer Milch im Mund.
»Wir nehmen dich jetzt mit. Dann reden wir.«
Auf der Polizeiwache saß eine Frau neben mir, die ein blaues Tuch umgebunden hatte. Sonst war sie kreidebleich. Alles an ihr war fahl – die Haut ihres Gesichtes, die Farbe ihrer Haare und selbst die unterschiedlich hellen Töne ihrer Kleidung. Ab und zu legte sie ihre Hand auf meine Schulter. Das fühlte sich fremd an. Es war nicht Mutters Hand.
Die Polizisten fragten die Frau, ob sie mir weiter Fragen stellen dürften. Die Frau fragte mich, ob ich erschöpft sei.
Ich sagte, ich sei nicht erschöpft. Ich wollte meine Mutter wiederhaben.
In allen Fragen ging es um sie.
»Wie war es in letzter Zeit bei euch zu Hause?«
»Hat sich deine Mutter mit jemandem getroffen?«
»Hatte deine Mutter einen Freund?«
»Gab es vielleicht jemanden, der deiner Mutter mal gedroht hat?«
Ob ich die Bekannten meiner Mutter gekannt hätte?
Ob ich gewusst hätte, dass sie sich manchmal mit Männern traf?
War Mutter glücklich? Normal? Fröhlich? Traurig?
Was hat Mutter am Morgen angezogen? Was hat Mutter gesagt, bevor sie zur Arbeit gegangen ist? Und in welchem Ton hat sie es gesagt? Hat Mutter mal von den Leuten erzählt, mit denen sie sich getroffen hat? Wenn ja, konnte ich mich an einen von ihnen erinnern?
Und so weiter.
Es vergingen Wochen. Die Polizisten waren andere, aber die Fragen blieben die gleichen.
Es vergingen Monate, und obwohl es immer noch die gleichen Fragen waren, hörte ich sie nun seltener. Dann hörten die Fragen ganz auf.
Ich war dreizehn.
Ich war mir schon damals sicher, dass die Polizei das Verschwinden meiner Mutter niemals aufklären würde.
Ich war mir immer noch sicher.
Das Gutshaus Kalmela lag direkt am Meer, vierundneunzig Kilometer westlich von Helsinki, dort stand es schon seit dem Jahr 1850. Zum Gutshaus gehörten insgesamt zweihundertsechzehn Hektar Land, von dem etwa die Hälfte als Ackerfläche genutzt wurde. Die andere Hälfte war Wald, teils bewirtschaftet und teils unbewirtschaftet. Die Uferlinie erstreckte sich über einen Kilometer, etwa ein Zehntel davon, einhundertzwanzig Meter am Ostrand des Grundstückes, war gerodet. Von einem langen Steg aus blickte man in westlicher Richtung auf einen mehrere hundert Meter langen steinigen und verwilderten Uferstreifen, der an mindestens zwei Stellen von steil ins Meer abfallenden, rotgrauen Felswänden unterbrochen wurde.
Das Gutshaus selbst lag auf einer kleinen Anhöhe und hob sich eindrucksvoll von der Umgebung ab. In seiner stattlichen, gelben Schönheit überragte es das Anwesen wie die Sonne an einem wolkenlosen Tag. Außerdem gab es ein Wirtschaftsgebäude mit Garage, ein Gästehaus, einen Bootsschuppen und eine Strandsauna.
Die Äcker waren an einen Bauern aus dem Ort verpachtet. Jetzt im September ruhten die Felder kahl und stoppelig. Abhängig von Intensität und Stellung der Sonne wirkten sie mal goldgelb, mal mattbraun und mal feldgrau. Im Frühling würden auf ihnen wieder Roggen, Hafer, Zuckerrüben und Kartoffeln wachsen.
Wald gab es, so weit das Auge reichte, und auch jetzt im Herbst war er überraschend dicht und dunkel.
Das Hauptgebäude war Anfang des Jahrtausends restauriert worden. Die weißgestrichenen Säulen zu beiden Seiten des Eingangs waren so dick wie ein Boxsack und hoben sich mit den ebenfalls weißen Fensterrahmen auf schöne Weise von der in vornehmem Hellgelb gestrichenen Fassade ab. Das restaurierte Gebäude hatte zwei Stockwerke, acht Zimmer und eine Wirtschaftsküche. Das untere Stockwerk wurde von allen gemeinschaftlich genutzt. Es wurde beherrscht von einem großen, lichtdurchfluteten Saal, in den alle Gäste, auch ich, zuerst geführt wurden. Dahinter lag das Esszimmer, und hinter dem Esszimmer befand sich, den Blicken verborgen, die Küche. Küche und Vorratskammern nahmen einen Großteil der Fläche des Erdgeschosses ein.
Ebenfalls im unteren Stockwerk befand sich die mit üppigen, englischen Ledersesseln und einer Bar ausgestattete Bibliothek, an deren Wänden Bücherregale aus dunklem Holz und mit Glastüren standen. Es gab sehr viele, zum größten Teil alte Bücher.
Die Schlafräume befanden sich im Obergeschoss. Einer von ihnen, der größte, umfasste drei kleinere Schlafzimmer, die verbunden und mit einem geräumigen Designer-Bad ausgestattet worden waren. In der Mitte des oberen Stockwerkes befand sich ein Salon, der dem großen Saal im Untergeschoss zwar ähnlich, aber kleiner als dieser war, und von dem aus Flügeltüren auf einen Balkon hinaus führten.
Vom Balkon aus hatte man einen Blick auf das Meer. Von hier aus sah man auch die gepflegte Rasenfläche, die gesäumt wurde von Reihen stolzen Wacholders und alten, ausladenden Ahornbäumen voller rot- und gelbgefärbter Blätter. Rechts lagen der Bootsschuppen und der Bootssteg, an dem ein fünfzehn Meter langes, schneeweißes Boot befestigt war. Zur Linken lag die mit naturbraunem Holz verkleidete Strandsauna, an der sich eine Terrasse sowie ein schmaler, für kurze Badegänge gedachter, Steg befanden.
So auf dem Balkon stehend, konnte man noch andere Beobachtungen machen. Es gab keine Nachbarn. Der Wind war der einzige, ständige Begleiter. Egal, in welcher Ecke des Grundstückes man sich aufhielt, immer wehte der Wind in den Haaren, immer rauschte der Wald, und immer trug eine frische Brise die salzige, verlockende Meeresluft überall hinein, auch ins Innere des Gebäudes. Wenn der Wind einmal schwächer wurde oder gar ganz nachließ, senkte sich eine wundersame Stille über alles. Nur der Mensch konnte sie durchbrechen.
Zwei Menschen waren ständig vor Ort: die Köchin Enni Salkola und ich. Zwischen uns herrschte eine Art kollegiales Einverständnis. Vielleicht so etwas wie ein instinktiver, unausgesprochener Gedanke: Wir waren diejenigen, die hier im Gutshaus arbeiteten – anders als die, die hier lebten oder zu Besuch kamen. Es gab sieund uns, und dieser Unterschied ließ Enni und mich auf derselben Seite stehen.
Vorgestern Abend war ich über den im Dämmerlicht liegenden Hof zu meiner Unterkunft gegangen. Ich hatte den ganzen Tag bei Wind und Kälte draußen gearbeitet. Da hatte Enni mich gerufen, und wir hatten daraufhin in der Küche zusammen Abendbrot gegessen: dünne, schmale Scheiben frischgebackenen Roggenbrotes mit Butter, gebeiztem Lachs und würzigem Emmentaler, dazu süß-säuerlich schmeckende Äpfel aus eigener Ernte. Ich war wirklich hungrig. Wir redeten ein bisschen über die Arbeit und genauso lange über das Wetter, aber die meiste Zeit saßen wir nur schweigend und aßen, ohne dass die Stille störend gewirkt hätte. Als ich beim Essen zu ihr hinüberblickte, lächelte sie nur und fragte, ob ich noch etwas essen wolle. Und ich hatte noch mehr gegessen.
Jetzt stand ich auf dem Balkon und sah aufs Meer hinaus. Es lag blau und ruhig vor mir, und fast schien es, als ob man auf seiner Oberfläche gehen könnte. An meinen nackten Unterarmen spürte ich den frischen Septemberwind. Ich kontrollierte noch einmal die gerade von mir ausgebesserten Fußbodenbretter und überprüfte, ob eines locker war, klapperte oder knarrte, wenn man darauf trat. Unter die schadhaften Stellen hatte ich Keile gelegt und so lange geschnitzt und geschliffen, bis alle Bretter schön gleichmäßig auf einer Höhe waren. Mit dem Ergebnis war ich sehr zufrieden. Ich erwartete nicht, dass jemand an einem kühlen Septemberwochenende auf dem offenen Balkon sitzen würde, aber dieser kleine Erfolg tat mir gut.
Ich ging hinein, verschloss die Balkontür hinter mir, nahm den Werkzeugkoffer in die rechte Hand und ging die Treppen hinunter ins Erdgeschoss. Ich überquerte den Hof zuerst in Richtung Werkstatt, wo ich meinen Werkzeugkoffer abstellte, und ging dann weiter auf die andere Seite des Gebäudes, wo ich wohnte.
Zu meiner Wohnung im zweiten Stock führte eine eigene Treppe. Ich schloss die Wohnungstür nie ab. Wozu auch. Ich besaß nur wenig, und das wenige, was wertvoll war, war es nur für mich. Ich stellte die schweren Arbeitsschuhe an der Tür ab, kochte mir einen starken Kaffee und bestrich zwei herzhafte Roggenbrotscheiben mit Butter und Ennis selbstgemachter Hasenpastete.
Ich saß am Fenster und sah zu, wie sich das fahle Nachmittagslicht in der dickwandigen Vase mit der grobkörnigen Oberfläche brach, die ich aufs Fensterbrett gestellt hatte.
Dezember 1993 – Juli 2003
Früher war sie mir nie aufgefallen.
Als ich in der kleinen, stillen Wohnung zum Fenster im Wohnzimmer ging, fühlte ich den Blick der Sozialarbeiterin in meinem Rücken.
Unser Zuhause, in dem Mutter und ich gewohnt hatten, sollte verkauft werden. Mir war immer wieder und mit immer neuen Worten erklärt worden, dass ich hier nicht allein wohnen bleiben konnte. Man sagte zu mir, dass ich erst dreizehn wäre und dass ich einen Erwachsenen um mich herum bräuchte, der auf mich aufpasst. Ich widersprach nicht. Natürlich war ich anderer Meinung, aber ich sah ein, dass es keinen Zweck hatte, dagegen zu protestieren. Nach Mutters Verschwinden nahmen die Dinge unaufhaltsam und unvermeidlich ihren Lauf. Als ob eine große, unsichtbare Hand zwischen meinem früheren und meinem jetzigen Leben eine Grenze gezogen hätte, gegen die ein einzelner kleiner Junge nichts ausrichten konnte.
Die Sozialarbeiterin ging in die Küche. Ich nahm die Vase in die Hand und fühlte, dass auch Mutter sie in der Hand gehalten hatte. Vielleicht hatte Mutter sie von ihrer Mutter bekommen. Ich wusste es nicht, und ich wusste auch so gut wie nichts über meine Oma oder über sonst irgendetwas. Vielleicht hatte Mutter sie auch nur einfach irgendwo gesehen und mit nach Hause gebracht. Auf jeden Fall hatten Mutters Hände diese Vase berührt. Ich holte ein T-Shirt aus meinem Zimmer und wickelte die Vase darin ein.
Ich fragte die Sozialarbeiterin, ob ich für eine Nacht zu Hause bleiben könnte.
Nein, es ging nicht.
Ich schaute der Sozialarbeiterin kurz in die Augen und sah, dass es ihr leidtat. Allen tat es leid. Aber das brachte Mutter nicht zurück, und es erklärte auch nicht, wohin sie verschwunden war.
Dann ging ich in mein Zimmer. Es war das kleinste Zimmer unserer nicht sehr großen Wohnung, aber es war mein eigenes. Ich dachte daran, wie Mutter einmal zu mir gesagt hatte, dass ich jetzt etwas besaß, was sie nie gehabt hatte. Dabei standen ihr Tränen in den Augen. Das kam manchmal vor. Vor allem dann, wenn sie von ihrem Leben vor mir sprach. Mutter sagte, dass es sie sehr glücklich machte, mir das alles geben zu können. Damals dachte ich, Mutter meinte nur das Zimmer.
Ich öffnete die Schubladen des Tisches mit der zerschrammten Oberfläche, den wir gebraucht gekauft hatten. Die Schubladen waren voller Krimskrams: Spielzeug, Zeichnungen, Sammelalben, Stifte, Radiergummis, Zeitungen – alles Mögliche, was ich gefunden und nach Hause geschleppt hatte. Die große, erbarmungslose Hand des Schicksals war auch hier schon gewesen. Ich begriff, dass ich nicht mehr der Junge war, der diese Bilder gemalt, diese Zeitungen gelesen und diese Spiele gespielt hatte. Ich war jetzt ein anderer, mein früheres Ich war zusammen mit Mutter verschwunden.
In Mutters Zimmer setzte ich mich auf den Rand ihres Bettes. Ihr Duft lag noch in der Luft, und die Gegenstände sahen aus, als ob Mutter jeden Augenblick zurückkehren und sie in die Hand nehmen könnte. Aber die Dinge waren schon in Bewegung: Sie schwebten über dem Tisch, lösten sich von den Kleiderbügeln und erhoben sich vom Fußboden. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Der Gedanke daran, dass Mutters Sachen einfach weggeschafft werden sollten, fühlte sich an, als ob Mutter ein zweites Mal verschwinden würde. Aber ich begriff auch, dass ich nicht alles mitnehmen konnte. Nicht einmal einen großen Teil davon.
Ich schaute mich um.
An dem Spiegel mit dem schwarzen Metallrahmen waren zwei weiße, fingerbreite Bänder befestigt. Ich erinnerte mich noch genau, wie Mutter sie an den schön geschwungenen Metallverzierungen angebracht hatte und welche Geschichten sich mit den zwei Schleifen verbanden. Die erste, die weiter innen und ganz oben am Rand befestigt war, hatte Mutter selbst gebunden. Das war leicht zu erkennen. Die Bögen hatten einen fröhlichen und kräftigen Schwung. Als ich sie betrachtete, sah ich Mutters Hände und Finger vor mir, wie sie die Schleife banden.
Es gelang mir, die Schleife abzuziehen, ohne den Knoten zu lösen. Die zweite, so hatte Mutter erzählt, war auf der Verpackung einer Schokoladentorte gewesen. Nicht irgendeiner Schokoladentorte, hatte Mutter gesagt, sondern einer selbstgebackenen Torte zum Namenstag, die sie von einem ihr wichtigen Menschen in einem wichtigen Augenblick bekommen hatte. Das machte die Schleife zu etwas Besonderem. Ich hatte immer gedacht, dass dieser Schleifenknoten irgendwie anders aussah, obwohl er aus dem gleichen Material und genauso schwungvoll gebunden war wie der von Mutter. Aber dieser Knoten war dicker, und die Schleife hatte vier Schlaufen. Als ich nah heranging, sah ich, dass es kein gewöhnlicher Schleifenknoten war. Er war sehr fest gezogen und in der Mitte steinhart. Er fühlte sich nach jemand anderem an. Ich streifte auch diese Schleife vom schwarz geschwungenen Metallrand, umschloss beide mit meiner Hand und lief zum Fensterbrett. Dort schob ich das T-Shirt beiseite, ließ die Schleifen in die Vase fallen, wickelte die Vase wieder ein und nahm sie unter den Arm.
Ich fragte die Sozialarbeiterin, was mit Mutters Sachen geschehen würde.
»Sie kommen bestimmt an einen guten Ort«, sagte sie.
»Wenn es ein guter Ort ist, kann ich dann auch dorthin?«
Die Sozialarbeiterin versuchte ihr Bestes, aber das Lächeln war nicht echt.
»So habe ich das nicht gemeint«, sagte sie.
Ich sagte nichts. Ich wusste, dass sie es nicht so gemeint hatte. Die Sozialarbeiterin trat einen Schritt aus der Zimmertür zurück.
Diese Sachen waren nicht meine Mutter. Und Mutter würde nicht böse sein, wenn ich nicht viel davon mitnähme. Ich war zwar erst dreizehn, aber ich verstand schon, worauf es ankam.
Es ist einfacher, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein.
Im Laufe der folgenden Jahre lernte ich, dass das nicht immer stimmte.
Ich hatte aufgehört, das Schicksal meiner Mutter als Verschwinden zu bezeichnen. Keiner ist über Jahre hinweg verschwunden und taucht dann irgendwann lebendig wieder auf. So etwas geschieht nicht. Meine Mutter war ermordet worden.
Ich war gerade aus der Armee entlassen worden, hatte mir eine siebzehn Quadratmeter große Einraumwohnung im Helsinkier Stadtteil Sörnäinen gemietet und angefangen, als Zimmermannsgehilfe zu arbeiten. Ich mochte die Arbeit, und ich mochte den Zimmermann, bei dem ich arbeitete. Sein Name war Kauko Ranne. Er war einen Kopf kleiner als ich, arbeitete von frühmorgens bis spätabends und spornte mich an.
»Meine Arbeit ist getan, wenn du die Dinge besser kannst als ich«, sagte Kauko Ranne. »Keiner will ewig Gehilfe sein, jeder möchte selbst etwas schaffen.«
Wir arbeiteten als Subunternehmer für andere Firmen und erledigten auch eigenständig komplette Hausrenovierungen. Ranne verlangte viel und bezahlte gut.
An einem Sommertag, es war unheimlich heiß und die Luft flimmerte, schaltete ich den Fernseher ein. Ich hatte mir gerade unter der Dusche den Baustaub abgewaschen, eine Hackfleischsuppe gegessen und mich auf die Bettcouch gesetzt, um einen Kaffee zu trinken.
Es lief ein Boulevardmagazin mit einem Beitrag über die schwere Wirtschaftskrise, deren Tiefpunkt Finnland vor genau zehn Jahren erreicht hatte. Es wurden jene erwähnt, die in der Krise untergegangen waren, und einige von denen interviewt, die sie erfolgreich überstanden hatten. Einer der Gewinner der Krise war der Finanzinvestor Henrik Saarinen.
Der Reporter stand im Jackett und mit flatternden Rockschößen in einem Hauseingang, der zu den Geschäftsräumen von Saarinens Investmentgesellschaft in Top-Lage an der Süd-Esplanade in Helsinki führte. Ein kräftiger Wind fuhr ihm in die Haare und ließ die dünnen, kurzen Strähnen in alle Richtungen abstehen. Der Reporter zählte Saarinens Vermögen auf: Er war mit einem Fünftel an einer Mediengesellschaft beteiligt, besaß fast fünf Prozent eines Lebensmittelgiganten und verfügte über unterschiedlich große Aktienpakete von zehn mittelgroßen finnischen Unternehmen.
Sie gingen hinein, und der Reporter interviewte Saarinen in einem behaglich eingerichteten Besprechungszimmer, das eher an einen Herrensalon von vor hundert Jahren als an einen modernen Büroraum erinnerte. Hinter Saarinen an der Wand hing ein wertvolles finnisches Gemälde: Frauen nach der Feldarbeit auf dem Weg zu ihren Hütten, die Strahlen der untergehenden Sonne tauchten den Horizont in rotes und violettes Licht. Die Frauen auf dem Bild hatten ausgezehrte, dreckverkrustete Gesichter und zerschlissene Kleider, sie wirkten geschlagen und zu Tode erschöpft. Henrik Saarinen lehnte den rechten Ellbogen auf die breite Armlehne seines protzigen Ledersofas und lächelte.
Wie konnte man gleichzeitig freundlich und völlig skrupellos aussehen?
Das hätte man den Finanzinvestor Henrik Saarinen fragen sollen. Er war etwa sechzig Jahre alt und sah aus wie jemand, der mit sich rundum zufrieden war. Er war ein großer Mann – in jeder Hinsicht. Der elegante blaugraue Nadelstreifenanzug, das weiße Hemd und die in einem leichten Goldton schimmernde Krawatte spannten, obwohl sie sicher Maßanfertigungen waren. Sein dunkles Haar sah gepflegt aus und war leicht graumeliert, genauso wie es zu jemandem mit Vermögen und Einfluss passte. Sein fülliges Gesicht war entweder leicht gebräunt oder hatte von Natur aus einen dunkleren Hautton. Die runden Brillengläser schwächten den Eindruck der kalten blauen Augen ab. Das war Absicht. Jedes Mal, wenn der Reporter eine Frage stellte, schien ein Hauch von Verachtung aus Saarinens Augen zu sprechen. Aber seine Antworten waren höflich, intelligent und klug, so dass der Eindruck von einem Mann entstand, der stets missverstanden wurde, obwohl er doch eigentlich nur Gutes wollte und Gutes tat, und das auch noch völlig uneigennützig.
Saarinens Charisma machte Eindruck auf den Reporter. Das zunächst barsch geführte Interview verwandelte sich ab der vierten Frage in ein Fantreffen. Saarinen konnte die Krise aus seiner Sicht schildern und ausführlich darlegen, wie er zu Erfolg gekommen war, indem er nämlich außergewöhnlich kluge, der ganzen finnischen Volkswirtschaft dienende Entscheidungen getroffen und dabei auf sich und eine die Geschicke lenkende, unsichtbare Hand vertraut hatte.
Natürlich wusste ich, wer Henrik Saarinen war. Jeder kannte ihn. Und Mutter ganz besonders. Sie hatte in einer von Saarinens Firmen gearbeitet.
Es kam mir so vor, als ob ich noch etwas anderes als nur ein Interview sah. Zuerst fesselten die Hände meine Aufmerksamkeit. Die eine, die auf der Lehne ruhte, und die andere, die in beherrschten Gesten das Gesagte unterstrich und dazu aufforderte, ihm Verständnis und Glauben zu schenken. An den Händen war etwas. Nicht unbedingt etwas Bekanntes, aber dennoch irgendetwas. Ebenso an den Lippen, die ich betrachtete, obwohl ich nicht mehr auf die Worte hörte. Und als ich die einzelnen Worte nicht mehr wahrnahm, da schien auch die Stimme so zu klingen, als ob jemand direkt neben mir sprach und mir beim Reden den Kopf zuwandte.
Ich stellte die Kaffeetasse auf den Holzfußboden vor der Couch, lehnte mich nach vorn und betrachtete Henrik Saarinens Gesicht. Es füllte meinen Einundzwanzig-Zoll-Fernseher komplett aus. Ich versuchte zu ergründen, was die Wangenfalten und die überschminkten, zumindest einmal operativ entfernten Tränensäcke an sich hatten, was ich vorher nicht bemerkt hatte; was an der Gesichtsform und den schmalen, verkniffenen, sich öffnenden und schließenden Lippen in mir das Gefühl hervorrief, ich hätte ein dunkles Zimmer betreten, das ich durchqueren musste, wenn ich jemals wieder hinaus und zurück ans Tageslicht finden wollte.
Der Bildausschnitt vergrößerte sich, und ich sah wieder die Hände. Die linke Hand. Die, die abwechselnd mal im Schoß lag und mal in der Luft die Bedeutung des Gesagten unterstrich und zum Zuhören aufforderte. Er streckte einen Finger nach dem anderen aus, als er seine Taten aufzählte. Beinahe spürte ich die Berührung der dicken, zu etwas anderem als sauberer Büroarbeit bestimmten Finger auf meinen Haaren, meinem Kopf und meiner Schulter.
Das eigentliche Interview war vorüber.
Der Reporter fuhr mit einem Bericht über Henrik Saarinen fort, der dabei in einer Ganzkörperaufnahme gezeigt wurde. Saarinen lief und unterhielt sich mit einer dritten Person in eben jenem, mit wertvoller Kunst ausgestatteten Besprechungszimmer. Für einen Sechzigjährigen seiner Größe war sein Gang erstaunlich leicht und federnd. Weder wankte er wie ein beleibter Mann breitbeinig hin und her, noch hatte er den typischen, hinkenden Gang von Menschen mit Knie- oder Hüftproblemen, und nicht einmal die oft mit dem Alter einhergehende steife Schwerfälligkeit war an ihm zu beobachten.
Und als Saarinen sich umdrehte – in dem Moment, als der Reporter seinen Bericht mit der Aufzählung von Saarinens Hobbys beendete: wertvolle Kunst, gutes Essen und die Jagd –, trat ich in das eben noch nur erahnte dunkle Zimmer. Saarinens Bewegung war in keiner Weise zackig oder schnell oder sonst irgendwie auffällig gewesen. Sie war nur einfach leicht zu erkennen. So leicht, dass ich im Dunkeln nichts anderes wahrnahm als Saarinen und seinen gebräunten, mit dunkelgrauen Haaren bedeckten Kopf. Der Kopf sprach. Die Stimme war ganz nah, direkt neben mir, und trotzdem hörte ich nicht, was sie sagte. Ich schaltete den Fernseher aus, saß auf meinem Platz und zwang meine Gedanken, das dunkle Zimmer in meinem Kopf zu verlassen und in den sonnigen Sommerabend zurückzukehren.
Ich begriff, dass etwas passiert war. Ich hatte eine einzigartige Erfahrung gemacht: Mir war vor Augen geführt worden, was ich schon wusste, beziehungsweise was ich hätte wissen müssen.
September 2013
Ich zog die Tür hinter mir zu und blieb auf dem Treppenabsatz stehen. Zwei aufgeplusterte Nebelkrähen saßen vollkommen unbeweglich auf dem Dach des Gutshauses. Vor dem Hintergrund des grauen Himmels wirkten sie wie zwei aus schwarzer Pappe ausgeschnittene Silhouetten. So wie die Scherenschnitte, die früher auf Jahrmärkten verkauft und zu Hause an die Wand gehängt wurden, um zu zeigen, was die anderen allerdings schon wussten, nämlich wie der Kopf des Verewigten im Profil aussah. Das nassfeuchte Herbstwetter hüllte die Landschaft ein. Ich lauschte dem Rauschen des böigen Windes in den hohen Wipfeln der Fichten und Birken. Die Luft war leicht und frisch, und in ihr lag ein harzig-süßlicher Duft.