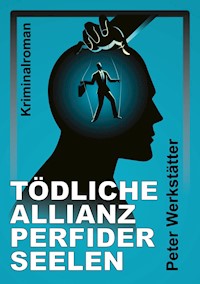
7,99 €
Mehr erfahren.
Das egozentrische Weltbild dieses Psychopathen lässt keinen Raum für Empathie und Toleranz. Menschen hatten für ihn da zu sein und mussten funktionieren. Wie ein Automatikuhrwerk: präzise, fehlerfrei und gänzlich ohne Emotionen. Er sieht sie als dressierte Vasallen in seinem Geschäft. Nur mit einer Person fühlt er sich seelenverwandt: Es ist eine tödliche Allianz perfider Seelen! Er formt die Menschen so, wie er sie braucht. Wer nicht perfekt funktioniert, muss sterben. Sein mörderisches Ensemble besteht aus Marionetten, die er selbst geschaffen hat. Die Fäden hält er fest in der Hand. Er ist ein Meister der Manipulation. Die blutige Spur seiner Grausamkeiten führt quer durch Europa bis nach Zentralasien. Fesselnde Unterschiede zwischen der betörenden Schönheit einer blühenden Alpenwelt, der bedrohlichen Tristesse abgelegener Wüstenregionen und des orientalischen Flairs morgenländischer Erzählungen aus "Tausendundeine Nacht" setzen die Handlung in einen schillernden Rahmen. Eine Wiener Sonderkommission unter Leitung der toughen und sympathischen Majorin Laura Stainer und ihres Partners Major Michael Kupfer jagt die skrupellosen Köpfe einer kriminellen Organisation mit aller Kraft. Unerwartete Wendungen des Geschehens und spektakuläre Täuschungen der Strippenzieher stellen das Ermittlerteam vor ständig neue Herausforderungen. Das von Beginn an mitreißende Geschehen ist in eine liebenswerte und unterhaltsame Nebenhandlung eingebettet. Wer die Kombination aus atemberaubender Spannung und gelegentlich amüsanten Passagen mag, wird dieses Buch nicht aus der Hand legen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Peter Werkstätter
Tödliche Allianz perfider Seelen
Kriminalroman
Copyright: © 2023 Peter Werkstätter
Umschlag & Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Titelbild: © 200622338 von rudall30 (depositphotos.com)
Verlag und Druck:
tredition GmbH
An der Strusbek 10
22926 Ahrensburg
Softcover
978-3-347-82731-8
Hardcover
978-3-347-82738-7
E-Book
978-3-347-82739-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Prolog
„Ja, ich werde weiterhin schwere Straftaten begehen, schreckliche Verbrechen sogar. Und nein, niemand wird mich daran hindern.“
Er sagte das leise, nicht unfreundlich und scheinbar emotionslos. Seine halb zusammengekniffenen Augen vermittelten jedoch einen anderen Eindruck: ein Blick voller Drohung und Hass.
„Lassen Sie mich ausreden“, blaffte er, ohne dass sein Gegenüber die Absicht einer Erwiderung erkennen ließ. „Sie werden mir bei der Umsetzung meiner zutiefst perfiden und misanthropischen Taten mit Hingabe behilflich sein – davon gehe ich in Ihrem Sinne fest aus.“
Er legte die Fingerspitzen seiner Hände langsam aufeinander und stützte sein Kinn auf die abgewinkelten Daumen. Seine jetzt interessiert geöffneten Augen wirkten erwartungsvoll, ließen aber gleichzeitig Überlegenheit und Arroganz erkennen. Der Besucher schien dem anderen Mann noch immer keine Gesprächsteilnahme zu gestatten. Er lehnte sich wieder in den bequemen Sessel zurück, wobei sich sein Gesichtsausdruck erneut veränderte: hart und bedrohlich.
„Gehen Sie bei allem, was Sie denken und künftig tun werden davon aus, dass ich in Ihrem Leben eine ähnliche Rolle spielen werde, wie der Rotor in einem Automatikuhrwerk: Solange ich mich bewege, funktionieren Sie in dem Rhythmus, den ich vorgebe.“
Erstes Kapitel
Obwohl es fast windstill war, glitzerten die kleinen Wellenberge auf dem malerischen Wolfgangsee wunderschön. Sie wirkten in der Frühlingssonne wie flirrender Goldstaub.
Professor Markus Dorn liebte die frühabendliche Erhabenheit dieses Anblicks, den er einmal mehr von der höhergelegenen Terrasse seines Anwesens genoss. Es war Vorsaison im Salzkammergut – aber selbst im August war der Trubel, den die anstürmenden Urlauber dann auslösten, hier oben kaum wahrnehmbar. Er hatte sich diese Villa am Nordufer des Sees vor fünf Jahren zunächst gemietet und im vergangenen Jahr gekauft. Der sündhaft hohe Preis des Grundstückes hatte diese Entscheidung nicht leicht gemacht, aber seine Frau hatte sich sofort in das Haus verliebt und sie konnten es sich leisten.
Als die Terrassentür geöffnet wurde sprang er sofort auf und begrüßte erfreut und entsprechend herzlich die junge Frau, die Arm in Arm mit der Hausherrin die Aussichtsebene der Villa betrat.
Bevor Markus Dorn seine Überraschung über den unerwarteten Besuch seiner Schwester zum Ausdruck bringen konnte, zog sie ihn am schmalen Revers seiner Trachtenjacke ein wenig zu sich heran: „Du siehst angespannt aus, Bruderherz – solltest vielleicht etwas kürzertreten.“
Der Professor löste sich sanft aus ihrem Griff. Lächelnd versicherte er seiner Schwester, dass es beruflich und privat bestens stünde, und wenn in seinem Gesicht Besorgnis zu erkennen sei, könne das nur an den neuesten Nachrichten liegen. Er zeigte dabei belustigt auf die Kronen Zeitung, die neben seinem Stuhl lag.
„Hast du Urlaub oder führt dich die Jagd auf Bösewichte ins Salzkammergut? Ich hoffe, es ist die Sehnsucht nach deinem Bruder – die bösen Buben sind ja alle bei euch in Wien“, scherzte Markus Dorn.
Laura Stainer ignorierte die Frotzelei zunächst und wirkte jetzt ein wenig nachdenklich.
Sie hatte es mit gerade einmal 30 Jahren geschafft, als Major eine Sonderkommission bei der Wiener Kriminalpolizei zu leiten. Ihr Ehrgeiz, aber sicher auch eine gewisse angeborene Begabung, waren zwei gute Gründe für diese steile Karriere. Leider war ihr bei dieser anspruchsvollen Arbeit das Privatleben aus dem Ruder gelaufen. Ihre Ehe widerstand dem dienstlichen Dauerdruck nur drei Jahre.
„Ganz so abwegig ist deine Annahme nicht, dass mich berufliche Pflichten in diese Gegend führen. Ich kann dich aber beruhigen – der Abstecher zu dir ist rein privat“, ergänzte sie lächelnd.
Wie sich im weiteren Gespräch herausstellte, würden sie ihre Ermittlungen etwa zwei Tage in der Region binden. Markus Dorn und seine Frau boten ihr selbstverständlich an, in dieser Zeit bei ihnen zu wohnen. Platz hatten sie schließlich ausreichend.
Sie saßen gemeinsam zusammen, bis die Sonne hinter den Bergen verschwand. Nach zwei Flaschen Chardonnay hatten sich die Geschwister auf den neuesten Stand der wichtigsten Themen gebracht. Das war nach zwei Monaten überfällig.
Der Blick aus den befristet angemieteten Diensträumen der SoKo Gold auf das pulsierende Zentrum von Wien, war ein Traum. Die großzügig dimensionierten Fenster fassten den Stephansplatz mit dem Erzbischöflichen Palais und dem Stephansdom in einen historischen Rahmen, der das kaiserliche Wien in seiner ganzen Pracht erstrahlen ließ. Diesen Eindruck komplettierten die detailtreu erhaltenen Fiaker und deren historisch gekleideten Kutscher, die ihre zweispännigen Lohnkutschen mit Stolz und Leidenschaft für Stadtrundfahrten anboten.
Leider hatten die drei Ermittler der Wiener Sonderkommission „Gold“ keine Zeit und damit auch nur einen flüchtigen Blick auf die Schönheiten ihrer Stadt übrig.
Majorin Laura Stainer hatte bereits ihre Unterlagen im Beratungsraum der SoKo ausgebreitet und ihre engsten Kollegen, Major Michael Kupfer und Leutnant Tobias Mehler, waren gerade dabei.
Obwohl der Mai vor wenigen Tagen erst begonnen hatte, Fahrt in Richtung Frühling aufzunehmen, erhitzte die Sonne heute bereits in den Vormittagsstunden das nichtklimatisierte Büro stark.
So schön der Blick aus den Fenstern auch war: An ein Öffnen der Flügel war nicht zu denken.
Der innerstädtische Straßenlärm gestattete diesen Luxus nur in Beratungspausen. Am Geräuschpegel hatte sich gegenüber der Kaiserzeit wenig geändert – nur die Art der Geräusche war heute anders. Schon um die Jahrhundertwende galt Wien als eine extrem „nervöse Großstadt“.
Dominierten damals schonungsloses Peitschenknallen, lautes Kutschergeschrei und das Dröhnen, Kreischen und Ächzen der elektrischen Straßenbahnen die akustische Wahrnehmung, so nervten heute das eintönige Brummen der Motoren, schwerfällige, dumpfe Bassrhythmen aus geöffneten Autofenstern und quäkende Hupgeräusche, ausgelöst von nicht ausreichend beachteten Kleinwagenfahrern.
Laura Stainer begann die Recherchen ihrer zweitägigen Dienstreise auszuwerten.
Der Anlass für die Ermittlungen im Salzkammergut war recht dürftig und beruhte im Wesentlichen auf zwei anonymen Hinweisen, die zunächst in keinem erkennbaren Zusammenhang zu stehen schienen.
Die erste Information wurde ihnen bereits vor 6 Monaten zugespielt. Der anonyme Informant behauptete, es sei eine größere Menge illegalen Goldes im Umlauf. Dabei würden die erlaubten Grenzen von 10.000, – EUR Kaufwert teilweise erheblich überschritten. Zur Herkunft des Goldes wurde nichts übermittelt. Erste Vermutungen und Recherchen ließen die Scheideanstalten im Schweizer Tessin in den Fokus der Ermittlungen geraten.
Der zweite Hinweis – und das war der eigentliche Grund für die Fahrt von Laura Stainer in das Salzkammergut – bestand darin, dass in den wohlhabenden touristischen Hochburgen Oberösterreichs, mit Hehlerware aus reinem Gold gedealt würde. Die Bandbreite ginge dabei von Münzen über Skulpturen oder anderen Kunstgegenständen, bis hin zu Zahngold. Exemplarisch wurden die beiden bekannten Urlaubsorte Sankt Gilgen und Hallstatt benannt.
Die Majorin hatte zunächst drei der zahlreichen Juweliergeschäfte in den beiden Regionen aufgesucht. Sie war unangekündigt erschienen und hatte mit ihren Fragen ehrliche Verwunderung ausgelöst. Zumindest empfand sie das so. Die Besuche hatten keinerlei Ermittlungsansätze ergeben. Auch bezüglich des Wahrheitsgehaltes der anonymen Anzeige konnten keine Hinweise aus der Befragung abgeleitet werden.
Laura Stainer hatte deshalb die Ermittlungen auf Kunsthändler und Antiquitätengeschäfte ausgedehnt. Am späten Nachmittag des zweiten Tages betrat sie den düsteren und wenig einladenden Verkaufsraum eines Ladens mit dem klangvollen Namen „Antikatelier“.
„Der Inhaber, Herr Alois Schwertinger, begrüßte mich ausgesprochen freundlich“, begann die Chefin der SoKo mit der Schilderung dieses Gespräches. „Die dunkle, verstaubte und wenig einladende Einrichtung des Repräsentationsbereich, war zum Glück nicht im Geschmack und im Charakter des Besitzers begründet. Sie war ausschließlich auf Herkunft und Alter der ausgestellten Gegenstände zurückzuführen. Auch nachdem ich mich vorgestellt und mein Anliegen erläutert hatte, blieb der gute Eindruck des älteren Herren bei mir erhalten. Er hörte aufmerksam zu, stellte keine Zwischenfragen und wartete höflich, bis ich ihn um seine Meinung und eventuelle Hinweise bat.
Er räusperte sich zunächst mehrmals, als ob es ihm schwerfiele, die richtigen Worte zu finden. Als er seine Gedanken geordnet und die Balance zwischen notwendigen und verzichtbaren Informationen hergestellt hatte, berichtete Herr Schwertinger in einer nicht vermuteten, schnörkellosen Klarheit.“
Die Majorin schaute in die kleine Runde. Die Blicke von Michael Kupfer und Tobias Mehler waren gespannt auf sie gerichtet. Sie erhofften sich zweifellos einen ersten Ermittlungserfolg – auch wenn sich ihre Erwartungen nach den letzten erfolglosen Tagen in engen Grenzen hielten.
„Der alte Herr hatte am Vortag Besuch von einem Ehepaar mittleren Alters gehabt. Die Mutter des Ehemannes war verstorben und hatte ihren zwei Söhnen 30 Goldmünzen hinterlassen. Es handelte sich dabei um Prägungen des bekannten `Wiener Philharmonikers`, einer der meistverkauften Anlage – Goldmünzen weltweit. Echtheitszertifikat und der entsprechende Auszug aus dem Erbschaftsdokument waren notariell bestätigt. Der von der `Münze Osterreich AG` stammende `Wiener Philharmoniker` besitzt einen aktuellen Goldwert von etwa 1.700, – Euro, was einer Unze Feingold entspricht.
Herr Schwertinger hatte an dieser Stelle seines Berichtes leicht gestockt, erklärte mir aber dann, dass die beiden Brüder in einer finanziellen Notlage seien und 10 der Münzen für nur 15.000, – Euro verkaufen würden.
Sie zeigten ihm die Münzen und er bestand darauf, eine Echtheitsprüfung durchzuführen, bevor er eine Entscheidung zu Ankauf oder Vermittlung treffen würde.“
Laura Stainer schien es ein wenig zu amüsieren, wie die beiden gestandenen Männer an ihren Lippen hingen und an große Jungs erinnerten, die ihre Neugier kaum zügeln konnten.
„Der nette Antiquitätenhändler scheint ein Experte in seinem Metier zu sein. Sein Prüfergebnis war verblüffend und um es gleich vorwegzunehmen: Die zehn Münzen bestanden jeweils aus einer Unze Feingold der zertifizierten Güte, entsprachen also einem Goldwert von gegenwärtig 17.000, – Euro.
Das war aber nur ein Teilergebnis seiner Prüfung. Herr Schwertinger stellte nämlich weiterhin fest, dass es sich bei den Münzen um Fehlprägungen handelt. Bei den geprüften `Wiener Philharmonikern` liegt eine sogenannte `Stempeldrehung` vor. Dabei steht das Münzbild beim Drehen um die Längsachse nicht gerade. Es ist um eine bestimmte Gradzahl verdreht.
Bei den Prüflingen war eine Drehung um 180 Grad zu erkennen, d.h., die Rückseite der Münze steht genau auf dem Kopf. Das fällt einem ungeübten Auge in den seltensten Fällen auf, zumal es bei französischen Münzen üblich ist. Bei österreichischen Münzen ist es dagegen eine Fehlprägung, die in Expertenkreisen als `französische Prägung` bezeichnet wird. Eine, in der `Staatlichen Münzanstalt Österreichs` hergestellte Fehlprägung dieser Art, wäre mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in den Umlauf gekommen.“
Nachdem die Chefin der SoKo Gold eine kurze Pause gemacht hatte, um das Gesagte wirken zu lassen, fasste sie den Rest des Gespräches in aller Kürze zusammen: „Der alte Herr war clever genug, seinen Besuchern diesen Teil des Prüfergebnisses nicht mitzuteilen. Er bestätigte lediglich den Goldwert, erbat sich aber eine Woche Bedenkzeit, da er erst mit seinem Teilhaber sprechen wolle, der sich aber noch im Urlaub befände. Nun ist er in großer Sorge, dass es sich bei dem Ehepaar um Verbrecher handeln könnte, die vielleicht seine Notlüge durchschauen. Er hat nämlich keinen Teilhaber. Deshalb entschloss er sich auch, in jedem Fall die Polizei zu informieren. Das erklärt vielleicht teilweise seine große Freude über mein Auftauchen“, beendete sie lächelnd ihren Bericht.
Angenehme 25 Grad und ein Himmel im tiefen Blau eines Nazar – Amuletts waren die schönen Begleiter dieses zu Ende gehenden Tages.
Die beiden Männer auf der Dachterrasse eines ehemaligen Hotels spürten nichts von dem frühlingstypischen Klima und sie nahmen auch die herrlichen orientalischen Gerüche nicht wahr, die vom nahegelegenen Siab Basar zu ihnen herüberwehten.
„Du hast deinen Laden nicht mehr im Griff“, blaffte der kleinere der beiden Typen den anderen, wesentlich größeren und übergewichtigen Kerl an. „Wir liefern dir die Ware mit großem Aufwand und hohem Risiko über mehrere Grenzen an einen sicheren Ort, und du bringst es fertig, auf dem letzten Teilabschnitt der Wertschöpfungskette einen Totalschaden zu verursachen?“
Der vierschrötige Mann wich trotz seiner offensichtlichen körperlichen Überlegenheit vor dem anderen Typ zurück. Als er nur noch einen halben Meter von der hüfthohen Terrassenbegrenzung entfernt war, blieb er stehen.
„Die Lieferung werden meine Leute zurückholen. Zumindest den Gegenwert. Ich habe Hinweise erhalten, dass die Ware bereits zu Feingold veredelt wurde und teilweise im Umlauf ist.“
Dieser Satz sollte zuversichtlich stimmen. Zumindest hatte er das gehofft. Wie falsch er da lag, zeigte die Reaktion seines hageren Gegenübers. Der verzog verächtlich sein Gesicht und hatte urplötzlich einen großkalibrigen Revolver in der Hand.
„Schade, dass unsere langjährige Zusammenarbeit so zu Ende geht. Wenn es nach mir ginge, hättest du unseren `Dostlik Orden` verdient. Aber leider – das Schicksal folgt seiner eigenen Logik – und: die kann zuweilen grausam sein.“ Er drückte sofort ab und leerte die Hälfte der Trommel. Die Schüsse waren präzise und zerfetzten den Brustkorb des beleibten Mannes. Dennoch taumelte er noch, wie vermutlich gewollt, das kleine Stück bis zur Brüstung der Dachterrasse. Der Schwerpunkt seines Körpers und dessen Bewegungsrichtung ließen den Mann unweigerlich über die Mauer in die Tiefe stürzen. Kein Schrei, keine gestikulierenden Bewegungen – er war tot, bevor er am Boden aufschlug.
Sein Körper landete etwa zwei Meter neben einer frisch ausgehobenen Grube. Trotz des sandigen Aushubs war deutlich zu erkennen, dass hier Technik zum Einsatz gekommen war. Da das Gelände unbewohnt und absolut menschenleer war, hatte der Mörder keine Eile damit, die Papiere des Opfers an sich zu nehmen und den Toten in das Loch zu ziehen. Mit einer bereitliegenden Schaufel bedeckte er ihn notdürftig mit Sand. Er wusste, dass das Grab noch vor Eintreten der Dunkelheit fachmännisch verschlossen und geschützt vor nachtaktiven Wildtieren sein würde. Die Abdeckung der Grube dürfte sich kaum erkennbar von den benachbarten sandigen Oberflächen unterscheiden und kein Mensch käme auf den Gedanken, dass sich hier ein Grab befinden könnte. Ein Restliches würde der nächste Sandsturm erledigen.
Als sich der hagere Mann aufrichtete, rollte fast lautlos ein dunkler Wagen auf ihn zu. Er stoppte neben der Grube und der Mörder nahm im Fond des Wagens Platz.
Als er seine Hände an einem, ihm vom Fahrer zugereichten Feuchttuch gereinigt hatte, setzte sich die schwere Limousine umgehend in Bewegung.
„Unser Freund, mein lieber Igor, wird keine erfundenen Geschichten mehr erzählen – eigentlich schade, er hatte einen so amüsanten Dialekt“. Er sagte das in einem aufgeräumten Plauderton, als käme er gerade von einer Lesung über die wunderbaren Reisen und lustigen Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen.
Laura Stainer saß in ihrem provisorischen Arbeitszimmer am Stephansplatz, als es an der Tür klopfte. Michael Kupfer, ihr Stellvertreter bei der SoKo Gold, betrat den spartanisch eingerichteten Raum.
Michael war ihr engster Vertrauter bei der Wiener Polizeibehörde. Sie mochte ihn und er hatte sich vor drei Jahren, als sie sich von ihrem Mann trennte, als wahrer Freund bewiesen. Die Trennung hatte sie extrem belastet, zumal sie ihrem damaligen Partner nicht wirklich etwas Schwerwiegendes vorwerfen konnte. Im Gegenteil, sie quälte der niemals ausgesprochene Vorwurf, selbst der schuldige Teil gewesen zu sein.
In Wahrheit waren die Trennungsgründe aus heutiger Sicht paritätisch auf beide Ehepartner verteilt gewesen. Das war wohl auch der Grund dafür, dass sie sich weitgehend geräuschlos getrennt hatten und noch heute gelegentlichen Kontakt miteinander pflegten. In Ermangelung einer plausiblen und erklärbaren Begründung für das Scheitern ihrer Ehe, hatten sie gegenüber engen Freunden und Verwandten den ebenso abgedroschenen, wie aussagearmen Satz: „es passte einfach nicht mehr“, verwendet.
Michael war damals der Einzige gewesen, mit dem sie über alle Probleme sprechen konnte. Das lag natürlich auch daran, dass viele Konfliktsituationen ihren Ausgangspunkt in Lauras dienstlichen Abläufen hatten. Ein Diskutieren solch interner Inhalte war ihr natürlich im privaten Freundeskreis nicht gestattet.
Die dienstlichen Rahmenbedingungen für ein dauerhaft freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden Kriminalisten waren dagegen eher suboptimal.
Vor wenigen Monaten wurden Laura und Michael am gleichen Tag zu Majoren befördert. Beide waren mit 29 bzw. 31 Jahren sehr jung für diesen Dienstgrad – und entsprechend ehrgeizig.
Als vor einem halben Jahr der erste ernstzunehmende Hinweis auf eine größere Menge, illegal sich im Umlauf befindlichen Goldes beim Bundeskriminalamt in Wien einging, wurde kurzfristig die Entscheidung zur Bildung einer Sonderkommission getroffen. Da ersten Erkenntnissen zufolge Handelsaktivitäten auf dem Schwarzmarkt in Oberösterreich stattfanden und als Herkunftsregion des Goldes das Schweizer Tessin vermutet wurde, übernahm das BKA Wien selbst den Fall. Laura und Michael waren dort im Bereich „Organisierte Kriminalität“ tätig.
Der SoKo Gold wurden in einem ersten Schritt drei Ermittler zugeordnet. Mit der Leitung der Sonderkommission wurde Majorin Laura Stainer beauftragt. Auch Major Michael Kupfer hatte sich natürlich Hoffnung auf den Chefposten der kleinen, aber wichtigen Ermittlergruppe gemacht. Am Ende schlug das Pendel in Richtung seiner Kollegin aus. Maßgebend für diese Personalentscheidung im Bundeskriminalamt waren zwei Punkte, die für Laura sprachen. Die Majorin hatte sich in ihrer bisherigen Ermittlertätigkeit einen hervorragenden Ruf als Teamplayer erarbeitet. Sie beherrschte es, aufmerksames Zuhören, logisches Ableiten von Zusammenhängen und uneitles Entscheiden schwieriger Fragestellungen in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen, was letztlich den Erfolg des gesamten Ermittlerteams sicherte.
Michael Kupfer hatte vor dem Wechsel ins Bundeskriminalamt bei der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität erste Erfahrungen gesammelt und dort zahlreiche Ermittlungserfolge erzielt. Bei der EGS war er zumeist als verdeckter Ermittler im Einsatz, was in der Regel individuelle und spontane Entscheidungen erforderte. Er war ein Einzelkämpfer.
Hinzu kam der Sachstand, dass der aus Deutschland stammende Major Kupfer bis zu seinem 16. Lebensjahr Österreich nur einmal bereist hatte und auch seit er hier wohnte, Wien meist nur für Urlaubsfernreisen verließ. Laura Stainer dagegen war gebürtige Salzburgerin und kannte sich in ihrem Heimatland bestens aus.
Ansonsten brachten beide Bewerber für den Chefposten der SoKo Gold gleich gute Voraussetzungen für diese Aufgabe mit. Michael Kupfer hatte das mit einem leisen „Zähneknirschen“ akzeptiert. Schließlich waren die Argumente pro Laura zutreffend, und er wusste das auch. Jetzt freute er sich ehrlich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Team mit Majorin Stainer.
Nachdem Laura Stainer Kaffee aufgebrüht hatte, versuchte sie, Struktur in die ersten Ermittlungsergebnisse des Falles „Illegaler Goldhandel“ zu bringen.
„Viele Ansätze gibt es ja noch nicht, aber die bisherigen Erkenntnisse scheinen zumindest zwei Absatzkanäle von illegal gehandeltem Gold aufzuzeigen“, eröffnete die SoKo Chefin das Gespräch. „Der misslungene Versuch, Goldmünzen aus privatem Besitz unter Wert in Umlauf zu bringen, ist auf den ersten Blick nur schwer zu begreifen. Warum freiwillig auf 2.000, – Euro verzichten? Das lässt nur einen Schluss zu: Das Gold wurde auf nicht legalem Wege in unser Land eingeführt. Die Fehlprägung ist ein Hinweis darauf, dass die `Wiener Philharmoniker`, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der Staatlichen Münzanstalt Österreichs geprägt wurden.“
Michael Kupfer nickte zustimmend.
„Ähnlich verhält es sich mit den 100g Goldbarren, die einem Dentallabor in Salzburg angeboten wurden. Übrigens: auch aus Privathand. Der Verkäufer hatte sich als Schweizer Juwelier ausgewiesen, der sich seit einem halben Jahr im Ruhestand befinden würde. Nach Geschäftsauflösung hätte er alle aufgekauften Altgoldbestände in einer Scheideanstalt im Schweizer Tessin zu 100g Barren Feingold umarbeiten lassen. Da die Prägung hochwertig wirkte und alle erforderlichen Angaben, wie Hersteller, Gewicht, Reinheit und Seriennummer aufwies, glaubte der private Eigentümer des Labors zunächst, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Die aktuellen Ankaufpreise für 100g Feingold belaufen sich auf 5.200, – Euro. Der Juwelier verkaufte seine acht Barren jedoch für 40.000, – Euro. Er ließ demzufolge 1.600, – Euro gegenüber dem üblichen Verkaufserlös nach.“
Major Kupfer lehnte sich zurück und schaute seine Kollegin an, als ob er Mitleid für die Käufer empfinden würde.
„Die Goldqualität wurde zwar gründlich geprüft, aber die Seriennummern, die ab einem Barrengewicht von 100g zwingend erforderlich sind, fanden keine hinreichende Beachtung. Erst bei der Bearbeitung fiel einem Mitarbeiter auf, dass zwei der Goldbarren identische Seriennummern aufwiesen. Das ist ein sicherer Hinweis darauf, dass das Gold aus einer illegalen Quelle stammt. Die versuchte Kontaktaufnahme mit dem Juwelier scheiterte. Alle Angaben des Schweizers stellten sich als falsch heraus und auch der eingeprägte Hersteller war ein Fake. Die benannte Scheideanstalt existiert nicht.“
„Offenbar ist auf dem Schwarzmarkt eine größere Menge von unkontrolliert nach Österreich gelangten Goldes im Umlauf“, versuchte Laura das Gesagte zusammenzufassen. „Wir müssen davon ausgehen, dass die beiden Ermittlungsansätze nur Zufallstreffer im Kampf gegen einen noch unsichtbaren Gegner darstellen.
Die hohe Goldqualität, sowie die Prägebrillanz der Barren und Münzen lassen auf eine professionelle Herstellung der Fälschungen schließen. Diese Aussage steht auch nicht im Widerspruch zu der Dopplung von Seriennummern und der Fehlprägung der `Wiener Philharmoniker`.
Der einzige Ansatzpunkt, den ich im Moment sehe, liegt bei Alois Schwertinger. Der Antiquitätenhändler wird uns umgehend informieren, wenn sich das Pärchen mit den Goldmünzen wieder meldet. Meine diesbezügliche Hoffnung ist nicht sonderlich groß. Ich glaube vielmehr, dass diese Masche auf `Sofortdeals` abzielt. Wenn es nicht am gleichen Tag funktioniert, wird das nächste Opfer gesucht. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Der alte Herr hat ja pfiffig reagiert und so eventuell das Geschäft am `Köcheln` gehalten.“
Major Kupfer stimmte dem zwar prinzipiell zu, sah aber noch einen weiteren Ansatz.
„Wenn tatsächlich eine größere Menge an nichtregistrierten, illegalen Goldprodukten nach Österreich gelangt ist, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um gebrauchsfertige, gegossene oder geprägte Feingoldbarren und Münzen. Da die Anzahl der Scheideanstalten bei uns sehr überschaubar ist und der Transport von Industriegold in Barren von meist sechs Kilogramm stark risikobehaftet wäre, schließe ich diese Beschaffungsvariante aus.
In Europa gibt es kaum noch Goldvorkommen. Einigermaßen rentabel arbeitende Goldminen gab es lediglich in Rumänien und mit weiteren Abstrichen in Bulgarien. Der Abbau wurde auch in diesen Ländern aus unterschiedlichen Gründen eingestellt oder ausgesetzt. Hauptgrund waren – und sind – massive Umweltprobleme.
Da liegt auch der Grund dafür, warum der weitaus größte Teil des sich offiziell im Umlauf befindlichen Europäischen Goldes aus dem Recycling – Bereich stammt. Es existieren so große Mengen an Altgold und recycelten Industriegold, dass der seriöse Goldhandel in Österreich nicht auf Minengold angewiesen ist.
Anders ist das beim illegalen Handel. Während Recyclinggold, ganz gleich ob aus privatem Altgold oder aus recyceltem Edelmetallschrott der Industrie gewonnen, niemals zu niedrigeren, börsenunüblichen Preisen in den Handel kommt, ist das bei schwarz eingeschleustem Minengold ein wichtiges Verkaufsargument: der Bonus für das Risiko.
Ich bin mir nahezu sicher: Das unerlaubt in Umlauf gebrachte Gold stammt aus der Veredlung von Dore´- Barren, dem sogenannten Minengold. Das würde auch unsere erste Vermutung erhärten, dass die Spur zu einer der Scheideanstalten im Schweizer Tessin führen könnte. Da werden in großen Mengen Dore` – Barren veredelt. Die Schweiz ist eine Drehscheibe im internationalen Goldhandel. Woher die Raffinerien ihr Gold beziehen liegt oftmals im Dunklen. Vermutet wird die Herkunft aus illegalen Minen in Afrika, wobei die Vereinigten Arabischen Emirate als offizielle Lieferanten fungieren. Auch Zentralasien, an der Spitze Usbekistan, liefert große Mengen Minengold in die Schweiz.
Ich glaube, wir sollten unsere Schweizer Kollegen um Unterstützung bitten. Nicht umsonst gibt es den `Vertrag über grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit` zwischen Österreich, der Schweiz und Liechtenstein“, beendete Michael Kupfer seinen, für ihn außerordentlich umfangreichen, Beitrag.
Laura Stainer lächelte. „Da könnte einiges dran sein und du machst mir ganz den Eindruck, als ob du nicht abgeneigt wärst, deine italienischen Sprachkenntnisse ein wenig aufzufrischen. Frühling am Lago Maggiore: Das ist schon ein Grund um auf solch abenteuerliche Theorien zu kommen. Ich kümmere mich um ein entsprechendes Amtshilfeersuchen, mein kleiner Italiener.“ Michael ignorierte die nette Ironie. Den „kleinen Italiener“ musste er sich bei seiner Körpergröße von 185 cm ohnehin nicht annehmen.
Zweites Kapitel
Die beiden Männer, die im Behandlungszimmer des Arztes Platz genommen hatten, wirkten weder krank, noch schien sie die empörte Sprechstundenhilfe zu beeindrucken, die sie vom unangemeldeten Eintreten in das Reich ihres Chefs abhalten wollte. Sie stand noch mit hochrotem Gesicht in der Tür, als Professor Borges sie bat, die „Gäste“ mit ihm allein zu lassen. Er tat das zwar in seiner gewohnt besonnenen Art, vermied aber bewusst das Wort „Patienten“.
Kaum waren die Herren mit dem Arzt allein, beugte sich der ältere von beiden abrupt nach vorn und platzierte seine großen, fleischigen Hände lautstark auf der Glasplatte des vor ihm stehenden Tisches. Die derben, für seinen schlanken Körper scheinbar überdimensionierten Pranken passten so gar nicht zu dem Buchhaltertyp, der einen maßgeschneiderten Anzug aus feinstem Tuch trug.
„Sicherlich habe ich den Arzt meines Vertrauens am Telefon völlig falsch verstanden. Deshalb kommen wir gleich persönlich vorbei – da kann man Missverständnisse sofort ausräumen, wenn sie denn überhaupt noch fortbestehen. Sie verstehen mich doch, lieber Professor?“
Er bewegte sich keinen Zentimeter und die weißen Knöchel seiner Hände ließen die Befürchtung aufkommen, dass der Glastisch dem Druck nicht standhalten würde. „Ich weiß ja, ein intelligenter Mensch wie Sie hat es nicht gerne, wenn man Selbstverständlichkeiten von ihm erbittet – aber noch einmal: Am Telefon ist unsere Botschaft ja leider nicht angekommen.“ Der Wortführer des Besucherduos schien in seiner Stellung erstarrt zu sein und dokumentierte damit auf pantomimische Art und Weise, dass er weder dazu bereit war seine Ansprache zu unterbrechen, noch seine Körperhaltung zu verändern. „Wir wollen doch wirklich nur, dass Sie ihre Arbeit machen: zwei Totenscheine ausstellen und 6 Behandlungsbetten in Ihrer Klinik zur Verfügung stellen. Sie werden doch keine verunfallten Mitarbeiter von uns abweisen! War das akustisch und inhaltlich zu verstehen?“, spie er den letzten Satz förmlich in Richtung des Arztes.
Die letzten Worte hatten seine Wirkung auf den Professor nicht verfehlt. Er war jetzt aschfahl im Gesicht und seine sonst so ruhigen, feingliedrigen Hände zitterten leicht.
„Ich habe mich sofort um die armen Menschen gekümmert und bestmögliche Hilfe geleistet. Das war in diesem Fall nicht selbstverständlich. Ich bin hier Chefarzt und Klinikleiter. Ich hätte einen Notarzt und zwei Rettungssanitäter schicken müssen. Schließlich liegt der Unfallort mehr als 100km von meiner Klinik entfernt. Da es sich um schwerste Vergiftungen handelt und weitere tödliche Verläufe sehr wahrscheinlich sind, bin ich spätestens jetzt verpflichtet, die zuständigen Behörden zu informieren. Sie haben das ja offenbar nicht getan. Die von mir durchgeführte Notversorgung und die provisorische Unterbringung der erkrankten Männer in einer Baracke inmitten der Wüste, verzögert den Verlauf der Vergiftung ein wenig, wird aber zu keiner Heilung führen. Sie müssen die Männer dringend in…“. – Die schweren Hände des Wortführers klatschten erneut geräuschvoll auf den Glastisch. „Sie haben mich auch jetzt nicht verstanden, das tut mir leid. Ich habe Ihnen bereits klar zu verstehen gegeben, dass es nur einen Behandlungsort für die Verunfallten geben wird: Ihre Klinik!“. Der Buchhaltertyp schaute auf seine Uhr.
„Der Krankentransport mit den 6 Patienten ist vor 10 Minuten gestartet. Er wird in knapp zwei Stunden hier eintreffen. Die beiden Verstorbenen werden wir würdevoll in ihrem Heimatdorf bestatten lassen.“
Er lehnte sich jetzt wieder zurück. „Übrigens“, er zog fast beiläufig und scheinbar uninteressiert eine Fotografie aus seiner Tasche, „haben wir eine größere Grabstätte für unsere Arbeiter ausgewählt, als das erforderlich ist. In den Weiten der Wüste ist das kein Problem.“
Der schlanke Mann drehte dabei das Foto in Richtung des Arztes. Professor Borges erkannte trotz der Entfernung sofort, dass es sich um ein Bild aus dem Arbeitszimmer seines Wohnhauses handelte. Es zeigte seine Frau und seine 12jährige Tochter, die sich lachend umarmten. Sein Kopf schien sich explosionsartig mit einer schaumigen Masse zu füllen, die alle gedankenführenden Nervenstränge erbarmungslos abdrückte. Das Farbfoto schien sich in grelle Blitze aufzulösen, die stechende Schmerzen in seinem Hirn erzeugten. „Wo sind die Beiden, was wollen Sie von ihnen…“, drang es mit großer Mühe und krächzend aus dem Mund des Arztes.
„Die haben eine kleine Reise in den `Roten Sand` unternommen. Wenn Sie unserer Bitte entsprechen, kann die Wüstensafari schnell zu Ende sein – im anderen Fall müssen unsere zwei toten Arbeiter ein wenig zusammenrücken“, fügte er in einem Tonfall an, als verkündete er die Gewinnmöglichkeiten eines Preisausschreibens.
Richter Christopher Maibach war am Oberlandesgericht Wien eine Galionsfigur. Er hatte zwar vor drei Jahren das ihm angetragene Präsidentenamt abgelehnt, galt aber im Justizpalast am Wiener Schmerlingplatz ebenso unausgesprochen wie unangefochten als „Graue Eminenz“.
Soeben hatte er die Hauptverhandlung in einem Strafrechtsprozess wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge abgeschlossen. Der Täter wurde, entgegen dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine Gefängnisstrafe von 5 Jahren forderte, aufgrund vorliegender „Zurechnungsunfähigkeit“, zur Unterbringung und Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Der „Maßnahmenvollzug“ wurde nach eingehender Prüfung des Sachverständigengutachtens eines renommierten Psychiaters und Forensikers, auf Grundlage der Letztentscheidungsbefugnis des Gerichtes, angeordnet. Diese Entscheidung war Richter Maibach leichtgefallen, da sie seiner anfänglichen Tendenz entsprach.
Er verließ gerade das Gerichtsgebäude, als das Mobiltelefon in seiner Tasche vibrierte. Christopher Maibach mochte es nicht, auf der Straße zu telefonieren und ignorierte deshalb zunächst das Signal. Als er sich außer Sichtweite des Justizpalastes befand, schaute er auf das Display. Genau in diesem Moment meldete sich der Anrufer erneut. Es war ein unbekannter Anschluss und er nahm das Gespräch jetzt an. Der Richter meldete sich gewohnt forsch und bestimmend. Als sich der Anrufer zu erkennen gab, war es mit seiner Sicherheit vorbei. Maibach bat für seine Verhältnisse fast höflich darum, den Gesprächspartner in 30 Minuten aus seinem heimischen Arbeitszimmer anrufen zu dürfen. Nach dessen Zustimmung war das Gespräch schon beendet und seine Laune auf dem Nullpunkt. Der einzige Satz, den der Anrufer von sich gegeben hatte, reichte dafür aus: „Sie waren gut heute, erhalten Sie sich diese Brillanz – wir brauchen nochmals Ihre Hilfe…“
Christopher Maibach war sich seiner unantastbaren Anerkennung und Wertschätzung als Richter am Oberlandesgericht absolut sicher. Auch sein „heißer Draht“ in das Wiener Palais Trautson wirkte beruhigend – auch wenn sich seine Kontakte zum Justizminister Österreichs seit Monaten ausschließlich auf öffentliche Empfänge und ähnliche offizielle Anlässe beschränkten. Aber: Er hatte sich erpressbar gemacht und was noch schlimmer war – er wurde bereits erpresst. Diesen Zustand von Schwäche und Abhängigkeit hätte er bei jedem anderen zutiefst verabscheut. Dass er sich selbst in eine solche Lage gebracht hatte, wenn auch ungewollt, empfand er als demütigend.
Dabei hatte diese Odyssee weit weniger poetisch begonnen, als bei Homer „mit der Anrufung der Musen“. Er hatte keinen Irrweg hinter sich, im Gegenteil. Sein Karriereweg hatte nur eine Richtung aufgezeigt: steil bergauf.
Maibach hatte sich schon frühzeitig für Straf – und Zivilrecht, also für die ordentliche Gerichtsbarkeit in der zweigeteilten Gerichtsorganisation Österreichs entschieden. Es war damals schon unter seiner Würde, lediglich Zivilrechtssachen mit meist geringem Streitwert zu verhandeln. Deshalb waren Amtsgerichte für ihn keine Option. Christopher Maibach startete seine Karriere am Landesgericht in Salzburg. Schon nach kurzer Zeit hatte er sich einen Namen in der Elite der Strafrechtler gemacht und galt als kompromissloser Entscheider. Insofern verwunderte es nicht, dass er bereits mit 42 Jahren an das Oberlandesgericht Wien wechselte. Auch hier galt er in Fachkreisen schnell als brillanter Analytiker mit hoher Kommunikationskompetenz. Seine strukturell bis ins Detail durchdachten Urteilssprechungen ließen Berufungsverfahren nur in wenigen Fällen zu.
An jenem denkwürdigen und gleichzeitig verfluchenswerten Freitag nach seinem 50. Geburtstag erhielt er ein Päckchen im A4 Format. Er nahm zunächst an, dass es sich um ein verspätetes Geburtstagspräsent handele und legte es auf die Arbeitsplatte seines heimischen Schreibtisches. Schließlich siegte die Neugier – und er hatte noch 20 Minuten Zeit, bis er wegen eines Arbeitsessens das Haus verlassen müsste.
Der Richter löste gewohnt sorgfältig die Banderole des Päckchens und öffnete die Verschlusslasche. Als die Fotos auf seinen Schreibtisch glitten, wusste er zunächst nichts damit anzufangen. Die obenauf liegenden Bilder zeigten eine junge Frau, die sich offenbar auf einer Bergtour befand. Danach folgten Fotografien derselben, ihm unbekannten blonden Frau, die allesamt sportliche Aktivitäten unterschiedlicher Disziplinen abbildeten. Per Rad, beim Surfen oder während eines Tennismatches – das Mädchen schien ein Allroundtalent zu sein. Dann wechselte abrupt die Thematik und Christopher Maibach verschwamm vor Entsetzen das nächste Foto vor den Augen. Es zeigte die gleiche junge Frau in unnatürlich abgewinkelter Stellung, auf, von Feuchtigkeit glänzendem Kopfsteinpflaster liegend. Ihre Augen waren weit geöffnet und aus ihrem Mund lief eine deutlich sichtbare Spur Blut, was auf den Steinen bereits eine Lache gebildet hatte. Es befanden sich noch weitere Bilder in dem Karton, die aber dem Richter seine grausame Vermutung nur bestätigten. Sie zeigten in einer verblüffend guten Qualität den teilweisen Hergang eines Unfalls. Eine blonde Frau war offenbar von einer schwarzen Limousine mit Wiener Kennzeichen erfasst worden, worauf sie auf dem Pflaster aufschlug. Der Wagen stoppte, was am Leuchten der Bremslichter auf einem Bild deutlich erkennbar war. Das letzte Bild zeigte das dunkle Fahrzeug in einiger Entfernung vom Unfallort. Die Bremsleuchten waren längst erloschen. Der Richter musste sich das Nummernschild nicht vergrößern – es handelte sich zweifelsfrei um seinen Wagen.
Drittes Kapitel
Major Kupfer hegte keineswegs Groll gegen seine Chefin. Sie hatte zwar wieder einmal recht gehabt – aber er genoss diesmal ihr untrügliches Näschen. Er saß, wie von ihr vorausgesagt, in einem malerisch gelegenen, kleinen Restaurant in Locarno. Dieser sonnenverwöhnte Urlaubsort in der südlichen Schweiz präsentierte sich von seiner besten Seite. In Blickrichtung schaute Michael Kupfer linkerhand auf die Wallfahrtskirche der Madonna del Sasso und rechts davon auf den Lago Maggiore, der bis an die Ausläufer der majestätischen Alpen zu reichen schien. Urlaub müsste man haben …
Sein Schweizer Kollege Lucas Schmid hatte die Location für ihr zweites Treffen ausgewählt. Das erste fand vor zwei Tagen in dessen Diensträumen statt. Oberleutnant Schmid war Bezirkschef des Tessiner Bezirkes Locarno und wollte die bevorstehenden Ermittlungen mit der Wiener Sonderkommission „Gold“ persönlich leiten.
Im Mittelpunkt sollten dabei zunächst drei kleinere Affinerien stehen, die ausschließlich Gold aufbereiteten. Diese befanden sich im Umkreis von etwa 100 Kilometern – bezogen auf ihren Standort.
Gestern hatten sie bereits zwei dieser Scheideanstalten unangekündigt besucht und nach dem Durchlaufen aller notwendigen Sicherheitskontrollen und Arbeitsschutzbelehrungen einen ersten Einblick in die Technologie der Feingoldgewinnung erhalten. Da beide Kriminalisten das Fach „Chemie“ zu keinem Zeitpunkt ihrer Schulzeit und des späteren Studiums geliebt hatten, drangen sie zugegebener Weise nur peripher in die komplexen Vorgänge von Reaktionen unterschiedlicher chemischer Elemente ein.
Michael Kupfer hatte sich zumindest gemerkt, dass Chlor eine entscheidende Rolle bei der Trennung des Goldes von anderen Metallbestandteilen spielte. Das wäre typisch für das am meisten angewandte „Millerverfahren“, hatte ihnen ein Technologe erläutert. Es sei weniger aufwändig und damit auch rentabler als die anderen beiden bekannten Verfahren. Nachteil dieser Methode wäre es allerdings, dass die maximal erzielbare Reinheit bei 99,95% liegen würde, während die anderen zwei Scheideverfahren 99,99%iges Gold erzeugten.
Diese Aussage stellte sich als essenziell heraus. Sie hatten noch am gestrigen Tag das Laborergebnis für die sichergestellten Goldbarren und die fehlgeprägten „Wiener Philharmoniker“ erhalten. Es handelt sich in beiden Fällen um 99.99%iges Feingold. Damit konnte der überwiegende Teil der Tessiner Scheideanstalten als Produktionsstätte der Fälschungen ausgeschlossen werden. Es verblieb nur eine Affinerie, die das sogenannte „Wohlwill – Verfahren“ nutzte. Das Borax – Verfahren als dritte Separationsmethode kam momentan nicht zur Anwendung.
Beide Polizisten hatten sich geeinigt, im Fall der einen noch zu überprüfenden Scheideanstalt anders vorzugehen, als bei den bereits besuchten Institutionen.
Wenn Minengold illegal zu reinem Feingold verarbeitet wurde, gab es bestimmt keinen offiziellen Auftrag. Eine Buchprüfung würde deshalb ins Leere laufen. Was nicht problemlos manipuliert werden konnte, waren Maschinendaten. Es handelte sich zwar im Gegensatz zum Miller – Verfahren um eine elektrolytische Raffination, aber Wäge- und Prüfprozesse gab es beim Wohlwill – Verfahren auch. Wenn es gelang, Abweichungen oder Ungereimtheiten zwischen den offiziellen Buchwerten und auslesbaren Maschinenparametern zu ermitteln, wäre das vielleicht ein Ansatz für eine richterlich angeordnete Tiefenprüfung.
Da beide Polizisten über keinerlei technologische Kenntnisse auf diesem Gebiet verfügten, musste externer Sachverstand her. Auch die Tatsache, dass eine Wiener Sonderkommission an der Ermittlung beteiligt war, durfte dem Management der Scheideanstalt nicht bekannt werden. Überhaupt: die Aktion musste den Eindruck einer Routinekontrolle erwecken, die auch im Interesse des Unternehmens liegen sollte.
Lucas Schmid und Michael Kupfer hatten sich ein paar Stunden Zeit gegeben, um eine Idee zu entwickeln, die diesem Anspruch gerecht wurde.
Oberleutnant Schmid war mit einer gehörigen Portion Glück erfolgreich gewesen und hatte einen Experten für moderne Goldscheideprozesse bei der Kantons–und Stadtpolizei Zürich ausfindig gemacht. Der in der Fachgruppe Elektrotechnik des Forensischen Institutes beschäftigte Kollege, hatte sich im Rahmen mehrerer Fälle ausgiebig mit der Feingoldherstellung beschäftigt. Er kannte die entsprechenden Technologien, einschließlich des Gießens von Goldbarren und des Prägens von Münzen, praktisch und theoretisch aus dem Effeff. Eben ein Glücksfall!
Michael Kupfer hatte in dieser Zeit eine mögliche Vorgehensweise entwickelt.
Die nicht zu widerlegende Behauptung, es wäre Feingold in Umlauf, welches Verunreinigungen enthielt, wodurch dessen aufgeprägter Feingoldanteil von 99,99% unterschritten würde, könnte hilfreich sein. Das Einsehen von Eich – und Prüfprotokollen sowie der Vergleich von technischen Daten und Systemeinstellungen wäre die logische Folge und sollte im Interesse des Unternehmens liegen.
Die Kriminalisten genossen ihren Kaffee auf der Sonnenterrasse des kleinen Restaurants und prüften die für den nächsten Tag geplanten Schritte auf Plausibilität.
„Ja, so könnten wir – vorausgesetzt, dass es sich um die gesuchte Scheideanstalt handelt – zu einem Ermittlungsergebnis kommen. Ihr solltet morgen früh den Züricher Kollegen mit allen notwendigen Fakten ausstatten. Ich warte dann im Hotel auf deinen Anruf. Wenn es zu brauchbaren Ergebnissen kommt, werde ich sofort in dein Büro fahren. Wenn nicht, stimmen wir das weitere Vorgehen telefonisch ab.“
Da die Chemie zwischen den Männern stimmte, waren sie schnell zum vertrauten „Du“ übergegangen.
Richter Maibach nahm das Mobilteil seines heimischen Telefons in die Hand und tippte eine Nummer von seinem Handy ab. Er zitterte dabei ein wenig, versuchte aber seiner Stimme einen selbstsicheren Klang zu geben, als sich der Anrufer von vorhin meldete.
Es lag jetzt zehn Jahre zurück, als er den ersten, damals sogar persönlichen Kontakt mit dem Unbekannten hatte. Seitdem wurde er, inclusive des heute beendeten Verfahrens, viermal telefonisch dazu erpresst, ein Urteil zu manipulieren. Es lagen stets viele Monate dazwischen, insofern war der heutige Anruf eine Ausnahme.
Das beunruhigte ihn auch deshalb, weil seine Richterkollegen und vor allem die Staatsanwaltschaft keinen Argwohn schöpfen durften. Das wäre die Vorstufe eines Manipulationsverdachtes. In einem minder schweren Anklagepunkt – es war bei der ersten Erpressung vor neun Jahren – wurde ein Freispruch von ihm erwartet. In den anderen drei Verhandlungen wäre es im regulären Urteilsverfahren zu langjährigen Freiheitsstrafen gekommen. Mit Unterstützung eines anerkannten Forensischen Psychiaters, der seiner Tendenz nicht nur folgte, sondern in einem fundierten Gutachten bestätigte, gelang der Nachweis von Zurechnungsunfähigkeit. Das hatte lediglich einen zeitlich überschaubaren Maßnahmenvollzug zur Folge. In allen drei Fällen wurden die Täter in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.
„Wie schon gesagt, mein lieber Richter, das haben Sie heute richtig gut gemacht. Übrigens: Die Robe steht Ihnen ausgezeichnet, Sie wirken darin ausgesprochen seriös und überzeugend.“ Er machte eine Pause. Kurz genug, um den Richter nicht ins Gespräch kommen zu lassen.
„Das macht mir Mut, gleich noch eine kleine Bitte loszuwerden. Gestern ist ein guter Freund von uns aufgrund eines Missverständnisses verhaftet worden. Er soll angeblich zwei Polizisten bei einer Routinekontrolle erschossen haben. Unser Freund ist seit längerer Zeit schon in psychiatrischer Behandlung. Er leidet unter typischen Symptomen einer paranoiden Schizophrenie, einer akuten Form von Verfolgungswahn. Als dieser arme kranke Mann vor ein paar Wochen, nachts, bei strömenden Regen mit einem Kleintransporter unterwegs war, wurde er von einem dunklen Wagen gestoppt. Er geriet in Panik, weil er glaubte, die Männer, die sich seinem Wagen näherten, wollten ihn umbringen. Das Blaulicht hielt er für eine Tarnung, da es sich um kein Polizeifahrzeug handelte. Er erschoss die beiden Männer aus purer Angst – er konnte ja nicht ahnen, dass es sich um eine Zivilstreife handelte. Die Pistole hatte er sich illegal beschafft. Auch das war seiner Krankheit geschuldet, die ihm ständig vorgaukelte, er sei in großer Gefahr.
Alles andere können Sie der Polizeiakte entnehmen.
Sie helfen uns doch, den armen Kerl vor dem Gefängnis zu bewahren? Das hat er wirklich nicht verdient“, schloss er mit butterweicher Stimme sein vermeintliches Plädoyer für humanitäre Hilfe, Gerechtigkeit und Nächstenliebe.
Christopher Maibach versuchte nur halbherzig, Argumente gegen seine Einflussnahme vorzubringen. Er wusste, dass es zwecklos war. So lief es jedes Mal.
Der unbekannte Anrufer ließ ihn nicht einmal ausreden und wechselte abrupt das Thema.
„Die Angehörigen der jungen Frau warten noch immer sehnsüchtig darauf, den Mann, der ihren Tod verschuldet hat, vor Gericht zu sehen. Wenn dann noch publik würde, dass dieser skrupellose Mensch ein Richter ist, der in mehreren Fällen Urteile zugunsten von Schuldigen manipuliert hat – oh, oh… Ich denke, mehr muss ich dazu nicht sagen! Bereiten Sie sich ordentlich auf den Fall vor. Die Klage wird schon bald vor dem Oberlandesgericht Wien anhängig sein und Sie werden dafür sorgen, dass sie in unserem gemeinsamen Sinne entschieden wird.“
Dann war die Leitung tot.
Richter Maibach sah die grausamen Bilder des Unfalls in einer erschütternden Klarheit wieder vor sich, obwohl sie sicher in seinem Safe verwahrt waren.
Der Umfang der Feier, anlässlich seines 50. Geburtstages, war ihm bezüglich der Anzahl der geladenen Gäste „aus dem Ruder gelaufen“. Da er allein lebte, hatten ausschließlich Kollegen und gute Kollegen, die er in Ermangelung richtiger Freunde so katalogisierte, ihm beratend zur Seite gestanden. Das Resultat war eine überdimensionierte Orgie in einer Location am Rande von Wien, wobei sich die, durch die Begrifflichkeit „Orgie“ suggerierten Ausschweifungen, hauptsächlich auf Speisen und alkoholische Getränke bezogen.
Er war mit dem Wagen gefahren, weil er die zu erwartenden Geschenke am Abend gleich mitnehmen wollte. Im Normalfall trank er kaum Alkohol, weshalb er diese Lösung favorisierte.
Der Abend verlief aber in keinerlei Hinsicht normal. Die Kollegen hatten sich einiges ausgedacht, was die Stimmung schnell auflodern ließ. Auch das fast zwanghafte Ritual des Anstoßens auf den Jubilar hatte er unterschätzt. Ab einem gewissen Zeitpunkt beschloss er deshalb, die Geschenke in seinen Wagen zu laden und am Ende der Geburtstagsfeier ein Taxi zu bestellen. Dann musste er sich eben morgen noch einmal zu diesem Gasthaus fahren lassen.
Als gegen 01.30 Uhr die feuchtfröhliche Stimmungslage langsam in Richtung eines sentimentalen Müdigkeitszustandes kippte, begann Christopher Maibach mit Hilfe einer jungen Mitarbeiterin seine reichlich empfangenen Geschenke zu verladen. Als er ins Freie trat, spürte er die Wirkung des Alkohols in voller Ausprägung. Zum Glück verfügte sein Wagen über eine Funktüröffnung – mit dem Schlüssel hätte er sich schwergetan.
Der Richter legte die Strecke zum Auto mehrere Male mit schweren Schritten und nicht immer auf dem kürzesten Weg zurück. Zwischendurch verabschiedete er immer wieder Gäste. Die Geburtstagsrunde befand sich in Auflösung. Als er sich schließlich erschöpft noch einmal auf seinen Stuhl fallen ließ, fiel ihm plötzlich ein, dass er kein Taxi gerufen hatte. In diesem Moment verabschiedeten sich die letzten beiden Kollegen und die Wirtin kam mit der Rechnung. Der Richter überreichte ihr seine Kreditkarte und zwei Scheine im Wert von vierzig Euro.
Wenige Minuten später startete Maibach sein Auto. Er fuhr in die Dunkelheit und passierte nach etwa zwei Kilometern ein nobles Vorstadtviertel. Die Räder machten blubbernde Geräusche auf dem feuchten Kopfsteinpflaster der Straße, als ein dumpfer, nicht sehr starker Schlag im vorderen Wagenbereich zu hören war. Christopher Maibach bremste sofort und ließ die Scheibe auf der Fahrerseite nach unten gleiten. Er sah wenige Meter hinter dem Auto eine Person auf dem Pflaster liegen. Aufgrund seines Zustandes sah er das Bild sehr verschwommen.
Seine Reaktion war ebenso falsch wie undurchdacht gewesen – zu logischem Denken war er damals einfach nicht mehr in der Lage. Er war losgefahren und hatte keine Hilfe geleistet. Das würde ihn ein Leben lang belasten, dessen war er sich seit diesem Tag sicher.
Die mehrfachen Manipulationen von Urteilen infolge seiner Erpressbarkeit hatten die Sache nicht besser gemacht. Dabei wusste der erfolgsverwöhnte Richter sehr gut, dass man eine solche Schuld nicht durch weitere Verfehlungen lindern kann. Der Druck blieb – trotz der größer werdenden Fläche, die seine Gesamtschuld abbildete – stets gleich. Das Gewissen folgte eben keinen physikalischen Gesetzen.
Die unangekündigten Ermittlungen in der Tessiner Scheideanstalt waren ein voller Erfolg – so stellte es sich zumindest nach jetzigem Erkenntnisstand dar.
Der Forensiker aus Zürich hatte seine Rolle als unabhängiger Wissenschaftler so perfekt gespielt, dass der Cheftechnologe, der die Polizisten begleitete, fast ehrfürchtig dessen Ausführungen und Kommentaren gelauscht hatte.
Im Resultat stand fest: Es wurden zehn Dore´ Barren unbekannter Herkunft, mit einem Gesamtgewicht von sechzig Kilogramm, zu 99,99%igem Feingold im Wert von 2,5 Millionen Euro veredelt. Die Geschäftsführung versicherte energisch und in gewisser Weise auch glaubhaft, weder von der Existenz dieses Industriegoldes, noch von der elektrolytischen Raffination der Barren gewusst zu haben. Sie hatten auch bedingungslos einer umfassenden Überprüfung eines längeren Zeitraumes zugestimmt, ohne eine richterliche Anordnung zu verlangen. Eigenartig war der Sachstand – und das sprach zunächst auch für die Unwissenheit der Unternehmensspitze – dass die illegale Feingoldherstellung während der 14tägigen Betriebsferien der Mitarbeiter der Scheideanstalt stattfand. Der Cheftechnologe war darüber fast entsetzt. Er empfand es vermutlich als Affront, dass die komplizierte Anlage auch ohne ihn erfolgreich bedient worden war.
Michael Kupfer hatte sich den kurzen Bericht im Büro seines Kollegen Lucas Schmid angehört. Allein für dieses Ergebnis hatte sich die neunstündige Fahrt von Wien gelohnt.
„2,5 Millionen Euro sind viel Geld, aber für das immense Risiko und den großen Aufwand des illegalen Betreibens einer gut gesicherten Produktionsstätte, die sich noch dazu in Betriebsruhe befand, erscheint mir die Summe fast zu gering. Zieht man den Risikobonus vom Verkaufserlös ab, verbleiben für die Vielzahl von Personen auf der Gehaltsliste der Auftraggeber noch etwa zwei Millionen Euro zum Verteilen. Da das Minengold mit Sicherheit einen langen Schmuggelweg hinter sich hat – vermutlich aus Zentralasien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten – steht mit großer Wahrscheinlichkeit eine mächtige Organisation dahinter, die natürlich auch finanziert werden muss. Das lässt darauf schließen, dass noch weitaus größere Mengen illegal eingeführter Dore´ – Barren hier verarbeitet worden sind. Ich bin auf das Ergebnis der Tiefenprüfung in der Scheideanstalt gespannt. Allerdings nehmen die Befragungen der Mitarbeiter, das Überprüfen aller Alibis während ihres Urlaubes und das Auslesen und Bewerten aller technologischen Daten über einen großen Zeitraum einige Zeit in Anspruch. Wir sollten zuerst die beiden Geschäftsführer zeitgleich und getrennt voneinander befragen.“
Lucas Schmid nickte und lächelte dabei. „Schön zu hören, dass die Hirne von Polizisten aus Österreich und der Schweiz offenbar über ähnliche Windungen verfügen. Meine Überlegungen gingen in die gleiche Richtung. Außerdem habe ich veranlasst, dass die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der Scheideanstalt zu einer Befragung vorgeladen werden. Sie befinden sich bereits in unserer Behörde. Eine erfahrene Kollegin wird den technischen Geschäftsführer und ich den kaufmännischen Geschäftsführer befragen. Danach sollten wir die Befragungsergebnisse zu dritt auswerten.“
Major Kupfer war sofort einverstanden. „Dann lasst mal die Herren nicht länger warten. Zeit ist Gold“, ergänzte er zweideutig.
Leutnant Lina Keller strahlte eine unbeschwerte Heiterkeit aus, die regelrecht ansteckend wirkte. Ihre kurzen, blonden Haare verliehen ihrem Habitus einen frechen Anstrich, der durch das hübsche, spitzbübisch lächelnde Gesicht eine überaus sympathische Note erhielt. Man schaute sie einfach gern an und sie schien dafür volles Verständnis zu haben, was sie unbekümmert erkennen ließ.
Die drei Ermittler saßen in einem schmucklosen aber freundlich hellem Büroraum. Sie waren mit Automatenkaffee versorgt worden und hatten sich zunächst ein wenig bekannt gemacht – zumindest was Michael Kupfer und Lina Keller anging. Dann war die blonde Frohnatur aber nicht mehr zu bremsen.
„Darf ich mit meinem Bericht beginnen? Ich halte mich bestimmt kurz, Chef, aber vielleicht ist dann die wichtigste Frage schon geklärt.“
„Was ist denn in deinen Augen die wichtigste Frage für uns?“, fragte Lucas Schmid sichtbar amüsiert über das aufgeregte Mitteilungsbedürfnis seiner Kollegin.
„Na, ich denke, wenn wir wüssten ob in dieser „Scheidungsanstalt“ noch mehr illegales Gold veredelt wurde oder eben nicht, wäre das eine wichtige Botschaft für uns“, sprudelte es förmlich aus ihr heraus.
„Scheideanstalt“, korrigierte Lucas Schmid lachend – „dann schieß mal los.“
Lina bemühte sich offenkundig, ihr Temperament ein wenig herunterzufahren. Sie holte tief Luft und begann sachlich zu berichten.
„Mein Gesprächspartner war der technische Geschäftsführer. Er hatte sich in der knapp verfügbaren Zeit gewissenhaft auf das Gespräch vorbereitet und er schien sich auch bestens in den Produktionsabläufen auszukennen. Darüber hinaus vermittelte er mir den Eindruck zu wissen – oder zumindest zu ahnen – auf welche Aussagen wir besonderen Wert legen. Auf meine Frage, ob die Auslastung der Produktionsanlagen in den zurückliegenden Monaten gut gewesen ist, legte er mir zahlreiche Dokumente vor. Er versicherte, dass das Herzstück der Veredlungsanlage, die elektrolytische Raffination, zu 100% ausgelastet gewesen wäre. Die Auftragslage sei ausgezeichnet. Er hat das über sechs Monate lückenlos mit geschriebenen Aufträgen belegt, denen er entsprechende Rechnungen und Zahlungseingänge zuordnete. Freilich müssen die Unterlagen noch von einem erfahrenen Fachmann auf diesem Gebiet geprüft werden, aber ich bin mir relativ sicher, dass er die Wahrheit gesagt hat. Es handelt sich übrigens um mehr als zweihundert kleinere Aufträge von Einzelkunden. Ich glaube, `der Ferieneinsatz in der geschlossenen Fabrik` war eine einmalige Aktion. Es ist für mich auch nicht vorstellbar, dass dieser geradlinige Unternehmer sein Eigentum – er besitzt 70% der Gesellschaftsanteile – so fahrlässig aufs Spiel setzt.“
Die beiden Herren in der Runde hatten angespannt zugehört. Der Bezirkschef nahm als Erster Stellung.
„Das überrascht mich schon, auch wenn die Produktionsauslastung noch über einen längeren Zeitraum geprüft werden muss. Wenn allerdings diese Auswertungen deine Vermutung bestätigen, haben wir vielleicht einen Zufallstreffer gelandet. Ich bin da ganz Michaels Meinung: Es sind mit Sicherheit noch wesentlich größere Mengen an Dore´ – Barren illegal in die Schweiz gelangt. Sonst würde sich der Aufbau eines internationalen Schmuggelringes nicht lohnen. Wenn in dieser Scheideanstalt nur 10 Barren Minengold zu Feingold aufbereitet wurden, ist das nur ein kleiner Teil des Kuchens.“
Die drei Männer ließen sich nicht stören, als ein junger Mann die Tür öffnete und das Abendessen abstellte. Sie spielten bereits seit zwei Stunden Skat und befanden sich offenbar in einer entscheidenden Phase.
Die Typen konnten unterschiedlicher nicht sein – zumindest was ihr Aussehen anging. Der links am Tisch sitzende Spieler war mit einem groben, pockennarbigen Gesicht gestraft. Ein massiv wirkendes Gestell rahmte die großen, runden Brillengläser und kaschierte das komplette Fehlen der Augenbrauen. Sein langes Haar umschloss in fettigen Strähnen seinen gewaltigen Kopf. Der in der Mitte platzierte Mann war eher ein intellektueller Typ. Seine feingliedrigen Hände hielten die Karten in einer Weise, als ob er mit aller Sorgfalt versuchte, wertvolle Briefmarken unbeschadet unter die transparente Folie eines Albums zu schieben. Er hatte ein schmales, hübsches Gesicht – nur seine Augen waren stechend und wirkten kalt.
Der dritte im Bunde fiel durch seine körperlichen Proportionen auf. Er war ein sogenannter „Sitzriese“. Seine Beine waren im Verhältnis zum Oberkörper viel zu kurz – oder richtiger: Sein Oberkörper war stark überdimensioniert, so dass seine normal gewachsenen Beine viel zu kurz wirkten. Auch die Arme des Mannes waren ungewöhnlich lang, passten aber zum Oberkörper. Er besaß ein Allerweltsgesicht, was man sich nur schwer einprägen konnte.
Nachdem der gänzlich in Weiß gekleidete junge Mann das Zimmer verlassen hatte, kam Bewegung in die Skatrunde. Der intelligent wirkende Herr hatte offenbar das Spiel gewonnen und erhob sich. Er war ca. 1,80m groß und bewegte sich mit sportlich dynamischen Schritten in Richtung des Erkers. Dort stand das Abendbrot für die drei Männer auf einem massiven Eichentisch bereit. Getränke befanden sich in einer eingebauten Kühlkombination im Eckschrank des Erkers.
„Wir sollten jetzt essen, damit wir unseren morgigen Ausflug noch präzise vorbereiten können.“ Obwohl er das in einem keineswegs unfreundlichen Ton gesagt hatte, reagierten die beiden Skatbrüder mit einer gewissen Unterwürfigkeit. Sie nahmen sofort am Tisch Platz und teilten sich artig das eine Bier, was ihnen der schlanke Typ zwischen ihre beiden Gläser gestellt hatte.
„Wenn morgen alles glatt geht, könnt ihr euch am Tag danach `die Kante` geben. Für heute muss das genügen“, ergänzte er mit einem Blick auf das Bier. „In wenigen Stunden müsst ihr bei klarem Verstand sein, soweit ihr das hinbekommt“, fügte zynisch hinzu. Er schaute in die kleine Runde und wechselte im Rahmen eines antrainierten Mimik – Repertoires in den versöhnlichen „Ich habe euch lieb – Modus“. Die beiden Mitspieler registrierten sein freundlich wirkendes Gesicht mit offenkundiger Erleichterung.
„Der grenznahe Winkel in Vorarlberg, wo sich unsere Nobelherberge befindet, zählt idealerweise zu den geringbesiedelten Gebieten im westlichen Österreich“, begann der smarte, jüngere Herr in dozierendem Tonfall. „Ihr seid doch hoffentlich damit einverstanden, wenn wir beim Essen schon ein wenig fachsimpeln. Ich fahre euch in unserem Einsatzfahrzeug zum Treffpunkt des Teams. Dort übernehmt ihr eure Transportfahrzeuge, einen unscheinbaren Opel Kombi und einen Seat, natürlich beide mit sauberen Papieren. Dort erhaltet ihr auch jeweils ein Navigationsgerät, was euch sicher zum Aufnahmeort bringen wird. Ihr passiert auf dem Weg dahin einen kleinen Ort. In Höhe der Kirche befindet sich ein festinstalliertes Blitzgerät. Haltet euch unbedingt an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30km/h!“
In diesem Moment klingelte sein Telefon. Er stand auf und bewegte sich in Richtung Tür. Kurz vorher blieb er stehen und wendete sich wieder dem gedeckten Tisch zu.
„Eine gute Nachricht, ich danke ihnen sehr. Dann bekommen wir also bald Zuwachs in unserer kleinen, glücklichen Familie. Arbeit gibt es genug!“
Er bedankte sich nochmals höflich, bevor der Anrufer das Gespräch beendete.
„Ich muss ein Telefonat führen, bevor wir unser Drehbuch für morgen zu Ende besprechen. Bin gleich zurück.“ Die Tür schloss sich gedämpft und saugend hinter ihm. Es herrschte absolute Ruhe.
Der junge Pfleger, der das Essen gebracht hatte, erwartete seinen Chef in einem kleinen Behandlungsraum, der über einen direkten Zugang zum Büro des Oberarztes der Psychiatrischen Klinik im Dreiländereck, einer Außenstelle des Klinikverbundes Vorarlberg, verfügte. Dr. Urs Töns leitete diesen kleinen Klinikbereich mit nur drei Pflegern und einer Krankenschwester. Für alle, nicht direkt mit der medizinischen Betreuung in Verbindung stehenden Dienstleistungen, hatte die Klinik Serviceverträge mit regionalen Anbietern abgeschlossen. Das aus nur 6 Personen bestehende Kernpersonal – es gehörte noch ein älterer Herr zu diesem Kreis, der als eine Art Faktotum alle sonst noch anfallenden Arbeiten erledigte – wohnte im Nebenflügel des Patiententraktes.
„Wir werden in Kürze einen neuen Schützling zugewiesen bekommen, der unseren gestrigen Neuzugang in unserer Luxus – Suite ablösen wird. Er erhält anfangs auch keinen Freigang, bis wir ihn so eingestellt haben, dass seine Loyalität über seine aggressive Heimtücke die Oberhand behält. Kontakt zu ihm ist euch nur zu zweit gestattet und die ersten Tage nur in meinem Beisein. Verstanden?“
Der Pfleger nickte etwas verunsichert. „Wir haben es doch nicht zum ersten Mal mit einem komplizierten Gast zu tun. Aber selbstverständlich, Herr Doktor, wir werden Vorsicht walten lassen, genau wie bei dem jetzigen Neuzugang.“
„Unser neuer Freund ist nicht kompliziert – er ist sadistisch. Das ist eine Herausforderung für unser kleines Team, aber wir werden aus diesem wilden Wolf ein Lämmchen machen, dem wir, bei Bedarf, den Schafspelz kurzeitig abstreifen lassen.“ Seine Augen wirkten jetzt wie Eiskristalle. Sie schienen jegliche Empathie zum Einfrieren zu bringen.
Victor Borges schaute sitzend aus seinem Dienstzimmer auf ein einzigartiges Ensemble islamischer Architektur und kultureller Kreativität. Der Registanplatz mit den angrenzenden Madrasas erinnerte ihn noch immer an „Tausendundeine Nacht“, jene Sammlung morgenländischer Erzählungen, die einst in seinen kindlichen Träumereien Figuren, wie Dschafar, Schah Zaman oder Sindbad, zum Leben erwecken ließen.
Heute war das anders. Seine Gedanken konzentrierten sich auf eine unwirtliche Gegend, irgendwo im roten Sand der „Kysylkum“ – Wüste, wo seine Frau und seine Tochter noch immer festgehalten wurden.
Von den 6 vergifteten Patienten waren bereits zwei während des Transportes zu seiner Klinik verstorben. Die für eine Cyanid – Vergiftung typischen, leuchtend rot ausgebildeten Todesflecken, hätten bei jedem seiner gut ausgebildeten medizinischen Fachkräfte sofort Argwohn hervorgerufen. Das Begleitpersonal des Krankentransportes hatte die beiden Leichen deshalb vorsorglich abgedeckt und der angebliche Arzt unter ihnen bestand auf eine sofortige Überführung der toten Arbeiter in die Pathologie zu Professor Borges.
Er hatte sie dort in Empfang genommen, untersucht und anschließend unverfängliche Totenscheine ausgestellt. Der vermeintliche Begleitarzt wollte die Verstorbenen mit zurücknehmen und benötigte dafür offizielle Dokumente.
Da die vier jüngeren Patienten offenbar mit kleineren Mengen der sonst tödlichen Blausäureverbindungen in Berührung gekommen waren und sich glücklicherweise auf dem Weg vollständiger Genesung befanden, war für morgen deren Rückführung in ihre Heimatdörfer geplant. Der Krankentransport der Erpresser sollte den Austausch der Genesenen gegen seine Frau und seine Tochter vornehmen.
Am darauffolgenden Morgen war Professor Borges schon früh in der Klinik und erwartete unter einem schmerzhaften Druck die nächste telefonische Anweisung. Er ging davon aus, dass die genesenen Männer die wenigen Meter von der Isolierstation, wo sie untergebracht waren, bis zum geräumigen Krankenbettaufzug mittlerweile ohne fremde Hilfe bewältigen konnten. Er hatte lediglich eine Begleitung organisiert. So war es mit dem Unbekannten telefonisch besprochen worden. Er wollte jegliches Aufsehen vermeiden, denn gegenüber der Verwaltung waren diese vier Patienten nicht vorhanden. Der Klinikchef würde da einiges improvisieren müssen. Zuerst musste er aber seine Frau und seine Tochter wohlbehalten in Sicherheit wissen. Bis dahin war alles andere nebensächlich.
In diesem Moment klingelte das Telefon. Eine Nummer wurde auch diesmal nicht angezeigt. Er nahm das Mobilteil seines Festanschlusses so hastig auf, dass er um ein Haar die Verbindung getrennt hätte.
„Mein lieber Professor, ist heute nicht ein schöner Tag für uns alle? Wir werden in 20 Minuten am Aufzug zur Isolierstation unsere Freunde in Empfang nehmen. Dann werden Sie noch ein paar Kilometer unser Gast sein, bevor ich Sie an einem Ort meiner Wahl wieder mit Ihrer Familie vereine. Dort wird Sie ein Taxi abholen und zu Ihrem Haus bringen. Ist das dem Herrn Professor so recht?“, fragte der Unbekannte zynisch.
Victor Borges war keineswegs begeistert über die vorgeschlagene Art und Weise der Übergabe. Er wusste aber gleichzeitig, dass dieses Vorgehen alternativlos war. Er bestätigte deshalb, dass er alles verstanden hatte, worauf der Erpresser sofort das Gespräch beendete.
Eine reichliche halbe Stunde später stoppte der Krankentransport abrupt am Holzunterstand einer ehemaligen Bushaltestelle. Die Linie war vor ein paar Jahren eingestellt worden, als die Straßenbahn in Samarkand ihren Betrieb aufnahm. Da das Schienennetz in einiger Entfernung vorbeiführte, war diese Gegend jetzt gänzlich vom bunten Stadttreiben isoliert.
Kurz darauf lagen sich Mutter, Tochter und Vater überglücklich in den Armen. Sie achteten nicht darauf, wie sich der Wagen schnell entfernte. Das Mädchen schluchzte jetzt hemmungslos. Victor Borges drückte sie fest an sich und schwieg. Als sich seine Tochter langsam beruhigte, kam auch schon ein Taxi. Zumindest diesbezüglich hatten die Verbrecher Wort gehalten.
Ihre Tochter Lonja hatte sich zu Hause sofort in ihr Zimmer zurückgezogen und war völlig entkräftet eingeschlafen. Das Ehepaar Borges war noch immer emotional aufgewühlt und musste die zurückliegenden Tage erst einmal in aller Ruhe Revue passieren lassen. Frau Borges konnte zu ihrem Aufenthalt wenig sagen. Sie waren mit verbundenen Augen in ein Haus mit einem großen Raum gebracht worden. Dieser kleine Saal, wie sie ihn bezeichnete, war sowohl ihr Schlafraum, wie auch ihre Wohnküche. Abgetrennt befand sich die Toilette und eine Waschgelegenheit. Alle Fenster waren mit einbruchsicheren Rollläden verschlossen, die sich von innen nicht öffnen ließen.
Lonja, die zu Hause immer bei vollständig geöffnetem Fenster schlief, hatte sehr unter diesen Bedingungen gelitten und fand entsprechend schlecht in den Schlaf.
Der Kühlschrank war gut und reichlich befüllt. Die Entführer hatten sogar an Obst gedacht. Kontakt gab es mit denen zum Glück nicht – abgesehen natürlich vom Tag ihrer Entführung und dem heutigen. Sie hatten sich untereinander ausschließlich in Russisch verständigt.
Auch Victor Borges erzählte seiner Frau alles, einschließlich des ersten Kontaktes mit dem vermutlichen Kopf der Bande.
„Ich konnte doch nicht ahnen, dass aus einer Gefälligkeit gegenüber einem verzweifelten Vater ein Erpressungsgrund inszeniert wird“, begann er seinen Bericht.
„Er stand bereits vor unserem Haus, als ich gegen 22.00 Uhr vom Spätdienst aus der Klinik nach Hause kam. Völlig außer Atem und glaubhaft verwirrt, lief er auf mich zu und erklärte mir mit aufgeregter Stimme, er wäre ein Nachbar und zeigte zu der in Sichtweite liegenden Wohnanlage. Sein Sohn bekäme plötzlich keine Luft mehr. Er hätte bereits erfolglos bei uns geläutet – was ja denkbar war, da du an dem Tag mit Lonja bei Großmutter übernachten wolltest. Da er verzweifelt wirkte und mir versicherte, wenn der gerufene Notdienst bereits da sei, würde er mich sofort zurückfahren, bin ich in seinen Kombi gestiegen. Dort wurde ich von einem Komplizen mit Chloroform betäubt und wachte erst kurz vor Ankunft an einer Baracke inmitten eines Wüstengebietes auf. Man verband mir vor dem Aussteigen die Augen und jemand führte mich in einen großen Raum mit sechs teilweise schwer erkrankten Männern und zwei Leichen. Ich tat alles, was unter diesen Bedingungen möglich war, um erste Hilfe zu leisten. Das Innere meiner Arzttasche war leider für einen solchen Großeinsatz viel zu knapp bestückt und auch die hygienischen Bedingungen ließen zu wünschen übrig. Ich bat die Entführer inständig, einen Rettungsdienst zu rufen und die erkrankten Personen in eine Klinik verlegen zu lassen. Die Männer reagierten nicht einmal auf meine Bitte.
Man brachte mich dann nach einer fast zweistündigen Fahrt über sehr schlechte Straßen wieder nach Samarkand. Bevor sie mich aus dem Wagen ließen, musste ich versichern, keinem Menschen von unserem Ausflug zu berichten. Wenn ich das täte, würden 6 Menschen sterben. Der Wortführer drohte mir damit, in diesem Fall keine Hilfe zu rufen und mit seinen Partnern zu verschwinden. Ein Auffinden der Erkrankten in der Wüste wäre ohnehin sehr schwierig und in der zur Verfügung stehenden Zeit unmöglich. Damit war die Zeit gemeint, die den armen Menschen bleiben würde.
Da es noch finster war, als ich in unsere Wohnung kam, entschloss ich mich, ein paar Stunden zu schlafen und dann eine Entscheidung zu treffen.





























