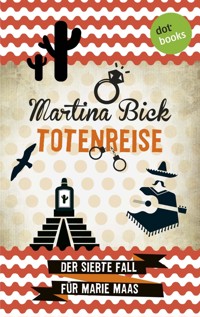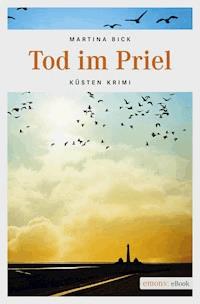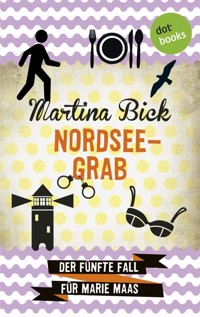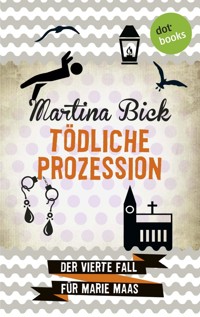
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Marie Maas
- Sprache: Deutsch
Kriminalkommissarin Marie Maas auf der Suche nach der Wahrheit: "Tödliche Prozession" von Martina Bick – jetzt als eBook bei dotbooks. Kriminalkommissarin Marie Maas macht Urlaub in einem kleinen polnischen Dorf. An Fronleichnam gerät sie zufällig in eine katholische Prozession. Unversehens eine schlägt eine junge Frau neben ihr auf dem Pflaster auf – sie ist tot. Und schon befindet sich die Kommissarin mitten in ihrem nächsten Fall, der sie hinter die friedliche Fassade der Kirchenhierarchie des Dorfes blicken lässt. Der vierte Fall für Marie Maas – eine außergewöhnliche Kommissarin stellt sich vor. Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Tödliche Prozession – Der fünfte Fall für Marie Maas" von Martina Bick. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Kriminalkommissarin Marie Maas macht Urlaub in einem kleinen polnischen Dorf. An Fronleichnam gerät sie zufällig in eine katholische Prozession. Unversehens eine schlägt eine junge Frau neben ihr auf dem Pflaster auf – sie ist tot. Und schon befindet sich die Kommissarin mitten in ihrem nächsten Fall, der sie hinter die friedliche Fassade der Kirchenhierarchie des Dorfes blicken lässt.
Der vierte Fall für Marie Maas – eine außergewöhnliche Kommissarin stellt sich vor.
Über die Autorin:
Martina Bick wurde 1956 in Bremen geboren. Sie studierte Historische Musikwissenschaft, Neuere deutsche Literatur und Gender Studies in Münster und Hamburg. Nach mehreren Auslandsaufenthalten lebt sie heute in Hamburg, wo sie an der Hochschule für Musik und Theater arbeitet. Martina Bick veröffentlichte zahlreiche Kriminalromane, Romane und Kurzgeschichten und war auch als Herausgeberin tätig. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. 2001 war sie die offizielle Krimistadtschreiberin von Flensburg.
***
Neuausgabe September 2014
Copyright © der Originalausgabe 1996 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de
Titelbildabbildung: © istockphoto; shutterstock; Fotolia.com
ISBN 978-3-95520-679-6
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Marie Maas an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
Martina Bick
Tödliche Prozession
Der vierte Fall für Marie Maas
dotbooks.
Dla Krystyny, Barbary i Jarka z serdecznym podziękowaniem za pomoc i gościnność.
1
Nicht, daß sie nicht damit gerechnet hätte. Als Kriminalkommissarin rechnete man ständig mit dem Tod. Er war wie die Unbekannte in einer Gleichung, aber immer vorhanden. Selbst wenn man zeitweise nicht an ihn dachte, ihn vergaß – irgendwann war es dann wieder soweit. Nicht also, daß sie völlig überrascht gewesen wäre, als der Körper von oben in die Menschenmenge fiel. Marie Maas hatte sich nur entsetzlich erschrocken.
Ein Aufschrei ging durch die Reihen, ein helles, fast musikalisches Kreischen, ein vielfacher Akkord aus den Hunderten, auf sanften Gesang gestimmten Kehlen der Fronleichnamsprozession. Die Menge teilte sich, nein, sie wurde zerschnitten von dem fallenden Körper, ein Kind wurde fast von ihm erschlagen und trug eine schwere Kopfverletzung davon, zwei alte Leute wurden ebenfalls verletzt. Der fliegende Körper hatte sie mit seinen Gliedmaßen gestreift. Man trat sich auf die Füße, Ellbogen wurden in Bäuche und Rücken gerammt, weil man zurückschreckte, um dann wieder vorzudrängeln und zu stoßen, um an den Ort des Schreckens zurückzugelangen. Die Glöckchen, die den Baldachin schmückten, unter dem der Propst mit der Monstranz ging, waren verstummt. Jemand schrie sehr laut.
»Policija! Policija!«
Kriminalhauptkommissarin Marie Maas hatte nach dem ersten Erschrecken über diesen herabstürzenden Körper direkt vor ihren Augen sofort nach oben gesehen. Vielleicht aus Angst, daß noch etwas folgen könnte. Vielleicht aber auch aufgrund ihrer Routine, sich ständig mit Ursachen und Anlässen von Ereignissen zu beschäftigen. Sie war etwa fünfzig Schritte vom Kirchenportal entfernt und gerade im Begriff gewesen, in die enge Gasse einzubiegen, die das der Kirche angeschlossene Klostergebäude und die Wohnhäuser auf der gegenüberliegenden Seite des Kirchplatzes hier bildeten. Die lange, schattige Front des Jesuitenkonvents lag still und menschenleer hinter dem hölzernen Gerippe des Gerüsts. Ein paar Fensterflügel standen offen, aber niemand lehnte sich hinaus oder war zwischen den weißen Vorhangbahnen zu sehen. Es war nicht auszumachen, von wo der arme Mensch herabgestürzt sein mochte und warum. Dann wurde die Kommissarin von der Panik der Menge erfaßt. Sie griff instinktiv nach Tomkins Arm, aber der war bereits zu weit weg und wurde zurückgedrängt, Richtung Kathedrale.
»Bleib stehen«, hörte sie sich laut schreien, fast hysterisch und wie unter dem Zwang, diesem Stimmenmeer von Rufen und Kreischen auch etwas hinzuzufügen. Als die Menge endlich etwas zur Ruhe kam, drängte sie sich mit der Übung zum Unfallort, wie sie nur Ärzte und Kripokommissare haben. Ein gebieterisches Murmeln auf den Lippen und zwei scharf teilende Hände und Schultern. Dann stand sie neben dem gestürzten Körper, der wie tief schlafend, flach auf den Bauch gedrückt, auf dem Pflaster lag. Es war eine junge Frau, und einen Augenblick lang wunderte sich die Kommissarin, wie eine Frau aus den Fenstern eines polnischen Jesuitenklosters fallen konnte.
Jemand wollte die Frau sachte auf die Seite drehen und fragte Marie etwas. Marie Maas verstand, ohne zu verstehen. Sie schüttelte den Kopf. Nein, sie war keine Ärztin, aber die hätte hier auch nicht mehr viel ausrichten können. Die Frau war tot. Ihr Gesicht war so zur Seite gedreht, daß man ihre überraschten, schreckgeweiteten Züge sehen konnte. Eine hübsche, blonde Frau Anfang oder Mitte Zwanzig. Die weit aufgerissenen Augen waren sehr blau. Sie hatte ein winziges Muttermal unter dem linken Lidrand. Am Hinterkopf blutete sie aus einer kleinen Kopfwunde. Aber der Blutstrom war nur ganz dünn und versiegte rasch.
Marie Maas breitete die Arme aus, um die Menschen zurückzudrängen. Sie schüttelte den Kopf, und man verstand, daß der Tod in die Reihen getreten war. Ohne Übergang wechselten die Schreckensschreie in jammerndes Weinen, in Lamentieren. In Wellen setzte es sich über die Menge hin fort, bis diese sich wieder teilte, um die Priester durchzulassen.
Ohne Baldachin und so aus der Nähe, von Angesicht zu Angesicht, sah der Propst, der das Hochamt gehalten hatte, um dann die ganze Gemeinde mit viel Weihrauch und Glockenbimmeln aus der Kirche zur Prozession zu führen, aus wie ein ganz normaler Mann. Er hatte dichte, braune Haare, die er kurzgeschnitten trug und die wie ein dicker Bärenpelz um seinen Kopf lagen. Auch er hatte die Augen weit aufgerissen vor Entsetzen, war aber ansonsten so gefaßt wie jemand, der ständig mit Katastrophen und menschlichen Tragödien konfrontiert ist und sich eine entsprechende Haltung zugelegt hat. Er sah Marie einen Moment aufmerksam an, als wollte er ganz exakt ihre Verfassung abschätzen, und beugte sich dann nieder zu der Toten, die wie ein Krippenkind zwischen ihnen lag. Mit einem kurzen, auf das Wesentliche begrenzten Bewegungsablauf schlug er das Kreuz vor seiner Brust und sprach ein paar Sätze mit einer Stimme, die alles in sich barg: Aufgabe und Pflicht und Betroffenheit und Schrecken. Dann legte er seine Hände auf das Gesicht der Toten und schloß ihr die Augen.
Nach dieser seltsam tröstlichen, konzentrierten kleinen Andacht, die die Umstehenden mit Gemurmel, Gebet und Bekreuzigungen begleitet hatten, brach plötzlich wieder der Lärm der ganzen Menge über ihnen zusammen. Der Propst erhob sich und blieb wie betäubt neben der Leiche stehen. Marie Maas sichtete Tomkins roten Haarschopf über den Köpfen der Umherstehenden und fand ihn, vertieft in den Anblick der Fassade des Klosters, an die gegenüberliegende Hauswand gelehnt. Die Gasse war hier so schmal, daß er den Kopf weit zurücklegen mußte, um die ganze Höhe des Klostergebäudes zu erfassen. Von ferne hörte man die elektronische Sirene der polnischen Polizeiwagen sich nähern, schon marschierten ein paar Schutzpolizisten in zwei Reihen in die Menge. Im Nu war der ganze Kirchplatz abgeriegelt, die Schaulustigen durch eine Reihe Polizisten von der Unfallstelle abgetrennt. Marie Maas und Tomkin suchten sich rasch einen Fluchtweg über einen Gang, der zwischen zwei sich dicht gegenüberstehenden Häusern zurück zur Ringstraße und zum Rathausplatz führte. Auf einem eisernen Geländer hockten wie Spatzen auf der Stromleitung viele kleine Mädchen in hübschen, weißen Kleidern, die Körbchen mit Blumen auf dem Schoß hielten und mißmutig die Blüten zerfledderten. Für sie war der Vorfall eine noch größere Katastrophe. So lange hatten sie sich auf die Prozession gefreut und sich darauf vorbereitet. Sie redeten eifrig und steckten die Köpfe zusammen. Tomkin griff nach Maries Hand und zog sie vom Kirchplatz fort, so schnell es ging.
»Zwei Wochen Urlaub in Polen, Marie. Vergiß das nicht. Du bist hier nicht im Dienst. Du bist nicht in Hamburg. Du hast hier nichts weiter zu suchen als Erholung. Kapiert?«
»Natürlich, Tomkin«, murmelte Marie Maas und überlegte, daß es am besten wäre, erst morgen früh zu ihren Kollegen hier zu gehen, um ihre Zeugenaussage zu machen und sich ein bißchen nach dem Stand der Dinge zu erkundigen.
2
Izabela Dudek war Tomkins leibliche Tante. Allein mit ihrer Mutter, hatte sie den Krieg erst in ihrer Heimat in Galizien und später in einem der Flüchtlingslager hinter der polnisch-russischen Grenze überlebt. Der Vater war gleich zu Anfang der Naziherrschaft in Polen umgekommen. Die jüngere Schwester, Tomkins Mutter, hatte man rechtzeitig nach England schicken können. Auch wenn sie dort bald nach Tomkins Geburt gestorben war, was eigentlich auch eine Folge des Krieges war, waren ihr doch die Grauen der Flüchtlingslager erspart geblieben. Der Rest der Familie war ausgelöscht.
Izabela lebte seit 1946 in Schlesien. Erst in Wroclaw, wo sie studierte, dann ging sie als Deutschlehrerin nach Klodzko. Die neue polnische Regierung besiedelte die malerische Grafschaft zwischen den Sudetenhügeln, in der fast alle deutschen Bewohner vertrieben worden waren oder schon vor der Befreiung geflohen waren, mit Flüchtlingen aus dem Osten, aus Galizien und den Gebieten der heutigen Ukraine. Auch dort hatte es viele Deutsche gegeben, vor allem viele deutsche Juden, die seit den Vertreibungen und Pogromen im Mittelalter dort lebten und in den Ghettos deutsche Kultur und deutsche Sprache erhalten hatten. Sie gab es nun nicht mehr. Nichts gab es mehr, was war wie früher.
Izabela wohnte seit zwölf Jahren in der Siedlung hinter dem ehemaligen evangelischen Friedhof, dem heutigen Park Wojciecha, nach dem auch die Siedlung benannt worden war, keine zehn Fußminuten von der Kathedrale entfernt. Aber in Klodzko war alles unweit der Kathedrale. Sie war der Mittelpunkt der Stadt, klotzig, breit das Hauptportal mit den beiden dicken, quadratischen Turmstumpen, die seit ein paar Jahrzehnten rote, spitze Ziegeldächer trugen. Dahinter erstreckte sich das riesige gotische Kirchenschiff, im 14. Jahrhundert auf den Sockel eines Felsens gebaut, von dessen Plattform es hinter der Kirche mit zwanzig Stufen hinunter ging auf den Zawiszy Czarnego. Von hier aus sah die Kathedrale mit ihren zwanzig Metern Deckenhöhe noch mächtiger aus, fast wie ein Ozeanriese über dem Meer der Dächer des Städtchens, seinem Tümpel, seinem kleinstädtischen Getriebe. Seit dem 17. Jahrhundert wurde die Kirche mit Unterbrechungen von den Jesuiten betrieben, die ihr Kloster gleich neben der Kirche errichtet hatten. Ein nicht minder beeindruckender Bau im großem Geviert, auf der Rückseite das Gymnasium, an dem die Priester auch heute noch für den Religionsunterricht zuständig waren. Ihre Vorgänger hatten die Schule als Lateinschule gegründet und über Jahrhunderte betrieben. Das Internatsgebäude, das ehemalige Konvikt, das heute das Landesmuseum beherbergte, lag ein paar Meter weiter, dem Kloster schräg gegenüber.
Rund um den Kirchplatz standen gutbürgerliche Wohnhäuser aus den Gründerjahren dieses Jahrhunderts, dazwischen wieder verfallene mittelalterliche Gebäude, verfallen auch die barocke Pracht, mit der sie einst ausgestattet waren, trotz der vielseitigen Bemühungen der Stadt, die historischen Gebäude zu erhalten; es gab dringendere Sorgen.
Trat man heraus aus diesem Kirchenraum, so fand man sich unvermittelt in wogendem Einkaufsrummel wieder, zwischen vielen kleinen Geschäften gefangen in engen Gassen, die düster wirkten, da ihnen die Farbe fehlte, mit geisterhaften Ruinenwänden dazwischen, durch die das Grün des Festungshügels leuchtete, üppiges Grün. Schuhgeschäfte, Lebensmittelgeschäfte, Jeansläden, eine historische Apotheke mit prächtiger Jugendstilausstattung im Innern, Läden für Staubsauger und Geschirr, Wechselstube, Schlachter, ein bunter Strauß von Läden und alle voller Menschen, die schauen wollten und handeln und kaufen.
Unvermittelt gelangte man zum Rathaus, das in der Mitte der Ringstraße am Boleslawa Chrobrego lag und durch seinen kostbaren Brunnen und den Uhrenturm aus der Renaissance beeindruckte. Und dahinter die Festung. In den kalkigen Felsen gehauen, klotzig wie die Kathedrale, ihr aber an Macht weit unterlegen. Und heute nur noch eine Touristenattraktion. Ein hübscher Aussichtspunkt, ein spannendes Labyrinth, ober- und unterirdisch, ein Zeitzeugnis für die Machtkämpfe der böhmischen und österreichischen und preußischen Könige und Kaiser um diesen Landstrich, diesen Brückenkopf zwischen Süden und Norden.
Sie hatten sich auf einer gemeinsamen nächtlichen Zugfahrt durch Frankreich zufällig kennengelernt, und auch später blieben die gemeinsamen Urlaube, die Marie Maas und Tomkin unternahmen, die einzige Möglichkeit, sich wirklich kennenzulernen und zu entdecken. Wie auch in ihrem zerfransten Alltag, wenn man die jeweils in vierwöchigem Abstand stattfindenden gegenseitigen Besuche in Hamburg bzw. in London überhaupt als solchen bezeichnen konnte, gefiel Marie Maas an Tomkin besonders gut seine ruhige, beobachtende Art und Weise, etwas Neues an sich heranzulassen. Er suchte sich immer im wirklichen wie im übertragenen Sinne einen Platz in der Ecke, mit dem Rücken zu einer Wand, von wo aus er in aller Ruhe das Geschehen um sich herum betrachten konnte. Und meistens, oder immer, fand sich Marie Maas in einer anderen, manchmal konträren Ecke des Lebens wieder, ebenfalls mit dem Rücken an der Wand und still die Dinge um sich herum beobachtend. Ihre Blicke kreuzten sich, das war das äußerste an Annäherung. Trotzdem ziemlich viel, heutzutage, fand die Kommissarin. Mehr wäre auch schon wieder zu viel gewesen für ihren Geschmack. Denn schließlich standen sie doch mit beiden Beinen in einer Gesellschaft, in der zwar von romantischer Liebe zwischen den Geschlechtern geschwärmt und geträumt wurde, tatsächlich aber harte Konkurrenz und Machtkampf den Alltag regierten. Allzuleicht unterlag das »schwache Geschlecht« und fand sich bald wieder darauf reduziert, zuschauendes, duldendes und höchstens ausführendes Organ zu sein. Hatte frau sich einmal aus dieser Position herausgekämpft, so durfte sie doch niemals vergessen, wie klein das Inselchen nur war, auf dem sie stand. Ein kleiner Schritt zurück, eine winzige Nachlässigkeit, und sie fiel wieder ins Wasser. Und auch die Männer, die diesen holprigen Pfad teilten, weil sie neugierig waren oder abenteuerlustig oder einfach nur sachlich und auf Kompetenz schauten, statt auf Geschlecht, oder auf Gefühl bauten statt auf Ressentiment, diese begehrten Ausnahmemänner konnten so schnell rückfällig werden. Auch bei ihnen mußte man immer wachsam sein. Sehr anstrengend. Die Versuchung war groß, bei ihnen alle Vorsicht zu vergessen. Und damit das größte Risiko einzugehen, wieder in den Bach zu fallen, dort wo er am tiefsten war.
Izabela Dudek hatte dieses Problem anders für sich gelöst. Sie war eine Frau, die ihren Weg ganz allein und selbständig ging und ihre verantwortungsvolle Position als stellvertretende Rektorin am Gymnasium mit der größten Selbstverständlichkeit und Routine ausfüllte. Für ihre Gäste gab es trotzdem jeden Tag ein frisch zubereitetes, üppiges Essen mit Suppe, Salat und saftigen Bratenstücken. Zum Frühstück stellte sie ihrem Besuch frische Brötchen, Aufschnitt und Käse hin, und zum Tee gab es selbst eingekochte, süße Fruchtkonfitüren.
Am Abend nach der Fronleichnamsprozession schien die kleine Wohnung am Wojciecha Park aus allen Nähten zu platzen. Bis in die Nacht hinein produzierte Izabela am laufenden Meter Schnittchen und setzte immer wieder aufs neue den Teekessel auf für immer neuen Besuch. Freunde, Nachbarn, Neugierige, dazwischen Anrufe von Kollegen oder Kolleginnen, Eltern von Schülern, Schülerinnen. Izabela blieb die Ruhe selbst, ja, sie schien mit wachsender Unruhe um sich herum erst in ihre eigentliche, gemütvolle Mitte zu rutschen. Marie und Tomkin fanden sich irgendwann kurz vor Mitternacht in den entgegengesetzten Winkeln des Wohnzimmers wieder, zwischen sich etliche leere Stühle, auf denen Tassen und Kuchenteller abgestellt worden waren, der Eßtisch war mit Papieren und Zeitungen überhäuft. Izabela wirtschaftete in der Küche und hatte sich wie üblich jede Unterstützung verbeten. Der Fernseher lief auf voller Lautstärke, es wurden noch die letzten Nachrichten abgewartet, die vielleicht Neuigkeiten über den schrecklichen Todessturz vor dem Kloster liefern konnten. Wieder und wieder war der Fall mit den verschiedenen Gästen durchgesprochen worden. Jeder hatte Izabelas Meinung dazu wissen wollen: ihre Freundinnen Helena und Janina, der Hausmeister aus dem Gymnasium, Konrad Baginska und seine Frau, die Izabelas Nachbarn waren und nur rasch auf ein Gläschen Eierlikör herübergekommen waren, um dann bis kurz nach elf Uhr zu bleiben. Klara Erdmann und Urszula Grabowski, die beiden Restauratorinnen, waren auch da und Marek, der Zahnarzt, ein guter Freund von Izabela. Und als sie alle endlich fort waren, hatte noch einmal das Telefon geklingelt.
»Ich muß noch einmal kurz weg, ihr Lieben. Bitte, geht ruhig schon ins Bett. Ich bin ganz leise, wenn ich zurückkomme.«
Izabela sammelte in rasendem Tempo die letzten Tassen und Teller ein, stellte den vollen Aschenbecher auf den Balkon, verstaute die Eierlikörflasche in einer Vitrine über der Couch. Dem Lärm nach zu urteilen, warf sie das Geschirr in der Küche in irgendeine Ecke, band sich auf dem Weg ins Bad die Schürze ab und rief dabei in Richtung Wohnzimmer: »Bitte laßt unbedingt das Geschirr stehen, ich spüle es später ab.«
Tomkin sah mit skeptischer Miene auf seine Armbanduhr und grinste dann Marie an. Die gähnte und stellte sich in die offene Badezimmertür.
»Izabela, es ist nach Mitternacht. Wo willst du jetzt noch hin?«
Izabela zog Marie ins Bad und schloß leise die Tür.
»Gerade hat der Propst angerufen. Er will mich unbedingt noch heute sprechen. Er wartet unten im Wagen auf mich.« Sie flüsterte und bürstete sich dabei die kurzen, blonden Haare, als wäre dadurch noch irgend etwas zu retten. Dann warf sie die Bürste ins Waschbecken. »Ich bin gleich zurück, Marie, meine Liebe, geht bitte ins Bett und macht euch keine Gedanken. Dieser Todesfall kann unsere Stadt völlig durcheinanderbringen, wenn wir nicht aufpassen. Weißt du, die Lage ist so unstabil, es ist so schwer für die Menschen, hier zu leben, durchzuhalten in dieser Ungewißheit. Da genügt ein Tropfen, damit das Faß überläuft. Die Tote ist übrigens eine Deutsche.«
Marie Maas zog überrascht die Augenbrauen in die Höhe.
»Wie kommt die hierher?«
»Das weiß ich noch nicht. Sie hat mitgeholfen, die Kirche zu restaurieren. Ich werde dir alles erzählen, was ich herauskriege, Marie. Später, ja?«
Marie Maas ging unschlüssig zurück zu Tomkin ins Wohnzimmer und beobachtete vom Fenster aus, wie Izabela in einen dunklen Pkw stieg, der langsam davonfuhr in Richtung Stadtgrenze. Sie drehte sich um und lehnte sich an die Fensterbank.
»Was liest du da?« fragte sie.
Tomkin hielt den Buchrücken hoch, so daß sie den Titel entziffern konnte.
»Der Prag-Führer«, las sie laut.
»Mhmh. Morgen ist Freitag.«
»Heute. Seit einer Viertelstunde.«
»Also fahren wir morgen nach Prag.«
»Samstag schon?«
»Hatten wir das nicht so vereinbart, Schatz?«
Marie hockte sich auf eine Stuhlkante. Ob sie einfach ins Bett gehen sollte? Oder lieber doch auf die Tante warten?
»Oder erinnerst du dich nicht daran?« erkundigte sich Tomkin beharrlich.
»Aber ja«, sagte Marie. »Ich erinnere mich genau. Wir wollen noch nach Prag und nach Wien und dann in Österreich ein paar Tage Badeurlaub machen.«
»Richtig.«
»Aber von Samstag war nie die Rede. Es ist auch noch ziemlich kalt. Zum Baden, meine ich.«
Tomkin sah auf.
»Und was soll das heißen?«
»Nichts. Gar nichts!« Marie Maas schüttelte den Kopf.
»Außerdem konnte ich ja nicht ahnen, daß Polen so ein
spannendes Land ist.«
Tomkin versenkte sich mit eisiger Miene wieder in den Prag-Führer.
»Ich jedenfalls werde am Samstag nach Prag fahren.«
3
Schwester Jadwiga hatte es in ihrem ganzen siebenundsechzigjährigen Leben noch nie an Bekreuzigungen fehlen lassen, aber heute morgen konnte sie wirklich gar nicht wieder damit aufhören. Jedesmal, wenn sie an dem unglückseligen Zimmer vorbeiging, riß es ihr die Arme hoch, sie mußte die Hände vors Gesicht schlagen und die Fäuste auf die Augen pressen, als könnte sie die Tränen so in die Augenhöhlen zurückbannen. Dann schlug sie sich mit der Faust gegen das Brustbein und ließ den schmerzhaften Schlag in einer innigen Bekreuzigung auslaufen, seufzend, nun doch wieder weinend, alternd vor Kummer, und das, obwohl sie meinte, doch schon genug Elend und Katastrophen erlebt zu haben. Wie schwer trug sie heute morgen an ihrem Wischeimer. Schwer wie Blei war ihr der Schrubber. Der Stiel schien am Boden festgenagelt zu sein wie ihr liebster Herr Jesus ans Kreuz. Und während sie den langen Flur des Dormitoriums wischte, unter den schönen, verglasten Passionsbildern entlang, die ehemals in der Kathedrale gehangen hatten, ehe um die Jahrhundertwende die neuen, größeren Plastiken des Leidensweges des Herren geschnitzt wurden, liefen ihr wieder die Tränen über die Wangen.
»Unergründlich sind deine Wege, o Herr. Und wir werden sie alle wiedersehen, unsere Lieben, im Himmel«, flüsterte sie hastig. Ihre kleinen braunen Augen schossen zur Decke, das winzige Mausgesicht wandte sich dem Himmel zu, dorthin jedenfalls, wo er sich befinden mußte. Dann faltete sie rasch die betenden Hände um den Schrubberstiel. So getröstet, wischte sie die Tränen mit der Schürze ihres grauen Leinenkleides ab und nahm ihre schwere Arbeit wieder auf. Sämtliche Flure waren heute dran, dazu vier Maschinen Weißwäsche, Flickarbeit, und alle Handtücher bügeln und forträumen, die sie am Mittwoch gewaschen hatte. Jeden Mittwoch wechselte sie bei allen sieben Priestern und bei Bruder Adam die Handtücher und alle zwei Wochen samstags die Bettwäsche. Dazu wusch sie zum Teil ihre zivile Wäsche – die Unterwäsche und eigentlich alles, was sie auf der Haut trugen, reinigten die Herren selbst, das war Vorschrift. Aber es hatte sich so eingeschlichen, daß sie sich um die Hosen kümmerte und meist auch um die Hemden und Pullover und natürlich um die Soutanen, wenn es nötig wurde. Auch die Schärpen und Skapuliere der Meßgewänder verstand nur sie richtig herzurichten, fein gestärkt und gebügelt und die Stickereien ausgebessert. Hier stieß sie schon fast an die Aufgaben der heiligen Frauen nebenan, Dominikanerinnen, die für die gesamte Ausstattung der Kirche und der Messe, den Blumenschmuck, die Reinhaltung der Altäre und so weiter zuständig waren. Nur durften die nicht Hand an die geistlichen Herren legen, die ja schließlich Männer waren. Gar nicht so einfach, all diese delikaten Dinge auseinander zu halten. Andererseits konnten die Brüder sich auch nicht ganz allein versorgen, welcher Mann konnte das schon? Also hatte man sie als Laienschwester hier eingegliedert, hatte ihr Dinge erlaubt und zugemutet, die nicht einmal den Klosterbrüdern untereinander erlaubt waren, geschweige denn irgendwem von draußen. Nur sie, Schwester Jadwiga, hatte Generalvollmacht. Sie war die Königin hier, insgeheim. Dafür mußte sie auch alle Tage, jahraus, jahrein, bis zu ihrem jüngsten Tag hier arbeiten. Und konnte noch dankbar sein dafür.
Endlich war sie am Ende des langen Flures angekommen und trug den Eimer mit dem Schmutzwasser zurück, vorbei an dem Ort des Schreckens, hastig ins Bad stürzend, den Eimer entleerend und bereit und übervoll für ein neues Gebet und eine neue Klage.
»Herr, du hast sie uns gegeben, du hast sie uns auch wieder genommen! Was war sie für ein junges schönes Kind!«
Erst als sie Pater Mariusz über den Flur zum Bad schlurfen hörte auf einem verspäteten Toilettengang, fand sie die Kraft, sich aufzuraffen und in ihr Bügelzimmer neben dem versiegelten Unglücksraum zu gehen. Dort wartete sie still ab, bis Pater Mariusz das Bad wieder verließ und sie ihre Arbeiten fortsetzen konnte.
4
»Es geht das Gerücht, Pater Superior, daß in Ihrem Hause Frauen verkehren. Sogar auf der Klausurstation. Ist das wahr?«
Der Propst schlug die Beine übereinander und lehnte sich im Stuhl zurück. Dann sah er den Vorgesetzten an und nickte.
»Das ist wahr, Pater Provinzial. Das heißt, es war wahr. Aber es handelte sich nicht um Frauen, sondern nur um eine einzige Frau.«
»Und diese Frau ist tot.«
Der Propst senkte den Kopf.
»Wie konnte das passieren, Pater Superior? Können Sie mir das erklären? Können Sie mir eine Rechtfertigung liefern, warum Sie unserer heiligen Kirche, unserem Orden, den Ihnen überantworteten Mitbrüdern und nicht zuletzt auch sich selbst diesen ungeheuren Schaden zugefügt haben? Sind Sie sich des Ausmaßes des Schadens überhaupt bewußt?«
Der Propst neigte ganz leicht den Kopf zur Seite. Seine Miene war steinern. Wenn er etwas in seinem Leben zu beherrschen gelernt hatte, dann waren es seine Gesichtszüge. In Stunden und Stunden und Stunden an Exerzitien. Nur sein linker Fuß zuckte ganz leicht unter der Soutane und begann unwillkürlich zu wippen. Er stoppte ihn rigoros. Die Stimme des Provinzials steigerte sich langsam in ein Crescendo. Der hohe Ordensgeistliche war bekannt für seinen Jähzorn sowie für den übermäßigen Genuß von verschiedenen Feuerwässerchen, mit denen er versuchte, seine Gemütsruhe wieder herzustellen, was oft genug in komaähnlicher Betrunkenheit endete. Lange würde er seine Position hier in Wroclaw nicht mehr halten können. Genau der richtige Posten für einen jungen, vielversprechenden Klostervorsteher, wie Propst Antoni es nun seit fünf Jahren in Klodzko war. Für den Augenblick aber mußte er dem Provinzial recht geben. Er hatte großes Pech gehabt, und der Provinzial durfte zornig auf ihn sein wie ein Grislybär und zeigen, daß er seinen jüngeren Untergebenen in der Hand hatte. Der Propst gab seiner Miene eine reumütige Färbung.
Der Provinzial schwieg, räusperte sich und blätterte mit spitzen Fingern in den Unterlagen, die vor ihm auf dem Tisch lagen. Sein Amtszimmer war mit den üblichen einfachen Holzmöbeln ausgestattet, wie sie auch in anderen polnischen Amtszimmern noch aus den Zeiten des Sozialismus gang und gäbe waren. Der Raum selbst jedoch, gelegen im altehrwürdigen Jesuitenkonvent an der Oder, errichtet in Blütezeiten des Ordens, war überreich ausgestattet mit Stukkaturen und kostbarer Täfelung und vor allem mit Blick auf den Fluß und die Türme von St. Maria auf dem Sande, der Lieblingskirche des Propstes in dieser Stadt, in der er selbst schon einmal sechs Jahre gelebt und gearbeitet hatte. Ein paar hübsche Edelholzstühle mit roten Ledersitzen standen für Besucher an der Wand aufgereiht, das war alles, was an Mobiliar aus besseren Zeiten übrig war. Der kostbare Wandschmuck war natürlich durch eines der standardisierten Papstporträts in billigstem Holzrahmen ergänzt worden. Das runde, helle Gesicht von Johannes II. lächelte gutmütig hinter der rotwangigen, aufgedunsenen Maske des erregten Provinzials.
»Es geht ferner das Gerücht, Pater Superior, daß Sie« – der Provinzial zögerte, sah aber nicht auf –, »daß Sie Beziehungen zu Damen unterhalten.«
Er unterbrach sich, ließ aber keinen Zweifel daran, daß er durchaus noch weiteres Material zu bieten hatte. Der Propst nahm die reuige Miene wieder zurück und erstarrte in abweisender Höflichkeit.
»Sie schweigen, Pater Superior?«
»In diesem Fall, Pater Provinzial, handelt es sich tatsächlich nur um ein Gerücht.«
Die beiden Männer saßen sich schweigend einen Augenblick gegenüber. Das Gesicht des Propstes hatte sich vollständig zugezogen, als hätte er eiserne Rollos heruntergelassen. Keine Unsicherheit, kein Lächeln, keine Trauer. Seit fast fünfundzwanzig Jahren, seit seinem achtzehnten Lebensjahr, lebte er im Kloster. Er hatte die zehnjährige theologische Ausbildung der Jesuiten absolviert, er hatte fünfzehn Jahre Berufserfahrung, er war kein grüner Junge mehr, kein Novize, den man zurechtweisen konnte wegen eines billigen Verdachts. Er war vielmehr ein hochrangiger und hochgeachteter kirchlicher Beamter, Priester, Seelsorger und Verwaltungsfachmann. Er führte das Kloster und die Stadtpfarrei in Klodzko mit ihren vier aktiven Pfarrern, drei emeritierten Geistlichen, einem Klosterbruder und mehreren Laien als Angestellten, ohne daß jemals etwas fehlgegangen wäre. Daß er eine Frau auf der Klausurstation der Priester untergebracht hatte, weil die anderen Gästezimmer des Hauses von den Handwerkern belegt waren, die wegen der Renovierungsarbeiten in der Kirche dort untergebracht waren, war ein Verstoß gegen die Klosterordnung, aber kein so schweres Vergehen, daß es irgendeine Rüge rechtfertigte. Wenn ihm etwas verziehen werden mußte, dann konnte das allein in der heiligen Beichte geschehen. Das wußte der Provinzial sehr wohl. Er versuchte nur die Schelte, die er selbst nach den letzten Zeitungsberichten bekommen haben mußte, nach unten weiterzugeben.
»Gehen Sie, Gott sei mit Ihnen, Pater Superior«, sagte der Provinzial und winkte dem Propst zu, als würde er eine Fliege von seinem Schreibtisch scheuchen. Er hatte keine rechte Genugtuung gefunden. »Wir hören voneinander.«
5
Am Freitagmorgen hatte sich ein finsterer Wolkenberg über dem Kessel, in dem das Städtchen lag, zusammengezogen. Kein Wind rührte sich, und man bekam den Eindruck, eingeschlossen zu sein zwischen den malerischen Hängen der Gebirgsketten. Das Adlergebirge lag plötzlich schwarz wie Tinte am Horizont, den man von Izabelas Fenstern aus fast rund um die Stadt betrachten konnte. Und die Bardoer Berge lagen in einem dunstigen Nebel – dort regnete es wohl schon.
Tomkin stand noch immer im Pyjama mit seiner Kaffeetasse am Fenster, als Marie Maas sich vor dem Garderobenspiegel anzog und dreimal den Regenschirm aus dem Ständer nahm, um ihn jedesmal wieder wegzustellen.
»In Hamburg würde ich sagen, es wird sicher regnen, aber hier ...«
»In London würde es auch regnen«, sagte Tomkin. »Aber hier ist Kontinentalklima. Außerdem liegen wir in einem Kessel. Eigentlich hatte ich ja heute mit dir nach Duszniki oder Kudowa fahren wollen, um in Heuscheuergebirge ein bißchen zu wandern, aber ...«
»... das hat bei dem Wetter bestimmt keinen Zweck, Tomkin. Außerdem habe ich mit Izabela verabredet, daß ich sie von der Arbeit abhole und wir dann zusammen auf den Markt gehen. Es soll frische Blaubeeren geben, und Izabela macht für uns heute abend Piroggen.«
Tomkin legte den Kopf abwägend auf die Seite und trat wieder ans Fenster, als Marie Maas die Tür ins Schloß warf. Piroggen waren natürlich eine Entschädigung. Aber daß die Kommissarin sich einen ganzen Tag lang damit aufhielt, das Essen zu organisieren, war doch sehr ungewöhnlich. Es war eigentlich gar nicht vorstellbar.
Marie Maas schritt eilig durch die Parkanlagen vor den Hochhäusern, überquerte die Ausfahrtsstraße nach Nowa Ruda und ging weiter durch die Grünanlagen unterhalb der Festung, zu deren Füßen die Altstadt mit der Kathedrale in ihrem Mittelpunkt lag. Bis Izabela mit dem Unterricht fertig war, hatte sie noch eine halbe Stunde Zeit, und die wollte sie nutzen, um sich noch einmal in Ruhe die Kirche von innen anzusehen. Sie war an ihrem ersten Tag in der Stadt schon einmal dort gewesen, hatte aber wegen der Bauarbeiten nicht viel wahrgenommen. Ihr Interesse galt vor allem der berühmten barocken Ausstattung der Kathedrale, und die war zum Teil noch verhängt, zum Teil demontiert, um in Spezialwerkstätten repariert und restauriert zu werden.
Schon im Windfang vor dem Seitenportal, das in einem kleinen, dem Kirchenschiff vorgelagerten Anbau lag, stieß die Kommissarin mit zwei Maurern zusammen, die einen schweren Zementkübel schleppten. Das Seitenportal stand offen, und dahinter erhob sich im matten Dämmerlicht die riesige, hohe Kathedrale.
Marie Maas ging auf leisen Sohlen bis zum Mittelgang und dann ein paar Meter weiter nach vorn, wo die Bankreihen sauber und nicht mehr von Gerüstpfeilern versperrt waren. Das schabende Geräusch der Malerspachtel hallte fremd und aufdringlich durch den Raum. Dazu ertönten hin und wieder Stimmen, die wie im Gebirge von sehr fern, sehr hoch oder auch sehr nah kommen konnten, es war nicht auszumachen. Trotzdem wagte die Kommissarin nicht, sich anders als andächtig und still zu bewegen, und ließ sich wie immer in Kirchen vorsichtig und zaghaft auf eine Bank gleiten. Das Presbyterium mit dem mächtigen, bis zur Decke reichenden Altar war bereits fertig renoviert und strahlte im Glanz seiner neuen Vergoldungen. Die Deckenfresken waren in zu grellen Farben nachgezeichnet, die mit den Jahren verblassen und damit wieder an Ausdruckskraft gewinnen würden. Lebensgroße geschnitzte Figuren wiesen rechts und links des Altars mit ausgestrecktem Arm auf den Schatz der Kirche, die kostbare frühgotische Marienfigur mit dem Jesuskind, die von einem barocken Strahlenkranz umgeben zwischen Säulen und unter einem Baldachin wie in einem Schrein ausgestellt war. Warm und freundlich fiel hier das trübe Vormittagslicht durch die seitlichen Fenster und brach sich tausendfach im Glitzer und Glanz der Verzierungen.
Marie Maas wandte sich um. Hinter dem Presbyterium wurde es dunkler, und im hinteren Teil der Kirche waren sogar Lampen angeschaltet, damit die notwendigen Arbeiten ausgeführt werden konnten. Von hier aus sah das Mittelschiff aus wie ein enger Tunnel, links und rechts flankiert von den Seitenschiffen bzw. -tunneln. An jedem Pfeiler waren Seitenaltäre aufgebaut, geschmückt mit geschnitzten, überlebensgroßen Figuren und biblischen Darstellungen. Insgesamt zwölf Altäre und Figurengruppen zählte die Kommissarin. Und im Mittelpunkt des Kirchenschiffs dort in der Höhe, fast unter der über zwanzig Meter hohen Decke: die Orgel. Geteilt in zwei Hälften, die zur Rechten und Linken eines schlichten Fensters aufgebaut waren, mächtig vorragend mit ihren Pfeifenwerken, auf denen ganz hoch oben wieder wundervoll geschnitzte Figurengruppen, Engel mit Harfen und Gamben, montiert waren. Darunter, rechts und links vom Hauptportal, das den Mittelgang abschloß, standen die Beichtstühle. Zehn Stück, in zwei Fünfergruppen aufgeteilt, geschnitzt aus dunkler Eiche. Eine düster drohende, aber prachtvoll gearbeitete Demonstration kirchlicher Macht und überirdischer Herrschaft.
Selbst die Verunstaltung durch das bis unter die Decke geführte hölzerne Gerüst konnte den imposanten Eindruck der Kathedrale nicht schmälern.
Nach und nach entdeckte die Kommissarin hier und dort Menschen auf dem Gerüst. Ein dicker, kleiner Mann lief aufgeregt unten zwischen den Bänken herum, den Blick nach oben unter die Decke gerichtet, und rief mit voller Stimmkraft auf polnisch Anordnungen und Befehle hinauf, deren Entgegnungen er dann offenbar nicht verstand. Er quittierte immer wieder mit einem lauten, scharfen »Co?«, das wie ein Peitschenhieb durch die Gewölbe hallte.