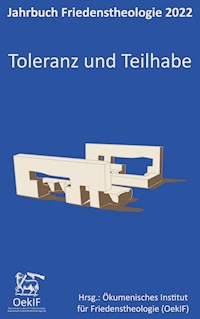
Toleranz und Teilhabe E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: edition pace
- Sprache: Deutsch
Mit diesem Jahrbuch für Friedenstheologie 2022 wird die gesamte Breite der am Ökumenischen Institut für Friedenstheologie vertretenen Forschung sichtbar. Verbindend ist die Fundierung der Friedenstheologie in pazifistischer Perspektive. Jahresthema ist "Toleranz und Teilhabe". Weitere theologische Beiträge und Rezensionen ergänzen den Band.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben von Matthias-W. Engelke – Stefan Federbusch OFM – Gottfried Orth – Michael Schober Stefan Silber
Inhalt
Editorial
Matthias-W. Engelke, Stefan Federbusch OFM, Gottfried Orth, Michael Schober, Stefan Silber
Toleranz und Teilhabe
H
AMIDEH
M
OHAGHEGHI
Geglückte und verwehrte Teilhabe in unserer Gesellschaft
M
ATTHIAS
-W. E
NGELKE
Die unbändige Barmherzigkeit
S
TEFAN
F
EDERBUSCH
OFM
Von der Kugel zum Polyeder – Päpstliche Geometrie für Toleranz und Teilhabe
U
LRICH
FREY
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“ (Röm 12,21)
– Die ultima ratio militärischer Gewalt und die Abschreckung mit Massenvernichtungsmitteln als Problem von Toleranz und Teilhabe – eine friedenstheologische Gedankenskizze
T
HOMAS
N
AUERTH
„daß niemand von seiner Religion Schaden haben darf“ –
Religiöse Toleranz im Jahr 1516? Ein Bericht aus Utopia
M
ICHAEL
S
CHOBER
Toleranz, die auf Teilhabe ausgerichtet ist.Aus dem interreligiösen Dialog lernen
S
TEFAN
S
ILBER
Auf der Suche nach einem anderen Wir. Postkolonialtheologische Anfragen an Toleranz und Teilhabe
ANJA V
OLLENDORF
Vertrauenskrisen als Herausforderung für den Frieden
J
OHANNES
W
EISSINGER
Schlag nach beim Rabbi! Die Kommentare zum Pentateuch und zu den Psalmen von Samson Raphael Hirsch
Beiträge zur Friedenstheologie
PETER B
ÜRGER
„Schwule Priesterpaare am NATO-Altar sind auch keine Lösung“
– Zur Kritik der bürgerlichen Wohlfühl-
Kirchenreform im Licht weltkirchlicher Widersprüche
M
ATTHIAS
-W. E
NGELKE
/FRANZ-JOSEF J
ANNICKI
SVD
Radulfus Niger – Kreuzzugskritik
KAREN H
INRICHS
Das Friedensinstitut Freiburg. Ein Beitrag zur nachhaltigen Stärkung der Friedensbildung
G
ERARD
M
INNAARD
Friedensort Woltersburger Mühle
G
OTTFRIED
ORTH
Wertschätzung – Anregungen, über die Basis von Verständigung nachzudenken
T
HEODOR
Z
IEGLER
Für eine Weiterentwicklung evangelischer Friedensethik
Projekte
Kirche und Weltkrieg Editionsprojekt – Quellen – Forschung
Rezensionen
U
LRICH
F
REY
Wilhelm Wille: Sie sagen Frieden, Frieden … Zwanzig Jahre Forum Friedensethik in der Evangelischen Landeskirche in Baden
G
OTTFRIED
O
RTH
Stefanie Wahl, Stefan Silber, Thomas Nauerth (Hrsg.): Gewaltfreie Zukunft? Gewaltfreiheit konkret! Ethische und theologische Impulse. Dokumentation des pax Christi-Kongresses 2019
M
ICHAEL
S
CHOBER
Franz Hübner: Mein Gott, dein Gott, unser Gott – Illustriert von Guliano Ferri
S
TEFAN
S
ILBER
Cristina Yurena Zerr, Jakob Frühmann (Hrsg.): Brot und Gesetze brechen. Christlicher Antimilitarismus auf der Anklagebank
S
TEFAN
S
ILBER
Judith Butler: Die Macht der Gewaltlosigkeit. Über das Ethische im Politischen
Statt eines Nachwortes
C
EYLAN
S
ERT
/F
EE
B
REMBECK
„… sie haben nicht ihr Haar, sondern einfach ihre Herzen verschleiert!“
Da pacem cordium / Salam aleikum
Autorinnen und Autoren
Editorial
Jahrbuch Friedenstheologie 2022: Toleranz und Teilhabe
Matthias-W. Engelke, Stefan Federbusch OFM, Gottfried Orth, Michael Schober, Stefan Silber
Die erfreulich positive Resonanz, die unser Lesebuch „Was ist Friedenstheologie?“ gefunden hat, hat Mitglieder unseres noch jungen Instituts ermutigt, sich an eine jährliche Publikation zu wagen, die sich an diesem Vorbild orientiert.
Wie im Lesebuch soll auch in unserm Ihnen nun vorliegenden „Jahrbuch Friedenstheologie“ die gesamte Breite der am Institut vertretenen Forschung sichtbar werden. Was uns eint, ist die Fundierung der Friedenstheologie in pazifistischer Perspektive und das Anliegen, diese Positionen, die an das Zeugnis der ersten Christ*innen anknüpfen, einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Neu ist das jeweilige Schwerpunktthema des Jahrbuchs – in diesem Jahr „Toleranz und Teilhabe“. Neben dem Schwerpunktthema gibt es einen Bereich mit freien Texten und einen für Rezensionen. Des Weiteren haben wir – wie bereits im Lesebuch – Raum gelassen, für lyrische und visuelle Unterbrechungen.
Mit dem Schwerpunktthema, das wir im Kontext der Debatte um eine „Gesellschaft der Vielfalt“ verorten, ist die Aussage verbunden, dass wir den interreligiösen Dialog als einen wichtigen Bestandteil der Friedensarbeit sehen. So freuen wir uns besonders, dass wir die seit Jahrzehnten im christlich-islamischen Dialog aktive muslimische Theologin Dr. Hamideh MOHAGHEGHI für einen Gastbeitrag gewinnen konnten, der unseren Band eröffnet. Gleichzeitig kann sie aus der Perspektive einer Frau mit Migrationshintergrund schreiben – eine für unser Schwerpunktthema unabdingbare Perspektive. In diesem Rahmen analysiert sie die gesellschaftliche Situation in unserm Land im Hinblick auf geglückte und verwehrte Teilhabe für Musliminnen und Muslime.
Wie im Lesebuch sind auch im Jahrbuch innerhalb der Bereiche die Artikel alphabetisch nach den Namen der Autor:innen angeordnet. Dies entspricht dem kollegialen Verständnis am Institut, das Erfahrenen und Neu-Publizierenden, bekannten und bisher noch nicht angemessen wahrgenommenen Forschenden einen Rahmen bieten möchte.
Matthias-W. ENGELKE ruft uns dabei die Außerordentlichkeit der Barmherzigkeit im Zeugnis Jesu in Erinnerung, die sich gegen jede Form von Exklusion wendet.
Stefan FEDERBUSCH OFM untersucht das jüngste Lehrschreiben von Papst Franziskus „Fratelli tutti“ auf seine Implikationen hinsichtlich von Toleranz und Teilhabe.
Ulrich FREY lotet die Grenzen von Toleranz bezogen auf die Debatte um atomare Abschreckung aus.
Thomas NAUERTH erschließt beispielhaft das reichhaltige Erbe hinsichtlich der Toleranz-Debatte im Humanismus der frühen Neuzeit, in dem er eine spannende „relecture“ von Thomas Morus‘ „Utopia“ vornimmt.
Michael SCHOBER nähert sich dem Spannungsfeld von „Toleranz und Teilhabe“ aus der Perspektive des interreligiösen Dialogs und dessen Beitrags zu einer Gesellschaft der Vielfalt.
Stefan SILBER bringt eine Sicht des globalen Südens in die Debatte um „Toleranz und Teilhabe“ ein, in dem er für einen differenzsensiblen „Wir-Begriff“ plädiert, der Geschöpflichkeit immer auch als „Mit-Geschöpflichkeit“ sieht.
Anja VOLLENDORF thematisiert den Umgang mit Intoleranz in einer Gesellschaft, die Toleranz und Teilhabe ermöglichen möchte.
Johannes WEISSINGER stößt auf inspirierende Entdeckungen in der jüdischen Theologie des 19. Jahrhunderts, was den Toleranzbegriff angeht.
Im freien Teil vervollständigen die folgenden Beiträge unser Jahrbuch:
Peter BÜRGER gibt uns eine aktuelle kirchenkritische Analyse und mahnt uns, Wesentliches nicht aus dem Blick zu verlieren.
Matthias-W. ENGELKE stellt uns erstmalig in deutscher Übersetzung von Franz-Josef JANNICKI SVD die Thesen des Radolfus Niger zu einer zeitgenössischen Kreuzzugskritik vor.
Karen HINRICHS stellt mit dem neu gegründeten Friedensinstitut in Freiburg eine wichtige friedenstheologische Schnittstelle vor.
Gerard MINNAARD gibt uns einen Eindruck von der langjährigen Tradition der Friedensarbeit am Friedensort Woltersburger Mühle.
Gottfried ORTH erörtert die grundlegende Bedeutung von Wertschätzung, die niemals auf Exklusion zielen darf, sondern Verwandlung ermöglichen soll.
Theodor ZIEGLER analysiert aktuelle Debatten in der evangelischen Friedensethik ausgehend von der Initiative „Sicherheit neu denken“.
Für die folgenden Jahrbücher haben wir drei Desiderate:
Wir wollen unsere Anstrengungen verstärken, Frauen als Herausgeberinnen und Autorinnen zu gewinnen.
Wir wollen zusätzlich die Stimmen des Judentums und anderer Religionen einbeziehen.
Wir wollen, dass in den Jahrbüchern die Zeug:innen der gewaltfreien Revolution 1989 verstärkt zu Wort kommen.
Um dies zu ermöglichen, benennen wir bereits jetzt das Schwerpunktthema des Jahrbuches 2023: „Vom Hineinreichen einer anderen Herrschaft: ‚Dein Reich komme‘ – Die Reich-Gottes-Botschaft in Theologie und Politik“.
So bleibt uns nun nur noch, Ihnen eine gute Lektüre dieses Bandes zu wünschen. Schön wäre es, wenn unsere Beiträge für friedenstheologische Fragestellungen sensibilisieren und zu eigenem friedenstheologischen Engagement ermutigen würden. Entsprechende Handlungsfelder gibt es genug.
Jochaim Bandau: Toleranz – Gleiches Gewicht – Gleichgewicht – Osnabrück 1648-1998 – Fotos: Michael Schober
Toleranz und Teilhabe
Geglückte und verwehrte Teilhabe in unserer Gesellschaft
Hamideh Mohagheghi
Eine Gesellschaft ist in dem Maße ein Spiegelbild der in ihr lebenden Menschen, wie diese an ihrer Gestaltung unabhängig von ihren persönlichen, sozialen, kulturellen und religiösen Hintergründen beteiligt sind und ihre spezifischen Anliegen vorbringen können. Es geht nicht um den Anspruch auf Sonderrechte, sondern darum, die Pluralität anzuerkennen und zu respektieren. Je vielschichtiger eine Gesellschaft ist, umso intensiver sind die Menschen herausgefordert, auf die Besonderheiten der unterschiedlichen Menschengruppen einzugehen und die Gesellschaft so zu gestalten, dass alle Menschen sich dazugehörig fühlen.
Das Gefühl, ein Teil der Gesellschaft zu sein, stärkt wiederum das Bemühen der Menschen, sich um die Belange dieser Gesellschaft zu sorgen und sich für das gute Zusammenleben aktiv einzubringen. Toleranz gegenüber unterschiedlichen Lebensweisen ist ein wichtiger Grundsatz, jedoch darf Toleranz nicht mit Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen verwechselt werden. Es geht darum, die Verschiedenartigkeit der Menschengruppen bewusst wahrzunehmen und bei den Entscheidungen diese Unterschiede zu berücksichtigen. Die Unterschiede können in persönlichen körperlichen und geistigen Handicaps, in kultureller und religiöser Zugehörigkeit sowie sexueller Orientierung begründet sein, in Merkmalen, die zur individuellen Identität von Menschen gehören, die jedoch von ihren Mitmenschen als „andersartig“ empfunden werden und sie angreifbar machen. Menschen mit den genannten Merkmalen gehören in der Regel zu Minderheiten und entsprechen angeblich nicht den Vorstellungen und Bildern der Mehrheit und werden oft als „nicht dazugehörig“ angesehen.
Dies wird durch alltägliche abwertende Bemerkungen durch Teile der Mehrheitsgesellschaft, Darlegungen in den Medien sowie Abwesenheit bzw. Vernachlässigung dieser Gruppen in den politischen und gesellschaftlichen Debatten und Entscheidungen sichtbar. In diesem Beitrag geht es um Identität und Teilhabe der religiösen Minderheiten am Beispiel des Islam und der Musliminnen und Muslime in Deutschland.
Die Postmoderne geht oft davon aus, dass die Religion keine prägende Rolle in den europäischen und westlichen Gesellschaften mehr spielt. Diese Annahme, die empirisch nicht belegbar ist, verleitet dann dazu, Menschen, deren Identität und Selbstwahrnehmung durchaus durch eine Religion geprägt ist, nicht ernst zu nehmen.
RELIGIÖSE VIELFALT – CHANCEN UND GEFAHREN
Die Zugehörigkeit zu einer Religion ist meist eine vererbte Identität, deren erste Bezugsgröße die Familie bzw. Gemeinschaft ist, mit der die ersten Erfahrungen im Leben verbunden sind. Die Musliminnen und Muslime in unserer Gesellschaft sind mehrheitlich Bürgerinnen und Bürger, die aus anderen Kulturen und Gesellschaften immigriert sind. Auch wenn sie über Jahrzehnte hier leben, haben sie ihre Bindung zu den Wurzeln ihrer Herkunft nicht verloren. Das Festhalten an ihren hergebrachten kulturellen und religiösen Überzeugungen und Praktiken hat vielfältige Gründe: Die verwandtschaftliche Beziehung zu Angehörigen, die weiterhin in diesen Ländern leben, ist stark und wird durch regelmäßige Besuche und Kontakte gepflegt.
Das vermittelte Gefühl, dass die Lebensweise der gläubigen Musliminnen und Muslime nicht vereinbar mit den westlichen Werten ist, stärkt das Empfinden, zu einer Minderheit zu gehören, die nicht willkommen ist. Dazu gehört auch das Prinzip, dass der Minderheitenstatus in einer pluralistischen Gesellschaft zu Spannungen mit der Mehrheit führt. Das „Ich“-Gefühl wird durch Abgrenzung gegenüber dem „Anderen“ gestärkt, indem die vertraute Lebensform an Bedeutung gewinnt. Gerade wenn zwei oder mehrere Weltbilder aufeinandertreffen, die nicht in allem übereinstimmend sind, wird der Mensch besonders sensibel und fühlt sich in seinem Selbstverständnis in Frage gestellt bzw. nicht als gleichwertig akzeptiert. Es kann dann eine Zerrissenheit entstehen, die den Menschen herausfordert, seine Identität zwischen verschiedenen Welten und Ansichten zu finden und eine Beziehung zu allen Bezugspunkten zu finden, mit denen er sich identifizieren kann und will.
Damit wird die Identitätsfindung zu einer Strapaze, die Zeit kostet, Geduld erfordert und Kenntnisse über den eigenen Standpunkt und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen braucht. Für manchen ist es dann einfacher, sich zurückzuziehen und sich stärker auf die vertrauten Gewohnheiten und Bräuche zu besinnen. Ausgrenzung und Stigmatisierung können diese Rückbesinnung fördern.
Der Glaube kann in dieser Situation Sicherheit geben und Sinn stiften, wenn der Mensch in einer unübersichtlichen Lage seinen Halt zu verlieren meint. Er dient als Schutzschild und Widerstand gegen das mangelnde Vertrauen und Zugehörigkeitsgefühl, gegen die Anpassungs- und Assimilationsforderungen. Auch wenn die Musliminnen und Muslimen über sechs Jahrzehnte in Deutschland leben, existiert bei einigen, auch unter jungen Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, diese Zerrissenheit. In diesem Land gelten sie immer noch als nicht dazugehörig, weil sie anders aussehen, einer fremden Religion angehören, andere Lebensgewohnheiten haben und ihre äußeren Erscheinungsformen nicht dem üblichen Straßenbild entsprechen. Aber auch im Land, aus dem ihre Eltern und Großeltern stammen, gehören sie oft nicht ganz dazu, da sie weder die Sprache noch die Kultur der sogenannten Heimat ausreichend kennen. Sie schweben zwischen zwei Welten, auch der deutsche Pass kann nicht immer ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln.
Der folgende Satz von einer Ärztin, die hier geboren und aufgewachsen ist und den deutschen Pass besitzt, beschreibt die Situation, in der sich einige Musliminnen und Muslime befinden: „Ich fühle mich nicht als Deutsche, auch nicht als Ägypterin, in erster Linie bin ich Muslimin und dies gibt mir Sicherheit.“ (aus einem persönlichen Gespräch mit einer muslimischen Ärztin in Deutschland).
Diese Haltung zeigt, warum die Religiosität unter den Migrantinnen und Migranten in der jungen Generation wieder an Bedeutung gewinnt. Es ist nicht der Radikalismus oder die Ablehnung der demokratischen und freiheitlichen Werte, wie uns immer wieder vermittelt wird, sondern eine Suche nach Selbstfindung. Das bedeutet, dass wir uns noch im Prozess des Ankommens und des Angenommenwerdens befinden, der nur durch gemeinsames Wollen und Bemühen zu einem erfolgreichen Abschluss gelangen kann.
Die Mobilität und die vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten überwinden Grenzen und lösen diese auf, ermöglichen mediale Kontakte zwischen unterschiedlichen Kulturen und Religionen, vermitteln Bilder und Meinungen über einzelne Gruppen in einer Gesellschaft. Wenn die Kontakte nicht durch reale Begegnungen zwischen Menschen geschehen, können die vermittelten Bilder von diesen Gruppen störend wirken. Wir meinen, viel über die anderen zu wissen, unser Wissen basiert allerdings überwiegend auf Medienberichten und den von diesen vermittelten Bildern. Dies ändert sich auch kaum, wenn die Menschen räumlich nah beieinander leben. Die Ruhelosigkeit unserer Zeit lässt wenig Möglichkeit für nachhaltige und persönliche Begegnungen und tiefes gegenseitiges Kennenlernen. Gerade die vermittelten Bilder und Informationen über den Islam und über Musliminnen und Muslime auf der Welt überschütten und erschüttern unsere Wahrnehmungen von Musliminnen und Muslimen, die hier leben.
Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit haben im Laufe der Geschichte grausame Kriege gegeneinander geführt, und auch heute sind gegenseitige Ablehnung und Anfeindungen vorhanden. Dialoge und Annäherungsversuche in den letzten Jahren haben einiges bewirkt und müssen vertieft und gestärkt werden. Damit das gegenseitige Kennlernen zu Anerkennung und Respekt führt, bedarf es Aktionen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Ein erster effektiver Schritt in diese Richtung und ein fester Bestandteil dieser Bemühungen sollte die interreligiöse Offenheit sein, die allerdings zuerst einer festen Überzeugung im eigenen Glauben sowie kritischer Auseinandersetzung mit ihm bedarf. Das bedeutet, dass der eigene Glaube nicht als die einzige und absolute Wahrheit gesehen werden kann, sondern als eine Wahrheit unter anderen. Erst dann ist es möglich, anderen mit offenen Augen und Herzen zu begegnen und bemüht sein, sie in ihrem eigenen Verständnis zu verstehen und respektieren.
Unsere gemeinsame Verantwortung für eine bessere Welt, eine Welt, in der Gerechtigkeit und Frieden herrscht, sollte die Basis des Zusammenlebens sein. Die Quellen, aus denen die Menschen ihre Kraft dazu schöpfen können, sind unterschiedlich. Das Ziel jedoch kann die Menschen verbinden und ihnen ermöglichen, verbindende und verbindliche Werte und Normen zu entwickeln, die zwar unterschiedlichen Quellen entspringen, aber im Kern ein gemeinsames Ziel haben.
Die Religionen verfügen über das Potenzial, dies zu verwirklichen, sie können aber auch instrumentalisiert und missbraucht werden, um machtpolitische oder ökonomische oder andere Interessen durchzusetzen. Die religiöse Vielfalt birgt in sich Gefahren und Chancen zugleich, es liegt an den Menschen, welches Potenzial sie entfalten und entwickeln wollen.
Die unterschiedlichen Religionen in einer Gesellschaft können sich gegenseitig bereichern und eine Plattform für die Verwirklichung der verbindenden Werte und Normen sein, die für alle Menschen gelten, gleich welchen Geschlechts, welcher sozialen Herkunft, Hautfarbe, Sprache oder Religionszugehörigkeit sie sind. Gegenseitige Bereicherung heißt positive wechselseitige Wirkung, keine Vermischung oder Vereinheitlichung. Dies ist möglich, wenn man sich gemeinsam auf die universellen Rechte bezieht und die individuellen Überzeugungen anerkennt und respektiert. Damit ist nicht die Verdrängung der Religiosität aus der Öffentlichkeit gemeint, denn die freie offene Ausübung von Religiosität ist ein unveräußerliches Menschenrecht.
Nur ein religiös neutrales Rechtssystem kann dieses Recht garantieren und gewähren, und nur ein religiös neutraler Staat kann der Garant dafür sein, dass verschiedene Lebensweisen miteinander in Frieden leben. Vielfalt ist die Realität der Gesellschaften unserer Zeit. Kreativität und Anpassungsfähigkeit sind die Voraussetzungen, die die Beziehungen zwischen den Menschen in solchen Gesellschaften regeln können.
Damit einher geht auch das Hinterfragen der eigenen Position und Angst vor der Selbstaufgabe. Auf dem Weg in die Zukunft ist zu lernen, mit dieser Form der Identitätsfindung umzugehen, um nicht dem eigenen Wesen untreu zu werden. Auf diesem Weg können die Religionen eine unterstützende Kraft sein, die der Mensch besonders in persönlichen und gesellschaftlich kritischen Situationen benötigt. Die Religion ist keine handelnde Person, die Menschen geben der Religion Gestalt, definieren und legen die religiösen Prinzipen und Praktiken fest. Es gibt feste Prinzipien – goldene Regeln und sogenannte (zehn) Gebote -, die in allen Religionen und Weltanschauungen in unterschiedlichen Wortlauten und Prägungen zu finden sind, im Kern aber sind sie Fundamente, auf die menschliche Handlungen begründet sein müssen. Töten und stehlen, Ungerechtigkeit und Feindseligkeit z. B. sind verpönte Taten, die für alle Menschen nicht hinnehmbar sind.
GEMEINSAME ZIELE – VIELFÄLTIGE AKTEUREUNTERSCHIEDLICHE WELTBILDER – TEILHABE DER MUSLIME
„Einheit in Vielfalt“, ein Spruch, der oft zu hören ist und eine Grundhaltung für die Gestaltung der Gesellschaften unserer Zeit sein sollte. In den demokratischen Gesellschaften, die auf Rechtstaatlichkeit aufgebaut sind, ist das gemeinsame Ziel, diese Prinzipien in besten Formen zu gewähren und zu entwickeln. Zu den Prinzipien in Deutschland gehören die Meinungs- und Religionsfreiheit als unveräußerliche Menschenrechte, die auch im Grundgesetz garantiert sind. Das bedeutet, dass die Menschen lernen müssen, mit der Vielfalt der Lebensgestaltungen umzugehen.
Die Bereitschaft zu akzeptieren, dass im Handlungsraum der Gesellschaft Menschen zusammenkommen, die unterschiedliche persönliche Lebensgeschichten und Lebensweisen haben und sich doch für die Gestaltung der Gesellschaft einbringen möchten, ist die Voraussetzung dafür, die Ressourcen und Kompetenzen wertzuschätzen und ihnen Raum zum Handeln zu bieten. Personen auszuschließen, weil sie angeblich nicht in das gesamtgesellschaftliche Bild hineinpassen, bewirkt Verlust von Ressourcen und Potenzialen, die die Gesellschaft für die Entwicklung benötigt. Partizipation und Teilhabe muss der Kompetenz und Absicht der Menschen unterliegen und nicht ihrem Aussehen, ihrer Hautfarbe, religiösen
Orientierung, Geschlechterzugehörigkeit oder einer äußerlichen Erscheinungsform wie Kleidung.
Es ist eine Realität, dass Musliminnen und Muslime in Europa aufgrund ihrer Abstammung durchaus sich auch anderen kulturellen Gewohnheiten zugehörig fühlen und diesen als Maßstab ihrer Lebensweise Gewicht zumessen und zeitweise in den sogenannten „Parallelgesellschaften“ leben, die aber nicht immer als Problem, sondern auch als Chance für konstruktives Leben in Vielfalt betrachtet werden können. Diesen Aspekt beschreibt Navid KERMANI autobiografisch in seinem Buch "Wer ist wir? Deutschland und seine Muslime":
„Gut kann ich mich an den kleinen Grenzverkehr meiner Kindheit erinnern. Auf dem Berg, auf dem wir lebten [in Siegen], war ich, soweit ich es wahrnahm, der einzige Ausländer. Es gab außer meinem Namen und meinen schwarzen Haaren nichts, was mich im Kindergarten oder in der Grundschule, auf der Straße und unter Freunden als Fremden markiert hätte. Sogar mein Deutsch hatte die Melodie und das rollende R unserer Mittelgebirgslandschaft. Wenn ich jedoch nach Hause kam, war es, als ob ich eine Grenze überschritten hätte. Von einem Schritt auf den anderen Schritt wechselte die Sprache, änderten sich meine Verhaltensweisen, folgte ich anderen Benimmregeln und war, ohne es zu reflektieren oder gar als problematisch zu empfinden, umgeben von Formen, Gerüchen, Geräuschen, Menschen und Farben, die es jenseits der Türschwelle nicht gab. Für mich war sie so gewöhnlich wie meine eigene Haut, aber auf meine Freunde übte diese Welt, wenn ich mich nicht täusche, eine Faszination aus, die sich darin äußerte, dass sie in der Regel vorzogen, bei uns zu spielen. Vielleicht war es die Neugier, die das Fremde weckte, vielleicht waren es nur die anderen, für uns Kinder laxeren Gesetze, die in unserer Welt herrschten. Es gab keine verbotenen Räume, keine festgelegten Essenzeiten, keine Eltern, die sich in alles einmischten. […] Ich weiß nicht und habe damals auch nicht darüber nachgedacht, ob die Verhältnisse bei uns typisch persisch waren, aber sie waren anders als bei meinen Freunden, und das spürten diese so gut wie ich. Mit diesem Bewusstsein, dass es drinnen und draußen, jenes und dieses gibt, bin ich großgeworden, und ich habe heute das anmaßende Gefühl, meinen Freunden in dieser Hinsicht etwas vorausgehabt zu haben. […]“1
Und dieses Leben in unterschiedlichen Welten sieht Kermani als Regel:
„Dass Menschen gleichzeitig mit und in verschiedenen Kulturen, Loyalitäten, Identitäten und Sprachen leben können, scheint in Deutschland immer noch Staunen hervorzurufen – dabei ist es kulturgeschichtlich eher die Regel als Ausnahme. […] Parallelgesellschaften sind kein Schreckgespenst, sondern der Modus, durch den es den Minderheiten gelang, einigermaßen unbehelligt zu leben und ihre Kultur und Sprache zu bewahren.“2
Navid Kermani stellt mit seinen Ausführungen fest, dass es eine Reduzierung der Menschen auf einen Aspekt ihres Daseins ist, wenn man sie nur auf ihre Religion, Kultur, Abstammung usw. reduziert.
„Ich bin Muslim, ja – aber ich bin auch vieles anderes. Der Satz ‚Ich bin Muslim‘ wird in dem Augenblick falsch, ja geradezu ideologisch, wo ich mich ausschließlich als Muslim definiere – oder definiert werde. Deshalb stört es mich auch, dass die gesamte Integrationsdebatte sich häufig auf ein Für und Wider des Islams reduziert – als ob die eingewanderten Menschen nichts anderes seien als Musliminnen und Muslime. Damit werden alle anderen Eigenschaften und Faktoren ausgeblendet, die ebenfalls wichtig sind: woher sie stammen, wo sie aufgewachsen sind, wie sie erzogen wurden, was sie gelernt haben.“3
So Navid Kermani, den das Leben in Parallelgesellschaft und Zweisprachlichkeit nicht daran hinderte, ein herausragender deutscher Literaturwissenschaftler zu werden.
Für die meisten Musliminnen und Muslime spielt die Religion eine wichtige Rolle für das tägliche Leben, und damit ist sie auch sichtbar in der Öffentlichkeit. Dies bedeutet für sie jedoch keinen Widerspruch zum Leben und Wirken in einer säkularen Gesellschaft. Auch die Musliminnen und Muslime sind Individuen mit jeweils persönlichen Lebenswegen, die sie dahin führen, wo sie gerade sind. Das sollte man vor Auge haben, wenn man aufgrund der Weltereignisse und der problematischen von Menschen gelebten Erscheinungsformen des Islam in unserer Gesellschaft sich ein bestimmtes Bild vom Islam und von den Musliminnen und Muslime macht, das sehr reduziert und eindimensional sein kann.
Die Musliminnen und Muslime und ihre Religion sind Teil der Gesellschaft, und die Mehrheit möchte aktiv in dieser Gesellschaft mitwirken. In diesem Zusammenhang sind bezüglich der Zukunft der Musliminnen und Muslime in Deutschland einige Fragen offen, die deutlich und ehrlich zu beantworten sind:
Seitens der Musliminnen und Muslime sind die Fragen zu beantworten, ob sie sich dauerhaft in einer Gesellschaft zuhause fühlen können, die nicht in allen Bereichen ihren Wertevorstellungen entspricht; ob sie bereit sind, ihre eigene Lebensweise selbstkritisch zu betrachten und sich von manchen kulturell geprägten Traditionen mit scheinbar religiöser Begründung zu befreien; ob sie den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zustimmen können, die in der Säkularität begründet sind – ohne ihre religiösen Grundprinzipien aufzugeben.
Seitens der deutschen Gesamtgesellschaft sind u. a. die Fragen zu beantworten, ob sie die Musliminnen und Muslime als Teil dieser Gesellschaft annehmen kann, d. h. dass sie nicht nur toleriert und geduldet werden, sondern ihnen als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger dieses Staates auch die gleichen Chancen eingeräumt werden; ob sie die Anwesenheit der Musliminnen und Muslime als eine Chance und eine Bereicherung wahrnimmt oder sie als Bedrohung für die lang erkämpfte Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sieht; ob die praktizierenden Musliminnen und Muslime nach ihrer Kompetenz und nicht nach ihrem Aussehen und ihren äußerlichen Merkmalen beurteilt werden und auch sie die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme in der Gesellschaft haben.
Konkret sind diese Fragen auch an die Politikerinnen und Politiker gestellt, die die Möglichkeit haben – und diese auch nutzen – die Gesellschaft zu sensibilisieren oder die Ängste und das Unbehagen der Menschen für ihre eigenen politischen Interessen zu manipulieren. Die Politik trägt eine große Verantwortung und kann mit ihrer Einstellung und Handlungsweise positive bzw. negative Zeichen setzen. Die religiösen und kulturellen Unterschiede können immer weniger Gründe zur Spaltung und Trennung sein, wenn ihre Existenz in der Gesellschaft als berechtigt und selbstverständlich wahrgenommen wird, dazu kann die Politik aktiv beitragen.
Der Weg in die Zukunft ist: gemeinsam lernen, mit vielfältigen Kulturen und Religionen zusammen auf engem Raum zu leben. Diese Gesellschaftsform bietet Chancen, ist eine Herausforderung für die Identitätsfindung, die mit Ängsten vor einer Selbstaufgabe verbunden ist. Die Religion kann in dieser Situation eine unterstützende Kraft oder auch ein trennendes Element sein, die eine Annäherung der Menschen verhindert; es liegt an uns, wie und für welchen Zweck wir die Religion nutzen.
Literatur
KERMANI, Navid: Wer ist wir? Deutschland und seine Muslime, München 2009.
1 KERMANI: Deutschland und seine Muslime, 9-12.
2 Ebd., 12.
3 Ebd., 19.
Die unbändige Barmherzigkeit
Matthias-W. Engelke
Toleranz hat, folgt man dem grundlegenden Werk von Rainer FORST, „Toleranz im Konflikt“, drei unverzichtbare Bestandteile: Die Ablehnung, die Akzeptanz und die Zurückweisung. Ohne ein Moment der Ablehnung ist es nicht nötig von Toleranz zu sprechen. Auch wenn Verhaltensweisen oder Haltungen abgelehnt werden, werden sie auf Grund moralischer Überlegungen akzeptiert. Entscheidend ist hierbei die Trennung von Ethik und Moral. Was aus ethischen Gründen abgelehnt wird, wird aus moralischen Gründen akzeptiert, z. B. die Beschneidung von neugeborenen Jungen oder das Schächten von Tieren. Diese Akzeptanz hat dort Grenzen, wo die Zurückweisung beginnt. Verschiedene Toleranzbegründungen ziehen andere Grenzen. Forst sichtet die Geschichte des Toleranzbegriffs und systematisiert die Toleranzbegründungen. Diese werden daraufhin befragt, wie gut begründet diese sind, so dass die Grenzziehung nicht willkürlich und/oder eine reine Machtfrage ist. Ihm begegnen dabei vier Typen von Toleranzkonzeptionen: Die Erlaubniskonzeption, die Koexistenz-, die Respekt- und die Wertschätzungskonzeption. Ein Herrscher, der es einer Minderheit erlaubt in seinem Bereich zu leben, wird für sich das Recht in Anspruch nehmen, diese Erlaubnis jederzeit zurücknehmen zu können. Das bindet die Betroffenen an den Herrscher und zwingt diese zur Loyalität. Damit wirkt die Toleranz intolerant und unfrei. Die Grenze, die der Herrscher zieht, ist dabei einzig in ihm verankert, so wie er sie zieht. Entsprechend oft haben Minderheiten in der Geschichte Europas erleben müssen, wie sie darunter zu leiden hatten, jüdische Gemeinden in ganz Europa oder protestantische Gemeinden etwa in Frankreich (Hugenotten).
Forst fragt nach einer Toleranzbegründung, die frei von Willkür und nicht abhängig von Machtfragen ist und sieht sie einzig in einer Respektkonzeption der Toleranz, die auf folgenden drei Kategorien beruht:
das Recht auf und entsprechend die Pflicht zur Rechtfertigung,
die Reziprozität und
die Verallgemeinerbarkeit.
Das Recht auf Rechtfertigung besagt, dass niemand berechtigt ist, auf mein Handeln oder Leben Einfluss zu nehmen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen.
Reziprozität meint inhaltlich: ‚Ich darf für mich nicht in Anspruch nehmen, was ich anderen verweigere‘. Die Reziprozität der Gründe meint: ‚Ich kann anderen meine Gründe nicht unhinterfragt unterstellen‘. Zusätzlich gibt es die Reziprozität der gemeinsamen Begrenztheit: Ich kann keine höheren Wahrheiten o. ä. in Anspruch nehmen, „deren Anerkennung nicht allgemein erwartet werden kann.“ 4 Die Gründe müssen „auf der Basis autonomer und ungehinderter Urteile teilbar“5 sein. "Die Grenze von Reziprozität und Allgemeinheit schützt ethische Personen in ihren Überzeugungen und zugleich schützt sie sie auch vor solchen Überzeugungen anderer."6
Die Verallgemeinerbarkeit fragt danach, welche der Gründe für alle verbindlich gemacht werden können. Hierbei setzt Forst eine „Verantwortungsgemeinschaft“7 voraus, in der die Beteiligten das Recht haben sich einzubringen. Eine Zurückweisung, die religiös begründet ist, mag für eine Gruppe von Menschen und innerhalb ihrer Grenzen praktiziert werden, kann aber nicht darüber hinaus Anspruch auf Geltung beanspruchen, weil die religiösen Voraussetzungen nicht von allen geteilt werden. Dies ist z. B. der Fall, wenn Frauen einer religiösen Gemeinschaft ausgeschlossen werden, weil sie unehelich Kinder zur Welt bringen.
Die Grundlage für das, was verallgemeinerbar verbindlich sein kann, besteht darin, dass dem Menschen Respekt gebührt und dies einzig und allein aus dem Grunde, dass er Mensch ist. Die wechselseitige Anerkennung dieses Respektes bildet die Grundlage für die Toleranzbegründung, die alle drei Komponenten in einer Weise beinhaltet, die frei von Zufälligkeiten und Willkür ist. Das reine Menschsein hat Vorrang. Jede andere Bestimmung des Respekts und der Würde des Menschen würde diesen wieder von anderen Größen abhängig machen und kann dazu führen, den Respekt und die Würde eines Menschen wieder einzuschränken8 . Hier hat Kant den Meilenstein gesetzt. Sein Konzept der autonomen Moral verlässt die vertikale Dimension der Würdebegründung des Menschen, die abhängig ist von der Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Schicht oder von religiösen Vorannahmen – sei es als Gottes Ebenbild oder als Gottes Kind o. ä. – und nimmt allein die horizontale Ebene der Gleichen zu Gleichen ein, die Perspektive der Goldenen Regel Jesu, Mt 7,12. In jedem anderen Fall droht der Mensch ein Mittel zum Zweck zu werden. Die Würde des Menschen ist unbedingt. Sie ist nicht ableitbar und abhängig von irgendwem und irgendetwas. Nur dann gilt sie unbedingt.
Diese Konzeption hat Konsequenzen für Theologie und Kirche. Wollen sie etwas einbringen, das Anspruch auf Verbindlichkeit und Allgemeinheit hat, dann kann es auf keinen anderen Gründen beruhen, als auf denjenigen, die für alle einsehbar und nachvollziehbar sind, auf keinen Fall also religiöse Glaubensgründe. Kirche muss sich also um Anschließbarkeit bemühen, auch wenn sie ansonsten gut daran tut, ihre Unverwechselbarkeit zu betonen.
Was Kirche und Synagoge, jüdische und christliche Gemeinde, christliche und jüdische Verkündigung in besonderer Weise unverwechselbar macht ist Barmherzigkeit. Dies verbindet sie unmittelbar mit allen anderen Glaubensgemeinschaft, in denen Barmherzigkeit geübt wird, insbesondere mit den frühen Suren des Korans (Q 107; 103; 93 und 90).
Das Buch Hosea 6,6 lässt Gott sprechen: „Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer.“9 Matthäus erzählt, Mt 9,13, dass Jesus dies zitiert: „Geht aber hin und lernt, was das heißt: »Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer.«“
An Barmherzigkeit wird weder im Werk von Forst noch bei Kant gedacht. Kant schließt sie geradezu aus seinen Überlegungen aus. Niemand kann, so Kant, dazu verpflichtet werden, das Leid zu vermehren, indem mit einem Freund mitgelitten wird, „dem ich doch nicht abhelfen kann“10. „Der Kritizismus KANTS ließ keinen Raum für „reine L.[iebe]“ oder überhaupt L.[iebe]“ 11 . Das mitmenschliche Phänomen der freiwilligen Hingabe zum Wohle anderer auch ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen ist kein Thema für Kant.
Forst und Kant sind hierbei konsequent. Beiden geht es um das Gefüge von Rechten und Pflichten. Freiwillige Hingabe kann jedoch per Definition nicht verbindlich gemacht werden. Sie ist keine Pflicht und kann nicht zur Pflicht gemacht werden. Sie kann nicht anerzogen und nicht erzwungen werden. Sie geschieht dennoch allenthalben und Menschen hoffen auf sie. Einen rechtlich verbindlichen Anspruch auf das was über Nothilfe oder Erste Hilfe hinaus geht besteht nicht.
Die Bedürftigkeit des Menschen vom Säuglingsalter an zeigt wie sehr der Mensch auf Gemeinschaft angewiesen ist. Erasmus schildert die Schönheit dieser Bedürftigkeit in seiner „Klage von Frau Friede“12.
BEDÜRFTIGKEIT UND BARMHERZIGKEIT
Bedürftigkeit und Barmherzigkeit entsprechen einander in einer Weise, die rechtlich nicht regelbar ist. Sofern der jüdische und christliche Glaube sich darauf verstehen, diese Barmherzigkeit zu leben und für sie einzustehen, entzieht sich dieser Bereich tatsächlich dem Wissen. Sie lässt sich nach den Kategorien der Reflexivität und des Rechtfertigungsanspruchs nicht verallgemeinern und liegt damit jenseits der Gefüge von Rechten und Pflichten. Aber nicht jenseits des Menschen. Barmherzigkeit ist eine dem Menschen mögliche Handlungsweise.
Im Alten wie im Neuen Testament sowie in koranischer Überlieferung wird sie auf Gott zurückgeführt. Lukas lässt Jesus sagen (Lk 6,36): „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ „Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte“, wird in einem Gebet bekannt (Ps 103,8,). Nahezu alle Suren beginnen im Koran mit dem Vorspruch, der wie eine Präambel das Verstehen dessen, was folgt, leitet: „Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.“13 (Koran, 103/Sure 1,1) Die Unverfügbarkeit der Barmherzigkeit korrespondiert mit der hier vorausgesetzten Unverfügbarkeit Gottes. Diese ist inhaltlich eindeutig qualifiziert: als Barmherzigkeit.
Das Wort im Hebräischen bezeichnet zugleich die Gebärmutter bzw. Eingeweide 14 . Es bezeichnet ein Erleben, das mit ‚Zusammenziehen der Eingeweide‘ wiedergegeben werden kann.15 Es hat eine Zeit gegeben, in der Menschen sich in einer Weise von ihren Organen betroffen und gelenkt erlebten, die in der Gegenwart kaum vorstellbar ist.16
Hunger, Zorn, Hass, Furcht und Barmherzigkeit können einen übermannen und zum entsprechenden Handeln treiben. Die Leber, die Niere, das Herz, die Lunge hatten ihre begrenzte Autonomie und Menschen haben diese entsprechend erlebt. Sobald die Vernunft diese Regungen sich unterwirft und im Zaum hält, übernimmt sie als Herrin im Haus das Regiment und kann dann auch Mitleid ausschließen, wie von der Stoa empfohlen. Gemäß der Stoa wäre Barmherzigkeit nur eine unvernünftige Handlungsweise.17
Anders die Überlieferung des Alten und Neuen Testaments. Barmherzigkeit ist in Gott verankert. Darum wird sie zugleich als unermesslich gedacht. Luther thematisiert dies in einer Schrift, deren Bedeutung EBELING entdeckt hat.18
Luther spricht von der „Toleranz Gottes“ im Zusammenhang einer Disputation über Röm 3,28, „So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.“ Die Toleranz Gottes ist Gottes Sündenvergebung19. Sie gilt den Sündern wie den Frommen: Denen, die das Leben anderer zerstören – und damit ihr eigenes mit gefährden – und denen, die sich etwas darauf einbilden, durch ihren Glauben etwas Besonderes zu sein, eine Versuchung, vor der wohl kein Mensch geschützt ist. Auch wenn gerechte Verhaltensweisen anzuerkennen sind und nicht ohne positive Auswirkungen auch für die so Handelnden sein sollten, sobald diese Taten zur Selbstrechtfertigung dienen, zur Selbstgefälligkeit oder gar Selbstgenügsamkeit führen – die ihre eigene Bedürftigkeit nicht mehr wahrnehmen –, fällt dieses wieder unter das Unwerturteil Gottes.
WAS TRÄGT DIESES TOLERANZVERSTÄNDNIS AUS?
Was nach diesem Verständnis von Gott abgelehnt wird, ist die Sünde, die Sünde derer, die das menschliche Leben in seiner Schönheit und gemeinschaftlichen Bedürftigkeit entstellen und die Sünde derer, die sich insbesondere in ihrer Religiosität auf sich selbst etwas einbilden.
Die Komponente der Akzeptanz liegt darin, dass Gott diese Ungerechtigkeit erduldet. Gott, dem nichts gleichgültig ist, leidet unter dem geringsten Mangel an Liebe. Der Zorn Gottes angesichts der Ungerechtigkeit, seine Haltung der Ablehnung, wird verwandelt „in die Glut seiner Liebe“20.
Das Moment der Zurückweisung erscheint in der Ausrichtung auf das Jüngste Gericht: Der Gerechtigkeitsbegriff erfordert es, dass Ungerechtigkeit nicht folgenlos bleibt. Im vorgestellten Jüngsten Gericht werden Menschen mit den Folgen ihrer Taten konfrontiert. Jesus von Nazareth wird als der geglaubt, der alle zurechtbringt, indem Unwahrheit, Unrecht und Schuld öffentlich wird und genauso Liebe, Geduld, Hingabe und Barmherzigkeit öffentlich zur Geltung kommen.
Die christliche Auseinandersetzung, ob diese Zurückweisung endgültig oder vorübergehend zu denken ist (Apokatastasis), ist bis heute unentschieden. Aus Gründen der Gerechtigkeit, kann eine letzte Zurückweisung nicht zu einer vorletzten werden. Aus Gründen der Liebe kann die Bosheit nicht endgültig sein und bleiben, sondern wird auch sie überwunden werden.
Luther hat aus seiner Einsicht in die Toleranz Gottes leider keine Konsequenzen gezogen. Sein Hass auf Jüdinnen und Juden und die Bäuerinnen und Bauern um Müntzer ist bekannt. Sein Antisemitismus hat sich bis in Grundlagen seiner Theologie hineingegraben, dort, wo es antijüdisch gemeint ist, dass allein Christus zum Heil führt21. Den Grund dafür sehe ich darin:
Da das Moment der Zurückweisung in der tolerantia Dei aufgeschoben wird, fehlt diesem Toleranzbegriff in seiner Bewährung im Alltag der begrenzende Teil. Ebeling steuert ihn in seinem Aufsatz nach, indem er die Grenze der Toleranz in der Intoleranz sieht: „Wer Toleranz verneint, kann sie nicht beanspruchen.“ 22 Damit erscheint erneut die Kategorie der Reflexivität und Rechtfertigung. Wird die Grenzziehung nicht rational, öffentlich und widerlegbar begründet, artet sie schnell in Willkür aus, sonst kann z. B. als Intoleranz auch das gelten, was dem eigenen Vorteil im Wege steht. Aber auch das kann Gott offenbar aushalten, weil es ihm um einen Heilsplan geht23: „Um der Sünde willen dem menschlichen Leben ein Ende zu machen, wäre als Triumph göttlicher Intoleranz die Verewigung der Sünde. Um der Herrlichkeit seines zukünftigen Reiches willen toleriert Gott vorläufig das Elend“24.





























