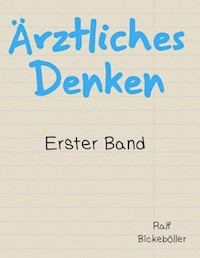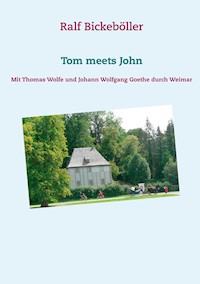
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Warum besuchte Thomas Wolfe im Mai 1935 mit Martha Dodd die Weimarer Goethestätten? Das literarische Berlin feierte ihn. Er erhielt die Anerkennung als Schriftsteller, nach der er sich in seiner amerikanischen Heimat umsonst gesehnt hatte. Die Schmeicheleien taten ihm wohl. Das Deutschland des nationalsozialistischen Aufbruchs beeindruckte ihn. Im Land, das er vor der Machtergreifung bereist und kennengelernt hatte, tat sich etwas. Aber was? In Johann Wolfgang Goethe sah er den deutschen Geist von Humanität, Freiheit und Aufklärung versinnbildlicht. Weimar bot ihm die luftigen Höhen der deutschen Klassik, doch Luft zum Atmen bot das Deutschland, das Thomas Wolfe zu sehen bekam, kaum mehr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Der trunkene Bettler
Ein kurzer Lebensabriss bis 1935
Über Mythen
Mutmaßungen über die Vorgeschichte einer Reise von Berlin nach Weimar im Mai 1935
Das zweite Buch
Manuskriptberge
Flucht nach Europa
Erschöpfung
Selbstzweifel
Gescheitert
Nach Berlin
Die Dodds
Röhm-Putsch
Ankunft in Berlin
In Berlin
Erfolg
Entscheidung für Weimar
Das Goethehaus in Frankfurt
Oktoberfest
Mutmaßungen über eine Reise nach Weimar im Mai 1935
Goethes Gartenhaus
Goethes Wohnhaus
Schillers Wohnhaus
Nietzsche-Archiv
Fürstengruft
Bauhaus
Stadtkirche
Abschied
Nach dem Besuch in Weimar
Zitateverzeichnis
Verwendete Literatur
Der trunkene Bettler
»Und der große Goethe hatte die unausweichliche Wahrheit erkannt, daß die Entwicklung der Menschen nicht geradlinig aufs Ziel losgehe, und hatte die Entwicklung und den Fortschritt der Menschheit mit dem Taumeln eines trunkenen Bettlers zu Pferde verglichen.
Vielleicht war es nicht so wichtig, daß er aufs Pferd gestiegen war und, wenn auch schwankend, irgendwohin ritt.«1
Ein kurzer Lebensabriss bis 1935
Thomas Clayton Wolfe wird am 3. Oktober 1900 in der Provinzstadt Asheville in North Carolina/USA geboren. Er ist das achte und jüngste Kind aus der Ehe von Julia Elizabeth geborene Westall und dem pennsylvania-deutschen Steinmetz William Oliver Wolfe. Die Mutter betreibt 1904 für sieben Monate während der Weltausstellung in St. Louis eine Pension. Toms Bruder Grover Cleveland Wolfe, geboren am 27. Oktober 1892, stirbt in St. Louis mit zwölf Jahren am 16. November infolge einer Thyphusinfektion. Die Familie Wolfe kehrt zurück nach Asheville.
Von 1905 bis 1912 besucht Thomas die Orange Street Public School in Asheville. Im August 1906 erwirbt seine Mutter ein Haus, das sie unter dem Namen Old Kentucky Home als Pension betreibt. Im Oktober zieht sie mit ihrem jüngsten Kind dauerhaft in ihre Pension um.
Thomas besucht von 1912 bis 1916 die North State Fitting School, einer unter der Leitung des Ehepaars Roberts stehenden Privatschule. Im September 1916 beginnt er ein Studium an der University of North Carolina in Chapel Hill. Im November 1917 erscheint sein erstes Gedicht in der Universitätszeitung. Er arbeitet in den Sommerferien 1918 als Kontrolleur und als Zimmermann.
Am 19. Oktober 1918 stirbt sein Bruder Benjamin Harrison, von allen nur Ben genannt, infolge der Spanischen Grippe.
Auf der Studentenbühne der University of North Carolina spielt Thomas am 14. und am 15. März 1919 die Titelrolle seines Theaterstücks The Return of Buck Galvin.
Im Juni 1920 beendet Thomas Wolfe sein Studium in Chapel Hill. Er erhält das Angebot, an der Bingham School, einer Militärakademie in Asheville, zu unterrichten, was er ablehnt. Ab September studiert er an der Harvard University in Cambridge Massachusetts, wo er sich als Student der Englischen Literatur vor allem dem dramaturgischen Fach widmet. Er nimmt an dem von George Pierce Baker 1912 gegründeten Workshop 47 teil, der als Forum für die Aufführung von Theaterstücken aus Bakers Englisch-Klasse dient.
Am 20. Juni 1922 stirbt der Vater infolge einer Prostatakrebserkrankung. Thomas schließt sein Englischstudium mit dem Master of Arts ab. Er bleibt für ein weiteres Jahr Mitglied des Workshops 47. Von 1923 bis 1924 studiert er Theaterwissenschaften an der Harvard University. Wolfe schreibt Dramen, z. B. Welcome to Our City oder Mannerhouse. Seine Versuche, New Yorker Produzenten für die Stücke zu begeistern schlagen fehl.
1924 wird Wolfe Dozent für Englische Literatur am Washington Square College der New York University, wo er bis 1930 unterrichten wird. Am 25. Oktober 1924 schifft er sich mit der Lancastria zu seiner ersten Europareise ein, die ihn nach England, Frankreich, Italien und die Schweiz führt. Auf der Rückreise in die USA lernt er die sich bereits als Bühnen- und Kostümbildnerin einen Namen gemacht habende Aline Bernstein kennen. Am 15. September 1925 erreichen sie New York.
Noch nicht einmal ein Jahr später schifft sich Thomas Wolfe am 22. Juni 1926 mit der Berengaria zu seiner zweiten Europareise ein, die ihn nach England, Holland, Frankreich und Deutschland führen wird. Im August beginnt er in London mit der Arbeit an Look Homeward, Angel, das zunächst den Titel O Lost bekommen sollte. Er kehrt zum Neuen Jahr zurück nach New York. Von Juli bis August reist er zum dritten Mal nach Europa, nach Frankreich, Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei. Über Weihnachten hinweg schreibt Thomas Wolfe die große Abschlussszene seines ersten Romans. Im März 1928 beendet er die Arbeit an Look Homeward, Angel. »(H)e has worked on it for past 20 month. Sent to publisher Monday before (March 26, 1928). Mentions going to dentist first time here.«2 Die Suche nach einem Verleger beginnt, das Manuskript wird mehrfach abgelehnt. Im Juli bricht Wolfe zu seiner vierten Europareise auf, die ihn u.a. wieder nach Deutschland bringen wird, nach Köln, Bonn, Wiesbaden, Mainz, Frankfurt/M. und München. Am 22. Oktober sagt der Cheflektor des Verlages Charles Scribner’s Sons Maxwell E. Perkins die Veröffentlichung zu. Aus Wien antwortet ihm Wolfe am 17. November. Am 21. Dezember schifft er sich auf der Vulcania nach den Vereinigten Staaten ein.
Der Vertrag für Angel (O Lost) wird am 9. Januar 1929 geschlossen. Wolfe erhält einen Vorschuss von $500. Am 18. Oktober erscheint Look Homeward, Angel Die Reaktionen auf seinen Roman fallen in Asheville heftig aus.
Im April 1930 erhält Thomas Wolfe ein Guggenheim-Stipendium. Im Mai bricht er zu seiner fünften Europareise auf. Nach dem Erscheinen von Look Homeward, Angel in England will Wolfe ganz mit dem Schreiben aufhören. Manche Kritiken äußerten Dinge, die er nie vergessen werde. Das Buch sei »schmutzig, unfair, verzerrt und voller Spott.«3
Im März 1931 kehrt Thomas Wolfe auf der Europa zurück in die USA. Er zieht nach Brooklyn, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Er beginnt mit den Arbeiten an Of Time and the River, die ihn fast vier Jahre binden und von ihm das Äußerste abverlangen werden.
Über Mythen
Der Mythenschöpfer Thomas Wolfe ist selbst zum Mythos geworden. Zu gerne versteckt man den Schriftsteller hinter der Erzählung von den Millionen Wörtern, den Tausenden von Seiten, der ungeheuren Fülle seiner Geschichten, Figuren, Orte und Zeiten. Hungrig stürzte er sich in das Leben, alles wollte er bis zur bitteren Neige auskosten, niederschreiben und weiter unersättlich leben. Im West-östlichen Divan schreibt Goethe:
»Trunken müssen wir alle sein! | Jugend ist Trunkenheit ohne Wein;| Trinkt sich das Alter wieder zu Jugend, | So ist es wundervolle Tugend. | Für Sorgen sorgt das liebe Leben, | Und Sorgenbrecher sind die Reben.«4
Auf die Trunkenheit kommt es beim taumelnd reitenden Bettler nicht an, auch nicht auf das Pferd, sondern, sich überhaupt auf den Weg gemacht, sich dem Leben voll und ganz ausgesetzt zu haben? Wie so viele junge Menschen fing Thomas an zu schreiben – die eigene Lebensgeschichte wie so viele andere junge Menschen auch. Antrieb war ihm der Wunsch, endlich der Gefangenschaft seiner Herkunft entfliehen zu können. Dazu dienten ihm das Studium der Englischen Literatur und der Theaterwissenschaften, diente ihm das Schreiben, das er mit unerbittlicher biographischer Schärfe rücksichtslos vorantrieb. Der begabte junge Bursche aus der amerikanischen Provinz schuf eine Künstlergestalt nach seinem Bilde. Sein Mythos war die Genialität der Künstlerschaft, die es ihm zuletzt doch erlaubte, hymnisch das Leben der kleinen Leute, den gemeinen Alltag und das Geschick seiner Generation in aller Nähe und doch mythisch überhöht in Worte zu fassen. Lebendig und herzergreifend, dann wieder erstaunlich nüchtern beschrieb er die Welt der kleinen und der großen Städte, der armen und der reichen Leute, der klugen und der dummen, der gebildeten und der einfachen Menschen, alles unter der Idee, einen großen amerikanischen Roman zu schreiben, der ganz Amerika in sich aufnehmen könne. Er reiste als Amerikaner mit Wurzeln in Deutschland nach Europa, dem alten, verbrauchten und ausgelaugten Kontinent, um wahre Kultur zu entdecken. Der amerikanische Künstler allerdings könne nicht von der Kultur Europas leben. Er müsse selbst eine eigene Tradition gegen den amerikanischen Materialismus und gegen das amerikanische Philistertum begründen. Thomas Wolfe sah sich in der Pflicht, nicht mehr und nicht weniger als ein ganzes Universum aus Erzählungen neu zu schaffen, einer neuen großen epischen Schöpfung.
In Goethe erkannte Thomas Wolfe einen Seelenverwandten, nicht zuletzt durch dessen Faust-Mythos. Er identifizierte sich mit dem leidenschaftlichen Forscher und Künstler des ersten Teils der Tragödie und sah den nur praktisch gewordenen planend Tätigen des neuen Jahrhunderts im zweiten Teil. Hatte zum Schluss Mephisto seine Wette gewonnen oder verlor er sie? Wir wissen es nicht, weil die Geschichte immer noch nicht zu Ende erzählt ist und wir weiter an ihr zu erzählen haben. Thomas Wolfe erzählte seinen Faust-Mythos weiter, spürte bei seinen Besuchen in Deutschland, wie das Faustische sich langsam vom Faust-Mythos löste, um eine reale politische Gestalt anzunehmen.
Trunken vor Leben trat Wolfe seine Reisen nach Europa an. Trunken erfuhr er die Gestalten des vor Machtphantasien besoffenen Deutschland, das dem Abgrund im Nirgendwo zuritt. Die Weimarreise ernüchterte ihn und führte ihn zur Erkenntnis, dass es besser ist, machtlos vor Leben trunken im Hier und Jetzt zu sein, statt die Macht reitend sich machtvoll irgendwohin in den Abgrund treiben zu lassen.
Mutmaßungen über die Vorgeschichte einer Reise von Berlin nach Weimar im Mai 1935
Der vierunddreißigjährige Thomas Wolfe kam am siebten Mai 1935 in Berlin an. Er hatte bereits eine lange Reise nicht nur nach Paris und London, sondern auch einen Horrortrip durch die Albträume künstlerischen Selbstzweifels hinter sich gebracht.
Das zweite Buch
Wolfes zweites großes Romanwerk Of Time and the River war am achten März in den Vereinigten Staaten erschienen. Vorangegangen waren erhebliche Auseinandersetzungen mit seinem Lektor Maxwell Perkins über die Komposition des Buches und die einzusetzenden künstlerischen Mitteln. Wolfe und Perkins hatten an dem neuen Roman über Monate hinweg bis zur Erschöpfung gearbeitet. Wolfe konnte innerhalb von nur drei Wochen Texte von über fünfundsiebzigtausend Worten zu Papier bringen, um zusätzlich abends von halb neun bis halb elf mit seinem Lektor Perkins den Text satzfertig aufzubereiten – eine wahre Herkulesaufgabe.
Doch jeder kreative Rausch nutzt sich mit der Zeit ab. Der Blick des Lektoren muss auf die Lesbarkeit und vor allem auf den gemutmaßten Publikumsgeschmack gerichtet sein. Da kann ein Roman noch so kunstvoll daherkommen, wenn er keine Leser findet, war die ganze Arbeit verlorene Liebesmühe, es sei denn, der Autor wollte einen Roman ohne Publikum schreiben, was erstens keines Lektoren und zweitens keiner Veröffentlichung bedürfen würde. Doch Thomas Wolfe wollte immer ein richtiger Schriftsteller werden, ein Profi, der für ein Publikum schreibt, bekannt wird und von den Honoraren zumindest gut leben kann.
Er wusste sehr wohl, was er an seinem Lektor Max Perkins hatte. Inmitten der Arbeit an Of Time and the River gab er in einem Brief seiner ewigen Dankbarkeit Ausdruck. Perkins habe ihn aus dem Sumpf herausgezogen. Wolfe wisse nicht, was er ohne Max angefangen hätte. Eine kleine, nur sehr leise unharmonisch klingende Note schloss sich an. Wolfe meinte, wenn das Werk herauskomme, könne Perkins das Buch als sein eigenes Werk beanspruchen. Hatte der Briefschreiber damit den künstlerischen Bankrott des ambitionierten jungen Schriftstellers erklärt?
Die gemeinsame Arbeit wurde zu einer sich gegenseitig auf- und zerreibenden Quälerei. Was nicht dem Plan des Buches entsprach, wurde gestrichen. Für einen Schriftsteller, der sich als Dazutuer verstand – so in einem Brief an Francis Scott Fitzgerald – , musste das Weglassen, das Kürzen, das Streichen ganzer Passagen einen den ganzen Menschen ergreifenden Kränkungsschmerz bereiten. Der Schmerz wurde zur existentiellen Bedrohung, denn Wolfe wusste selbst nur zu gut, dass er eigentlich das Handwerk des professionellen Schriftstellers noch nicht richtig erlernt hatte und möglicherweise nie wirklich erlernen würde.
Der Erfolg seines Erstlings Look Homeward, Angel gründete in der kritiklosen Hingabe an das wirkliche Leben. Jede Kleinigkeit könnte wichtig, jedes noch so marginale Ereignis handlungstreibend sein. Das Erstlingswerk ist darum selbst mehr ein Ereignis als ein kunstvoll reifer Roman. Das als Selbstbildnis des werdenden Künstlers gestaltete Prosastück – Look Homeward, Angel ist ein sehr ausladendes Exemplar seiner Gattung – mag in seiner überschäumenden Erzählfreude noch angehen und wäre einer literaturgeschichtlichen Fußnote wert, wenn der werdende Künstler nicht die Ambitionen gehabt hätte, tatsächlich ein Künstler und zwar ein wirklicher Schriftsteller zu sein – oder sollte man besser sagen, zu werden? Noch sprach man nur von Begabung. Hatte sich am Erstling die Begabung gezeigt, sollte am zweiten Buch die Könnerschaft sich Bahn brechen. Reichte die Begabung für einen wirklichen Roman, für das zweite Buch? Konnte er sich als professioneller Schriftsteller etablieren?
Manuskriptberge
Die künstlerischen Ambitionen waren hochgespannt. Bernard De-Votos Diktum von 1936, dass Genie nicht genüge, war Thomas Wolfe vollkommen bewusst. Er kannte seine Schwäche zur Weitschweifigkeit, zur exzessiven Nutzung von Adjektiven, zur unendlichen Aufzählung. Aber er fühlte bestimmt, dass er im Vergleich zu allen anderen arrivierten amerikanischen Schriftstellern seiner Zeit in der Lage war, das Amerika des frühen zwanzigsten Jahrhunderts lebendiger, reicher, großzügiger, brutaler, hymnischer, klangreicher, fühlbarer, riechbarer, wirklicher, farbenfroher und liebenswürdiger aus den Buchstabenbergen seiner Manuskripte erstehen zu lassen. Er liebte den ungezügelten Ausdruck und die hymnische Beschwörung. Nichts sollte weggelassen, nichts übersehen werden. Im Verlauf der vierjährigen Arbeit an seinem zweiten, den für seine schriftstellerische Karriere vielleicht wichtigsten Roman, sammelten sich Berge von Manuskriptseiten an. Der junge Schriftsteller meinte halb im Scherz halb im Ernst, dass es ein wunderschöner Gedanke sei, mit siebzig Jahren aus dem Manuskripthaufen viele begrabene Meisterwerke ausbuddeln zu können.
Gleichwohl blieb die Arbeit an Of Time and the River eine quälende, harte Tätigkeit. Er schrieb täglich drei- bis viertausend Worte. Max Perkins strich ganze Passagen, um aus der Seitenhortung einen ganzen Roman zu machen. Wolfe wusste sehr genau, dass das, was Perkins mit seinem Text tat, unbedingt notwendig war, schließlich sollte das Buch gekauft und gelesen werden. Es zerriss ihm das Herz, wenn wirklich hervorragende Textpassagen dem kürzenden Strich des Rotstifts zum Opfer fielen. Im September 1934 gab Perkins ohne das Wissen Wolfes die letzten Teile des Manuskriptes von Of Time and the River in den Druck. Das Buch musste endlich den Händen seines Schöpfers entrissen werden, sollte es wirklich irgendwann erscheinen. Er nutzte die Abwesenheit Wolfes, der sich gerade in Chicago aufhielt und schaffte Fakten. Am 8. März 1935 erschien Of Time and the River bei Charles Scribner‘s Sons.
Flucht nach Europa
Von der panischen Angst getrieben, den hochgestellten Erwartungen der professionellen Literaturkritik und der Leserschaft nicht zu genügen, floh Wolfe dem Ort seiner – befürchteten – größten Schmach.
Die Nachricht des Erscheinens erreichte Wolfe per Telegramm in Paris. Auf der Ile de France war er aus den Vereinigten Staaten über den Atlantik nach Europa gereist. So wie Wolfe von seinen Sorgen und Ängsten durcheinandergeschüttelt wurde, so schüttelte und rüttelte der Ozean das Sechsundvierzigtausendtonnenschiff seiner Passage. Er hatte noch nicht verwunden, dass ihm sein Kind so brutal entrissen worden war. Was hatten »die Schweine«5 ihm und seinem Buch angetan? Jede Kontrolle und Verfügungsgewalt war verloren, war ihm geraubt worden. Die wirrsten Ängste quälten ihn bis zum Albdruck: wie wohl das New Yorker Publikum und die Geier an Rezensenten sein Werk aufnehmen würden? Er trank viel zu viel, suchte Entspannung, ließ sich vom Alkohol aufputschen. Seine panisch depressive Gemütslage bekam paranoide Züge. Er nahm sein zerfallendes Selbst durchaus wahr, was die Angst, tatsächlich verrückt und ein Fall für die Psychiatrie zu werden, noch schürte. Ihm war, als zerfiele er in sechs Personen, als träten mehrere Gestalten aus seinem Ich. Er litt – nach heutigen Maßstäben – wahrscheinlich nicht unter einer Psychose, wohl jedoch an einem Zustand, den man „Burn Out“ nennen würde. Kein Wunder, dass Wolfe während der Atlantiküberfahrt nicht arbeiten konnte, dass es nach seiner Ankunft in Paris genauso weiterging. Das Gedächtnis verließ ihn, ganze Tage verschwanden ohne jede Erinnerung. War er in eine Schlägerei verwickelt worden? Woher hatte er die Schwellung oberhalb der Leiste?
Hätte es ein banaler Leistenbruch sein können, den Wolfe sich unter der heftigen Anstrengung der Schlägerei zugezogen hatte, würde vielleicht ein Arzt erwägen?
Erschöpfung
Die Ursache seiner paranoiden Zustände konnte Wolfe später genau benennen. Fünf lange Jahre hatte er angestrengt gearbeitet. Vor allem das letzte Jahr forderte von ihm alles, hatte mehr gefordert als er zu leisten imstande war.
Dieses verfluchte die Seele aufzehrende zweite Buch … Hätte er nur noch ein halbes Jahr bekommen … nur sechs Monate … alles hätte sich zum Guten gewendet und er hätte der ganzen Welt gezeigt, was für ein zweites Buch er zu schreiben in der Lage wäre … Die Niederschrift jedes einzelnen Buches war für den Künstler Wolfe eine Angelegenheit der Ehre, eine der ganzen Persönlichkeit und des integren Charakters. All das stand bei jedem neuen Werk auf dem Spiel und er spielte mit einem hohen Einsatz.
Max Perkins teilte seinem Schützling Wolfe telegraphisch mit, dass die Besprechungen von Of Time and the River in der Presse sehr positiv ausgefallen waren. Es sei wahrhaftig ein Meisterwerk. Der Künstler Wolfe werde mit den denkbar größten Schriftstellern Amerikas in einem Atemzug genannt. Was hätte er sich anderes wünschen können? Trotz des offensichtlichen Erfolges blieb er skeptisch. Vor allem die wirtschaftliche Seite des gut anlaufenden Verkaufs stimmte ihn positiv. Nun konnte er den erhaltenen Vorschuss von zweitausendfünfzig Dollar seinem Verlag zurückzahlen. Er freute sich, endlich Geld mit seiner Schriftstellerei verdienen zu können.
Selbstzweifel
Aber der Stachel des künstlerischen Ungenügens blieb im Fleische stecken. Was, wenn er ein Bestsellerautor werden würde? Müsste er sich fragen, was an dem Buch verkehrt sei, weil es ein Bestseller geworden war? Ob er zu populär und oberflächlich geschrieben habe? Dieselben Anwandlungen überfielen Wolfe erneut in London, wohin er nach seinem Parisaufenthalt weiterreiste. Dort lernte er den Schriftsteller Hugh Walporte kennen. Als bekannter vielgekaufter Autor war er für seinen Verlag und die eigene Schatulle »ein gutes Rennpferd«6