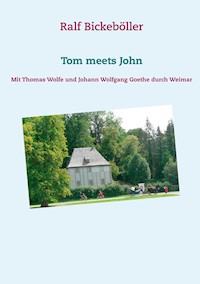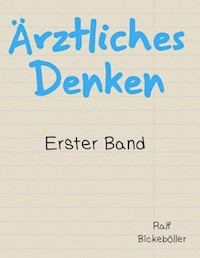
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ärztliches Denken lässt sich als ein für Ärzt*Innen besonderer Denkstil deuten. Ihm liegen besondere für Ärzt*Innen typische Erfahrungen der beruflichen Sozialisation zugrunde, deren Form durch verschiedenste kulturelle Leitideen zur ärztlichen Praxis und zur medizinischen Wissenschaft und durch die gegebenen institutionellen Bedingtheiten des Gesundheitssystems bestimmt werden. Das Projekt Ärztliches Denken erkundet aus der Perspektive eines Praktikers die Zusammenhänge, Notwendigkeiten, Zufälle, Unterschiede und Widersprüche von klinischer Erfahrung, medizinischer Wissenschaft, Patient*Innenorientierung, Professionalität und Alltagswissen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 890
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Bickeböller
Ärztliches Denken
Erster Band
Impressum
© Ralf Bickeböller, 2022
Verlag: Ralf Bickeböller | Goldammerstraße 17 | 60528 Frankfurt/M.
Herstellung: Neopubli GmbH | Köpenicker Straße 154a | 10997 Berlin
Kontakt: ralf-bickeboeller[at]t-online.de
Vorwort
1. Ludwik Fleck und die Entdeckung des ärztlichen Denkstils
2. Die Magie der Medizin von den Anfängen über Hippokrates bis Galen
3. Wie wissenschaftlich ist die Medizin? Eine erste Annäherung
4. Bemerkungen zum hippokratischen Eid
5. Über den Begriff der Wahrscheinlichkeit
6. Weitere Bemerkungen zum hippokratischen Eid
7. Nürnberger Kodex und Deklaration von Helsinki
8. Ärztlich-medizinisches Wissen
9. Was Krankheit meint
10. Perspektiven der Gesundheitspolitik
11. Skizze einer ärztlich medizinischen Wissenschaftsontologie
12. Einige Gedanken zu Big Data, Data Mining, Wissenschaft und ärztliche Praxis
Nachwort
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Vorwort
Am 30. Dezember 2019 wurde auf der Melderegisterplattform ProMED – Program for Monitoring Emerging Diseases – über einen Cluster einer neuartigen Pneumonie unbekannter Ätiologie mit möglichem Ursprung in Wuhan berichtet.1 Durch die Kombination von »human and artificial intelligence« war es der kanadischen Firma bluedot gelungen, den Cluster zu erkennen und sachgerecht zu bewerten.2 Die aus der kleinen Meldung entstandene Pandemie brachte und bringt die Gesundheitssysteme weltweit an und weit über ihre Belastungsgrenzen hinaus. Die Pandemie erschütterte liebgewonnene Gewissheiten, die sich nicht als in dieser Weise gewiss herausgestellt haben und sie zeigte erbarmungslos die Schwachstellen unserer Weisen ärztlich tätig zu sein auf.
Natürlich … in der Rückschau sind wir immer klüger. Es gelten immer nur die Handlungsgründe, die zum Zeitpunkt der Entscheidung leitend waren und nicht die, die retrospektiv zur späteren Entwicklung passten. Die, die in der Rückschau erfolgreich waren, konnten ihren zukünftigen Erfolg nicht wissen, auch keine objektive Wahrscheinlichkeit nennen, erfolgreich zu werden. »Weltweit werden mindestens 341 Impfstoffprojekte vorangetrieben«3, doch ist es neben dem Fleiß, der Klugheit, dem Wissen und dem Können der Forscher*Innen vor allem das glückliche Händchen des Zufalls, was den entscheidenden Unterschied ausmacht. Der Weg zum Erfolg ist von all den anderen gepflastert, die nicht das notwendige Quäntchen Glück hatten.
Die bitteren Einsichten der Pandemie legten allerdings nur offen, was wohl immer schon als Unbehagen in der Medizin einen konstitutiven Teil des Selbstverständnisses von Ärzt*Innen ausmachte. Ärztliche Praxis und medizinische Wissenschaft sind vom Dreieck bestehend aus Kontingenz, Emergenz und Determiniertheit eingerahmt. Die Spannung zwischen einem begründeten Vertrauen und Hoffen in die Leistungsfähigkeit der modernen Medizin und der Enttäuschung angesichts erfahrener Ohnmacht ist zu einem kollektiven Gefühl geworden. Ärztliches Denken musste schon immer, wollte es verantwortlich sein, das Dilemma des Zwangs zu handeln und der Unklarheit seiner Voraussetzungen aushalten. Es mag einige wenige Teilbereiche der Medizin geben, in denen genügende Klarheit herrscht, doch sind es wenige, allerdings die Illusion genährt habend, dass es überwiegend so wäre. Der Triumph einer zupackenden Medizin wird leider allzu oft von der enormen Verletzlichkeit eines jeden Menschen eingeholt. Wir sind grundsätzlich begrenzt durch den Ort und die Zeit unserer Existenz. Von daher sind wir reduzierte Wesen, die sich ihrer Begrenztheit klar sein müssen, um als Ärzt*In klinisch praktisch tätig sein zu können. Das jeweilige ärztliche Denken sucht nach Hilfen, die es in der aufmerksamen empathischen Wahrnehmung der Patient*Innen, im Austausch mit Kolleg*Innen, in der persönlichen Erfahrung der Praxis und mit Fragen an die medizinische Wissenschaft zu finden hofft. Eine weitere Hilfe sind die verschiedensten Institutionen, die unser Gesundheitswesen ausmachen. In ihnen manifestiert sich ein quasi vernetztes ärztliches Denken, das über das der einzelnen Ärzt*In weit hinausgeht, es aber sogleich wesentlich einengt und oft mit nicht immer nur sanfter Gewalt zwingt. Das Unbehagen in der Medizin hat hier seinen Ursprung. Ärzt*Innen tanzen auf dem »zwischen Tier und Übermensch« gespannten Seil »– ein Seil über einem Abgrunde.«4 Eine solche Existenz wäre in ihrer vollen Verantwortlichkeit keiner Ärzt*In erträglich. Von daher sind die Einengung und der von Institutionen ausgeübte Zwang zumeist eine ungeheure Entlastung, weil die Verantwortlichkeiten in die Institution selbst gelegt sind, was die Entscheidung im konkreten Einzelfall einfacher, aber nicht einfach macht. Wichtig ist, eingedenk der ständig über Ärzt*Innen hereinbrechenden existentiellen Grenzsituationen, dem beruflichen Alltag eine Gestalt verleihen zu können, die das gespannte Seil stabilisiert statt es zum Schwingen zu bringen. Doch zu viel Stabilität behindert wiederum die Seiltänzer*In, die eigene Position des inversen Pendels durch feinste Korrekturbewegungen in einem Gleichgeweicht halten zu können. Insbesondere der Kopf mit seinem Gleichgewichts- und Gesichtssinn sollte zur Vermeidung von Schwindel nicht zu sehr geneigt und bewegt werden. Als Fixpunkt dient nicht die unmittelbare Nähe, sondern eine Ferne, die der geraden Haltung des Kopfes zu passe kommt.
Unser Unbehagen in der Medizin lässt sich an den verschiedensten Stichworten festmachen. In aller Munde sind die Ökonomisierung und Technisierung der Medizin, ist der Mangel an Sprechender Medizin und das Überwiegen der Apparate. Die Arbeit in Praxen und in den Krankenhäusern habe sich hin zu einer entfremdeten Fließbandarbeit entwickelt. Die einen beklagen, dass zu wenig, die anderen, dass zu viel auf wissenschaftliche Evidenz geschaut werde. Schon längst sind Gesundheit und Krankheit zu einem Konsumgut geworden, das denselben Marktgesetzen gehorchen soll wie andere Konsumgüter auch. Individualisierung und Personalisierung sind die beglückenden Formeln einer sich immer weiter in kleinste Subgruppen differenzierenden Massengesellschaft, die die Massenhaftigkeit sogar noch verstärken, indem Waren industrialisiert individualisiert sind. Auch sogenannte Alternative Heilkunden und die sogenannte Integrative Medizin wurden von diesem Strom mitgerissen. Die »Medikalisierung des Lebens«5 ist so weit vorangeschritten, dass es nur noch um deren Gestaltung gehen kann, schon lange nicht mehr um deren Verhinderung. Die in der Corona-Pandemie wieder aktuell gewordene Polarität von Impfbefürwortern und Impfgegnern, von Wissenschaftsverfechtern und Wissenschaftsleugnern ist keine andere als die von homöopathischer und anthroposophischer Heilkunde und der sogenannten Schulmedizin. COVID-19 machte die Themen virulenter, gleichwohl blieben sie Ausdruck unseres Unbehagens in der Medizin. Natürlich hätte ich Geschichten erzählen können, Geschichten aber verführen zu zu frühen Identifikationen. Verfremdung und Postdramatik sind vielleicht Wege, unsere allzu selbstverständlichen Urteile als Ärzt*Innen zu überdenken. Ärztliches Denken ist der Versuch einer Verfremdung und Postdramatisierung unseres Unbehagens in der Medizin und zugleich ein kleiner Beitrag im Diskurs über eine gelingende medizinische Praxis.
1. Ludwik Fleck und die Entdeckung des ärztlichen Denkstils
Womit beschäftigt sich eine Ärzt*In? »Mit der Medizin« könnte eine Antwort lauten, »mit der Patient*In« eine andere, vielleicht »mit dem Krankhaften« eine weitere. Jedenfalls wissen wir ganz selbstverständlich: die Ärzt*In ist weder eine Geistes- noch eine Natur- oder Sozialwissenschaftler*In. Ihr Gebiet liegt irgendwie dazwischen und doch umfassend übergreifend darüber. Weil ihr Gegenstand ein eigener ist, benutzt die Ärzt*In die anderen Wissenschaften, die ihr lehren können, was als normal in den Welten des Geistes, der Natur und des Sozialen anzusehen sei. Sie beschreiben ihre Gegenstände wie sie sind, welche Gesetze darin herrschen, unabhängig davon, ob die Natur, der Geist und die Gesellschaft je andere Zugangsweisen benötigen, damit deren Normalzustände erforschbar sein könnten. Schon während der Schulzeit erfahren wir die grundsätzlichen Unterschiede im Denken der verschiedenen Wissenschaften. Wir kennen es: die eine kann sich gut in einen literarischen Text eindenken, die andere genießt die Schönheit eines mathematischen Beweises, die dritte versteht die Funktionsweise eines technischen Gegenstandes. In der Regel haben Lehrer*Innen der jeweiligen Fächer ihre Schwierigkeiten, miteinander über ihre Fächer ins Gespräch zu kommen. Man versteht einander kaum, nicht bloß, weil man eine andere Fachsprache spricht, sondern weil der Gegenstand des jeweiligen Faches ein anderes Denken erfordert. Über viele Jahre hinweg, beginnend in der Schule, dann weiter über das Studium in den Berufsalltag hinein, werden die Notwendigkeiten, die Eigenheiten und die Verfahrensweisen des spezifischen Denkens eines Faches trainiert. So wie die Sportler*In einen Bewegungsablauf immer wieder üben muss, damit sie ihn ohne bewusst zu denken ablaufen lassen kann, so müssen Fachleute ihr fachspezifisches Denken üben, so dass sie ohne zu denken Denken lernen. Die unnatürlichen Bewegungen der Turner*In müssen durch das Training quasi zu ihrer zweiten Natur werden, ihr Körper muss in der Art eines Reflexes funktionieren. Nicht anders ist es mit Musiker*Innen, bei Handwerker*Innen und eben auch bei Wissenschaftler*Innen. Sie alle haben ein ganz spezifisches Denken antrainiert bekommen, das sie so denken lässt, dass für jeden erkennbar wird, hier handelt es sich um einen Menschen mit einem ganz bestimmten Beruf, mit einer ganz bestimmten Weise die Welt zu betrachten und in der Welt mit den Gegenständen ihres Berufes tätig zu werden. Wir erkennen am Denkstil unseres Gegenübers, welcher Berufsgruppe, welchem Fach es angehört. Und es ist dieser besondere Denkstil der Ärzt*In, der das spezifisch ärztliche am Denken der Ärzt*In ausmacht.
Es war der polnische Arzt, Mikrobiologe und Wissenschaftstheoretiker Ludwik Fleck (1896 – 1961), der den Begriff des Denkstils in die Wissenschaftstheorie einführte, lange bevor das Paradigmenkonzept Thomas Kuhns (1922 – 1996) einen ähnlichen sehr wirksam gewordenen Ansatz verfolgte. Thomas Kuhn bezog sich ausdrücklich auf Ludwik Fleck als den Urheber der Idee seines Paradigmenkonzeptes.6 Flecks Aufsatz mit dem Titel Über einige spezifische Merkmale des ärztlichen Denkens7 erschien 1927. Er wurde 1926 als Vortrag bei einer Versammlung der Gesellschaft der Freunde der Geschichte der Medizin in Lwów erstmalig vorgestellt. Sehr kurz und knapp stellt Fleck fest, die Naturwissenschaftler*In suche nach typischen, normalen Phänomenen, die Ärzt*In hingegen nach dem Nichttypischen, dem Nichtnormalen, letztlich nach dem Krankhaften und der Krankheit. Das sogenannte Normale lässt sich in seinen Grenzen eindeutig beschreiben, hingegen das Krankhafte keine derart eindeutigen Grenzen kennt. Krankhafte Phänomene treten in einer ungeheuren Vielfalt auf, bieten eine gewaltige Individualität, was zu der Feststellung verleiten könnte, es gäbe gar keine eine Krankheit, die ein zweites Mal auftreten könne. Die phänomenale Varianz des Untypischen, des Unnormalen, des Krankhaften ist derart ausgeprägt, dass es beinahe unmöglich ist, innerhalb der Vielfältigkeit so etwas wie einen gemeinsamen Nenner innerhalb der Phänomene zu finden. Aber gerade darin liegt die denkerische Herausforderung für die Ärzt*In, ein Gesetz für die nichtgesetzmäßigen Phänomene zu finden. Die Grenzen innerhalb derer ein Organ als adäquat funktionstüchtig bezeichnet werden kann sind relativ eng. Diese normale Funktion zu beschreiben ist die Aufgabe der Biologie, der Biochemie oder der Physiologie. Auch wenn die Grenzen zwischen dem Normalen, der Normvariante und dem Unnormalen nicht immer klar gezogen werden können, so bleibt die Erfahrung einer sich erst im Krankhaften ungeheuer steigernden Vielfalt. Es zeigen sich immer neue Phänomene, immer neue Bilder, »(e)s entsteht ein riesiger Reichtum an Material«8, der einem Chaos gleicht. Wie kann darin eine Gesetzmäßigkeit gefunden werden, mit welchen Methoden kann eine Ordnung in die Unordnung gebracht werden? Fleck ist ein wissenschaftstheoretischer Optimist. Er weiß von der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie unzusammenhängende Ereignisse hinter dem Zufall doch zu gewissen Typen gruppiert werden können, die etwas wie eine »höhere Ordnung«9 darstellen. Diese Typen sind das, was man Krankheiten nennt, wobei, das betont Fleck immer wieder, Krankheiten idealtypische Konstruktionen sind, fiktive Bilder, die auf einer abstrakten Hypothese beruhen. Diese Vielfalt der Phänomene, die niemals idealtypischen Konstruktionen entsprechen können, lassen vorläufig nicht zu, von dieser oder jener einen, abgegrenzten Einheit Krankheit sprechen zu wollen. Damit das nun doch geschehen kann, muss die Ärzt*In manche Teilaspekte von Phänomenen des Unnormalen übersehen. Die zwar wahrgenommene, aber übersehene Beobachtung spielt bei der Diagnosefindung keine Rolle. Wie einerseits beobachtete Phänomene verworfen werden, werden andere Phänomene als wahrscheinlich vorhanden vermutet. Das bunte Phänomen-Potpourri wird auf der einen Seite in seiner Vielfalt beschränkt, auf der anderen Seite hypothetisch erweitert. Nur über den Weg der Hypothese ist die Ärzt*In in der Lage, innerhalb des Chaos der Phänomene ein idealtypisches fiktives Bild von einer Krankheitseinheit zu entwerfen. Als wichtiges Hilfsmittel macht Fleck die Wahrscheinlichkeitsrechnung und die Statistik aus, die allein fähig sind, innerhalb der zahlreichen beobachtbaren Phänomene das individuelle Merkmal als zufällig entstanden zu identifizieren. Das individuelle Merkmal ist »mit dem Zufall identisch und muss entfernt werden.«10 Er formte seinen Krankheitsbegriff so aus, dass er keine essentialistischen Wahrheiten annehmen müsste, sondern sich des fiktionalen, hypothetischen, idealtypischen Charakters bewusst blieb. Nicht die statistische Beobachtung erzeugt »den Grundbegriff unseres Wissens, der der Begriff der Krankheitseinheit ist.«11 Fleck spricht von einer spezifischen Intention, die eine Ärzt*In haben muss, um zu einer spezifischen Diagnose zu kommen und damit zu einer hoffentlich erfolgversprechenden Therapie. Die Evidence based Medicine spricht von der je persönlichen Erfahrung der Ärzt*In, die gleichwertig als interne Evidenz der externen Evidenz der mathematisch-statistischen Aufarbeitung von Beobachtungsdaten beigestellt ist. Aufgrund der Einsicht, dass Krankheitseinheiten hypothetische Konstrukte sind, kann Fleck erklären, wie im Laufe der Medizin- und Wissenschaftsgeschichte spezifische Denkstile der jeweiligen Entwicklungsstufe der Medizin entsprechen. In einer spezifischen Entwicklungsstufe entstehen spezifische Krankheitseinheiten, weil der ärztliche Denkstil einer jeden Epoche spezifische Hypothesen, Erklärungsmodelle, fiktive Bilder usw. generiert. Deshalb können in einer bestimmten Epoche verschiedene Wissenschaftler*Innen gleichzeitig ein neues Phänomen entdecken und erkennen. Die neue Entdeckung wie die neue Erkenntnis lagen in der Luft und mussten nur noch geschickt aufgeschnappt werden. Es ist der Denkstil einer bestimmten Forscher*Innengemeinde und einer bestimmten Forscher*Innengeneration, der die Möglichkeit der Wahrnehmung und der Interpretation von Phänomenen erlaubt, die anderen verborgen geblieben wären, weil sie noch nicht oder nicht mehr das notwendige Sensorium ausgebildet haben. Dergestalt entstehen ganz bestimmte Krankheitseinheiten, die aus denselben Gründen wieder verschwinden können und werden. Zuerst werden innerhalb einer Krankheitseinheit Abweichungen festgestellt, dann müssen Untergruppen gebildet werden, endlich wird der ursprüngliche Begriff der jeweiligen Krankheitseinheit aufgegeben, weil es zu viele Abweichungen gegeben hat und weil der Begriff zu sehr einem nun veralteten Ideal folgte, eben einem bestimmten Denkstil. Fleck behauptet, dass in keiner anderen Wissenschaft die Fiktivität so bedeutend sei wie in der Medizin.12 Das erklärt die für die Medizin »charakteristische Diskrepanz von Theorie und Praxis.«13 Die Theorie unterscheidet sich oft von den Phänomenen, die eine richtige Patient*In bietet. Häufig kann und weiß die Praxis mehr oder weniger oder anderes als die Theorie. Wie oft kommt es im klinischen Alltag vor, dass Dinge funktionieren, die theoretisch gar nicht funktionieren dürften. Abzugrenzen ist diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis von pseudologischen Erklärungsversuchen wie zum Beispiel denen der Homöopathie. Die Homöopathie kennt derartige Erklärungslücken, wie sie die praktische Schulmedizin täglich erfährt, nicht. Sie bietet eine exakte, logische, mathematisch anmutende Ableitung innerhalb ihres Lehrgebäudes. Aus den Allgemeinsätzen kann durch eine klare Verstandestätigkeit auf den Einzelfall geschlossen werden, was selbstverständlich bedeutet, immer eine klare Antwort auf die Fragen der Patient*In zu haben, nie um einer Antwort verlegen zu sein. In einer fast scholastisch zu nennenden Weise wird deduziert und wenn der gewünschte Erfolg nicht eintritt, hat die Praxis nicht die Theorie widerlegt, sondern die Theorie zeigte, dass irgendein Fehler in der Praxis sich hat einschleichen müssen. Es gibt eben keine Diskrepanz, immer nur eine fehlerhafte Praxis. Die so gescholtene Schulmedizin, die gleichwohl sehr erfolgreich ist, weiß um die Diskrepanz und weiß um ihre mangelhaften Erklärungsversuche über Gesundheit und Krankheit. Das macht bescheiden, sowohl die theoriebildende Wissenschaftler*In, als auch die praktisch klinisch tätige Ärzt*In. Leider geht die notwendige Bescheidenheit zu gerne verloren, weil die Macht des Machbaren so groß geworden ist, weil die der Wissenschaftler*In für ihre Forschung zuteilwerdende Ehre zu leicht den Kopf verdrehen kann. Fleck stellt fest, dass in der Medizin der einzigartige Umstand auftrete, »dass je schlechter ein Arzt ist, um so ›logischer‹ seine Therapie ist.«14 Selbstverständlich anerkennen die meisten Ärzt*Innen das Kausalprinzip. Jede Wirkung muss eine Ursache haben und jedes Werden ist die Folge einer Wirksamkeit. Im Unterschied zu den Naturwissenschaften kann die Medizin meist erst im Nachhinein sagen, wie etwas habe geschehen können, selten in die Zukunft hinein wie etwas werde. Wie etwas werde, kann vielleicht mit statistischen Wahrscheinlichkeiten angegeben werden, hingegen die Praxis bei der einzelnen Patient*In nie Wahrscheinlichkeit sein kann, immer nur eine Eins oder eine Null, ein Ja oder Nein. Entweder ein Geschehen tritt ein oder es tritt nicht ein, dazwischen gibt es bei der Patient*In nichts.
Die Konstruktionen der Ingenieurwissenschaften stützen sich auf ein sicheres Wissen um Kausalzusammenhänge in dem Wirklichkeitsausschnitt, den sie technisch beherrschen. Die Ingenieur*In weiß, wie sie eine Brücke an einem bestimmten Standort mit bestimmten Nutzungsbedingungen zu konstruieren hat. Sie weiß nicht, ob sie gebaut werden soll und wenn sie es weiß, dann nicht als Ingenieur*In, dann vielleicht als Verkehrsplaner*In, die in ihrer Eigenschaft als Verkehrsplaner*In Verkehrsströme leiten soll. Damit ist die Frage nach der Opportunität des Verkehrs noch lange nicht beantwortet. Die Antwort bewegt sich auf einem unsicheren Gelände, das von den unterschiedlichsten und sich widersprechenden Argumenten bestellt ist. Hier bedarf es eines politischen Denkens, das mit der Konstruktion einer Brücke so gar nichts mehr zu tun hat. Schließlich wird eine Brücke nie von nur einer Ingenieur*In konstruiert. Es sind Statiker*Innen, Materialwissenschaftler*Innen, Architekt*Innen und viele andere anwendende Wissenschaftler*Innen beteiligt, die ihren Teil zur komplexen Kausalitätsbetrachtung beitragen. In der Medizin ist das nicht anders. Biologische Systeme sind jedoch komplexer als technische Systeme, was bereits in der Biologie zu den verschiedensten Kausalitätshypothesen führt, zu anatomischen, embryologischen, entwicklungsgeschichtlichen, zu funktionellen, zu regulatorischen und vielen anderen mehr. In der Biologie gibt es nicht die eine Erklärung für die Phänomene, auch nicht das eine Erklärungspaket. Viel schwieriger wird es, wenn die Medizin zusätzlich zum überkomplexen biologischen System Mensch die ungeheure Variabilität vor allem des Unnormalen denkerisch bearbeiten muss. Die Ärzt*In mag kausale Zusammenhänge entdecken, so ist die Beziehung von Ursache und Wirkung in Abhängigkeit von der Patient*In, vom Ort, von der Zeit und auf der Ebene der beobachtbaren Phänomene sehr unterschiedlich, unterschiedlich in ihrer quantitativen qualitativen Ausprägung. In einem multikausalen Geschehen treffen innere und äußere Ursachen zusammen, so dass »wir in der Medizin nichts herleiten«15 können. So kann die Ärzt*In eine Therapie einleiten, die bei einer ganz bestimmten Konstellation statistisch die erfolgversprechendste ist. Sie kann jedoch für die je einzelne Patient*In keine deduktiven Schlussfolgerungen vornehmen, die zwingend zum Erfolg infolge der eingeleiteten Maßnahmen führen. Wir Ärzt*Innen sind nicht annähernd in der Lage, das Kausalitätsknäul entwirren zu können.
Die sogenannte individualisierte Medizin hat allerdings genau das auf ihre Fahnen geschrieben. Seit einigen Jahren geistert das Wort von der personalisierten Medizin16 durch die medizinische Welt, zunehmend auch durch die Laienpresse und die Gesundheitspolitik. Letztlich gehen ihre Verfechter*Innen von bestimmten in der Bevölkerung vorhandenen oder nicht vorhandenen Eigenschaften aus, meist in den Genen verortet, die mit molekularbiologischen Methoden dargestellt werden können und eine Gruppe identifizieren, die auf eine Therapie besonders gut oder besonders schlecht ansprechen. Letztlich ist damit jedoch eine sichere Aussage über den Verlauf der Erkrankung nicht möglich. Wir haben zwar eine feinere statistische Diskriminierung der Gruppen. Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines bestimmten Ereignisses bei einer bestimmten Gruppe kann für die jeweilige Gruppe besser vorausgesagt werden, doch gibt es in den jeweiligen Gruppen weiterhin Therapieversager, trotz hoher Wahrscheinlichkeiten für die Wirksamkeit einer Therapie und auch Therapieprofiteure, obwohl ihre Gen-Ausstattung ein Ansprechen der Therapie nicht hätte erwarten lassen. Ein deduktives Vorgehen mag in der personalisierten Medizin mit höheren Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Gruppen einher gehen, die Gesamterfolgsrate kann sie jedoch nicht steigern, vielleicht senkt sie sie sogar, weil den seltenen Ausnahmen im Ansprechen eine für sie erfolgreiche Therapie vorenthalten würde. Vielleicht verändern sich die Nebenwirkungswahrscheinlichkeiten, da Patient*Innen keiner unnötigen toxischen Therapie ausgesetzt würden, aber würden wir tatsächlich keine Therapie einsetzen, nur weil bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung die Ansprechwahrscheinlichkeiten schlecht sind? Wohl kaum! In jedem Fall eines guten Ansprechens einer jeden Therapie würde die behandelnde Ärzt*In sich freuen. Für Patient*Innen der einen Gruppe könnte sie eine Ursache angeben, für die der anderen Gruppe nicht. Vielleicht hätte sie eine Vermutung – vielleicht. Auffallend ist dabei allerdings, dass die Ärzt*In erst nach dem Therapieversuch die Kausalität bemüht, nicht zuvor. Zuvor denkt die Ärzt*In mit Wahrscheinlichkeiten, nur ganz entfernt mit Kausalitäten. Die tauchen in der denkerischen Rekonstruktion des Geschehens auf, indem der Therapieentscheidung nachträglich ein teleologischer Kausalnexus zugesprochen wurde. Die Zuschreibung erfolgte »danach«17, nicht davor, davor vielleicht als vage Idee, bestimmt nicht als sichere Aussage. Die bleibt dem Krankheitsverlauf vorbehalten, der sich in der rückblickenden Betrachtung gewiss als Null oder Eins herausstellt. Zum derzeitigen Zeitpunkt der Medizin – ob es je anders sein wird ist nicht unsere Frage – stellt sich die Medizin in weiten Teilen auch ihrer wissenschaftlichen Disziplin als eine Kunst dar, die »eine ungeheure Anzahl von Zusammenhängen miteinander«18 verbindet und den medizinischen Phänomenen versucht eine Typisierung zu verleihen, wo ursprünglich das Chaos herrschte. Wir brauchen heute nur auf eine Graphik zu schauen, die die bekannten Signal- und Steuerungswege innerhalb einer Zelle für eine onkologische Erkrankung darstellt. Es ist ein Gewirr von miteinander interagierenden Prozessen, die sich neutralisieren, hemmen und verstärken oder sonstiges, das wir gewiss noch nicht kennen. Das Krankheitsgeschehen bleibt ein wirres Konglomerat an Phänomenen, das als Ganzes irrational wirkt. In der Medizin geht es jedoch nicht um das Ganze, sondern um den je Einzelne*n. Innerhalb des Chaos der Phänomene müssen die gefunden werden, die auf die Patient*In zutreffen und aus diesen muss die behandelnde Ärzt*In die aussuchen, die zu einer rationalen Entscheidung führen. Der Entscheidung liegen vielleicht keine sicheren Kenntnisse der Kausalzusammenhänge zugrunde, obwohl zumindest Wahrscheinlichkeiten über den Eintritt des Ereignisses von der behandelnden Ärzt*In angegeben werden, wohl wissend, dass diese Abstraktionen keine Individualaussage zulassen. Zumindest wird so eine Lichtung des Typischen in den Wald der Atypien geschlagen. Ab diesem ersten Punkt der Rationalität im Irrationalen bestimmt das zeitliche Geschehen die Interpretation der medizinischen Phänomene. Die Krankheit ist nämlich kein dauerhafter Zustand, »sondern ein sich unablässig verändernder Prozeß, der seine eigene zeitliche Genese, seinen Verlauf und Hingang hat.«19 Die Zeitlichkeit gibt dem Atypischen eine individuelle Richtung, sie verwandelt das amorphe Chaos in eine »konkrete Einheit.«20 Nicht umsonst sprechen wir von einer Kranken-Geschichte. Innerhalb der Zeitlichkeit des Lebens mischt sich die Atypie ein und verändert die die Zeitlichkeit des Lebens anzeigenden Phänomene. Das Leben in seinem Verlauf besitzt eine eigene Zeitlichkeit, sowohl individuell als auch in größeren oder kleineren Gruppen. Auch Krankheiten haben so etwas wie eine Geschichte. Es gibt definierte Erkrankungen aus vergangenen Zeiten, die wir als die Erkrankung wie sie damals war heute nicht mehr kennen können, so wie es heute Krankheiten gibt, die es in der Art zukünftig nicht mehr geben wird. Ebenso gebieten definierte Erkrankungen oft einen ganz spezifischen Verlauf und drittens besitzen Erkrankungen bei einem Individuum ihren individuellen Ablauf in der Zeit. Das Individuelle der Erkrankung wie das Typische der Krankheit treffen auf einen typischen Menschen, der zugleich ein individueller Organismus ist. Krankheiten können an geographische, soziale, politische Vorbedingungen geknüpft sein.
Wir sehen, dass das Chaos der Vielfalt sich wesentlich in der Zeit abspielt, was zu Flecks Behauptung führt, dass der Krankheitsbegriff eine geschichtliche Fassung habe.21 Für die praktisch tätige Ärzt*In besitzen die Phänomenologie der Zeitlichkeit und die Phänomenologie der kranken Patient*In in der Zeit einen hohen, nicht zu unterschätzenden Wert. Die Anamnese bildet den Grundstock und das Fundament des ärztlichen Denkens. Selbst ein banales mechanisches Ereignis wie ein Knochenbruch besitzt eine Geschichte, die von den Unfallmechanismen erzählt, von den Konsequenzen für die Gegenwart und die Zukunft der Verunfallten. Die Versorgung der Fraktur erfolgt hoffentlich nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin, die ärztliche Betreuung richtet sich nach den Kriterien der narrationsbasierten Medizin, denn Medizin muss stets beides im Auge behalten, die Tatsachen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft und die erzählte Geschichte der Patient*In vor, während und nach ihrer Erkrankung. Hinzu gesellt sich die ungeheure Anpassungsfähigkeit des menschlichen Organismus, indem Anomalien durch andere Organe ausgeglichen werden können oder eine Verstärkung erfahren. Die Krankheit wird zu einem dynamischen Prozess sich gegenseitig beeinflussender Faktoren, ohne dass eindeutig festgestellt werden könnte oder müsste, was nun krank und was gesund ist. Wenn sich Krankheit und Gesundheit so eindeutig in ihrem Wechselspiel nicht unterscheiden lassen, kann Gesundheit »als die im gegebenen Moment günstigste Krankheit«22 bestimmt werden. Für das ärztliche Denken entsteht ein Bild der Vielfalt, der Inkommensurabilität, der paradoxen Zusammenhänge, das nur denkend bewältigt werden kann, wenn ständig ein neuer Standpunkt eingenommen wird. Es kann darum nicht erstaunen, dass es zu einer Situation einer Patient*In mehr ärztliche Meinungen gibt als Ärzt*Innen daran beteiligt sind.
Das auch in der Medizin geltende Kausalitätsprinzip ist kein einfacher Ursache-Wirkungszusammenhang, es ist eine dynamische Durchdringung und Überlagerung verschiedenster Prozesse zu einem spezifischen Komplex von Phänomenen. Wo die naturwissenschaftliche Beobachtung einen genauen Punkt angeben kann, dort beschreibt die Medizin einen größeren Flecken mit unscharfen Rändern. Mit einem Bild macht Fleck diesen Unterschied klar. Die Naturwissenschaftler*In arbeitet mit geradlinigen Koordinaten, die in einem festen Winkel zueinander stehen. Der Schneidepunkt der Koordinaten bildet den gesuchten Punkt. In der Medizin sind die Koordinaten geschwungen, beweglich, manchmal vor- manchmal rückläufig zugleich, so dass es eine Vielfalt der sich kreuzenden Koordinaten gibt, eine flächige Wolke der Erscheinungen. Für die Ärzt*In ergeben sich aus solchem Denken erhebliche Konsequenzen. Die Diagnose und die Therapie stehen stets unter einem Vorbehalt. Was heute gilt, kann morgen schon falsch sein, was heute falsch ist, ist morgen geboten. Folgerichtig bezeichnet Fleck das naturwissenschaftliche Koordinatensystem als das System Descartes und das der Medizin als das System Gauss. Das ärztliche Denken produziert eine sich bewegende Wolke, das naturwissenschaftliche einen idealen Punkt ohne Fläche. Medizin ist deshalb keine angewandte Naturwissenschaft, das sind cum grano salis die Ingenieurwissenschaften. Es mag Mediziner*Innen geben, die rein naturwissenschaftlich denken, weil ihr Interessens- oder Forschungsgegenstand nach der klaren Methodik des Systems Descartes verlangt. Wenn sie aber als Ärzt*In mit dem kranken Menschen zu tun hat, wird sie ihr naturwissenschaftliches Denken um die andere Methode des Systems Gauss erweitern – oder besser: modellieren, aus geraden Koordinaten gebeugte machen, aus gerichteten ungerichtete. Der Krankheitsbegriff gewinnt einen schwebenden Charakter, er ist unbestimmt, variabel in der Zeit, variabel in der Konkretisierung am Individuum. Eine eindeutige Antwort, welche Krankheit jemand habe, ist nicht zu geben, vielleicht im Definitionsrahmen einer ganz schmalen medizinischen Sparte, die von den Anfeindungen der Skepsis nicht betroffen scheinen, vielleicht innerhalb sektenartiger Gewissheitsgemeinschaften, deren Weltbild so eindeutig und klar ist, dass es einen Zweifel nicht zulässt. Zweifelsohne gehört zu derartigen Gewissheitsgemeinschaften auch das bürokratische Gebilde des Gesundheits-, besser: der Krankheitsverwaltung bestehend aus der Sozial- und der Arzneimittelgesetzgebung, den Kassenärztlichen Vereinigungen, den Krankenkassen, der Rechtsprechung, dem Verhältnis zu außermedizinischen Bereichen wie z. B. der „Krankschreibung“ einer Patient*In gegenüber der Arbeitgeber*In. Überall wird eine eindeutige Benennung der Erkrankung oder der Krankheit verlangt, die dann noch dargelegt in der Kurzform einer Nummer einem exakten Punkt im Feld des Möglichen und des Unwahrscheinlichen entspricht. Jemand muss zumindest eine Krankheit haben, damit sie amtlich als Kranke anerkannt wird, wenigstens muss ein Verdacht auf … ausgesprochen sein. Ob es der Patient*In gut oder schlecht geht ist zunächst nicht das Problem. Das erste ist die Krankheitsnummer mit der alle weiteren tatsächlichen Maßnahmen begründet werden können. Auf bürokratischer Ebene bestehen eindeutige Wenn-Dann-Beziehungen, so auch z. B. in den Flow-Charts der heute so beliebten Leitlinien. Der Bezug erfolgt über das Geschriebene, über das Zitat, nicht unähnlich dem Vorgehen der Scholastiker. Man schaut nach, was geschrieben steht und dreht sich die Ansicht der Welt so, dass sie in das Schema passt, einem eineindeutigen Schema, weil es auf dem Dogmatismus der Schriftgelehrten beruht, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Interpretation von Schriften, sogenannten Studien, geschult sind und institutionell zur Festlegung der Dogmatik berufen wurden. Ärzt*Innen, vor allem wissenschaftlich ausgebildete Ärzt*Innen, müssten es eigentlich besser wissen. Sie bewegen sich als Dienstleister*Innen für die Bürokratie nicht mehr im Bereich der ärztlichen Medizin. Eine Verwaltungsbeamt*In, eine Jurist*In denkt anders als eine Ärzt*In. Die Verwaltungsbeamt*In arbeitet nicht ohne Grund mit Formularen, denn sie muss formal den Vorschriften genügen. Wo es Interpretationsspielräume gibt, gibt es eine Lücke in den Vorschriften, die vielleicht noch nicht beachtet oder vom Gesetzgeber und der Politik, offengehalten wurde. In diesem Sinne sind Verwaltungen Idealist*Innen. Dagegen ist die Ärzt*In eine Nominalist*In, die die Individualität der Patient*In herausarbeiten muss und letztlich diese Individualität nicht in der Art einer spezifischen Krankheitsentität benennen kann. Die Krankheitsbezeichnung ist immer eine Hilfskonstruktion mit allen Einschränkungen, die denkbar sind. Erst Jahre des Trainings führen zu Situationen, in denen eine Ärzt*In die andere überhaupt verstehen kann. Man muss vieles gesehen, erfühlt und erlitten haben, nur dann ist Verständigung möglich, mit sich, den Kolleg*Innen und den Patient*Innen.
Die üblichen Wissensquellen für Medizinstudent*Innen sind das Lehrbuch, die Schule des theoretischen Unterrichts und der pädagogischen Vermittlung des Lernstoffs. Eine andere Wissensquelle ist die ganz spezifische Art der ärztlichen Erkenntnis vor dem Hintergrund medizinischer Theorien innerhalb der ärztlichen Denkgemeinschaft. Die Theorien formen zwar bloß den Hintergrund, doch ohne den Kontrast zum Hintergrund würde niemand je irgendetwas erkennen können. Vor ihm nämlich agieren auf der Bühne der Praxis die ärztlichen Fachleute. Vor dieser sitzen wie in einem Theater die Laien. Funktioniert nun die Erkenntnis der Fachleute eines Wissensgebietes wie der Medizin in derselben Weise wie die eines Laien, der sich die Theorie dieses Wissensgebietes aneignete?23 Sehen und fühlen wir nicht dasselbe, eine ungetrübte klare Anschauung der Wirklichkeit wie sie ist und können wir nicht bei demselben theoretischen Wissen zur selben Erkenntnis kommen, die Laien und die Fachleute? Fleck fragt weiter, ob es nicht gewisse »Elemente des Wissens« gibt, »deren Genese weder empirisch noch spekulativ, sondern allein soziologisch«24 sind? Bedarf es einer spezifischen Sozialisation, um genau so zu denken wie eine Ärzt*In denkt? Das würde sofort die Frage folgen lassen, ob nur Fachleute das erkennen können, was Fachleute desselben Fachgebietes erkannten? Und wie sieht es dann mit der Struktur des jeweiligen Denkens aus? Ist zumindest diese Struktur ähnlich, dass vielleicht Fachleute verschiedener Fachgebiete einander wenigstens über Strukturähnlichkeiten verstehen können?
Ein Erlebnis im eigenen persönlichen Umkreis mag die Problematik plastischer darstellen. Man sprach über eine Bekannte, die schwer erkrankt für viele Wochen das Krankenhaus nicht verlassen konnte. Am Gespräch waren eine Geistliche Begleiter*In mit dem Segen der Katholischen Kirche beteiligt, eine Psychotherapeut*In, eine Biolog*In und zu guter Letzt auch eine Ärzt*In. Alle hatten aus guter Freundschaft zu der Erkrankten aktiv am Krankheitsgeschehen teilgenommen, insbesondere durch die Übernahme der Kinderbetreuung im Wechsel. Zu den Zeiten, da es mit der Genesung nicht so recht voran gehen wollte, da Rückschläge drohten, besprachen sich die Frauen. Alle waren sie Fachleute für ihr Gebiet: die Kontemplation, die Psychotherapie, die Biologie, die Medizin. Schon die Fragestellungen waren andere, so waren die Möglichkeit eine Antwort zu finden je verschieden. Die Spirituelle Begleiter*In im Segen der Katholischen Kirche fragte nach der Bedeutung der Erkrankung mit ihren vielen Prüfungen für die Erkrankte. Die Psycholog*In versuchte, sich in das Gefühlsleben der Erkrankten einzufühlen, voller Empathie, emotional nachvollziehend, was die Psyche wohl erlebt haben mag. Die Biolog*In fragte nach dem Messbaren, den Laborwerten und dem Sichtbaren, dem feingeweblichen Befund. Hätten sie sich auf dem Boden ihrer jeweiligen Fachgebiete treffen können? Als Professionelle des Berufes, deren Angehörige sie waren? In ihrer Eigenschaft als Psycholog*In: hätte vielleicht sie ein Verständnis für die Frage nach der Krankheitsbedeutung und ein Verständnis für die Biologie der Erkrankung gehabt? Vielleicht nur ein Verständnis, das die Fragestellung als eventuell mögliche betrifft? Schwierig wäre ein Verständnis der Seelsorger*In für die Ärzt*In herzustellen gewesen, umgekehrt selbstverständlich auch. Die Professionellen konnten sich nicht verständigen, die Laien sehr wohl, denn sie waren der Denkdisziplin ihres Faches nicht mehr unterworfen. Der Ärzt*In ging es nicht anders. Irgendwie hatte sie mit allem zu tun, der Bedeutung, der Empathie, der Biologie, aber doch irgendwie anders, nicht professionell in diesen Dingen, sondern professionell in der Beurteilung der klinischen Situation, wie es der Patient*In gehe und was zu tun sei. Das war ihre professionelle Frage, wissen wie das aktuelle klinische Bild sich darstellt und probieren, darauf eine positiv wirkende Handlung für die Patient*In zu finden. Die Professionalität der Ärzt*In ist die diffuseste, eigentlich ist sie als Ärzt*In in der Spiritualität, in der Psychologie und in der Biologie ein Laie und letztlich kann es nur eine Verständigung zwischen den Frauen geben, wenn sie auf ihre Professionalität verzichten und sich als Laien begegnen, dann bilden sie ein Gruppe und können den Denkstil pflegen, der für die Gruppe üblich ist. Auch für Ludwik Fleck ist klar, dass eine Verständigung grundsätzlich nur innerhalb einer Gemeinschaft möglich ist.25 Selbst wenn die Verständigung zwischen verwandten Gemeinschaften stattfinden soll, ist sie nur sehr unvollständig möglich, indem die Worte bei einer Wanderung zwischen den Gemeinschaften ihre Bedeutung verlieren, zumindest verändern. Der Sinn verändert sich umso stärker je weiter die Gemeinschaften voneinander entfernt sind, desto schwieriger wird die Verständigung, bis die Fremde einen Grad erreicht hat, wo ein Austausch vollkommen unmöglich ist. Aus diesem Grund verstehen wir kaum mehr die Denkbewegungen der Menschen früherer Epochen. Wir gehen zu leicht von einem Fortschritt aus, der die alten Ideen, der das alte Denken überflüssig mache, weil heute die Wahrheit näher erreicht worden sei. Da wir in einer anderen historischen Situation leben und damit in einer anderen Denkgemeinschaft, sind wir zum Verständnis der alten Zeiten unfähig, vielleicht schon für die der Eltern und für die der Kinder. Nur noch mit Unverständnis verfolgen wir heute die anatomischen Abhandlungen des Mittelalters, die tatsächlich der Ansicht waren, dass der Mann auf einer Körperseite nur elf Rippen habe, insgesamt eben dreiundzwanzig. Konnten sie nicht zähen, waren sie die perfekten Ignorant*Innen? Ihre Frage war, wie der Körper aussehen sollte, nicht wie er tatsächlich aussieht.26 Weil die Bibel erzählt, dass die Frau aus der Rippe des Mannes erschaffen wurde, konnte der Mann nur dreiundzwanzig Rippen haben, der Schöpfungsplan sah es so vor. Der damaligen Anatomie reichte es, diese Frage mit ihren Denkmitteln zu beantworten. Der tatsächliche Körper interessierte sie nicht. Wir können also nicht sagen, dass es so etwas wie eine »unvoreingenommene, reine Beobachtung«27 gibt, weder historisch, noch psychologisch, noch sozial. Niemals gab es die singuläre Forscher*In, die durch reine Beobachtung zu einer objektiven Erkenntnis gelangt wäre. Es bedarf einer Schule des Sehens, die sich im Rahmen einer Denkgemeinschaft entwickelt. Der mittelalterliche Mensch konnte die nicht fehlende Rippe des Mannes nicht sehen, es fehlte ihm dazu die dafür notwendige Schulung des Auges, die es erlaubte, die zwölfte Rippe zu tasten, zu sehen, zu registrieren. Es ist »ihr andersartiger Denkstil«28, der den »Stil unserer gedanklichen Beobachtungsmittel«29 prägt. Geistliche Begleiter*Innen erlernen einen anderen Denkstil als die Psycholog*Innen und diese wieder einen anderen als Biolog*Innen oder Ärzt*Innen. Die über geteilte Auffassungen, Theorien und Ideale eintrainierten Stilmittel der Beobachtung produzieren exakt das Bild der Natur, das genau diejenigen erkennen, die jener spezifischen Beobachtungsart angehören. Fleck behauptet, dass eine leere Seele überhaupt nichts sehen kann. Deshalb gilt: »Es gibt keine anderen naturgetreuen Beobachtungen als die kulturgetreuen.«30 Der mittelalterliche Mensch lebte in einer anderen Kultur als der moderne und Naturwissenschaftler*Innen in einer anderen als Theolog*Innen. Brücken gibt es zwischen den Welten kaum und wenn, dann nur sehr schmale. Wenn die erlernten Stilmittel der Beobachtung eine ganz bestimmte Art der Perspektive auf einen Gegenstand der Natur bewirken, kann auch nur die Person eine Beobachtung aus der jeweiligen Perspektive nachvollziehen, die ihr als Stilmittel der Beobachtung zur Verfügung steht. Nur innerhalb einer spezifischen Kulturgemeinde ist ein weitest gehendes Verständnis für spezifische Beobachtungen der sogenannten Natur denkbar, wobei immer regulativ im Hinterkopf mit bedacht bleibt, dass jeder Mensch den verschiedensten Gemeinschaften angehört, dass jeder Mensch seinen speziellen Standpunkt einnehmen muss, so dass kleinste Verschiebungen der Perspektive stets vorhanden sind. Diese kleinsten Änderungen der Perspektiven einer Denkgemeinschaft verändern die Beschreibung und die Interpretation einer Beobachtung innerhalb dieser Gemeinschaft, so dass der Kreislauf eines Gedankens grundsätzlich immer mit dessen Umgestaltung verbunden ist.31 In komplexen Gesellschaften erfolgt die Kommunikation jedoch nicht nur innerhalb einer Denkgemeinschaft. Beobachtungen werden nicht nur allein um der Beobachtung willen gemacht. Die meisten Beobachtungen erfolgen für einen praktischen Gebrauch. In der Medizin wird eine Patient*In untersucht, weil irgendetwas getan werden soll oder muss, selbst wenn es die Handlung des Nichtstuns sein sollte. Bevor es an die Therapie geht, wird die Patient*In aufgeklärt, ihr müssen die Beobachtungen erklärt werden. Damit gibt es eine, die ihre Gedanken über Beobachtungen in ihrer Denkgemeinschaft einem anderen Menschen, der Vertreter eines oder mehrerer verschiedener Denkstile ist, mitteilen muss. In der praktischen Medizin stehen wir tagtäglich vor solch einer Herausforderung. Wir wissen, dass eine Verständigung eigentlich unmöglich ist.
Die Mystiker*In kann die Naturwissenschaftler*In nicht verstehen und umgekehrt und doch müssen sie miteinander kommunizieren, wenn sie ihren Beobachtungen übersubjektive Gültigkeit zuschreiben wollen. Gedanken, die an ein anderes Denkkollektiv gerichtet sind, sollten so umformuliert werden, dass das Subjekt des anderen Denkkollektives sie als Umgeformtes verstehen kann. Gedanken eines Denkstils können jedoch nicht vollständig in Gedanken eines anderen Denkstils transformiert werden. Durch die Transformation entsteht ein neuer Gedanke, der dann vielleicht von Vertreter*Innen beider Denkstile verstanden wird, wobei durch die Transformation ein neues, nun gemeinsames Denkkollektiv geformt wurde. Der Gedanke hat wesentliche Umformungen erfahren und ist letztlich nicht mehr der Gedanke, der er ehemals war. Doch es geht nun nicht mehr um die Beobachtung als solche, nicht mehr um eine Perspektive der Wahrheit, es geht um den intentionalen Gehalt eines Gedankens jenseits der Wahrheit. Im praktischen Leben müssen wir uns auf eine gemeinsam verantwortete Handlung einigen, wir müssen uns jenseits der Denkstile auf ein Tun konzentrieren, das im neuen gemeinsamen Denkkollektiv verstanden wird, egal wie unterschiedlich das Verständnis in den ursprünglichen Denkkollektiven gewesen wäre. Dass der neue Denkstil Gedanken hervorbringt, die ausschließlich in diesem neuen Denkkollektiv denkbar sind, ist folgerichtig. In der neuen Gemeinschaft lassen sich dann auch Beobachtungen und Ansichten mitteilen, die sonst nie geäußert worden wären.32 Bestimmte Gemeinschaften zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Situation können als Kollektiv produktiv werden. Neues ist jenseits dieser Kollektive nicht zu erwarten.
Um fortschreitend produktiv zu sein, bedarf es der produktiven Gemeinschaft. Durch die Umformung der Denkinhalte spezifischer Denkstile zum Zweck der gemeinsamen Kommunikation über Denkstile hinweg, findet ein kreativer Prozess statt, der im Sinne des Fortschritts Denkgrenzen überwinden kann, aber nicht muss. Fleck weist auf soziale Strukturen des jeweiligen Denkkollektives hin, die vom Verhältnis der Elite zur Masse der Durchschnittlichen abhängt. Wo die Eliten sich anstrengen müssen, um die Gunst der Masse zu gewinnen, dort ist das höchste Kriterium »die Anerkennung aller, über jede Wahrheit kann und soll man diskutieren.«33 Solche Kollektive besitzen offene Grenzen, neue Mitglieder sind willkommen. Die Zukunft ist ihr Thema, der Fortschritt weiterer Entwicklungen. Die Grundsätze derartiger Kollektive könnten beinahe demokratisch genannt werden. Die Wirklichkeit wissenschaftlicher und medizinischer Kollektive sieht jedoch regelhaft anders aus. Wo eine Elite die Masse dominiert, da »blühen Zeremonie und Dogmatik auf.«34 Das Kollektiv orientiert sich an der Vergangenheit, die Traditionen werden gepflegt, Unterordnung und Gehorsam sind gefordert. Demokratisch mögen die Strukturen sein, ihr Geist eher nicht. Es gibt Herrscher und Untergebene, die Elite und die Masse, wobei wie naturgegeben die Elite vorgibt, wie zu denken sei. In der Wissenschaft kann eine solche Gemeinschaft nicht kreativ tätig sein, allenfalls mit der Kombination des Bekannten innovativ. Sie suhlt sich in ihren einstigen Erfolgen, schaut zurück, nutzt immer wieder dieselben Methoden, um die ewig gleichen Varianten an Fragestellungen abzuarbeiten. Die Grenzen des Kollektives sind abgeschlossen, neue Mitglieder sind nicht willkommen und wenn, dann nur in der Pose der Unterwerfung. Für kreative Ideen in der Wissenschaft und für deren Ausarbeitung im Prozess der Forschung ist ein freies, offenes zukunftsorientiertes soziales Wissenschaftsumfeld notwendig. Das Beharren auf der Tradition um der Tradition willen ist kein wissenschaftsfreundliches Umfeld, weil die Gedanken der Mitglieder des Denkkollektivs eher Folklore betreiben als aus dem Tradierten etwas Neues entstehen zu lassen. Sie können Lösungen anbieten und tun das auch oft und unaufgefordert, aber es sind Lösungen für Probleme aus der Vergangenheit, die heute als Problem gar nicht mehr verstanden werden können. Die zur Folklore eines Denkkollektives verkommenen Traditionen sind nicht mehr als leere Parolen, die allenfalls der scharfen Abgrenzung dienen, meist jedoch einer dumpfen Binnenversicherung der eigenen Exzellenz, die mit allen zur Verfügung stehenden Machtmitteln verteidigt wird. Elitismus ist nicht mehr als eine inhaltsleere degenerierte Pose, die Elite nicht mehr Elite, die Fachleute haben ihren Fachstatus verloren. Als soziales Wesen gehört jedes Individuum verschiedensten Denkkollektiven an. Die wenigsten der Denkkollektive erlauben ihren Mitgliedern mehr als das Mit- und Nachsprechen konventioneller für Wissen ausgegebener Parolen. Viele Denkkollektive, wie z. B. die Ingenieurwissenschaften oder die Medizin, grenzen sich durch lange Jahre der Ausbildung, durch viele zu bestehende Examina, durch gesetzliche Zugangsbestimmungen und mittels staatlich vergebener Zulassungen wie z. B. der Approbation bei Ärzt*Innen sehr effektiv ab. Die Aufnahme eines Mitgliedes ist streng geregelt und wird oftmals zeremoniell vollzogen, was Fleck ein »Aufnahmesakrament«35 nennt. Nun sind die Mitglieder eines Denkkollektives in sehr unterschiedlicher Weise an der Entwicklung des jeweiligen Denkstils beteiligt. Gleichwohl gibt es etwas wie eine kollektive Stimmung innerhalb der Gemeinschaft, die eine spezifische Kollegialität produziert. Wenn man sich als Kolleg*In zu erkennen gibt, hat man zumindest eine minimale Gemeinsamkeit, auch wenn z. B. die Rolle einer Ärzt*In die der Patient*In geworden ist. Die gemeinsame Initiation durch das Aufnahmesakrament und die spezifische Kollegialität einer Gemeinschaft bedeutet jedoch nicht Gleichheit der Individuen im Rang innerhalb z. B. der Medizin. Jede Ärzt*In ist approbiert, jede Ärzt*In nennt sich Kolleg*In und jede Ärzt*In darf für sich in Anspruch nehmen, eine ausgewiesene Fachfrau oder ausgewiesener Fachmann zu sein, sonst dürften sie die Berufsbezeichnung Ärzt*In nicht führen. Obwohl alle Mitglieder im Rahmen einer gruppeninternen Denksolidarität am gemeinsamen Projekt Medizin teilhaben, gibt es jene, die den Denkstil prägen und vielleicht vorantreiben und jene, die in einer eher rezeptiven, repetierenden Rolle verharren, die gleichwohl für den ärztlichen Alltag und für die unmittelbare Patient*Innenversorgung ausreichend ist. Die stilprägenden Mitglieder des Denkkollektives Medizin sind jedoch allein aufgrund ihrer stilprägenden Eigenschaften nicht die besseren Ärzt*Innen in der Versorgung der Patient*Innen. Sie stehen nur näher in Kontakt zur kollektiven Denkbewegung und agieren schöpferischer mit dem sich stets entwickelnden Denkstil. Diesen kleinen Kreis nennt Fleck den esoterischen Kreis.36 Diejenigen Mitglieder, die nur durch Vermittlung partizipieren, z. B. über Fortbildungen und nicht in der wissenschaftlichen Diskussion stehen, bilden den größeren exoterischen Kreis.37 In der Medizin sind die Gestalten des esoterischen Kreises z. B. Universitätsprofessor*Innen, die noch weiter forschend tätig sind, z. B. Mitglieder von Leitlinienkommissionen oder auch manche Chef- und Oberärzt*Innen. Das Gros der Ärzt*Innen findet sich im exoterischen Kreis. Sie sind Fachleute für die Übersetzung der Erkenntnisse der wissenschaftlichen Medizin, was sich dann im klinischen Können beweist. Die Mitglieder des esoterischen Kreises können als die Elite des Denkkollektives bezeichnet werden, die des exoterischen Kreises als die Masse. Wie in jeder Gemeinschaft gibt es in der Medizin eine »charakteristische Konkurrenz zwischen Elite und Masse, den Widerstand der Masse gegen die Elite (...) und die Abneigung der Elite gegenüber der Masse (...).«38 Bei den Eliten kann sich die Abneigung bis zur Verachtung steigern, bei den Massen kann sich der Widerstand zum Spott und zur Ignoranz gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickeln. Der aktuelle Denkinhalt in der Medizin ist zumeist verfasserlos.39 Inhaltliche Änderungen und Erweiterungen, aber auch neue Denkwege werden in der Medizin weder von den Eliten noch von der Masse im Alleingang zustande gebracht. Erst das Kreisen der Idee, eines Vorschlages etc. im Kollektiv, aber auch schon der Weg zur entstehenden Innovation, ist durch eine lange Formung und Umformung durch die Gemeinschaft geprägt. In der anhaltenden Diskussion mögen bestimmte Bereiche mehr oder weniger Interesse hervorrufen, bestimmte Postulate können sich in der allgemeinen Stimmung entwickeln, die vielleicht in einem Begriff kondensieren. Erst wenn dieser das gesamte Kollektiv durchlaufende Prozess eine gewisse Reife erfährt, ist vielleicht eine Person in der Lage, das aus der allgemeinen Stimmung geborene Postulat ausdrücklich zu formulieren. »(D)as Kollektiv wird ihn als den Entdecker anerkennen, aber ihr Urheber ist eigentlich nicht er, sondern die kollektive Stimmung.«40 Die Spannungen zwischen der Elite und der Masse lassen sich vielleicht mit einer derartigen Analyse leichter entschärfen. Die Leistung einer Person, die es zuwege bringt, ein für das Denkkollektiv wesentliches Postulat zu formulieren, um somit die allgemeine Stimmung auf den Punkt zu bringen, darf nicht unterschätzt werden. Sie bilden, wenn auch oft unbekannt und nicht in den Machtzentralen beheimatet die Elite ihres jeweiligen Faches. Das schließt freilich mit ein, dass die als Elite ausgewiesene Person des einen Denkkollektives in den vielen anderen Kollektiven, wo sie Mitglied ist, eben doch in den exoterischen Kreis gehört, vielleicht sogar zu den absoluten Laien. Eine zum esoterischen Kreis eines Denkkollektives gehörende Person muss diesem Kreis nicht für immer angehören. Die Elite hat sich fortwährend durch Leistung zu behaupten und zwar durch Leistungen, die für den Denkstil prägend und innovativ sind. Allein eine leitende Position im Medizinbetrieb zu bekleiden genügt nicht. Die Verweise auf ehemalige Leistungen, die den Status innerhalb des esoterischen Kreises begründeten, genügen nicht. Auch wenn viele z. B. an ihren Posten klebende Hochschullehrer*Innen schon lange nicht mehr wissenschaftlich tätig sind, verteidigen sie ihren Elitestatus mit den politischen Mitteln, die ihr Amt ihnen zur Verfügung stellt. Möglicherweise sind sie weiterhin überzeugt, den Posten wirklich verdient zu haben, vielleicht benötigen sie den Elitestatus innerhalb ihres Denkkollektivs für eine bessere Positionierung in der Hackordnung andere Kollektive, meist aber wird es ein fehlgeleitetes Bewusstsein der eigenen Herrlichkeit sein. Das Gefühl, zur Elite zu gehören, kann süchtig machen, die Augen für die Realitäten werden zu leicht durch den Stolz verklebt, was nicht zu selten bei Akteur*Innen in den bestehenden Wissenschafts- und Medizinstrukturen zu bemerken ist. Der Verweis auf ehemalige Leistungen in Kombination mit den Machtmöglichkeiten eines Postens stützen Eliten, die vielleicht einmal Eliten waren, aber schon lange nicht mehr zu ihnen zählen sollten. Sie üben Macht innerhalb der Institutionen aus, gestalten deren Denkstil aber nicht mehr mit.
Gerne wird die Mitgliedschaft in einem esoterischen Kreis benutzt, um ohne adäquate Leistungen unter bewusster Missachtung der Leistungen anderer Mitglieder des anderen Denkkollektivs direkt wieder in den esoterischen Kreis dieses Denkkollektives aufgenommen zu werden, obwohl dort allenfalls eine Verortung im exoterischen Kreis angezeigt gewesen wäre, vielleicht nur mit dem Status des Laien. Gerade die Strahlkraft der Elite in einer kleinen Gemeinschaft lässt die alltägliche Einsicht außer Acht, dass jeder von uns vielen Kollektiven angehört. Die meisten von uns bekleiden in den meisten Kollektiven allenfalls den Rang eines Laien. Der Elitestatus ist die Ausnahme, nur kurz erreicht und schnell wieder verloren. Dass die sogenannten Eliten anders von sich denken, spielt dabei keine Rolle. Durch die Mitgliedschaft in den verschiedensten Denkgruppen erfährt der jeweilige Denkstils Umstilisierungen infolge der anderen Stilarten. Es kommt zu Umstellungen, zu Missverständnissen, zu mehrfachen Umgestaltungen. Im sozialen Kreislauf entwickelt sich ein völlig neuer Gedanke heraus, der mit dem Ursprungsgedanken nichts mehr zu tun hat. So kann für jedes Denkkollektiv angenommen werden, dass »gewisse Elemente des aktuellen Denkinhalts (...) verfasserlos sein«41 können. Der Weg durch den sozialen Kreislauf verändert den sozialen Wert der Aussage. Wird ein Erkenntnisinhalt popularisiert, bedient man sich der Umgangssprache, ist weniger präzise und vernachlässigt Einwände und Widersprüche. Der Adressat ist der Laie und »der Laie schenkt dem Fachmann sein Erkenntnisvertrauen.«42 Der Laie ist jedoch nicht in der Lage, die Fachleute zu kontrollieren. Die popularisierte Aussage der Fachleute wirkt viel »apodiktischer«.43 Der soziale Wert einer legitimierten Aussage ist ein gänzlich anderer. Der Aussage sollen die Merkmale »von Objektivität und Gewissheit«44 zukommen. Der soziale Werdegang eines Gedankens wird seiner Geschichte, seiner Psychologie und seiner Individualität entkleidet. Es bleibt eine nackte Aussage, die »den Schemata des Gesamtsystems«45 angepasst wird. Sie wird gleichsam zu einem Kondensat des Systems, das von der Denkgemeinschaft »als das einzig gute«46 angesehen wird. Eine derartige Aussage ist nicht mehr nur die Aussage z. B. einer Wissenschaftler*In. Sie repräsentiert in reiner Form die gesamte Denkgemeinschaft. In der Medizin haben Leitlinien manchmal einen solchen Charakter, man lauscht den vortragenden Fachleuten andächtig und staunt immer wieder über die ausgefeilten Methoden der Evidence based Medicine. Einen dogmatischen Anspruch können sie meist nicht verhehlen. In ihnen zeigt sich die reine Lehre, wobei die reine Lehre nicht die Aussage z. B. der Leitlinie ist, sondern das System der Methoden, die in der Denkgemeinschaft akzeptiert sind. Wer diesem System nicht glaubt, der kann nicht Mitglied der Denkgemeinschaft sein, es sei denn, es folgt quasi mechanisch den Regeln und bewegt sich an den äußersten Rändern des exoterischen Kreises. Vielleicht ist das Verhältnis der Schulmedizin zur Alternativen Medizin und umgekehrt mit sich überlappenden exoterischen Kreisen beschreibbar. Da die Systeme vollkommen anderen Denkwelten angehören, ist die Verständigung zwischen den Menschen der beiden Gruppen beinahe unmöglich, auch wenn beide Ärzt*Innen sein sollten. So kann ihr Denken völlig verschieden und jeweils gegenseitig unverständlich sein. Solcher Art sind die Schwierigkeiten mit der Verständlichkeit historischer wissenschaftlicher Texte in der Medizin, wie bereits am Beispiel der fehlenden Rippe beim Mann in anatomischen Atlanten des Mittelalters gezeigt. Sie betrieben eine Anatomie wie sie gemäß des Schöpfungsplanes der Bibel sein sollte. Wer zwölf Rippen auf jeder Thoraxseite des Mannes zählte, den interessierte nicht die Wirklichkeit, sondern das Ideal. Das Sollen sollte das Sein bestimmen. Auch ein streng mathematisch-wissenschaftlich vorgehender Physiker wie Isaak Newton (1642 – 1727) betrieb etwas, das man als mathematische Alchemie bezeichnen könnte, die mit unserem modernen Verständnis von Wissenschaft nur wenig gemeinsam hatte. Wir sind zwar in der Lage z. B. mit der Schwerkraft zu rechnen, wir verstehen sie jedoch nicht, solange wir nicht mehr in der Lage sind, mystisch zu denken wie es Newton tat. Tycho Brahe (1546 – 1601), der Astronom, der genauste Beobachter seiner Zeit, der die exaktesten Datenreihen über den Lauf der Gestirne zusammenstellte, dachte gemäß unserer heutigen Maßstäbe für rationales Denken ausgesprochen irrational. Der Gedanke, dass etwas so schweres wie die Erde sich nicht bewegen könne, sondern die so viel leichter wirkenden Sterne, war für Brahe völlig evident.47 An seinem Beispiel lässt sich gut zeigen, dass es alleine mit exakten Beobachtungen nicht getan ist. Das Auge muss wissen, was es erkennen soll, damit aus einem Sinneseindruck eine Beobachtung werden kann. Tycho Brahe arbeitete als Astronom vor dem Hintergrund des ptolemäischen Weltbildes. Er sah in den Himmel, vermaß die Planeten- und Sternenbewegungen vor dem Hintergrund seiner und der zeitlich gegebenen metaphysischen Annahmen. Seine Beobachtungen sollten nur eine weitere Erläuterung der als wahr angenommenen Annahmen sein. Nicht anders schaut eine Patholog*In ins Mikroskop. Sie erlernte das Sehen wie es für eine Patholog*In vor dem Hintergrund der metaphysischen Annahmen unserer heutigen Medizin als wahr erachtet wird. Nur innerhalb dieses Rahmens kann sie aus ihrem Sinneseindruck eine beschreibbare Beobachtung machen und aus dieser eine klinisch-praktische Diagnose, die wir als die Erkenntnis der Patholog*In bezeichnen wollen. Als religiös gläubiger Mensch interpretierte Tycho Brahe seine Beobachtungen und versuchte sie in das bestehende System einzupassen. Und die so entstandenen Erkenntnisse passten empirisch besser in das geozentrische System als die Beobachtungen, die ein heliozentrisches Weltbild als Hintergrundannahme hatten. Paul Feyerabend (1924 – 1994) untersuchte die damalige Datenlage sorgsam und konnte zeigen, dass empirisch die Katholische Kirche zur Zeit der beginnenden Moderne in der Auseinandersetzung mit Galileo Galilei (1564 – 1641) die Argumente auf ihrer Seite hatte.48 Tycho Brahe scheiterte als kosmischer Geist an der unbedingten Bindung seines Schicksals an seinen Glauben, an seine Metaphysik. So kann die fast als Erlösungsschau zu bezeichnende Passage in Max Brods (1884 – 1968) Roman Tycho Brahes Weg zu Gott interpretiert werden: »Längs dieser Kreise aber begannen die Sterne sich zu bewegen, so wie es sich Tycho vor Himmelskarten tausendmal vorgestellt hatte. (...) Er sah ja das, wonach er sich seit so vielen Jahren gesehnt und fruchtlos zerarbeitet hatte: den wahren Lauf der Sterne, der mehr war als astronomisches Wissen, nämlich eine offenbare Darstellung des göttlichen Gesetzes in der Weltordnung, ein höchster Zusammenhang, die begriffene Einheit des Geschaffenen, niedergelegt in flammenden Zeichen.«49 Wie anders tritt dagegen im Roman Johannes Kepler (1571 – 1630) auf. Über ihn wird gesagt: »Er hatte sein Herz an keine Theorie gehängt, zitterte für nichts und sehnte nichts herbei, verwarf mit Leichtigkeit seine eigene frühere Überzeugung; jede neue Beobachtung konnte alle früheren Resultate stürzen.«50 Tycho Brahe war jede Einzelheit wichtig, jeder Fortschritt in der Genauigkeit seiner Beobachtungen. Und doch war er nicht in der Lage, die so exakten Beobachtungen in der rechten Weise zu interpretieren. Nikolaus Kopernikus (1473 -1543) schien dagegen aus einem anderen Holz geschnitzt gewesen zu sein. Max Brod lässt Tycho Brahe im Roman sagen: »So bescheiden wie Kopernikus bin ich nun freilich nicht. Der sagte einmal, er wolle sich glücklich schätzen, wenn der wirkliche Lauf der Sterne von seinem Kalender um nicht mehr als zehn Bogenminuten abweiche. Das scheint mir allerdings allzu genügsam.«51 An der Beobachtung konnte es bei Brahe nicht gelegen haben. Er war seiner Zeit empirisch voraus und blieb doch im Mittelalter stecken. Er gehörte voll und ganz den Zeiten alten Denkens an. Er konnte partout nicht modern denken. Letztlich waren für Brahe die hervorragenden Beobachtungen sinnlos. Er konnte mit den Daten nichts anfangen, weil er einem Denkstil angehörte, der neue Interpretationen der Daten nicht erlaubte, nicht weil er nicht rechnen konnte, sondern weil er im Lichte der falschen Theorie beobachtete. Es gibt keine reine Empirie. Die Vorstellung, dass wenn man nur scharf genug beobachte, man nur genau genug messe, alle Kleinigkeiten beobachte, wenn man nur Daten von einer guten Qualität habe, dass man dann eine gute Beschreibung der Welt erhalte, muss als naiv bezeichnet werden. Wer Daten nur als Daten betrachtet, der sieht nichts, noch nicht einmal das Chaos. Brahe verzweifelte, weil seine Daten nicht zu seinem Weltbild passten. Kopernikus wollte es gar nicht so genau wissen, um sein Weltbild nicht ins Wanken zu bringen. So ungefähr, das reichte und lag damit besser als Brahe mit seinen exakten Messungen. Kepler wird bescheinigt, dass er mit Leichtigkeit seine Überzeugungen verwerfen konnte, so dass er in die Lage versetzt wurde, die Daten mit den verschiedensten Systemen abzugleichen, um dann das Weltbild zu nutzen, das die plausibelste Beschreibung bot. Offensichtlich brach Kepler mit einem festgelegten Weltbild, um sich das funktionstüchtigste je nach Bedarf herauszusuchen. Und doch ist auch diese Unbestimmtheit, diese Fluidität des Weltbildes, das letztlich keines sein will, desgleichen ein Weltbild, ein anderes als das des Tycho Brahe, auch keines, das sich aus reinen Daten hätte erschließen lassen können, aber eines, das auf Nachdenken beruhte, auf dem Versuch der theoretischen Durchdringung des Datenmaterials. Ohne das theoriegetriebene Nachdenken sind Daten nichts, unnützes Zeug. Und das ist vielleicht die große Neuerung der Moderne, tatsächlich das sichere Zentrum aufgegeben zu haben, Weltbilder situationsgerecht zu nutzen und Widersprüche als Widersprüche zu begreifen, die Anlass genug sein sollten, die eigene Überzeugung wieder schnell genug über Bord zu werfen. Erst Theorien lassen Daten als Beobachtungen sprechen. Theorien ohne Daten sind Hirngespinste, Daten ohne Theorien sind das Chaos. Das eine kann ohne das andere nicht, wobei, das sei betont, auch das Chaos Strukturen auszubilden in der Lage ist. Zwar war Kepler in der Lage, leicht Überzeugungen über Bord zu werfen, so lebte er doch nicht in einem von der Umwelt abgeschotteten Raum. Auch Kepler war Mitglied eines Denkkollektives und zwar desjenigen, das die Leute umfasst, »die gefühlsmäßig gegen die alten Ideen und die mit ihnen verbundenen Maßstäbe der Gelehrsamkeit eingenommen sind.«52 Paul Feyerabend schrieb den Satz mit Focus auf Galilei, was für Kepler sicher so auch zutraf. Der alte Denkstil sucht nach Übereinstimmungen mit dem göttlichen Gesetz. Die Welt ist ihnen eine Offenbarung Gottes, die genau in dieser einen Weise zu sein hat. Der neue Denkstil hat vielleicht einen eigenen Stil noch nicht gefunden, doch findet er eine den Akteur*Innen gemeinsame Plattform der geteilten Ablehnung. Das Gemeinsame ist die Suche nach neuen Mustern, ist der Versuch einer Neuerziehung des Schauens. Zunächst sieht das Mitglied des neuen Denkkollektives nichts, so wie ein Laie, der durch ein Mikroskop ein pathologisches Präparat sieht, ebenfalls nichts sieht. Bei bestehenden Denkkollektiven, die ihren Stil gefunden haben, können die Fachleute den Laien das richtige Sehen beibringen, können ihnen die Muster zeigen, die typisch z. B. für eine Krebserkrankung sind. Bei den einen neuen Stil entwickelnden Denkkollektiven gibt es keine Lehrer*In. Es bedarf einer Grundstimmung, die das Neue erblicken will. »Man braucht eine spezifische, unruhige Stimmung, um etwas Neues zu suchen. Man braucht eine gerichtete Denkbereitschaft, um etwas Neues zu erblicken.«53 Es geht um die Überwindung des Alten, um ein bewusstes Übersehen der alten Muster. Vielleicht ist das der Grund, warum vor allem junge Wissenschaftler*Innen in der Lage sind, ohne ein Zuviel an Wissen in bekannten Datenmengen neue Muster zu erkennen?
In seiner Replik auf Ludwik Flecks Aufsatz Wissenschaft und Umwelt, dem das vorige Zitat entstammt, wirft Tadeusz Bilikiewicz (1901 – 1980) ein, dass Muster sich in der Umwelt manifestieren, als Mode, Sitten und Trends. Diese in der Umwelt einer bestimmten Epoche wirkenden Kräfte wirken auf »ein Sich-Ausbilden von bestimmten Mustern im Verstand der Forscher.«54 Gern gibt Bilikiewicz zu, dass es nicht leicht sei zu erklären, wieso dann spezifische Stile in den neuen Denkkollektiven entstehen, aber es scheint, dass über Versuch und Irrtum hinweg der neue Denkstil in seinen Grundzügen bereits in der Luft liegt. In einem auf die Umwelt und Epoche bezogenen Sinn ist das Neue dann natürlich zur Mode geworden, die sich von der alten scharf abgrenzt. Das neue Weltbild des Kopernikus war, indem es zur neuen Mode wurde, bald der herrschende Stil. Es gibt Lehrer*Innen und Schüler*Innen, es gibt eine Art, wie durch das Fernrohr oder Mikroskop in richtiger Weise zu sehen sei. Die wissenschaftliche Antwort auf eine Frage, die nun popularisiert im gewöhnlichen Wissenschaftsbetrieb mit immer neuen Entdeckungen erhärtet und erweitert wird, hat ein Stadium erreicht, in dem sie nicht mehr der Erkenntnis dient, sondern Inhalt des psychologischen, sozialen, politischen und philosophischen Bemühens »der Vermittlung, des Vereinbarens und Angleichens«55 ist. Die Wissenschaft in der Gestalt des Wissenschaftsbetriebes beginnt ein Eigenleben zu führen, unabhängig von den Intentionen der individuellen Wissenschaftler*In. Das heliozentrische Weltbild ist längst zu einem Gemeinplatz geworden, genau wie unsere naturwissenschaftlich orientierten Krankheitssysteme Gemeinplätze sind. Mehrfach weist Fleck darauf hin, wie bizarr und phantastisch das Wissen der primitiven Völker sei.56
An dieser Stelle sei ein Beispiel aus Claude Lévi-Strauss (1908 – 2009) Das Rohe und das Gekochte vorgestellt, ein Mythos südamerikanischer Indianer, der den Ursprung der Krankheiten zum Thema hat.57 Zu einer Zeit, da Krankheiten unbekannt waren, blieb ein junger Mann in der Familienhütte über die gebotene Zeit wohnen, obwohl er eigentlich in das Männerhaus hätte umziehen müssen. Der junge Mann magerte ab und wurde krank, zudem hörte und roch er nachts etwas, das abgehenden Flatulenzen glich. Misstrauisch geworden und den Grund für seine Erkrankung erfahren wollend, stellte er sich eines Nachts schlafend. Er ertappte seine Großmutter, die erbost über das Verhalten ihres Enkels, diesem ihre Darmgase in die Nase einblies. Er tötete seine Großmutter mit einem tief in den großmütterlichen After getrieben Pfeil. Während sie starb quollen ihre Gedärme hervor. An der üblichen Schlafstelle der Großmutter grub der junge Mann ein Loch, um dort die Leiche zu versenken. Am selben Tag ging das Dorf zu einem „Gift“-Fischfang an den Fluss. Einen Tag später kehrten die Frauen zurück, um die Fische aus ihrem Fang einzusammeln. Die Enkelin der getöteten Großmutter wollte, damit sie mit den anderen Frauen zum Fang gehen könne, ihren jüngeren Bruder zur Aufsicht der Großmutter übergeben. Natürlich konnte die Großmutter auf den Ruf der Enkelin nicht antworten. Die junge Frau legte ihren jüngeren Bruder auf einen Ast, wo er auf sie warten sollte. Kaum war die Schwester fort, verwandelte sich der Junge in eine Termite. Die Frauen am Fluss sammelten die toten Fische ein. Die junge Frau jedoch, die ihren Bruder alleine gelassen hatte, fraß all ihre Fische gierig in sich hinein. Ihr Bauch schwoll unter quälenden Schmerzen an. Und während sie ihren Schmerz an Klagen reich bekundete, entwichen ihrem Körper alle Krankheiten, die nun über das Dorf herfallen konnten. Die beiden Brüder der sich ungeheuer quälenden Frau töteten ihre Schwester. Der eine schnitt ihren Kopf ab und warf ihn in einen See im Osten. Der andere trennte die Beine ab und warf sie in einen See im Westen. Die beiden Brüder vergruben ihre Speere in der Erde.