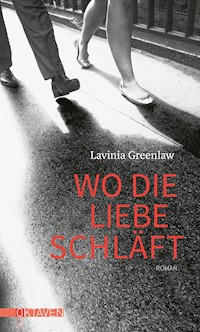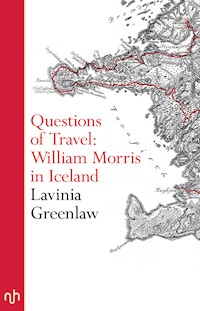Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Musik ist mehr als Töne... Herausgerissen aus ihrem vertrauten Londoner Umfeld und ins ländliche Essex verpflanzt, entdeckt Lavinia Greenlaw, entwurzelt und einsam, zwischen Klavier-und Geigenunterricht, den abendlichen Madrigalchorproben der Mutter, Opernbesuchen mit dem Vater und Radio Luxemburg ihre Liebe und Faszination für die Musik. Mit der beginnenden Pubertät setzt eine lange Identitätskrise ein. Ihre chamäleonartige Zugehörigkeit zu verschiedenen Musikrichtungen wird zu ihrer sozialen Währung, während sie versucht, sich anzupassen. Greenlaws Aufzeichnungen sind ein poetisches Erinnerungsbuch und ein leidenschaftliches Plädoyer für die Macht und die Kraft von Musik. Und es erinnert uns daran, wie inspirierend der richtige Song zur richtigen Zeit sein kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LAVINIA GREENLAW
TONSPUREN
ERINNERUNGEN AN EINE JUGEND
Aus dem Englischen von Anne Brauner
OKTAVEN
Die Originalausgabe mit dem Titel The Importance of Music to Girls erschien 2007 bei Faber & Faber Limited, London.
1. Auflage 2022
Oktaven
ein Imprint des Verlags Freies Geistesleben
Landhausstraße 82, 70190 Stuttgart
www.geistesleben.com
eISBN 9783772544293
Alle Rechte vorbehalten.
© 2007 Lavinia Greenlaw
Deutsche Ausgabe:
© 2022 Verlag Freies Geistesleben
& Urachhaus GmbH, Stuttgart
Gestaltungskonzept: Maria A. Kafitz
Umschlagfoto: © Cavan Images / Getty Images
Satz: Bianca Bonfert
Dies ist eine Erinnerungsarbeit –
Fakten wurden verfälscht.
Namen wurden geändert.
Für Georgia Elizabeth, die auszieht
Inhalt
1 DER WALZER MEINES VATERS
2 DAPPLES AND GREYS
3 EINE VOM BLITZ GETROFFENE WOLKE
4 KREISEND HÜPFTEN SIE BALD
5 SCHLICHTE UND EINFACHE REGELN
6 KORE
7 EIN GEZUPFTES PIZZICATO
8 COME ON SOMETHING
9 SPANISCHE TÄNZERIN
10 TONLÖCHER
11 WIE KANN ICH MICH RETTEN?
12 COVERVERSIONEN
13 SCHWÄRMEREI
14 TAXONOMIE
15 LACHGAS
16 I LATE WENT SINGING
17 DELICATISSIMAMENTE
18 DER KRISTALLDETEKTOR
19 FREUDIGE EREIGNISSE
20 DIE KÜCHENARIEN
21 STIMMBRUCH
22 DIE ANDRE SEITE DER LUFT
23 DAS ELEKTRISIERTE ICH
24 DER LANGSAMTANZ
25 ALS WÄR ES DER RAUM
26 GEISTIGE GETRÄNKE
27 INNERHALB VON ZEHN SEKUNDEN
28 DER REINRAUM (1)
29 IM ÜBERFLUSS
30 DER REINRAUM (2)
31 ÜBER MUSIK
32 ZWÖLF KOPIEN DESSELBEN ORIGINALS
33 DAS SILBERNE THRONJUBILÄUM
34 ELVIS EST MORT
35 TRENNUNG UND GEGENSATZ
36 FREIHEIT
37 PROTEST AND SURVIVE
38 TREFFPUNKT FÜR VERMISSTE
39 EIN ZUHAUSE FÜR GUTE MUSIK
40 SEKUNDÄRWELTEN
41 GEBIRG UND FLUR
42 DIASTOLE, SYSTOLE
43 EIN GEWISSES DURCHEINANDER
44 VERGISSMEINNICHT
45 THE ELECTRIC BALLROOM
46 SPIRAL SCRATCH
47 FOREVER YOUNG
48 PUNK EST MORT
49 SPALTE DIE LERCHE
50 AUSDRUCKSBEWEGUNGEN
51 UNSTET
52 BING
53 WON’T YOU BE MY GIRL?
54 FUCK ART, LET’S DANCE
55 CCD
56 SIEBEN JAHRE SPÄTER
DANKSAGUNG
ANMERKUNGEN
SOUNDTRACK ZUM BUCH
1
DER WALZER MEINES VATERS
Ein kaputter Knöchel an der Hand
Die meine umschließt;
Bei jedem falschen Schritt von dir kratzte
mein rechtes Ohr über den Gürtel.
THEODORE ROETHKE, MY PAPA’S WALTZ1
In den ersten Lebensjahren ist das Tanzen in meiner Erinnerung geräuschlos, als wäre es eine rein körperliche Angelegenheit. Bestimmt summte mein Vater eine Melodie, während ich auf seinen Schuhen stand und er mit mir tanzte, doch mir sind die Riesenschritte im Gedächtnis geblieben, die ich auf einmal machen konnte. Die Welt bäumte sich unter einem Fuß auf und drückte mich zur Seite, wenn dieser Fuß einen gewaltigen hohen Bogen beschrieb. Ich wusste nicht, ob ich soweit mitkommen konnte, doch im letzten Moment holte die Welt auch mein übriges Ich nach. Und so ging es weiter: Die Welt zog und schob, ich dagegen schlingerte und reckte mich.
Es war kein sanftes Spiel und genau aus diesem Grund liebten wir vier Kinder es. Wir fanden es toll, herumgeworfen zu werden – sei es von einer Achterbahn, Rutsche oder Schaukel, im aufgewühlten Meer, auf einem Trampolin oder aber von Erwachsenen, die uns in ihrer Geschwindigkeit im Kreis umherschleuderten und uns einen Vorgeschmack auf die Dimensionen des Erwachsenenlebens lieferten. Wir hatten einen jungen Onkel, der beim Spielen weniger Rücksicht nahm als mein Vater. Er schnappte sich meine Hände und schwang mich im Kreis wie ein Geschirrtuch mit nassem Salat, bis ich dachte, er würde mir die Arme ausrenken. Während mir der Schmerz in die Schultern schoss und mein Verstand schrumpfte, staunte ich gleichzeitig über die Möglichkeit einer solchen Bewegung. Angst hatte ich nicht. Zwar wusste ich, dass ich mir etwas brechen konnte und hatte auch bereits eine Vorstellung, wie es sich anfühlen würde, doch gleichzeitig wusste ich genau, dass es nicht soweit kommen würde.
Der Walzer war interessanter als ähnliche Spiele, weil man der Wucht etwas entgegensetzen musste. Man musste die Spannung zwischen dem Bemühen, stillzuhalten, und dem Vertrauen auf die Führung austarieren. Ich stemmte mich in die väterlichen Schuhe, spannte die Arme an und vergrub die Fingernägel in seinen Manschetten wie jemand, der sich an eine Klippe klammert. Auf diese Weise nimmt der Tanz seinen Anfang: Etwas – die Musik, die Schritte, dein Partner – hält dich, doch du musst den Halt erwidern, die notwendige Spannung aufbauen, und dagegenhalten.
In meiner Kindheit wurde ich oft zurückgehalten oder gebremst. Bevor wir das Haus verließen, dauerte es Stunden, uns alle bereitzumachen und bereitzuhalten – als wollte man vier Teller kreiseln lassen. Da ging ein Handschuh verloren, der Mantel wollte nicht angezogen werden, jemand war eingeschnappt oder hungrig oder brauchte eine frische Windel. Wir verbrachten viel Zeit mit Warten – darauf, irgendwohin gebracht oder abgeholt zu werden, auf das Ende eines Schultages oder den Anbruch eines neuen Tages. Wir reisten als Karawane im Kameltempo und brauchten mit unseren beiden tuckernden Morris zwei Tage für die zweihundertfünfzig Meilen von London an die walisische Westküste.
Einmal losgelassen, waren wir übermütig und ungeduldig. War es irgendwo hoch, kletterten wir hinauf und sprangen hinunter; war es steil, rasten wir auf Fahrrädern, Schlitten oder Brettern abwärts. Wir rannten oder rollten jeden Hügel hinunter, ohne uns von Brennnesseln, Glasscherben, Hundekacke oder Steinen abhalten zu lassen. Wenn sich die Landschaft in Regen, Laub, Nebel oder Schnee hüllte, rasten wir weiter hindurch, so schnell wir konnten, und fürchteten uns nicht vor dem, was nun im Verborgenen lag.
Hin und wieder wehrte sich die Welt und ich stieß schmerzhaft mit ihr zusammen. Im Alter von vier Jahren rutschte ich eine Rutsche hinunter, während ich an einem Bambushalm aus dem Garten lutschte. Er traf vor mir auf und bohrte sich fünf Zentimeter tief in meinen Gaumen. Anschließend beugte ich mich über ein Waschbecken und sah zu, wie es sich mit meinem Blut füllte. Ich spürte nichts. Interessant war höchstens, dass meine Schwester mir ihren Teddybär geben wollte, von dem sie sich normalerweise niemals trennte. Als ich nach der Operation, in der das Bambusstück entfernt wurde, aufwachte, richtete sich meine Neugier nur auf das Kohlenfeuer gegenüber dem Bett und den Geschmack des Speiseeises, das es im Krankenhaus gab.
Lange Zeit war dieser Unfall nur etwas, das meinem Mund zugestoßen war. Andere mussten mich auf die Bedeutung hinweisen.
«Das Bambusrohr steckte ganz nah am Gehirn», sagte meine Mutter zu einem späteren Zeitpunkt. «Wir dachten, dass es dir mehr oder weniger gut ging, aber die Chirurgen wussten nicht, ob sie das Stück ohne bleibende Schäden entfernen konnten.»
«Darum erschießen sich die Leute so», fügte mein Bruder hinzu.
«Außerdem hätte es deine Sprache beeinträchtigen können», fuhr meine Mutter fort. «Wenn dein Gaumen sich verformt hätte.»
Durch die Deformierung begriff ich erst, dass ich eine eigene Gestalt besaß, zu der ich zurückfinden konnte wie meine Spielzeugkatze, die auf einer Trommel saß und deren Körperteile elastisch in Spannung gehalten wurden. Sobald ich auf die Unterseite der Trommel drückte, fiel die Katze auf die Knie oder sackte seitlich weg. Sobald ich die Finger wegnahm, schnellte sie mit tänzerischem Schwung zur Seite. Die Unmittelbarkeit, mit der sie ihre Gestalt veränderte und ruckzuck zurückerlangte, faszinierte mich ebenso wie die Zweideutigkeit ihres strahlenden Gesichtchens – begierig zu gefallen und gleichzeitig undurchdringlich.
Bisher hatte sich mein Körper wie der jener Spielzeugkatze angefühlt, als Ansammlung von Einzelteilen. Wenn ich beispielsweise mit der Hand den Stab eines Heizstrahlers berührte oder mir einen Nagel in den Fuß trat, entdeckte ich, dass sie zu mir gehörten. Mittlerweile wusste ich, dass mein Mund meine Stimme formte und mein Gehirn genau dort war, direkt darüber. Dreißig Jahre später sah ich es kristallklar auf einem Röntgenbild, auf dem die obersten Wirbel meines Rückgrats meinen Kopf nach vorn stießen statt sich zurückzubiegen und meinen Schädel zu halten. Bei dem Unfall war mein Kopf so ruckartig nach hinten gestoßen worden, dass er diesen Vorfall seitdem kompensierte, was mir das Gefühl gab, kopflos in den nächsten Augenblick, Gedanken oder Satz zu kippen statt mich aufrecht anzunähern.
Der Körper läppert sich also zusammen und die Welt weist mahnend auf die körperlichen Grenzen hin, wenngleich sie dabei erstaunlich gnädig sein kann. Mit acht Jahren sprang ich durch ein Fenster und erinnere mich bis heute, wie das Glas sich blähte und mich festhielt, bevor es in tausend Stücke zersprang. Ich schwebte in der Luft, war dem Verfolger entkommen, und wurde gehalten. Seitdem ist mir nie wieder etwas derart Friedliches begegnet. Ich trat aus dem Scherbenkreis wie eine Leiche aus dem Kreideumriss und trug nur Kratzer auf beiden Knien davon.
Diese Zusammenstöße mit der Welt zeigten mir ihr Wesen und ihre Gesetze sowie die meinen auf. Ich hatte getanzt, bevor ich meinen Körper kennengelernt hatte, ohne zu verstehen, was mich bewegte. Musik war es damals noch nicht.
2
DAPPLES AND GREYS
Oder es sang eine Stimme und reichte ein Stück weit aus der Erwartung heraus …
RAINER MARIA RILKE, DIE GROSSE NACHT2
Die Frauen in unserer Familie haben die gleiche Stimme. Am Telefon kann niemand meine Mutter, meine Schwester, meine Tochter und mich auseinanderhalten. Zeitweise spule ich den Anrufbeantworter zurück und habe das Gefühl, ich hätte mir selbst eine Nachricht hinterlassen. Beim Gesang sticht jedoch der glasklare Sopran meiner Mutter hervor. Wir anderen haben trockene tiefe Singstimmen. In der Kirche und bei Konzerten haben wir Mühe; wenn die Oberstimmen in die Höhe gehen, brechen wir ein, warten und konzentrieren uns auf die Begleitstimmen.
Meine Mutter wurde nie laut. Als Ärztin war sie klinisch pragmatisch. Wenn sie sich einen Finger ausrenkte, verarztete sie sich selbst. Wenn die Zeit nicht reichte, einen Kuchen zu backen, servierte sie die Backmischung roh als Pudding. Wenn es ihr nicht gelang, vier Kinder nachts in ihren Betten zu halten, fixierte sie uns mit Laufgeschirren für Kleinkinder. (Zeitweise erinnerten wir sie selbst daran, indem wir «Zügel! Zügel!» riefen). Ihre Übersicht war atemberaubend und befreiend und gleichzeitig auf eine gewisse Weise zu klar. Manchmal wollte ich einfach nicht mehr sehen als das, was ich erwartet hatte.
Selbst wenn Fragen bereits formuliert sind, kann es unmöglich sein, sie zu stellen. Meine Mutter war so zurückgezogen und ich derart geprägt, sie nicht zu kennen, dass ich sie niemals gefragt hätte, mit wem sie zu Mittag gegessen hatte, geschweige denn, wie es ihr ging. Allerdings enthüllen wir beim Singen einen Teil unseres Wesens, den wir in der Sprechstimme verbergen können. Als würden wir die Tür zu einer inneren Akustik öffnen, und die Akustik der Stimme meiner Mutter war der absolute Raum. Wenn sie mich in den Schlaf sang, schenkte sie mir Frieden, doch es war, als würde ich in Leere gewickelt. Ich fühlte Liebe und Unendlichkeit, und sobald ich singe, treten diese Gefühle erneut hervor.
Was wir einem Kind vorsingen, das zu jung zum Mitsingen ist, ist vielleicht ebenso wenig gesteuert, wie wenn wir vor uns hinsingen. Meine Mutter sang keine Klagelieder, aber die zurückgenommene Stimmung von ‹Greensleeves› oder ‹Scarborough Fair› wurde mir durch ihre Stimme klarer als durch die Worte, sobald ich sie endlich verstand. Als ich noch zu jung war, um einer Geschichte in Gänze zu folgen, hielt ich mich an Kleinigkeiten fest, die ihre Stimme mit forensischer Sorgfalt darlegte (mein Vater hatte sie erstmals in dem Sezierraum einer medizinischen Hochschule gesehen, als sie eine Leiche obduzierte): ein großes Beiboot, eine enge Gasse, ein Batisthemd, all die hübschen Pferdchen.
Volkslieder, Schlager und Seemannslieder wurden von Pathos befreit und ihre Bilderwelt in Licht und Schatten geklärt. In ‹What Shall We Do With the Drunken Sailor?› war kein Hauch von Rum, Meersalz oder fröhlichen Matrosen zu hören. Für mich persönlich hing es an dem Vers: «Put him in the longboat until he’s sober.» Ich stellte mir eine hohe Schiffswand vor, den dunklen, tiefen Abgrund irgendwo, nicht auf dem Wasser treibend, sondern abseits, einen Ort der Bestrafung oder der Ruhe – was wusste ich? In dem Lied ‹Cockles and Mussels› schob Molly Malone ihre Schubkarre durch breite Straßen und enge Gassen und auch hier dockte meine Vorstellungskraft an dem kleinen Mädchen und den hochaufragenden Häusern an – an der Fantasie, das allein im Dunkeln zu erdulden. Das seltsam düstere Lied ‹Pretty Little Horses› faszinierte mich besonders und wenn meine Mutter über «Blacks and bays, dapples and greys» sang, flirrten sie durch meine Gedanken wie Sonnenstrahlen übers Wasser. An anderer Stelle sog ich das Wesentliche aus dem Klang: das «cambric shirt» aus ‹Scarborough Fair› mit seinem groben Saum aus zwei c’s, die einem in der Kehle stecken blieben; oder aus der dehnbaren Länge des nachgezogenen ‹Greensleeves›, woran das Lied wiederholt zupfte.
Bevor wir alt genug waren, um mit dem Bus zu fahren, brachte meine Mutter uns zur Schule, hin und wieder auch im Morgenrock. Mein jüngster Bruder schlingerte als Wickelkind über die Rückbank, während wir Älteren uns zankten und sie sang: «Who will buy this wonderful morning? Such a sky you never did see …» Heute ist mir klar, dass das vermutlich ironisch gemeint war. Aber vielleicht wollte sie uns doch darauf aufmerksam machen, wie wundervoll der Morgen tatsächlich war.
Wir singen nicht, wenn wir gehetzt sind. Der Gesang meiner Mutter war Teil ihrer Coolness, wie die kühle weiße Hand, die sie allmorgendlich auf meine Wange legte, um mich zu wecken, oder ihre kühle Art, mich festzuhalten, wenn ich in Rage geriet, als wäre sie aus Marmor und ich aus brodelndem Matsch. Bei ihrer hochmütigen Ausstrahlung konnte man sicher sein, dass sie im Fall einer Autopanne in ihrem rüschenbesetzten himmelblauen Morgenmantel notfalls hocherhobenen Hauptes durch London stolzieren würde. Sie hatte noch immer die königliche Haltung einer Debütantin, außerdem wäre es ihr scheißegal gewesen. So wie sie alles für uns getan hätte, würde sie auch alles andere tun.
Diese besungene Welt war in ihrer Wahrhaftigkeit beschaulich wenngleich nicht sonderlich bequem. Sie schickte mich in den Weltraum und schon sehr früh entwickelte sich die Vorstellung von den Tiefen des Alls zu einer Quelle des Trostes. Ich schloss die Augen und vertraute der Stimme meiner Mutter, selbst wenn sie mich loszulassen schien, denn ich begriff, dass dieses Loslassen aus Liebe geschah.
3
EINE VOM BLITZ GETROFFENE WOLKE
Die Katze ging hierhin und dorthin,
Und der Mond wie ein Kreisel sich dreht,
Und die nächste Verwandte vom Mond,
Die schleichende Katze, sie steht.
W. B. YEATS, DIE KATZE UND DER MOND3
Als ich so klein war, dass ich wie eine Katze nichts von Spiegeln wusste, sang und tanzte ich vor mich hin.
Ich war das zweite von vier Kindern und wuchs in der Stadt auf, wo das Leben überwiegend aus Bewegung und Lärm bestand. Sobald ich sang oder tanzte, nahm ein Teil des Lebens Gestalt an.
Ob ich ein lautes Kind war? Ich machte Krach, um Menschen heranzuholen, aber auch, um sie fortzuschicken. Woher sollten sie meine jeweilige Absicht erkennen? Beziehungsweise ich selbst? Handelte es sich um Kriegsgeheul oder doch eher um ein Liebeslied? Einen anmutigen Anblick oder einen Kraftakt? War es hässlich oder schön? Wir vier Kinder hielten den Lärmpegel als eine Form von Wachsamkeit hoch. Er klang nach Steinen, die aneinandergeschlagen wurden, Schwertern, die auf Schilder eintrommelten, stampfenden Stiefeln und Flugzeugen im Sturzflug. Wie viel Tanz und Gesang kamen dabei heraus?
Meine Familie gab mir Halt. Bei aller Kompliziertheit war sie stark, eine Maschine, die das Leben in Gang hielt, sodass ich es nicht selbst tun musste. Sie beschützte mich auch. Ungefähr bis ich elf wurde, war ich nicht dafür geschaffen, Gestalt anzunehmen.
Ich war zu Entzücken und Furcht gleichermaßen in der Lage und erlitt keinerlei ungewöhnliche Traumata. Der Eindruck war ausschlaggebend. Jede Erfahrung war traumatisch.
Der Lärm, den wir veranstalteten, gefiel mir grundsätzlich, und doch war mir das Leben zu laut, und da ich die Lautstärke nicht herunterdrehen konnte, nahm ich mich selbst zurück. Zuvor hatte ich mich wie eine vom Blitz getroffene Wolke gefühlt. So hatte jemand einmal das Gefühl beschrieben, in mich verliebt zu sein, und man könnte sagen, ich war verliebt darin, wie das Leben auf mich einwirkte.
4
KREISEND HÜPFTEN SIE BALD
Kreisend hüpften sie bald mit
schöngemessenen Tritten
Leicht herum, so wie oft die befestigte Scheibe der Töpfer
Sitzend mit prüfenden Händen herumdreht, ob sie auch laufe.
Bald dann hüpften sie wieder in Ordnungen gegeneinander.
HOMER, DIE ILIAS, 18. GESANG4
Wenn Kinder auf andere Kinder treffen, müssen sie etwas tun – spielen oder kämpfen. Unsere Spiele waren ungeordnet, ihre Regeln boten Stoff für weitere Meta-Spiele. Da wir vier jeweils im Abstand von zwanzig Monaten geboren worden waren, basierten diese Spiele vor allem auf dem Wunsch, einander umzubringen. Ich überredete meinen älteren Bruder, in eine Gondel zu klettern, weil ich wusste, dass der Sitz ausgehakt war. Er verlor den Halt, fiel herunter und schlug sich beim Aufprall auf dem Weg den Kopf blutig. Er dagegen forderte mich heraus, eine Wespe zu essen, auf ein Dach zu steigen oder vom Baum zu springen. Er verließ sich darauf, dass ich mich nicht verweigern konnte. Wenn wir etwas bauten, machte mein jüngerer Bruder ein Spiel daraus, uns mit Ziegelsteinen zu bewerfen. Meine Schwester war stiller, dadurch aber umso angsteinflößender. Wenn ich lesend in einem Sessel saß, schlich sie sich gerne an und drückte mir die Kehle zu.
Vier war in jeder Hinsicht eine schlechte Zahl. Zwei können einzeln tanzen und viele Menschen in einem Raum können zusammen tanzen. Sechs bilden einen anständigen Kreis. Aber können Sie sich vorstellen, wie vier Menschen tanzen sollen? Es würde merkwürdig wirken – zwischen Intimität und feierlichem Anlass. Während zwei einen konzentrierten Gegensatz bilden, drei eindeutig aus dem Gleichgewicht sind und fünf zahlreiche Orientierungsmöglichkeiten haben, wirken vier zu offensichtlich. Man kann höchstens Spannung aufbauen, wenn es drei gegen einen steht, und da ich meinem älteren Bruder zu nah war, als dass ich ihn hätte bewundern können, gleichzeitig aber selbst zu nah an den Jüngeren, um meinerseits bewundert zu werden, war ich diese einzelne Person.
Als ich mit fünf in die Schule kam, musste ich das Kämpfen als Ausdruck meiner Persönlichkeit aufgeben. Gleichzeitig entwickelte sich Tanzen unvermittelt zu etwas Gefährlichem. In der Schule musste ich stillsitzen und den Mund halten, aufstehen, wenn der Lehrer in den Raum kam, mich im Gang links halten, nur in den Pausen zur Toilette gehen, in der Vollversammlung mit verschränkten Armen im Schneidersitz sitzen, mich anstellen, um einen Raum zu betreten und wieder zu verlassen, und auch zum Mittagessen Schlange stehen. Um etwas sagen oder essen zu dürfen, musste ich aufzeigen und warten. Ich war verwirrt und wusste nicht, wie ich mich sortieren und diese ungeheure Kontrolle bewahren sollte.
Es war sogar noch schwerer, die Regeln der Schulhofspiele einzuhalten. Worte und Schrittfolgen waren nicht das Problem – die begriff ich rasch –, sondern die Nuancen. Die Spiele erforderten Aufmerksamkeit und Koordination nicht nur auf der körperlichen, sondern auch auf der sozialen Ebene. Ich hatte kein Gefühl dafür, wie man Freunde gewann, da ich mich bis zu diesem Zeitpunkt auf meine drängelnden Geschwister verlassen hatte, wenn es darum ging, andere Kinder zu besiegen oder auszuschließen. Obwohl wir uns oft stritten, hatte ich unter ihnen meinen angestammten Platz und kein Bedürfnis nach anderen Kindern. Auf einmal dann doch: In der Schule wünschte ich mir plötzlich eine eigene Welt mit meinen eigenen Leuten. Die Kinder, die ich in die engere Wahl zog, hatten bereits ihren Platz gefunden, einen Kreis gebildet und geschlossen. Um Freunde zu finden, musste ich in einen derartigen Zirkel einbrechen.
Ich kannte bereits Kreistänze wie ‹Ring-a-ring o’-Roses› und ‹Here We Go Round the Mulberry Bush›, ohne jedoch zu wissen, wie viel Macht davon ausging. Auf einem Schulhof voller Mädchen waren die Kreise groß. Wenn man nicht zu denen zählte, die festlegten, wie der Kreis gebildet werden sollte, musste man rasch dazu stürmen, während er noch in der Entstehung war. Denn sobald sich alle an der Hand hielten, war der Kreis geschlossen. Man konnte in der Nähe lauern und darauf hoffen, dass ein Mädchen stolperte und losließ, oder selbstbewusster, jemandem auf die Schulter klopfen oder an einem Ärmel ziehen. Kaum war man drin, hieß es aufpassen, da immer jemand älter, größer und entschlossener war und den Kreis schneller oder in die andere Richtung laufen ließ. So jemand konnte auch neue zusätzliche Regeln, Gesten oder Schritte einbauen. Man durfte nicht nachlassen.
An die Lieder, die wir zu diesen Kreistänzen sangen, kann ich mich nicht erinnern. Die Bedeutung der Wörter interessierte uns nicht, zumal sie so vertraut waren, dass sie sich wie Geplauder zu einem Rhythmus und einer Ansammlung von Stichworten abstrahierten. In einem Kreis zu sein, war der perfekte Zustand. Ich war unsichtbar und doch Bestandteil eines Ganzen, in Bewegung und doch gesichert. Ich musste mit niemandem reden, niemand sah mich an, aber ich befand mich im Zentrum des Geschehens. Je schneller wir uns drehten, je fester wir uns an den Händen hielten, umso genauer wussten wir, wenn wir in diesem Moment losließen, würden wir hinfallen, wenn wir uns jedoch festhielten, würden wir vielleicht abheben und fliegen. Das Lied verlor seine Form oder nutzte sich durch die stetige Wiederholung ab. Wir wurden immer leichter, je schwerer wir atmeten. Am Ende bestanden wir nur noch daraus, aus Atem – losgelassen, ekstatisch.
Zum ersten Mal verstand ich, dass Zugehörigkeit mir die Flucht vor mir selbst erlaubte und mir einen Platz in dieser Welt anbot: die Unschärfe des fortwährenden Sich-Drehens, die Geschwindigkeit, mit der die Mädchen im Kreis verschmolzen, wenn man nichts mehr sehen konnte und alles erspürte, und die Unterschiede zu Figuren auf einer Vase verflachten.*
Ich konnte mithalten, doch ich gehörte nicht dazu, weil ich nicht gelernt hatte, mich auf die Figur zu beschränken, die ich darstellte. Nervös und wütend, wie ich war, mir kaum meiner selbst bewusst, schreckte ich andere ab. Am Rande des Zirkels wurde ich geduldet, bis die Anführerin eines Tages verkündete, ich dürfte nicht mehr mitspielen. Sie schlug es im Tonfall jedes anderen neuen Spiels vor: «Also heute gehen wir ohne …» und die anderen Mädchen folgten ihr auf die andere Seite des Schulhofes. Normalerweise hätte mich eine solche Zurückweisung unglaublich wütend gemacht. Einmal habe ich ein Mädchen geschlagen, weil es nicht meine Freundin sein wollte. Doch an jenem Tag auf dem Schulhof hatte ich eine Eingebung und als sich der Kreis ohne mich schloss, verließ ich ihn, ging weg und beschäftigte mich mit einem Kreis meiner Fantasie. Rasch besannen die Mädchen sich eines anderen und holten mich zurück. Ich nahm die Einladung an und die Angelegenheit wurde abgetan wie ein x-beliebiger Tanz.
Die Schule bestand aus einer ganzen Reihe von Kreisen: Freunde, Geschlechter, Klasse und Stufe sowie Unterrichtsraum, Gebäude, Schulhof, Gelände. Obwohl die Türen und Tore nie abgeschlossen waren, war es unvorstellbar, zu anderen als den erlaubten Zeiten hindurchzugehen. Eines Tages bastelte ich einen Papierlöwen, der ausnahmsweise meinen eigenen Ansprüchen genügte und auch der Lehrerin gefiel. Als es klingelte, lief ich rasch zum Schultor, umklammerte meinen Löwen und konnte es nicht abwarten, ihn meiner Mutter zu zeigen. Da sie nicht dort war, wartete ich derart inständig auf sie, dass mir gar nicht auffiel, dass ich ganz alleine war. Als ich es bemerkte, geriet ich in Panik – wo war meine Mutter? Dann schaute ich mich um und dachte als Nächstes: Wo sind all die Anderen? Ich blickte hin und her und die Frage lautete: Wo bin ich? Das Schulgebäude und der Schulhof lagen still in meinem Rücken, während sich vor meinen Augen das Londoner Alltagsleben der Erwachsenen abspielte, das ich nicht kannte. Schließlich kam ich auf die Idee, dass die Klingel nur zur Pause geschellt hatte und seitdem der Vormittagsunterricht fortgesetzt wurde. In meiner rasenden Aufregung hatte ich den Tag komprimiert. Ich stand vor der Schule und niemand hatte es gemerkt. Als ich zum Gebäude zurückblickte, erschien es mir ebenso undurchdringlich und abgelegen wie das Stadtzentrum. Ich war im Nirgendwo gelandet.
Obwohl ich nicht mehr weiß, wie ich ins Klassenzimmer zurückgekehrt bin, weiß ich, dass ich es getan habe. Das Erlebnis hatte mir jedoch eine Möglichkeit eröffnet, die ich nicht ungenutzt verstreichen lassen konnte. Kurz darauf, ich war sechs Jahre alt, beschloss ich, nach Hause zu gehen, weil ich Lust dazu hatte. Ich ging durchs Tor, die Straße entlang, durch Hampstead Heath, erklomm den Hügel und klingelte an der Haustür. Es war so einfach, dass ich nicht verstand, was in meine Mutter gefahren war, als sie mir öffnete. Und es war tatsächlich, als hätte sie etwas umgehauen – als hätte ich sie umgehauen, indem ich aus der Reihe getanzt war.
* Dieses Phänomen beschreibt Homer als khoreia (später ein Bestandteil des Wortes Choreografie). Es ist ein Tanz in einem Kreis, an dem jeder gleichermaßen beteiligt ist, mit einer eigenen Dynamik wie ein Rad, das den Hügel herunterrollt. Da Homer ein Detail auf einer Vase beschreibt, wird der Kreis doppelt zum Kreis – feststehend in sich selbst und festgehalten im tönernen Kreis.
5
SCHLICHTE UND EINFACHE REGELN
Die Linien, welche die Tänzer und Tänzerinnen beim Konter- oder Figurentanz bilden, ergeben ein das Auge erfreuendes Spiel, besonders, wenn die ganze Figur mit einem Blick zu übersehen ist, wie von der Galerie des Komödienhauses …
Die Tänze barbarischer Völker werden immer ohne diese Bewegungen dargestellt, da sie nur aus wildem Hüpfen, Springen und Kreisen bestehen oder aus einem Rückwärts- und Vorwärtslaufen, begleitet von krampfartigem Zucken und verdrehten Gebärden.
WILLIAM HOGARTH, ANALYSE DER SCHÖNHEIT5
«Ich weiß nicht, was aus Hampstead geworden ist», sagte meine Urgroßmutter einmal. «Überall Türken und Ungläubige.» Sie lebte am Rande der City, wo sie auch begraben ist, ganz oben auf dem Hügel, auf dem Hampstead erbaut wurde. Beinahe wäre ich um die Ecke herum geboren worden, doch in letzter Minute bezogen meine Eltern auf der anderen Seite des Hügels eine Wohnung in einem Haus, das Evelyn Waughs Vater gebaut hatte. Reizlos prangte es genau zwischen den Postcodes NW3 und NW11, zwischen dem Künstlerviertel Hampstead und dem Außenbezirk Golders Green, oder, wie die Mutter von Robert Lowell es mit Bezug auf ihre eigene Bostoner Geografie ausdrückte, «gerade noch am äußersten Rand der schicklichen Wohngegenden.»*
Unsere Adresse zählte zu den Aspekten in unserem Leben, die den Erwartungen unserer Gesellschaftsschicht nicht entsprachen und derentwegen wir aus dem Rahmen fielen. Allgemein galt, dass man am falschen Ort leben konnte, Hauptsache, das Haus besaß Charme. Meine Eltern waren eher abenteuerlustig und meine Mutter verweigerte auf gewisse Weise die Ästhetik, die ihr qua Geburt mit auf den Weg gegeben worden war. Wir wuchsen in einer verwirrenden Mischung aus Schäbigkeit und Schönheit auf, in dem Bewusstsein, dass Gegenstände abgenutzt oder verschenkt werden sollten, und befanden uns leichter aber inhaltsloser, als wir wohl gedacht hätten.
Unser Leben war der Stadt zugewandt, denn die Arztpraxis meines Vaters lag in Camden Town. In dieser Umgebung, an einem derart vielschichtigen Ort, der einem Arzt so viele Aufgaben bescherte, war mein Vater in seinem Element. Er kümmerte sich ebenso um die obdachlosen Alkoholiker, die im Arlington House übernachteten, wie um junge Schauspieler, Architekten und Schriftsteller, darunter einige, die später berühmt wurden. Wir aßen Croissants, Dolmades und Rollmops und brühten türkischen Kaffee in einer Messingkanne auf. Einer der jungen attraktiven Brüder aus der Trattoria Lucca gegenüber der Praxis brachte Cappuccino auf einem Tablett, das er auf den Fingerspitzen über die verkehrsreiche Straße balancierte, und seine Mutter, Mrs Boggi, schenkte mir Schokolade und kniff mich in die Wange. Der Bäcker nahm uns in die Küche mit, wo mich die warme zuckerhaltige Luft in einen wahren Rausch versetzte. Wir kauften blaustichige Nordseekrabben in gedrehten Papiertüten bei einem Mann, der sie auf dem Flask Walk vor seinem (mittlerweile sehr schicken) Geburtshaus verkaufte.
Wir schlenderten um die Marktstände und Kanalschleusen und gingen mit dem Hund auf dem Primrose Hill in der Abenddämmerung Gassi, wenn die Wölfe im Zoo mit ihrem Geheul begannen. Der Hund heulte dann zurück, während ich schweigend mit meinem Vater in der Dunkelheit stand, wissend, dass wir beide traurig waren, aber nicht darüber sprechen konnten. Die Dunkelheit gab uns Kraft. Ich blickte auf eine beleuchtete City hinab, die sich weder in Kreise noch in Linien ordnen ließ, und fühlte mich geborgen.
Heute mutet es seltsam an, dass ich an einem Ort wie Camden Town englische Volkstänze erlernen sollte. Der Unterricht fand im Cecil Sharp House statt, dem Sitz der English Folk Dance and Song Society. Diese Tänze fühlten sich an, als würde man statt um Geld um Streichhölzer spielen. Es war kein bisschen spannend, und da ich weder Antrieb noch Freude verspürte, schleppte ich mich in einem Kinderrudel dorthin, lernte Tanzfiguren und Schrittfolgen, die mich noch weniger interessierten als die Schulhofspiele, denen ich allmählich entwuchs. Ich wollte nicht mehr automatisch hüpfen und klatschen, wenn Musik ertönte, sondern musste dazu überredet werden.
Linkisch versuchten wir, den Reel oder ‹Hey› zu meistern, bei dem zwei Reihen oder Reigen von Tänzern in entgegengesetzter Richtung zu verschlungenen Tanzwegen aneinander vorbeischreiten. Auch die Musik schleppte sich dahin (woher kam die Musik? Von einem Grammofon?), während wir Kinder wabbelige Kreise und schlaffe Reihen bildeten und zusammenstießen, wenn das eine Paar energisch zu ‹Heel and Toe› ansetzte, nur um sofort die Nebentänzer zu bedrängen, die noch damit beschäftigt waren, wie man den Fuß wann und wo nach unten führen sollte.
Cecil Sharp stützte sich größtenteils auf John Playfords 1651 erschienenes Werk The English Dancing Master, or, Plaine and Easie Rules for the Dancing of Country Dances with the Tunes to each Dance. Playford behauptete, «Platon, der berühmte Philosoph, fände es nur recht und billig, kunstsinnige Kinder das Tanzen zu lehren». Seine Tänze klingen leidenschaftlich und kompliziert: ‹Every Lad his Lass› – ein Triple Minor-Set; ‹The Friar in the Well, or The Maid Peeped Out at the Window› – Longways für beliebig viele Paare; ‹Dissembling Heart, or The Lost Love› – Longways für sechs Tänzer; ‹Fain I Would› – Square Dance für acht; ‹The Collier’s Daughter, or The Duke of Rutland’s Delight› – erneut ein Triple Minor-Set.
Später sollte ich anlässlich von Ceilidhs und Hochzeiten wildere Volkstänze aufführen und erleben, wozu das diente. Mit sieben Jahren war ich ungeduldig und nicht sonderlich begeistert. Wir lernten, am Anfang und Ende jeden Tanzes unserem Partner mit einem knappen Knicks oder einer Verbeugung «die Ehre zu erweisen» und befolgten die Anweisung lustlos. Ich erinnere mich an die vorbeiziehenden gleichgültigen Mienen der anderen Kinder, während wir uns aufstellten, einhakten, in die Hände klatschten und zu hüpfen begannen. Es gab keine komplizierten Schrittfolgen oder extravaganten Gesten und man tanzte mit einem Partner in einem Tanz für zwei oder vier Paare. Wir trotteten dahin, während uns jemand von außen mit lauter Stimme Weisungen erteilte. Die Tanzfiguren waren schlicht – Cast oder Basket, Drehung oder Körbchen. Selbst die Promenadenfigur bestand aus einem gemäßigten Spaziergang. Schottische, irische und walisische Volkstänze bezogen Kostüme, Stampfen, eine kerzengerade Haltung und komplizierte Details mit ein. Getanzt wurde zwischen Schwertern.
Ich hörte im Cecil Sharp auf und machte an einer lokalen Schule mit dem Volkstanz weiter. Dort musste ich einen Rock tragen, der mit winzigen grünen Zweigen bedruckt war, und dazu eine weiße Bluse mit Puffärmeln. Der Rock wurde durch ein grobes Gummi an der Taille festgehalten und die Bluse kratzte. Die Wirkung war unfreiwillig bieder. Ich sah eher wie eine Großtante statt wie ein Bauernmädchen aus und nicht im Mindesten duftig oder erblühend.
Wenn diesen englischen Tänzen etwas Gutes anhaftete, dann der Versuch, einfach nett zu sein. Es hätte Tanzunterricht für Menschen sein können, die sich sonst schämten zu tanzen. Das sollte der englische Nationaltanz sein? In anderen Ländern wurde mit Gläsern und Tellern geworfen, die Tänzer trugen Schärpen, Hüte, Troddeln, Schals und rauschende Röcke; sie machten Lärm. Wir wurden nur angehalten, uns wie an Sportwettbewerben in der Schule und bei den Pfadfinderinnen zu beteiligen.