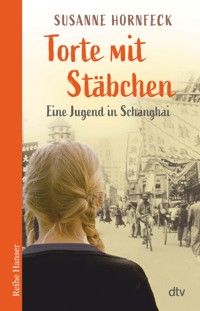
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die abenteuerliche Geschichte eines jungen Mädchens im Schanghai der 30er- und 40er-Jahre. Während der Reichspogromnacht 1938 wird auch die Konditorei des Ehepaars Finkelstein zerstört. Finkelsteins beschließen daraufhin, nach Schanghai und in eine ungewisse Zukunft zu fliehen. Was für ihre Eltern ein Schrecken ist, ist für ihre Tochter Inge das große Abenteuer: Während die Eltern ums Überleben kämpfen, erobert sie mit ihrem Freund Sanmao die Stadt, die Menschen und die Sprache.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Susanne Hornfeck
Torte mit Stäbchen
Eine Jugend in Shanghai
Roman
Muss i denn, muss i denn…
Genua, 1938– Jahr des Tigers
虎
Es war ein heiterer Tag mit weißen Schäfchenwolken, ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Zumindest wenn man aus dem Norden Deutschlands kam und einen dicken Wintermantel trug. Inge musste ihn anhaben, denn in den Koffer hatte er nicht mehr hineingepasst. Nun stand sie schwitzend zwischen Mutter und Vater an der Reling der »Conte Biancamano«. Graf Weiße Hand– ein passender Name. Das klang nach dem Märchenprinzen, der dich bei der Hand nimmt und vor allem Bösen rettet.
Ein weißer Märchenprinz war es auch gewesen, der sie nach der endlos langen Zugfahrt vor den Menschenmassen in der Wartehalle am Hafen gerettet hatte. Wieder waren sie mit Hunderten anderer Passagiere und Unmengen von Gepäck zusammengepfercht gewesen. Im erregten Stimmengewirr hörte man viel Deutsch, aber die Durchsagen waren alle auf Italienisch– keiner kannte sich aus. Dann war ein Mann von der Reederei erschienen, hatte ihre Karten inspiziert, und auf einmal war alles ganz anders. Eine Verbeugung andeutend, hatte er Inge und ihre Eltern freundlich angelächelt: »Schanghai?« Auf ihr verschüchtertes Nicken hin hatte er einen Kabinensteward herbeigewinkt. So war Paolo in Inges Leben getreten. Nach all den braunen und schwarzen Uniformen in ihrer Heimat war er ihr wie ein Engel in Weiß und Gold erschienen. Mit schwarzen Locken und spitzbübischen dunklen Augen. Inge fand ihn wunderbar, und auch er schien einen Narren an dem Mädchen mit den blonden Zöpfen gefressen zu haben.
»Ich bin Ihre Kabinesteward und werde während die Reise für Ihre Wohl sorgen«, hatte er sich in einem klangvollen Deutsch vorgestellt, das einsamen Konsonanten gern einen Vokal an die Seite gab.
»Das Ihre gesamte Gepäck?«
Inges Vater hatte nur stumm genickt.
Mit großer Geste griff er nach den Koffern und packte sie auf einen kleinen Gepäckwagen. Als er den letzten anhob, zog er hörbar die Luft ein, sagte aber nichts. Mutter und Tochter tauschten einen wissenden Blick.
»Bitte Sie mir folgen.«
Folgen war sonst nicht Inges Stärke, aber diesmal trabte sie ohne Zögern hinter ihrem Retter über die Gangway hinein in die weiße Innenwelt des riesigen Schiffs und über Treppen und Gänge immer weiter hinauf.
»Hier oben sind Kabinen erste Klasse. Ihre hat Numero 375.Außenkabine mit Blick auf Meer. Prego, Signora.«
Schwungvoll öffnete er die Tür. Inges Mutter war so verblüfft, dass sie im Türrahmen stehen blieb. Inge musste sie ein wenig zur Seite schieben, um auch etwas sehen zu können: ein richtiges kleines Wohnzimmer, aber statt des Fensters hatte es ein rundes Bullauge, durch das Hafen und Berge zu sehen waren; in der Mitte eine Sitzgruppe mit Sofa und Sesseln, auf dem Tisch eine Obstschale und eine Wasserkaraffe samt Gläsern, bedeckt mit einer gestärkten weißen Serviette. Es roch nach Möbelpolitur.
»Nebenan ist Schlafezimmer, und für Signorita haben wir Bett in Ankleidezimmer gestellt. Ich hoffe, das ist Signorita angenehme.«
Angenehm? Inge war schlichtweg begeistert von ihrem privaten Reisekämmerchen.
»Ich voreschlage, Sie gehen jetzt auf Promenadendeck, sonst Sie verpassen Auslaufen. Ich auspacke Koffer.«
Dieses Angebot riss Inges Mutter aus ihrer Erstarrung. »Aber nein«, stieß sie hervor, »das machen wir später selbst. Bemühen Sie sich nicht.«
Paolo gab erst auf, als Inges Mutter ihm mit Nachdruck erklärte, dass sie jetzt allein sein wollten.
»Zum Promenadendeck vorne rechts, dann Treppe hinauf. In zehn Minuten wir ablegen«, mahnte er, bevor er ging, und blinzelte Inge verschwörerisch zu. »Bitte klingeln, wenn Sie etwas brauchen.«
Seufzend ließ Inges Mutter sich gegen die geschlossene Tür fallen, der Vater sank, den Hut noch auf dem Kopf, in den nächsten Sessel. Doch Inge ließ ihnen keine Ruhe.
»Wir müssen an Deck. Schnell! Ich will doch sehen, wie das Schiff ablegt.«
»Das Kind hat recht, Willi. Das dürfen wir nicht verpassen.«
Triumphierend zerrte Inge die beiden eine weitere Treppe hinauf aufs Promenadendeck. Dort herrschte längst nicht solches Gedränge wie auf den unteren Etagen, wo die Menschen um einen Platz an der Reling kämpften. Alle wollten das Ablegemanöver verfolgen oder zurückbleibenden Angehörigen winken. Inge und ihre Eltern hatten niemand, dem sie winken konnten.
Die beiden riesigen Schornsteine des Dampfers spuckten bereits schwarze Rauchschwaden, die Schiffssirene stieß ein dumpfes Blöken aus, und die Bordkapelle intonierte einen flotten Marsch. Die riesigen Schiffsschrauben wirbelten das Wasser zu weißer Gischt. Am Kai machten Hafenarbeiter die armdicken Leinen von den Pollern los. Inge spürte den gewaltigen Schiffsleib unter sich beben, das Stampfen der Maschinen ließ ihre Fußsohlen vibrieren. Sie schaute zurück auf die Hafenanlage und die steilen Hänge dahinter. Dort stapelten sich Häuser bis hoch hinauf, dazwischen reckten Palmen ihre Wuschelköpfe. Die schonungslose Sonne des südlichen Mittags ließ jedes Detail deutlich hervortreten. Das Halbrund der Berge bildete die gut ausgeleuchtete Kulisse für diesen dramatischen Moment, den sie wie von einem Logenplatz mitverfolgte. Jetzt spielte die Kapelle »Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus…« Aber statt des großen Auftritts wurde die Kulisse nach hinten weggezogen; zwischen Kaimauer und Schiffswand klaffte eine Lücke, die sich rasch mit schmutzigem Hafenwasser füllte und immer größer wurde. Eben noch unbeteiligter Zuschauer, trafen Inge die Ereignisse plötzlich wie ein Magenschwinger. Hilfe suchend blickte sie nach links und rechts zu den Eltern auf: Der Vater mit grauem Gesicht, den Blick starr geradeaus; die Mutter das weiße Batisttaschentuch an den Mund gepresst, jeder ganz und gar mit sich selbst beschäftigt. Kein vielversprechender Anfang für eine Schiffsreise. Und Inge? Die wusste natürlich, dass es der Dampfer war, der sich mühsam in Bewegung setzte. Dennoch kam es ihr vor, als würden Hafen und Berge sich von ihr entfernen. Fassungslos sah sie zu, wie man ihr das Land wegzog.
***
Zurück in der Geborgenheit der holzgetäfelten Kabine nahm der Vater zum ersten Mal seit Beginn der langen Reise den Hut ab. Erschöpft strich er sich mit den Handflächen über den kahlen Schädel, auf dem sich dunkel die ersten nachwachsenden Haarstoppeln abzeichneten.
»Herrje, Marianne, wo sind wir denn hier gelandet? Ich bin überhaupt noch nicht zum Denken gekommen, seit du mich da rausgeholt hast. Wieso dieser unnötige Luxus?«, seufzte er, nachdem sich die kleine Familie um den Tisch versammelt und aus der Wasserkaraffe bedient hatte.
»Was blieb mir anderes übrig?«, entgegnete seine Frau. »Alles war über Monate ausgebucht, und die Passagen in der ersten Klasse hab ich auch nur bekommen, weil dieser arme Junge an Scharlach erkrankt ist und seine Familie nicht fahren konnte. Aber wo wir nun schon mal hier sind, können wir’s ebenso gut genießen. Ein bisschen Luxus kann dir nicht schaden, nach allem, was du durchgemacht hast.«
Wilhelm Finkelstein blickte mit einer Mischung aus Bewunderung und Resignation zu seiner Frau hinüber.
»Auf dem Schiff gibt’s sogar ein Kino und ein Schwimmbad«, quasselte Inge sich dazwischen. Niemand beachtete ihren Einwurf.
»Ich mach dir ja keine Vorwürfe, Marianne. Es ist nur alles so schnell gegangen. Schanghai war für mich bisher bloß ein Punkt auf der Landkarte.«
»Für mich ja auch, Willi.«
»Aber nicht für mich«, bemerkte Inge, um dann auch gleich weit auszuholen: »Schanghai ist eine große Hafenstadt an einem Fluss, der kurz darauf ins Meer mündet«, sprudelte sie los. »Da ist alles groß und laut und bunt. Und man kann auf der Straße essen, und die Kinder müssen nicht so früh ins Bett wie in Deutschland. Statt mit dem Taxi fährt man in einer Rikscha, die wird von einem Mann gezogen. Und wenn man eine mieten will, winkt man mit der Hand. Aber so, mit den Fingern nach unten.« Sie fuchtelte mit der Hand vor den Gesichtern ihrer verblüfften Eltern. »Und dazu sagt man láilái. Da muss die Stimme ein bisschen nach oben gehen. Habt ihr gewusst, dass das Chinesische vier verschiedene Töne hat? Wenn man den falschen erwischt, bedeutet es ganz was anderes. Man kann sich furchtbar blamieren. Und zur Begrüßung fragen sich die Leute, ob sie schon gegessen haben. Ist das nicht lustig? Aber es stimmt überhaupt nicht, dass alle Chinesen Hunde und Vogelnester essen.« Ganz außer Atem hielt Inge mit ihrer Belehrung inne.
»Woher weißt du denn das alles?« Die Eltern sahen ihre Tochter erstaunt an.
»Von Ina, die kommt doch aus Schanghai. Sie hat mir viel von Zuhause erzählt, und ein bisschen Chinesisch hat sie mir auch beigebracht.«
Jetzt erinnerte sich ihre Mutter an das kleine Chinesenmädchen, das in Brandenburg als Pflegekind lebte und mit Inge zur Schule gegangen war. Sie war in den Wochen vor der Abreise oft zu Besuch gekommen, doch damals war sie selbst viel zu beschäftigt gewesen, um sich zu fragen, was die beiden in Inges Zimmer trieben.
»Ich dachte, ihr spielt mit euren Puppen.«
»Dazu hatten wir keine Zeit. Ich musste sie doch über Schanghai ausfragen. Die Puppen hab ich ihr dagelassen, bis auf die Gundel.«
Bei der Erwähnung von Inges Lieblingspuppe warf die Mutter einen hastigen Blick auf ihre Uhr. »Höchste Zeit zum Mittagessen. Paolo hat uns fürs zweite Menü eingetragen, das wird um halb zwei serviert. Deine Sachen kannst du später auspacken, Inge.«
»Soll ich die Stäbchen mitnehmen, die Ina mir geschenkt hat? Dann kann ich schon mal üben.«
»Aber Kind«, kam es mit leisem Vorwurf von der Mutter. »Wir sind doch noch nicht in China.«
»Ich komme nicht mit, Marianne. Ich möchte nicht im Speisesaal essen«, sagte der Vater ruhig, aber bestimmt. »Nicht in diesem Zustand.«
»Dann werden wir eben Paolo bitten, dass er dir was in die Kabine bringt.« Bevor er protestieren konnte, hatte sie schon nach dem Kabinensteward geklingelt, der auch prompt erschien.
»Ich hoffe, die Herreschaften haben sich eingerichtet. Was kann ich für Sie tun?«
»Würden Sie meinem Mann bitte ein leichtes Mittagessen in die Kabine bringen? Eine Bouillon vielleicht.«
»Aber gerne. Er fühlt sich nicht wohl? Benötigen Sie Dottore?«
»Nein, nein, Paolo, nur eine kleine Unpässlichkeit. Wenn Sie uns jetzt vielleicht den Speisesaal zeigen?«
»Mit Veregnügen, Signora. Gentilissima Signorita.« Damit machte er vor Inge eine galante Verbeugung und ging den beiden voraus.
***
Der Speisesaal der ersten Klasse war ein eindrucksvoller, spitz zulaufender Raum ganz vorn am Bug des Schiffes. Durch die großen Panoramascheiben sah Inge zum ersten Mal aufs offene Meer hinaus. Doch ihre Aufmerksamkeit wurde ganz von ihrer unmittelbaren Umgebung in Anspruch genommen: funkelnde Kristalllüster, das Klingen von Gläsern und Besteck, vielsprachiges Stimmengewirr. Paolo bugsierte sie vor sich her durch Tischreihen mit blütenweißen Damasttischdecken. Dann stellte er sie ihren Tischnachbarn vor, einer stattlichen deutschen Dame mit ihrem etwa fünfzehnjährigen, pummeligen Sohn.
»Reisen Sie auch nach Schanghai?«, erkundigte sich Frau Kommerzienrat Schwab, während sie mit beringten Fingern die Serviette über ihren Schoß breitete, der Sohn schaute gelangweilt zum Fenster hinaus.
»Ja«, erwiderte Inges Mutter schlicht.
»Wir leben da schon länger. Mein Mann hat eine Firma dort, und Rüdiger besucht die Kaiser-Wilhelm-Schule. Wir kommen gerade vom Heimaturlaub. Ein Jammer, dass man im Ausland lebt, jetzt, wo die Bewegung Fahrt aufgenommen hat. Wir waren sehr beeindruckt, nicht wahr, Rüdiger?«
Ein beiläufiges Nicken des Sohns, Frau Finkelstein blieb still. Doch die Einsilbigkeit ihres Gegenübers schien Frau Schwab keineswegs zu stören. Sie bedurfte keiner Ermutigung. Wortreich klärte sie ihre Tischnachbarin über die Unsitten der Chinesen auf; wie schmutzig sie seien, dass sie spuckten und feilschten und einen bei jeder Gelegenheit übers Ohr hauten.
»Beim Personal müssen Sie sich besonders vorsehen«, fuhr Frau Schwab fort. »Kaum stellt man einen Küchenboy ein, schon bringt er seine ganze Sippe mit. Und dann die Sache mit dem cumshaw. Von dem Geld, das man ihnen für den Einkauf gibt, wandert die Hälfte in die eigene Tasche.«
Inge hörte sich das alles an. Wie gut, dass man mit vollem Mund nicht reden durfte, sonst hätte sie bestimmt widersprochen. Inge hatte schließlich eine chinesische Freundin, die weder schmutzig war noch spuckte. Und anstatt zu feilschen, hatte sie ihr die Essstäbchen aus Elfenbein geschenkt, eines der wenigen Andenken an die Heimat. Wie viel praktischer die jetzt wären, dachte Inge bedauernd, während sie mit der schweren Silbergabel die widerspenstigen Spaghetti zu bändigen suchte. Ihr gegenüber verputzte Rüdiger sein Steak. Fasziniert sah Inge zu, wie er das blutige Fleisch zersägte. Am Gespräch beteiligte er sich nur nach ausdrücklicher Aufforderung seiner Mutter.
Bei Inge bedurfte es solcher Aufforderung nicht. Sie handelte streng nach dem Motto: »Wer nicht fragt, bleibt dumm«, auch wenn ihr das manch strafenden Blick ihrer Mutter einbrachte. Als ihr Teller endlich leer war, konnte sie ihre Neugierde nicht länger zügeln und mischte sich ungefragt ins Gespräch der Erwachsenen ein.
»Können Sie Chinesisch?« Es interessierte sie brennend, wie diese Frau sich mit ihren chinesischen Bediensteten verständigte.
»Aber nein, natürlich nicht, mein Kind, das kann man unmöglich lernen. Wozu auch! Mit den Dienstboten spricht man Pidgin-Englisch.«
Was war denn das nun wieder? Inge hatte zwar in der Schule ein bisschen Englisch gelernt, aber von dieser Pinguin-Sprache hatte sie noch nie gehört. Außerdem war sie sich sicher, dass man Chinesisch lernen konnte. Sie hatte ja bereits damit angefangen.
Nach einem abschließenden Mokka für die Mutter und einem Eis für Inge verabschiedeten sie sich von ihren Tischnachbarn.
»Puh, die hört ja gar nicht mehr auf zu reden«, bemerkte Inges sonst so höfliche Mutter, als sie außer Hörweite waren.
»Kein Wunder, dass der Sohn keinen Ton sagt.«
»Das könnte dir nicht passieren, mein Entlein.« Frau Finkelstein legte liebevoll den Arm um die Schulter ihrer vorlauten Tochter. Inge wurde von den Eltern auch Entlein genannt, weil sie immer dazwischenquakte.
»Mama, lass uns beim Schwimmbecken vorbeigehen«, bettelte Inge auf dem Rückweg in die Kabine. »Ich würde so gern baden gehen.«
»Inge, wir haben Dezember.«
»Aber hier ist es doch viel wärmer als zu Hause.«
Tatsächlich planschten einige Kinder in dem Becken, während ihre Mütter auf Liegestühlen ausgestreckt in Gespräche oder Bücher vertieft waren. Wie gerufen erschien der allgegenwärtige Paolo. »Darf ich reservieren Deckchair für Signora?«
»Au ja, Mama, bitte!« Inge strahlte ihren Retter an.
»Du weißt genau, dass man mit vollem Bauch nicht schwimmen soll. Frühestens nach dem Mittagsschlaf.« Und zu Paolo: »Wir kommen um drei.«
Nicht einmal Inge hatte gegen Mittagsschlaf etwas einzuwenden. Die Reise und die Aufregungen der letzten Woche hatten allen schwer zugesetzt. Ohne Widerrede zog sie sich in ihr Kämmerchen zurück, legte sich aufs Bett und schlief sofort ein.
Inges Mutter wusch noch rasch ein Paar Seidenstrümpfe im Waschbecken aus und breitete sie zum Trocknen über ein Handtuch. Sie hatte sie während der langen Zugfahrt nicht wechseln können.
Inge war als Erste wieder munter und weckte ihre Eltern. Den Badeanzug mit dem aufgenähten Freischwimmerabzeichen hatte sie bereits angezogen, ein Handtuch nahm sie sich vom Waschtisch. Dann stiegen sie die Treppe zum Promenadendeck hinauf.
Inge hatte den ganzen Pool für sich und machte toten Mann. Man musste sich einfach nur auf den Rücken legen; wenn man sich ganz leicht machte und keine Angst bekam, ging man nicht unter. In Brandenburg mit seinen vielen Seen und Kanälen lernten die Kinder früh schwimmen; auch Inge hatte die Sommer, solange ihr das noch erlaubt war, mit den Freundinnen im Freibad am Grillendamm verbracht.
Es war wunderbar, sich einfach treiben zu lassen und in den blauen Himmel zu schauen. Vor allem, wenn man sich vorstellte, dass man dabei wie in einer schwimmenden Badewanne über ein noch viel größeres Wasser glitt. Aber auch die Gedanken begannen zu treiben. Inge dachte daran, wie sie mit Lotte und Ina den bestandenen Freischwimmer mit Kakao und Kuchen im elterlichen Café gefeiert hatten. Plötzlich wurde ihr kalt.
»Jetzt ist aber Schluss, Inge. Du hast ja schon ganz blaue Lippen!« Die Stimme der Mutter aus dem Deckchair holte sie in die Gegenwart zurück. Bibbernd zog sie sich warme Sachen an und kroch im Liegestuhl neben der Mutter unter eine Decke. Auch ihr Vater hatte sich überreden lassen, die Kabine zu verlassen. Er stand, den unvermeidlichen Hut auf dem Kopf, etwas abseits an der Reling und starrte aufs Meer hinaus. Dass dem das nicht langweilig wurde, wo es außer Wasser doch rein gar nichts zu sehen gab? Aber Inge verstand ihn. Vermutlich war auch er in Gedanken weit weg, nur dass seine Erinnerungen nicht nach Torte und Pflaumenkuchen schmeckten.
Als sie wieder in die Kabine kamen, erwartete sie ein vorwurfsvoller Paolo an der Tür, in der Hand einen Wäschesack mit dem Emblem der Lloyd Triestino, den Initialen L und T verbunden durch einen Anker.
»Aber Signora, Sie brauchen Wäsche doch nicht selber waschen«, sagte er mit Nachdruck und ließ Mutter und Tochter einen Blick in den Wäschesack werfen, in dem ein einsames Paar Seidenstrümpfe lag. »Das machen wir für Sie. Im Schrank finden Sie Vorrat von diese Wäschesäcke. Einfach an Tür hängen. Nächste Tag alles ist wieder da.«
Während der Ereignisse der vergangenen Wochen hatte Inge ihre Mutter nicht ein einziges Mal verlegen gesehen. Nun kroch eine leichte Röte vom Hals über ihr Gesicht. Statt gegen die Entführung ihrer Strümpfe zu protestieren, nickte sie nur und erwiderte: »Danke, Paolo. Wir gehen jetzt zum Abendessen.«
Diesmal waren sie zu dritt. Während Frau Finkelstein den Luxus, das Lichtermeer, die leise Klaviermusik, die ganze exklusive Welt des Speisesaals allmählich zu genießen schien, verzehrte ihr Mann lustlos, was ihm vorgelegt wurde. Es war ein Pflichtakt, den er stumm vollzog. Selbst Frau Schwab, die ihn nur zu gern ausgefragt hätte, scheiterte an seinem stoischen Schweigen.
Satt, zufrieden und müde von den Ereignissen dieses ersten aufregenden Tages auf See verzog Inge sich bald nach dem Essen unaufgefordert in ihr Kämmerchen. Die Seeluft hatte sie müde gemacht, und sie war schon im Halbschlaf, als sie nebenan die erregten Stimmen ihrer Eltern hörte.
»Marianne, versteh mich richtig, ich bin dir unendlich dankbar, dass du mich da rausgeholt hast, aber wie konntest du ein solches Risiko eingehen?«
»Dann sag mir mal, wie wir uns von zehn Reichsmark pro Kopf da drüben eine Existenz aufbauen sollen? Den Erlös aus dem Verkauf von Café und Konditorei durften wir ja nicht mitnehmen. Was uns der Wallenburger dafür bezahlt hat, war ohnehin ein Witz. Immerhin hat es für die Schiffspassagen gereicht.«
»Das ist es ja, was mich so fertigmacht, dass ich dich mit hineinziehe, in dieses ganze Elend. Da hast du dich mit deinen Eltern überworfen, um einen mittellosen Juden aus dem Waisenhaus zu heiraten. Und als er dann endlich was auf die Beine gestellt hat, nehmen sie’s ihm wieder weg.«
»Aber mich werden sie dir nicht wegnehmen«, hörte Inge die Mutter leise, aber bestimmt sagen. »Es ist eine Verschnaufpause, die wir uns hier erkauft haben. Wer weiß, was uns am anderen Ende der Reise erwartet. Dann bleibt uns womöglich nur mein Familienschmuck.«
»Schon gut, Marianne. Ich versteh dich ja, aber wie konntest du ausgerechnet die Puppe dazu hernehmen. Wenn die Zollbeamten das entdeckt hätten! Vor dem Kind!«
»Es war der sicherste Platz«, rechtfertigte sich die Mutter. »Und wenn ich meinen Schmuck schon versetzen muss, kann ich ihn ebenso gut vorher noch mal tragen«, fügte sie bitter hinzu.
Bei dem Wort Puppe war Inge auf einmal hellwach. Während des ersten Tages auf See hatte sie völlig vergessen, die Gundel, ihre Käthe-Kruse-Puppe, auszupacken. Höchste Zeit, dass sie aus dem Schulranzen befreit wurde, in dem sie gereist war. Jetzt sofort wollte Inge sie zu sich ins Bett holen. Als sie leise die Tür öffnete, sah sie ihre Mutter am Tisch sitzen und mit den Fingern im weichen Stoffkörper ihrer Puppe wühlen. In Gundels Rücken klaffte ein Loch. Inge stieß einen spitzen Schrei aus: »Mama! Was machst du da?«
Die Köpfe der Erwachsenen fuhren herum.
»Inge!« Ihre Mutter fand als Erste die Sprache wieder. »Äh… wegen der Gundel. Ich kann dir das erklären. Ich hab da eine kleine Operation an ihr vornehmen müssen. Sie hat uns geholfen, etwas sehr Kostbares über die Grenze zu bringen.« Vor ihr auf dem Tisch lagen ein Diamantring, ein Paar passende Ohrringe, einige Broschen und eine feingliedrige Goldkette. »Ich verspreche dir, dass ich sie jetzt sofort wieder zunähe. Mit Narkose.«
Inges Mutter hatte den ziemlich ramponierten Stoffkörper der Puppe schon mehrfach geflickt und ihr auf Inges Geheiß zuvor immer eine Betäubungsspritze mit der Nähnadel gegeben.
»Betäubung ist nicht nötig. Die spürt sowieso nichts.«
Einen Moment lang sah die Mutter ihre Tochter verblüfft an. Dann sagte sie: »Da siehst du, Willi, was für ein großes, verständiges Mädchen wir haben, auch wenn sie erst zehn ist. Ich finde, Inge sollte unsere Vertraute sein. Nach allem, was passiert ist, können wir ihr keine heile Welt mehr vorspielen. Unsere kleine Familie muss zusammenhalten und miteinander reden. Gemeinsam können wir besser mit der neuen Lage fertig werden. Übrigens finde ich es großartig, dass sie jetzt unsere China-Expertin ist. Oder hast du gewusst, dass das Chinesische vier Töne hat?«
Der Vater zuckte nur mit den Schultern, doch sein Blick ruhte mit liebevollem Staunen auf seiner Tochter.
Geschickt nähte Inges Mutter die Puppe wieder zu und schickte die beiden anschließend ins Bett. »Und sei mir bitte nicht böse. Es musste einfach sein«, sagte sie noch, als sie sich über Inge beugte und ihr einen Gute-Nacht-Kuss gab, den zweiten an diesem Abend. Dann schloss sie leise die Tür zum Ankleidezimmer.
Doch einmal geweckt, ließ sich die Vergangenheit nicht aussperren. Erinnerungen drängten mit Macht an die Oberfläche. Diesmal waren es keine glücklichen Bilder wie unter dem blauen Nachmittagshimmel. Jetzt war dunkle Nacht, so wie damals, als markerschütterndes Krachen und Klirren sie geweckt hatte. In das Bersten von Glas hatte sich das Johlen von Männerstimmen gemischt. Knappe Befehle wurden geschrien, wieder krachte es. Tritte gegen das Hoftor, dann das Splittern von Holz. Die Stimmen, lauter jetzt, grölten in der Einfahrt und schallten gleich darauf durchs Treppenhaus: »Komm raus, du Judenschwein!«
Inge hatte das für einen schlimmen Traum gehalten. Doch als sie sich in den Arm zwickte, musste sie feststellen, dass es daraus kein Erwachen gab. Sie hatten den Vater mitgenommen, die Konditorei und das Café kurz und klein geschlagen. Danach war nichts mehr so gewesen wie zuvor. Inge drückte ihre Puppe an sich, um nicht wieder in diesen Albtraum zurückzufallen, aber die Gundel kam ihr irgendwie hohl vor.
Am nächsten Morgen beim Frühstück trug auch Frau Finkelstein neben ihrem Ehering einen Diamant am Finger.
Abendland– Morgenland
Auf See, 1938– Jahr des Tigers
虎
»Papa, Mama, da unten gibt’s ganz viele so wie wir. Ich meine, Deutsche, die nach Schanghai fahren, weil sie jüdisch sind.«
Aufgeregt kam Inge von einem ihrer Erkundungsgänge in die unteren Etagen zurück. Sie hatte rasch herausgefunden, dass es in der ersten Klasse kaum Kinder gab, zumindest kaum welche, mit denen sie sich verständigen konnte. Und auf den hochnäsigen Rüdiger konnte sie gern verzichten. In der zweiten und dritten Klasse war es zwar eng, aber dafür ging es wesentlich lustiger zu, jedenfalls unter den zahlreichen Kindern. Die Erwachsenen wirkten bedrückt; Frauen standen in Grüppchen auf Deck und machten Pläne für eine ungewisse Zukunft, während die Männer unbeteiligt herumsaßen oder übers Meer schauten wie Inges Vater, viele ebenfalls mit geschorenem Kopf, den sie unter Hüten oder Mützen zu verbergen suchten. Inge hatte mittlerweile einen Blick für solche eingeschüchterten, gebückten Gestalten. Das waren Männer, die im Lager gewesen waren.
»Manche da unten essen bloß gekochte Eier und Fisch, weil das Essen auf dem Schiff nicht koscher ist. Außerdem, sagt Max, ist die Verpflegung ziemlich mies«, berichtete Inge. Sie wusste zwar, was »koscher« bedeutete, aber bei den Finkelsteins hatten die jüdischen Speisevorschriften nie eine Rolle gespielt. Genau genommen war Inge gar nicht jüdisch, weil sie eine evangelische Mutter hatte, aber nach dem nationalsozialistischen Blutschutzgesetz galt sie dennoch als Halbjüdin. Und nach dem gleichen Gesetz galt die Ehe ihrer Eltern als Rassenschande.
»Und wer bitte ist Max?«, wollte die Mutter wissen.
»Der fährt auch mit seinen Eltern nach Schanghai. Er kommt aus Stuttgart, deshalb redet er ein bisschen komisch, aber sonst ist er ganz in Ordnung. Denen hat die SA auch den Laden zusammengeschlagen. Seine Eltern hatten ein Bekleidungsgeschäft.« Das sollte genügen, um die Mutter zu beruhigen, und Inge konnte nun ihrerseits fragen.
»Haben die das denn in ganz Deutschland gemacht? Ich dachte immer, das wäre nur bei uns in Brandenburg passiert?«
»Leider nein, Entlein. Die Ereignisse vom neunten November waren gezielte, von oben angeordnete Gewaltakte gegen jüdische Geschäftsleute und Bürger. Und jetzt reden sie verharmlosend von Reichskristallnacht, weil dabei überall im Reich so viele Glasscheiben zu Bruch gegangen sind.«
Meistens war es die Mutter, die ihr solche Fragen beantwortete. Herr Finkelstein wollte über diese Dinge nicht sprechen, auch nicht über das, was ihm im Lager zugestoßen war. Beim Anblick des stummen Vaters gab es Inge jedes Mal einen Stich. Das war nicht mehr der gut situierte Bürger und deutsche Frontkämpfer, den sie ihr Leben lang gekannt hatte; er war wie ausgewechselt. Nichts erinnerte an den stattlichen Konditormeister und Caféhausbesitzer, der seine Gäste im dunklen Anzug und mit gestärkter Serviette über dem Arm bedient oder in der Backstube die wunderbarsten Torten und Plätzchen gezaubert hatte. Wo war der Mann, der in allen Lebenslagen Rat wusste und sich schützend zwischen seine kleine Tochter und die Welt gestellt hatte, die in jener Nacht klirrend zu Bruch gegangen war? Wohin war sein spöttisches Lächeln verschwunden? Zusammen mit dem welligen, dunklen Haar schien ihm jegliches Selbstvertrauen abhanden gekommen zu sein. Hoffentlich wuchs so was nach.
»Paolo hat mir erzählt, dass wir vor Schanghai noch viele andere Häfen anlaufen«, erzählte Inge, um ein angenehmeres Thema anzuschneiden. »Wir müssen schließlich Kohlen bunkern und Wasser und Vorräte an Bord nehmen.« Die Eltern warfen sich einen amüsierten Blick zu. Ihre Tochter war mit den Erfordernissen der Dampfschifffahrt inzwischen bestens vertraut. »Im Speisesaal gibt’s eine Karte, da sind alle Städte drauf und mit Fähnchen gekennzeichnet: Colombo, Manila, Singapur, Hongkong. Ist das nicht toll? Vielleicht können wir unterwegs mal aussteigen.«
»Wir sind hier nicht auf Urlaub, Inge, auch wenn sich das vielleicht so anfühlt«, mischte der Vater sich ein. Inge hatte gar nicht bemerkt, wie sich seine Stirn in zornige Falten gelegt hatte. »Ich glaube kaum, dass die Briten einem deutschen Juden Zugang zu ihren Kolonien gewähren; ich könnte ja bleiben wollen«, erklärte er bitter. »In ihr Amerika oder England oder Australien haben sie uns ja auch nicht einreisen lassen. Es sei denn, wir hätten dort reiche Verwandte gehabt, die für uns bürgen. Es wundert mich nicht, dass viele der Passagiere auf den unteren Decks auch nach Schanghai wollen. Um dorthin zu kommen, braucht man lediglich Schiffspassagen, aber auch die sind schwer zu bekommen. Wenn deine Mutter nicht gewesen wäre…«, hier versagte Herrn Finkelstein die Stimme.
Inge fiel der kleine Junge in Berlin ein, der jetzt mit Scharlach im Bett lag, während sie an seiner Statt mit ihren Eltern übers Meer fuhr. Doch diesen Gedanken schob sie gleich wieder weg.
»Morgen nach dem Frühstück hab ich mich mit Max verabredet«, verkündete sie stattdessen. »Paolo sagt, dass wir heute Nacht in Port Said anlegen. Und morgen fahren wir durch den Suezkanal. Da sieht man endlich mal was anderes als immer nur Wasser. Wir haben uns schon einen Platz auf dem Promenadendeck gesucht, von wo man eine prima Aussicht hat.«
***
Am nächsten Morgen hielt es Inge kaum am Frühstückstisch. Immer wieder wanderte ihr Blick durch die Panoramascheiben des Speisesaals nach draußen. An der Hafenmole, wo die »Conte Biancamano« über Nacht angelegt hatte, stand die riesige steinerne Statue eines Mannes. In der einen Hand hielt er eine Planskizze, mit der anderen lud er zur Einfahrt in den Kanal ein.
»Wer ist das denn?«, entfuhr es ihr.
»Das ist Ferdinand de Lesseps, der Erbauer des Suezkanals.« Wie auf Knopfdruck wurde der sonst so stille Rüdiger gesprächig. Hier sah er eine Gelegenheit, vor der Kleinen mit seinem Schulwissen zu protzen. »Dieser Durchstich zwischen dem Mittelmeer und dem Golf von Suez hat den Schifffahrtsweg nach Ostasien um viertausendfünfhundert Seemeilen verkürzt. Das heißt, wir kommen einige Tage früher in Schanghai an.«
»Unser Rüdiger hat immer beste Noten in Erdkunde. Kein Wunder, er ist ja schon so viel rumgekommen mit seinen jungen Jahren.« Frau Schwab betrachtete ihren Sohn mit stolzem Mutterlächeln.
Klugscheißer, dachte Inge und ließ den Löffel mit Wucht auf die Spitze ihres Frühstückseis niedersausen. Dann konnte sie es sich aber doch nicht verkneifen zu fragen: »Und vorher? Musste man da um Afrika rumfahren?« Auch Inge konnte man in Erdkunde nichts vormachen.
»Ja. Die Umrundung des Kaps der Guten Hoffnung war nicht nur zeitraubend, sondern auch gefährlich. Stürme und Piraten bedrohten die Handels- und Passagierschiffe«, dozierte Rüdiger weiter. »Jetzt benötigt man für die Durchfahrt der hunderteinundsechzig Kilometer langen Wasserstraße nur noch sechzehn bis achtzehn Stunden, je nach Gegenverkehr.«
»Er liebäugelt mit einer Stellung bei der Handelsmarine«, kommentierte seine Mutter.
Inge ignorierte sie; sie wollte dem neunmalklugen Rüdiger noch ein paar nützliche Informationen entlocken, die sie später an Max weitergeben konnte.
»Und wie funktioniert das mit dem Gegenverkehr?«
»Für zwei große Passagierdampfer oder Frachtschiffe ist der Kanal zu schmal. Die können nur an den Ausweichstellen passieren. Die Ausweichstellen heißen gares, wie französisch für Bahnhof. Dabei haben die von Süden kommenden Schiffe Vorfahrt.«
»Das heißt, wir müssen ausweichen«, kam es prompt von Inge. Das versprach ja interessant zu werden.
Ganz blöd ist sie nicht, die Kleine, schien der Blick zu sagen, mit dem Rüdiger sie bedachte. Dann wandte er sich wieder seinem Sandwich zu. Die Fragestunde mit dem Experten war beendet.
»Darf ich aufstehen?«, bat Inge die Mutter, sobald sie fertig war. Vorher hatte sie noch rasch zwei Croissants in ihrer Serviette verschwinden lassen. Ohne eine Antwort abzuwarten, rutschte sie vom Stuhl, warf ein »Wiedersehen« in die Runde und schlängelte sich durch die Tische davon.
»Um zwölf bist du wieder in der Kabine«, rief die Mutter ihr nach, aber das hörte Inge schon nicht mehr.
Mittlerweile fand Inge sich auf dem Schiff bestens zurecht. Ein paar Gänge entlang, die Treppe hinauf, schon war sie auf dem Promenadendeck und sah Max an der Reling stehen, ein schlaksiger Junge, etwas älter als sie, mit einem Käppi über dem roten Bürstenschnitt, das seine empfindliche Haut vor der Sonne schützen sollte. Dünne Beine mit knubbeligen Knien stakten aus kurzen Hosen, dazu trug er ein kurzärmeliges kariertes Hemd. Und er war nicht allein. Inge kam eben dazu, wie ein Schiffssteward ihn anblaffte: »Non é permesso. Geh nach unten, wo du hingehörst.«
Das war nicht der Ton, den Inge von der Besatzung gewöhnt war, auch wenn dieser Steward sehr viel besser Deutsch sprach als Paolo. Instinktiv ließ sie die Serviette mit dem Proviant hinter dem Rücken verschwinden, dann sah sie sich Hilfe suchend um. Prompt entdeckte sie ihren Retter, der drüben am Pool gerade die Deckchairs aufstellte.
»Paolo!«
Er kam herüber und schien die Situation mit einem Blick zu erfassen.
»Paolo, das ist mein Freund Max, und wir wollten doch nur…«, sprudelte Inge hervor. »Du hast doch gesagt…«
»Va bene, Signorita«, beruhigte er Inge und wechselte dann ein paar Sätze in Stakkato-Italienisch mit seinem Kollegen. Mit großer Geste forderte er die beiden anschließend auf, ihm zu folgen.
»Ich euch zeige extra Platz mit beste Aussicht.« Sie folgten ihm eine weitere Treppe bis fast auf die Höhe der Kapitänsbrücke, dort befand sich ein kleiner Ausguck. Hier waren sie der strengen Klassengesellschaft des Schiffes enthoben. »Und wenn jemand schimpfen, dann sagen: ›Paolo a permesso.‹ Capito?«
»Capito«, wiederholte Inge. »Grazie mille, Paolo.«
»Haidenai!«, entfuhrt es Max, der die ganze Aktion in ehrfürchtigem Schweigen mitverfolgt hatte. »Und fremde Sprachen ko des Mädle au.«
Inge sonnte sich in der Bewunderung des Älteren. Dann zog sie, um das Maß vollzumachen, die Serviette mit den Croissants hinter dem Rücken hervor. »Und ein bisschen Schiffszwieback hab ich dir auch mitgebracht.«
Nachdem Max seine Verblüffung überwunden hatte, griff er sofort zu und senkte die Zähne in das weiche Gebäck.
»Inge, auf dich isch Verlass«, erklärte er kauend.
Noch lag das Schiff an der Mole vertäut.
»Sieh mal, wer uns da besuchen kommt.«
Erst als sie sich über die Reling beugte, sah Inge, was sich unmittelbar zu Füßen des »Grafen« alles abspielte; es war, als hielte er Hof. Um seinen steil aufragenden Bug tummelten sich unzählige Boote, auf denen Einheimische Früchte, bunte Tücher und Andenken feilboten. Die Ware konnte man in einem Körbchen, in das man vorher das Geld legte, an Bord ziehen. Die Verständigung funktionierte mit Zurufen und Handzeichen. Längsseits hatten flache Lastkähne festgemacht. Schwitzende Männer mit freiem Oberkörper balancierten schwere Kohlelasten auf dem Kopf über schwankende Planken und hievten sie durch die Ladeluken in den Bauch des Schiffes. »Kohlen bunkern« nannte man das. Über das Fallreep kam ein würdevoll aussehender Mann in Uniform an Bord. Der Kapitän ging ihm entgegen, begrüßte ihn herzlich und brachte ihn auf die Brücke. Inge und Max machten sich so unsichtbar wie möglich, konnten von ihrem Platz aber alles bestens verfolgen.
»Das muss der Lotse sein«, vermutete Max. »Kein Schiff darf ohne einen Lotsen durch den Kanal fahren.« Offenbar hatte auch er Erkundigungen eingezogen.
»Guck mal, das große Haus da drüben. Sieht aus wie aus Tausendundeiner Nacht.« Inge deutete auf ein prächtiges Gebäude mit Kuppeln und Türmchen direkt am Hafenbecken.
»Das ist das Verwaltungsgebäude der Kanalgesellschaft. Mein Vater hat gesagt, die Schiffe müssen ziemlich hohe Gebühren zahlen, wenn sie durch den Kanal fahren wollen. Kein Wunder, dass die sich so einen Palast bauen können.« Max schien dabei weniger an Märchen als an das einträgliche Geschäftsmodell zu denken.
»Dafür geht’s ja auch viel schneller«, bemerkte Inge und erklärte ihm die Sache mit der Zeitersparnis.
Bald darauf wurden die Leinen der »Conte Biancamano« von Hafenarbeitern gelöst. Schreiend und gestikulierend vertrieben sie die Boote der Einheimischen, die sofort Kurs auf den nächsten Neuankömmling nahmen. An der Mole herrschte ein ständiges Kommen und Gehen; Zeit war kostbar im Kanal. Wieder tutete die Schiffssirene, die Schrauben legten los, und der Dampfer drehte die Nase langsam in Richtung Kanaleinfahrt. Dann begann das sanfte, langsame Gleiten über die Wasserstraße. Schiffe durften hier nicht schneller als zehn Knoten fahren, darüber wachte der Lotse, der die Kraft der Maschinen auf ein Minimum drosseln ließ, um das Schiff sicher durch die enge Fahrrinne leiten zu können.
Inge kam sich vor wie auf den teuersten Plätzen im Filmpalast, nur dass hier alles wirklich und in Farbe war; interessante Gerüche streiften ihre Nase, und der Wind zerrte an den Zöpfen. Zu beiden Seiten zog jetzt die Landschaft vorbei. Links, unter flimmernder Sonne, nichts als fahlgelbe Sandwüste; rechts ein Schienenstrang, dahinter ein See. Jenseits des Deiches, der die beiden Wasserflächen voneinander trennte, konnte man die großen, spitzen Dhau-Segel der ägyptischen Boote erkennen. Das Tempo war genau richtig, um alles in Ruhe zu betrachten.
»Da fährt unser Schatten«, sagte Max und deutete auf das rechte Ufer. Dieser dunkle, über die Deichböschung huschende Doppelgänger machte ihnen erst bewusst, wie hoch die Aufbauten der »Conte Biancamano« über dem schmalen Wasserweg aufragten. Vom Land aus musste das ziemlich komisch aussehen: Ein Schiff, das mitten durch die Wüste fuhr.
»Jetzt sind wir ein Wüstenschiff«, fasste Inge die Situation zusammen.
»Und da drüben sind welche mit vier Beinen.«
Inge musste die Augen gegen die Sonne schützen, um die gemächlich schwankenden Silhouetten zu erkennen, die sich in langer Reihe auf dem Deich abzeichneten.
»Mensch, Max, das sind ja richtige Kamele.«
Inge war völlig hingerissen. Diese Tiere mit den langen Wimpern, der hängenden Oberlippe und dem klugen, aber immer etwas hochmütigen Blick kannte Inge nur von Bildern und aus der Tierschau. Sie hatten ihr in ihrer herablassenden Arroganz schon immer imponiert. Und hier kam gleich eine ganze Karawane vorbei. Das Leittier und das Kamel am Schluss trugen vermummte Gestalten, die anderen waren mit großen Säcken beladen. Inge leuchtete sofort ein, warum die Reiter so eingemummelt und in Tücher gehüllt waren.
»Knirscht’s bei dir auch zwischen den Zähnen?«, fragte sie Max.
»Das ist Sand aus der Gobi«, erwiderte er sachkundig.
»Glaub ich nicht, die ist zu weit weg.«
»Auf jeden Fall ist das da drüben Asien«, sagte Max und deutete nach links.
»Dann ist das hier Afrika«, konterte Inge und wies in die andere Richtung.
»Morgenland«, sagte Max und wandte den Kopf nach links.
»Abendland.« Inge schaute in die Gegenrichtung.
»Morgenland, Abendland, Morgenland, Abendland«, sangen sie gemeinsam und warfen die Köpfe hin und her wie bei einem Tennismatch, bis sie vor Lachen nicht mehr konnten.
»Wir fahren genau zwischen zwei Erdteilen durch.«
Noch bevor Inge diese Erkenntnis richtig verdauen konnte, tutete es. Vor ihnen tauchte der Bug eines anderen Schiffes auf.
»Die haben Vorfahrt, weil sie von Süden kommen.« Inge hüpfte vor Aufregung von einem Bein auf das andere. Zum Glück tat sich rechts von ihnen eine Ausweichstelle auf. Oder hatten die Lotsen das vorher untereinander ausgemacht?
»Wirst sehen, wir fahren jetzt gleich in den Bahnhof da drüben.« Inge deutete auf die Ausbuchtung im Kanalverlauf. Rüdigers vornehmes französisches Wort hatte sie längst vergessen.
»Bahnhof?«, fragte Max nach, als die »Conte Biancamano« auch schon fügsam in die Ausweichstelle einbog, um die Fahrrinne freizugeben.
»Ein Union Jack– das müssen Engländer sein.« Max hatte die Flagge des entgegenkommenden Schiffes als Erster erspäht.
Sobald der Schiffsrumpf nahe genug war, buchstabierten sie zweistimmig: »Ja-pa-ne-se Prin-cess London.« Die japanische Prinzessin, etwas kleiner als der italienische Graf, schob sich elegant an ihnen vorbei. Besatzung und Fahrgäste beider Schiffe drängten sich an der Reling zu vielstimmigem Hallo und gegenseitiger Begrüßung. Von drüben wehten die Klänge von »Jingle Bells« herüber.
Die sind Weihnachten daheim, dachte Inge wehmütig, während sie hinüberwinkte. Wer jetzt wohl in Vaters Backstube die Plätzchen buk? Diese Frage ließ sich leicht beantworten, nur dass in Inge jedes Mal eine hilflose Wut hochkochte, wenn sie daran dachte: Herr Wallenburger, der Leiter der Brandenburger Konditorinnung, dem Vaters Betrieb schon immer ein Dorn im Auge gewesen war. Nun hatte er sich, die Notlage der Finkelsteins nutzend, für eine lächerlich geringe Summe einen Konkurrenten vom Hals geschafft und einen gut gehenden Zweitbetrieb erworben. Inge hätte ihm am liebsten in den Teig seiner Weihnachtsplätzchen gespuckt.
Doch unter der südlich heißen Mittagssonne verflüchtigen sich solche Gedanken rasch. Weiter ging’s, vorbei an den Hütten der Kanalaufseher, die wie Bahnwärterhäuschen an der Strecke lagen, vorbei an vereinzelten Palmen und großen Schaufelbaggern, die die Fahrrinne vom angewehten Wüstensand frei hielten. Dann weitete sich der enge Kanal plötzlich zu einer glitzernden Bucht. Hier lag das Städtchen Ismailia, wo der Dampfer kurz anlegte, weil der Lotse wechselte. Wieder belagerten Boote mit reichhaltigem Warenangebot das Schiff. Inge bewunderte gerade das Obst und die verschiedenen Dattelsorten, als unter ihr der Gong erscholl: »Platz nehmen zum zweiten Menü!«
»Ach herrje, ich muss zum Essen.«
»Geht ja ganz schön vornehm zu bei euch«, bemerkte Max. »Uns muss keiner zum Essen rufen. Da werden bloß ein paar Schüsseln auf den Tisch gestellt, und wer zu spät kommt, hat das Nachsehen. Und mit Extrabestellungen ist nicht. Dafür würde meine Mutter niemals Geld rausrücken.«
»Ja, ja, ›Wer weiß, was noch kommt‹, das kenn ich von meiner«, ergänzte Inge. »Bis nachher. Ich muss los.«
Frau Finkelstein erwartete ihre verschwitzte ungekämmte Tochter schon am Esstisch. »Hab ich dir nicht gesagt…«, zischte sie.
Inge ließ sämtliche Vorwürfe stoisch über sich ergehen. Sie wusste genau, dass ihre Mutter mit Rücksicht auf die Schwabs nicht laut werden würde. In Rekordgeschwindigkeit schlang sie ihr Essen hinunter. Den Mittagschlaf, der sich seit Antritt der Schiffsreise eingebürgert hatte, konnte sie diesmal erfolgreich abwehren: »Das geht heute nicht, Mama, auf gar keinen Fall. Wirklich nicht. Ich muss wieder rauf zu Max. Paolo hat uns einen tollen Ausguck gezeigt, ganz oben beim Kapitän. Die Fahrt durch den Kanal ist so spannend, schlafen kann ich noch, wenn wir wieder auf dem Meer sind.«
»Du tust ja gerade so, als käme das Schiff ohne euch nicht durch den Kanal«, bemerkte Frau Finkelstein, ließ ihre Tochter aber schließlich doch ziehen. »Und vor dem Abendessen wird sich umgezogen, mein Fräulein. Ich schicke Paolo, wenn du nicht pünktlich bist.«
»Capito!« Darauf würde sie’s gern ankommen lassen, dachte Inge. Im Vorbeigehen griff sie sich noch ein paar Petit Fours vom Nachspeisenbuffet.
Auf dem Weg zurück zum Ausguck rannte sie prompt in Paolo. Sein Blick fiel auf die mit süßen Teilchen gefüllte Serviette.
»Sie nicht satt geworden, Signorita?«, fragte er mit gespieltem Entsetzten.
»Ich wachse doch noch, Paolo«, konterte Inge dem Kabinensteward mit unschuldigem Augenaufschlag.
Der kurze Halt in Ismailia lag längst hinter ihnen, sie durchquerten jetzt die Bitterseen. Platz gab es hier eigentlich genug, dennoch mussten sich die Schiffe an die enge, mit Pfählen markierte Fahrrinne halten. Nur dort war tief genug ausgebaggert, dass die Dampfer mit ihrem beträchtlichen Tiefgang nicht stecken blieben.
Inge und Max spielten Flaggenraten. Richtig international ging es hier zu, und sie kannten bei Weitem nicht alle Hoheitszeichen der entgegenkommenden Personen- und Frachtschiffe. In einem solchen Fall mussten sie warten, bis am Bug des entgegenkommenden Schiffs der Heimathafen zu entziffern war.
Gegen Abend legte sich unvermittelt ein rosiger Schimmer über die eintönige Landschaft; es wurde so schnell dunkel, als hätte jemand das Licht ausgeknipst. Die beiden hatten gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen war. Vorn am Bug wurde ein zusätzlicher Scheinwerfer angeschaltet. Er bildete einen Lichtkorridor, durch den das riesige Schiff– mittlerweile wieder in den engen Begrenzungen des Kanals– in gespenstischer Stille dahinglitt. An den unbeleuchteten Ufern war kaum noch etwas zu erkennen.
Ende, Fin, The End – die Kinovorführung war für heute beendet.
Inge und Max verabredeten sich für den nächsten Morgen am gewohnten Platz, ganz gleich, wo das Schiff sich dann befinden würde. Diesmal schaffte Inge es sogar noch rechtzeitig in die Kabine, wusch sich endlich mal die Hände und tauschte das verschwitzte, vom Ruß der Schiffsschlote leicht angegraute Kleid gegen ein frisches. Dabei informierte sie ihre Eltern atemlos über alles, was die wieder mal verpasst hatten. Warum sie bloß ständig in dieser langweiligen Kabine rumsaßen? Da gab’s doch rein gar nichts zu sehen?
Als Inge später in ihrem Kämmerchen im Bett lag, spürte sie, wie unter ihr die Maschinen der »Conte Biancamano« zu voller Kraft ansprangen. Endlich wieder das gewohnte Stampfen und Beben. Der von den Lotsen gebändigte Riese war wieder frei. Jetzt ging es »Volldampf voraus« durchs Rote Meer in den Indischen Ozean. Und morgen, dachte Inge, bevor sie endgültig einschlief, wache ich im Morgenland auf.
Mensch ärgere dich nicht
Auf See, 1938– Jahr des Tigers
虎
Dank ihres neuen Spielkameraden gingen die Tage dahin wie Ferien; sie spielten, erkundeten das Schiff und dachten sich ständig neuen Blödsinn aus, wobei Paolo, wenn sie es nicht zu toll trieben, seine schützende Hand über die beiden hielt. Nur dass es eben doch keine Ferien waren. Auf der großen Landkarte am Eingang zum Speisesaal wanderte das vom Kapitän täglich neu platzierte Fähnchen stetig weiter über die blaue Fläche des Ozeans.
»Sag mal, Max, war dein Vater auch in so einem Lager?«, erkundigte sich Inge, als sie ihn gut genug kannte, um sich das fragen zu trauen.
»Nein, zum Glück nicht. Mein Onkel hat ihn gewarnt. Er konnte sich bei einem Bauern im Heuschober verstecken. Als die SA unseren Laden kaputt geschlagen hat, waren Mutter und ich allein. Sie wollten ihn abholen, aber meine Mutter hat gesagt, sie weiß nicht, wo er ist. Später hat sie dann die Schiffskarten besorgt. Er ist schon voraus, irgendwie hat er’s über die Grenze nach Italien geschafft. Wir haben ihn erst in Genua wiedergetroffen.«
»Und? War er noch wie vorher?«
»Natürlich nicht. Schließlich hatte er sein Geschäft verloren, das er von meinem Opa übernommen hat. Er musste von einem Tag auf den anderen weg von zu Hause.«
»Und sonst? Ich meine, hatte er seine Haare noch?«
»Ja, wieso?«
»Weil sie meinem Vater im Lager die Haare abgeschnitten haben. Den ganzen Kopf haben sie ihm kahl rasiert. Deshalb mag er den Hut nicht abnehmen und ist überhaupt so komisch. Er redet kaum, lacht nie.«
»Haare wachsen nach. Daran allein kann’s nicht liegen.«
»Das hab ich mir auch gedacht. Wahrscheinlich haben die noch andere schlimme Sachen mit ihm gemacht, aber er spricht nicht darüber. Mir sagt jedenfalls keiner was. Aber ich muss doch wissen, was mit ihm los ist und was man dagegen tun kann.«
»Ich hab mitgekriegt, wie meine Eltern über diese Lager geredet haben. Die Häftlinge mussten ganz schwere Arbeit tun. Sie haben zu vielen in Baracken geschlafen, und die Aufseher konnten sie beleidigen und mit ihnen machen, was sie wollten. Die Leute wurden wie Verbrecher behandelt, nur weil sie Juden sind.«
»Bloß ein Mal, da ist mein Vater richtig wütend geworden.« Inge war froh, sich endlich mit jemand austauschen zu können, dem es ähnlich ergangen war. »Das war beim Packen. Aber ich hab’s nicht so recht verstanden. Es ging um seine Auszeichnung als Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg. Auf die war er furchtbar stolz, sie hing in einem Rahmen über seinem Schreibtisch. Er hat sie von der Wand genommen und gesagt: ›Und zum Dank machen die mich zum »Israel« und stempeln mir ein »J« in den Pass.‹ Dann hat er das Ding in den Papierkorb geschmissen, dass es gekracht hat.«
»Das mit dem ›Israel‹ ist ein neues Gesetz. Alle jüdischen Männer bekommen zusätzlich diesen Vornamen in den Pass. Und du und deine Mutter, ihr heißt Sara.«
»Tun wir nicht, weil wir nämlich evangelisch sind«, verkündete Inge.
»Ach so.« Max sah sie verblüfft an. »Dann musstet ihr ja eigentlich gar nicht weg.«
»Klar doch, wegen Papa.« Da ließ Inge keine Zweifel aufkommen und fragte dann gleich weiter: »Waren bei euch auch solche Aufpasser beim Kofferpacken?«
»Ja, aber der bei uns war schwer in Ordnung. Er hat meine Mutter gefragt, ob er mal austreten darf. Da hat sie schnell was von ihrem Schmuck in den Koffer getan, bevor er versiegelt wurde.«
»Ha, weißt du, wie meine Mama das gemacht hat?« Inge sah sich rasch um, dann beugte sie sich zu Max hinüber und flüsterte ihm die Geschichte von Gundels kostbaren Innereien ins Ohr.
Max grinste. »Isch doch zu ebbes nutz, wenn Mädle mit Puppe spieled.« Vor lauter Begeisterung fiel er ins Schwäbische, das er sonst aus Rücksicht gegenüber Inge unterdrückte.
»Tu ich gar nicht, dafür bin ich viel zu groß. Meine Puppen hab ich alle der Ina geschenkt, bis auf die Gundel.«
Da musste Max erst recht grinsen.
***
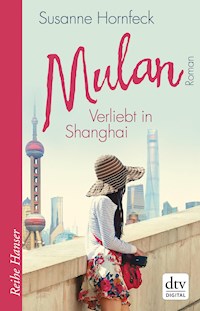













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














