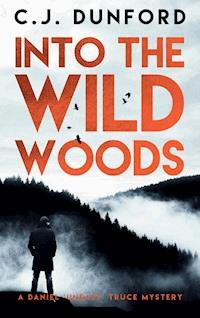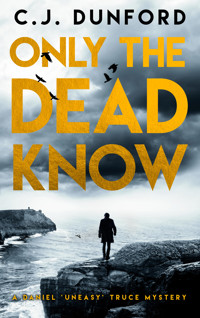4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Nach einem traumatischen Einsatz im Nahen Osten kehrt Daniel Truce in seine Heimatstadt Edinburgh zurück, um dort als Ermittler in einer Spezialeinheit der Polizei zu arbeiten. Aber seine neue Chefin kann ihn nicht leiden und teilt ihm nur die Fälle zu, die sonst keiner haben will.
So auch den Fall der "verrückten June": Jeden Morgen, pünktlich um 11 Uhr, erscheint June im Polizeirevier, um einen Mord zu melden, den sie beobachtet hat. Als sich jedoch herausstellt, dass der Ermordete noch am Leben ist, glaubt niemand der alten Frau. Truce beschäftigt sich näher mit dem Fall und stößt schon bald auf Ungereimtheiten ...
"Totenflüstern" ist der Auftakt zu einer neuen Reihe um den schottischen Ermittler Daniel Truce.
eBooks von beThrilled - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
Über dieses Buch
Wie klärt man einen Mord auf, der nie begangen wurde?
Nach einem traumatischen Einsatz im Nahen Osten ist Daniel Truce froh, in seine beschauliche Heimatstadt Edinburgh zurückzukehren. Dort arbeitet er als Ermittler in einer Spezialeinheit der Polizei. Aber als Außenseiter bekommt er zunächst nur Fälle zugeteilt, die sonst niemanden interessieren – zum Beispiel den Fall der »verrückten June«: Jeden Morgen um elf Uhr erscheint June im Polizeirevier, um einen Mord zu melden. Aber offenbar ist der Ermordete noch am Leben. Will die alte Dame nur Aufmerksamkeit? Und warum soll Truce sie unbedingt zum Schweigen bringen? Er beginnt zu ermitteln, aber bald schon stößt er auf ein Netz von Intrigen, Lügen und Ungereimtheiten …
Über die Autorin
Caroline Dunford arbeitete als Psychotherapeutin und Journalistin, bevor sie ihre Liebe zum Romanschreiben entdeckte. Zurzeit ist sie Writer in Residence am Siege Perilous Theater in Edinburgh. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in einem Cottage an der schottischen Küste.
C.J. DUNFORD
TOTENFLÜSTERN
Aus dem Englischen vonLen Wanner
Deutsche Erstausgabe
Copyright © 2018 by Caroline Dunford
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der Originalausgabe: »Only the Dead Know«
Für diese Kooperationsausgabe:
Copyright © 2018 by Thalia Bücher GmbH, Hagen
Textredaktion: Lars Schiele
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Bastian Kienitz | Carlos Caetano | Maurizio Callari | Frank Brehm_frankolor
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-96071-156-8
www.thalia.de
KAPITEL 1
Er hält es für Farbe.
Als wäre er in tiefes Wasser geworfen worden. Alles klingt dumpf. Verzerrt. Es hämmert in seinen Ohren, seine Sicht verschwimmt, ein schrilles Pfeifen schießt ihm durch den Kopf. Plötzlich schwankt alles, er liegt auf dem Rücken, schaut zur Farbe empor, die auf ihn herabregnet. Ein scharfer Schmerz sticht ihm in die Hüfte, als hätte ihm jemand einen Dolch in den Knochen gestoßen. Sein rechter Arm brennt vor Schmerz. Er kann nur noch Staub riechen. Sanft plätschert ihm die Farbe ins Gesicht.
Sekunden vergehen.
Sind es Sekunden? Oder war es noch schneller vorbei?
Er weiß es nicht.
Aber jetzt erkennt er es. Den versengten Kupfergeruch von – das ist kein Staub. Das ist …
***
Daniel Truce erwacht. Er zittert am ganzen Körper, vom Scheitel bis zur Sohle. Fühlt sich wie eine Gitarrensaite, die zu fest gezupft wurde. Reibt sich so fest die Augen, dass er ein Feuerwerk von Farben sieht, doch die Szene vor seinem inneren Auge lässt sich nicht ausradieren. Sie zieht ihn zurück in die Vergangenheit. Er lässt die Hände fallen und starrt an die Zimmerdecke. Winzige Risse zeichnen sich in der weißen Farbe ab, ein verrücktes Muster, das ihn an eine aus der Ferne betrachtete Straßenkarte erinnert. Er versucht, sich auf die wirre angebliche Karte zu konzentrieren, indem er sich eine längst vergessene Zivilisation ausmalt. Das Blut, das ihm eben noch übers Gesicht lief, spürt er nicht mehr. Er berührt seine Wangen und hält seine zitternden Hände vor sich hoch. Sauber. Es ist vorbei. Er konnte nichts tun. Kann auch jetzt nichts tun, als sein Leben weiterzuleben. Stillschweigend wiederholt er die Worte wie ein Mantra. Diese Lektion hat er noch immer nicht gelernt.
Truce stakst zur Dusche. Hält nur einmal kurz inne, um den hageren Fremden im Spiegel zu betrachten. Eine Ex-Freundin hat mal behauptet, er sehe aus wie Jake Gyllenhaal. Er hatte den Namen googeln müssen, den Vergleich aber recht schmeichelhaft gefunden.
Er fährt sich mit den Fingern durchs Haar, als könne er sich die Albträume aus dem Hirn kämmen. Aber jemandem anvertrauen, wie sehr er seine Schwäche hasst, wie sehr er sich dafür selbst hasst, das könnte er nie. Eins … zwei … drei … Er holt tief Luft und atmet lang aus, ehe er den Wasserhahn aufdreht. Er muss sich versichern, dass auch wirklich Wasser aus dem Hahn kommt. Nein, niemals könnte er sich anderen Menschen anvertrauen. Die hätten zu viel Verständnis.
Fünfundvierzig Minuten später – er hat gelernt, sich Zeit zu nehmen – steht er wieder vor dem Spiegel, diesmal, um seine Krawatte zu überprüfen. Die Krawatte seines alten Regiments. Aus Seide und mit roten Streifen, so dezent, dass ihre Bedeutung von Zivilisten gemeinhin übersehen wird. Doch für Truce symbolisiert sie Sicherheit und erinnert ihn an eine Welt, in der er alles verstand. In die er hineinpasste.
Er könnte auch die zur Krawatte passenden Socken anziehen, doch der Gedanke, was Leighton dazu sagen würde, hält ihn davon ab. Anzüge sind der einzige Luxus, den er sich gönnt. Die Notwendigkeit, für sich selbst zu sorgen, hat er tief verinnerlicht, seit er in jungen Jahren die Eltern verloren hat. Seither ist es ihm wichtig, Geld auf dem Konto zu haben. Schließlich gab es nie jemanden, den er um finanzielle Hilfe bitten konnte. Der Einzige, auf den sich Truce je verlassen hat, ist Leighton. Und meistens leiht sich Leighton Geld von ihm.
Seltsam, sich nach so vielen Jahren wieder in Uniform zu sehen. Obwohl sie teuer war, steht sie ihm nicht. Er zupft an der Krawatte.
»Na, bist du bereit für einen weiteren Tag als Gesetzeshüter und ehrbares Mitglied der Gesellschaft?«
Unverhofft steckt Leighton seinen ungekämmten kastanienbraunen Schopf zur Tür herein. Am Kinn sprießen ein paar Härchen in den unterschiedlichsten Orangetönen. So sehr er sich auch bemüht, es wächst ihm kein richtiger Bart.
»Geht so ….«
Leighton kommt herein und hockt sich auf die Bettkante. Seine Zivilklamotten ähneln einer Uniform so wenig, dass er es sich damit ohne Weiteres auch unter einer Brücke bequem machen könnte. »Die Welt jenseits der Army ist komplett durchgeknallt. Das Polizeipräsidium ist nicht blau und du musst noch nicht mal eine Uniform tragen. Fair ist das nicht. Ihr gebt den Verbrechern ja gar keine Chance.«
»Machst du dir Sorgen?«, fragt Truce. Ein Lächeln umspielt seine Mundwinkel.
»War das etwa ein Anflug von Humor?«, entgegnet Leighton und verschränkt die Arme vor der Brust. »Pass bloß auf. Nicht dass du noch zu einem normalen Menschen wirst.«
Truce dreht sich um und hebt seine Tasche auf – eine Herrenhandtasche hatte der Verkäufer sie genannt. »Ich muss los.«
»Ich wünsch dir einen schönen Tag im Büro, Schatz.« Leighton schmunzelt. »Wenn du heimkommst, steht der Tee auf dem Tisch.«
Truce deutet einen blitzschnellen Kinnhaken an, doch wie üblich weicht Leighton aus.
»Such dir ’n Job«, sagt Truce.
Schulterzuckend ruft Leighton ihm nach: »Mach ich. Sobald ich einen Grund dafür finde.«
***
Truce steigt in seinen Audi R8 und drückt den Startknopf. Er findet es immer noch seltsam, keinen Schlüssel zu benutzen. Fahrbereit lehnt er sich zurück. Hoffentlich ist auf der Brücke kein Stau. Er bereut es nicht, in Edinburgh ein Haus gekauft zu haben. Die allmorgendliche Fahrt über den Forth muss eine der schönsten auf der ganzen Welt sein.
Er denkt über Leightons Worte nach. Dass er einen Grund zum Arbeiten finden müsste. Sich an den Haushaltskosten zu beteiligen, sollte eigentlich reichen. Es ist immer dasselbe mit ihm. Von Anfang an ist Leighton seinen eigenen, faulen Weg gegangen, außer er hatte einen »Grund«, davon abzuweichen. Überraschenderweise ist ihm das auch bei der Militärpolizei gelungen, dabei ist er überhaupt nur beigetreten, weil Truce es ihm vorgemacht hat und ihm anscheinend nichts Besseres eingefallen ist, als dem Beispiel zu folgen. Irgendeinen Beruf musste er früher oder später ja ergreifen. Man kann schließlich nicht ewig in einem Waisenhaus bleiben. Wie Truce musste sich also auch Leighton entscheiden, entweder eine neue Anlaufstation zu finden oder auf der Warteliste für eine Sozialwohnung rumzugammeln. Truce wusste, dass er zugrunde ginge, wenn er seine Füße nicht fest auf dem Boden behielt, wenn er sich nicht an Grenzen und Befehlen orientieren konnte. Leighton hätte sich überallhin treiben lassen können, doch aus Gründen, die nur ihm bekannt waren, hatte er sich dauerhaft an Truce gebunden, seit sie sich in früher Kindheit kennengelernt hatten. Truce, dem es nahezu unmöglich gewesen war, Freundschaften zu schließen, hatte sich in diese Bruderbeziehung gestürzt wie ein Wüstenreisender auf eine Oase. Zugegeben, Leighton konnte ein nervender Penner sein, aber er war Truces nervender Penner. War immer für ihn da. Hielt ihm den Rücken frei. Schon damals waren die beiden eigentlich wie Hund und Katze, aber irgendwie sind sie unzertrennlich.
Truce befolgt Befehle. Mag es, wenn er weiß, wo er steht. Definiert sich gern. »Über deine Arbeit?« Er kann Leightons höhnischen Tonfall fast hören. »Du armes Würstchen.« Aber Truce sieht das anders. Es gibt Recht und es gibt Unrecht. Und es ist einfacher, in der Welt zurechtzukommen, wenn man die Dinge schwarz und weiß sieht. Grautöne sind für Zivilisten. Ausgerechnet zu denen gehört er jetzt, so sehr er das auch bedauert.
Er fährt auf das ehemalige Landhaus zu, das seinem experimentellen Team derzeit als Hauptquartier dient, und hält auf seinem klar gekennzeichneten Parkplatz: Daniel Truce, Sonderberater der Vereinten Spezialeinheiten, Polizei Schottland. Ob er den dazugehörigen Dienstausweis bekommen wird, ist noch unklar. Sein scheidender Regimentsleiter, Major Percival Bay – trotz seines Bonzennamens ein anständiger Mann –, hat ein paar Strippen gezogen, um ihm den Job zu verschaffen. »Sie haben Talent. Das muss doch zu was nütze sein«, hat er gemeint. »Aber bei den Feldjägern können Sie ja wohl kaum mehr bleiben, nicht wahr? Sehen Sie’s einfach als eine andere Art, Ihrem Land zu dienen. Sie waren einer unserer Besten. Immer ehrlich. Immer ihren Mann gekriegt, wie es in den Western heißt, aber Sie waren eben ein wenig zu gewissenhaft.« Truce erinnert sich an das Gespräch, als habe es erst vor ein paar Minuten stattgefunden. Zack, war seine Militärkarriere vorbei. Zum ersten Mal war ihm ein Soldat durch die Lappen gegangen, der Fahnenflucht begangen hatte.
Er sollte dankbar sein, dass Major Bay mit einigen hohen Tieren der Landespolizei zusammen die Schulbank gedrückt hatte, sonst hätte er diese neue Stelle nie gekriegt. Er ist aber nicht dankbar. Er musste drei zermürbende Interviewrunden mit wichtigen Vertretern des Polizeiapparats über sich ergehen lassen, mit Leuten also, die er vermutlich nie wieder sehen wird. Einige wollten partout nicht glauben, dass eines seiner größten Talente darin besteht, Menschen zu lesen. Bis er sie las und ihnen sagte, was er sah. »Wie Sherlock Holmes«, erwiderte einer der alten Herren und griente vor Entzücken. Dabei weiß Truce, dass er nicht das Geringste mit dem berühmten Detektiv gemeinsam hat. Er ist kein Genie. Seine Fähigkeit, Leute zu lesen, ist angelernt. Seit er acht Jahre alt war, hat er jedes Buch verschlungen, welches er zu menschlicher und tierischer Verhaltenslehre auftreiben konnte, weil er andere Leute einfach nicht kapiert. Hätte er nicht gelernt, ihre unfreiwillige Gestik und Mimik zu deuten, wäre ihm nichts anderes übrig geblieben, als den Rest seiner Tage in einem Zustand ständiger Überraschung zu verbringen, überwältigt vom daraus folgenden emotionalen Chaos.
Der schwierigste Teil der Aufnahmeprüfung war die psychologische Beurteilung. Seine Therapie hat seinem Empfinden nach nicht geholfen. Hat alles nur schlimmer gemacht. Er ist besser beraten, allein damit fertigzuwerden, und hat daher alles darangesetzt, seine mentale Verfassung zu verklären – und er ist damit durchgekommen.
Jetzt steigt er aus dem Wagen, überprüft zweimal den Inhalt seiner Herrentasche und macht sich, als es sich nicht länger verschieben lässt, auf den Weg in die Dienststelle.
Mit gezücktem Passierschein nickt er Bob dem Portier zu. Zumindest nimmt er an, der Mann heiße Bob. Ein Sergeant, der den Zenit seines Lebens überschritten hat, langsam in die Bedeutungslosigkeit abgleitet und somit kaum von seinen Kollegen zu unterscheiden ist. Bob grunzt zum Gruß, macht dann aber doch den Mund auf. Die Bobs reden nicht oft, also bleibt Truce stehen, um aufzuhorchen. »Heute ist sie selten schlecht gelaunt.«
Truce bedeutet ihm mit einem knappen Nicken, dass er die Warnung versteht, ehe er sich in das Großraumbüro wagt.
»Truce.« Ihre Stimme hat die Wärme eines Schockfrosters. Chief Superintendent Lydia Rose schaut demonstrativ auf ihre Armbanduhr. Sie ist jünger als Truce, kaum über dreißig, aber dafür brennt sie vor Ehrgeiz.
Truce wirft einen kurzen Blick auf eine der Wanduhren. 8:02 Uhr. Falls er tatsächlich zu spät dran ist, dann höchstens um zwei Minuten. Und er war zu Beginn seiner Schicht bereits auf dem Gelände. Aber Verspätung bleibt Verspätung.
»Ma’am«, sagt er und wartet. »Wird nicht wieder vorkommen.«
»Mein Büro, auf der Stelle.«
Gehorsam folgt er ihr in das einzige Büro mit eigener Tür. Ihr Parfüm hängt in der Luft wie ein Hauch von Schwefel nach dem Silvesterfeuerwerk. Er unterdrückt einen Hustenreiz. Rose nimmt Platz und greift nach einer Akte. Ihr Schreibtisch ist groß genug, um einen eigenen Hausmeister zu beschäftigen. Der blaue Lederbezug ist auf Hochglanz poliert. Um die Kanten ist ein winziges Goldmotiv graviert. Abgesehen von der Akte hat sie lediglich drei kleine Holzfächer auf ihrem Tisch: Ablagen für Eingänge, Ausgänge und laufende Verfahren. In dem Ausgangsfach liegt ein Papierstapel, ansonsten ist der Tisch leer. Selbst ihr Computer steht auf einem kleinen Beistelltisch. Die Schreibtischoberfläche scheint keinem anderen Zweck zu dienen, als leer zu sein, um jedem zu zeigen, dass Rose ihren Job im Griff hat. Jetzt greift sie nach der Akte und reicht sie halb über den Tisch, sodass das Ding im Niemandsland schwebt. Er streckt sich nicht danach und sie weigert sich, ihm entgegenzukommen. Klassisches Machtspiel.
»Ich habe was für Sie«, sagt Rose. »Fällt genau in Ihren Zuständigkeitsbereich. In der Wache in Dunfarlin erscheint täglich eine Frau, um einen Mord zu melden. Jeden Tag um Punkt elf Uhr. Inzwischen stellen die Kollegen dort die Uhr nach ihr. Was übrigens in Anbetracht Ihrer heutigen Verspätung auch Ihnen nicht schaden würde.«
»Möchten Sie, dass ich der Sache nachgehe, Ma’am?«, fragt Truce.
Rose ist Leiterin des experimentellen Teams, das unter dem Banner der neu strukturierten Polizei Schottlands firmiert. Dank der übergreifenden Befugnis ist das Team mit Experten gespickt, die eine Fülle an ungewöhnlichen Fähigkeiten mitbringen. Detective Sergeant Herbert kommt aus dem IT-Bereich, kam jedoch zu den Ordnungshütern, als er begriff, dass er hier besser verdient. Detective Sergeant Finnigan war eine gescheiterte Wissenschaftlerin – wegen einer Scheidung während ihrer Abschlussexamina hatte sie schließlich als Verkäuferin arbeiten müssen, bis die Polizei, ihr Freund und Helfer, ihr spannendere Arbeit bot. Detective Inspector Random war Klempner, ehe er dem Ruf der Sirenen folgte. In der Schule hatte ihn seine unerkannte Legasthenie nicht weit kommen lassen, doch dann machte er den MENSA-Test, nur so zum Spaß, und erzielte ein derart hohes Resultat, dass man es zur Kenntnis nehmen musste. Jetzt ist er für seinen Scharfsinn bekannt sowie für seine makellose Risikoanalyse, wenn der Tatort in einer Bruchbude liegt. Detective Sergeant Blue ist eines der eigenwilligsten Teammitglieder: eine junge Frau Anfang dreißig mit dem Körperbau einer Athletin und einer befremdlichen Verschwiegenheit, was ihre Vergangenheit anbelangt. Truce hat den Überblick verloren, wie viele Sprachen sie beherrscht. Jedenfalls besteht die Truppe aus einer Menge sonderbarer Typen, Truce hätte also bestens hineinpassen sollen.
»Sie halten sich für was Besonderes, oder, Truce? Glauben Sie, dass Sie Erfolg haben, wo andere gescheitert sind?«
Er denkt an die Zahl der Soldaten, die er im Laufe der Jahre aufgespürt hat, an die Bedingungen, unter denen er gearbeitet hat, und an die lange, lange Liste seiner Erfolge. »Ich bin nicht ganz unbedarft, Ma’am«, erwidert er.
»Ich möchte nicht, dass Sie der Sache nachgehen. Ich möchte, dass Sie die Frau zum Schweigen bringen. Angeblich kennt Ihre Sozialkompetenz ja keine Grenzen. Zeigen Sie mir, dass Sie damit fertigwerden können, dann lasse ich Sie vielleicht mit den großen Jungs spielen.«
»Ma’am?«
»Als sie ihren Augenzeugenbericht zum ersten Mal abgab, ging man der Angelegenheit gründlich nach. Ich weiß ja nicht, wie das in Übersee gehandhabt wird oder an den Luftkurorten, die Ihre Armee als Militärbasen bezeichnet, aber wir machen hier klare Ansagen.« Sie legt eine Kunstpause ein.
Truce beobachtet, wie sie bewusst ihre Atmung reguliert, um die Selbstkontrolle zurückzuerlangen. Er fragt sich, warum er sie so sehr aus der Fassung bringt. Unter dem Tisch ballt er die Hände zu Fäusten, zumal er nichts lieber täte, als seine Kameraden zu verteidigen. Aber er schnappt nicht nach ihrem Köder.
Daher fährt sie fort: »Wie dem auch sei, die Geschichte ist ganz unterhaltsam, nur ist der Mann, dessen Ermordung sie laut eigener Aussage beobachtet hat, gesund und munter.«
»Zwillinge, Ma’am?«
»Das Leben ist keine Fernsehserie, Truce.« Seufzend streicht sie sich eine Strähne aus dem Gesicht, die die Frechheit besaß, ihrem glatten blonden Pferdeschwanz zu entkommen. Einen Augenblick fragt sich Truce, ob sie mit offenem Haar und einem Lächeln womöglich wie ein menschliches Wesen aussähe. Sie wirft einen Blick in die Akte. »Und siehe da, der ermittelnde Beamte hat das tatsächlich geprüft. Die Frau spinnt.«
»Ich verstehe, Ma’am«, sagt Truce, obwohl er keine Ahnung hat, worauf sie hinauswill.
»Und deshalb«, sagt Rose, »dachte ich mir, wir könnten den Fall doch Ihnen übergeben. Sie könnten mit ihr reden: von Therapiekrüppel zu Therapiekrüppel.«
Auch auf diese Provokation geht er nicht ein. In der Army war es nicht unüblich, dass ein derart unverschämter Kommentar ungeahndet durchging, im zivilen Leben jedoch, das weiß Truce, hat sie eine Grenze überschritten. Zweifelsohne der Grund, warum sie ihn in ihr Büro zitiert hat. Er konzentriert sich auf die Wand, sodass er knapp an ihrem linken Ohr vorbeischaut, ohne dass sie bemerkt, dass er sie nicht mehr ansieht. Bewusst verlangsamt nun auch er seine Atmung, doch er bleibt aufmerksam. Bleib ruhig. Bleib höflich. Keinesfalls wird er ihr sagen, was er von ihr hält.
»Darf ich offen sprechen, Ma’am?«, fragt er.
»Wir sind hier nicht in der verdammten Armee«, kontert Rose.
»Ich habe das Gefühl, dass Sie mich nicht mögen, Ma’am.«
»Ach, wie kommen Sie denn auf die Idee?«
Truce könnte sagen, er habe bemerkt, dass Sie nie die Augenbrauen hebt, wenn sie ihn beim Betreten eines Raumes erblickt, er bezweifelt jedoch, dass sie weiß, dass diese Bewegung der Brauen eine völlig ungewollte Gesichtsregung bei allen Menschen ist. Ein Zeichen, dass man sich freut, jemanden zu sehen.
»Bauchgefühl, Ma’am.« Mehr sagt er nicht.
Rose lehnt sich in ihrem Bürostuhl zurück. »Ich sehe einfach keinen Grund dafür, Sie in mein Team aufzunehmen. Mein Laden läuft wie am Schnürchen. Ich habe gute Detectives. Alle handverlesen. Sie hingegen sind offenbar nur wegen einer Riesenportion Vitamin B hier. Alle anderen haben sich ihren Platz in meiner Abteilung verdient. Ich mag keine Fremdkörper. So, jetzt machen Sie, dass Sie wegkommen, und beweisen Sie mir, dass ich mich irre.« Endlich stößt sie die Akte über den Tisch.
Allerdings ist die Bewegung so schnell und schwungvoll, dass die Akte zu Boden segelt, wo sie ihre Papiere im ganzen Büro ausgebreitet hätte, hätte Truce sie nicht noch im Flug gefangen. Seine Reflexe sind noch immer pfeilschnell. Er nickt ihr zu. »Ma’am.« Verzieht dabei jedoch keine Miene und lässt nicht durchblicken, dass er sehr wohl weiß, dass sie das absichtlich getan hat. Dass sie ihn die Papiere aufheben lassen wollte, um ihn sprichwörtlich in die Knie zu zwingen. Dass sie ihn daran erinnern wollte, wer hier der Chef ist.
Er verlässt ihr Büro und sucht sich einen freien Schreibtisch, um die Unterlagen zu lesen. Einen eigenen Tisch hat hier außer der Chefin niemand, damit auch ja keiner Familienfotos oder Topfpflanzen mitbringt. Null Ablenkungspotenzial, null Zugehörigkeitsgefühl. Es besteht also doch kein so großer Unterschied zur Army.
Trevor Cooper schlendert herüber, ein Mann mittleren Alters, dessen Spezialität die blutrünstigen Aspekte großer Vorfälle sind. Er hat eine Nase für grausige Details und außerdem einen warzigen Hals. »Gab’s Saures?«
»Nichts für deinen Geschmack, Trevor. Ging bloß um eine alte Selbstdarstellerin.«
»Klingt ernst«, sagt Cooper. »Die Gute wirst du wohl ordentlich rannehmen müssen.«
Truce fragt sich zum x-ten Mal, warum so viele glauben, dass er Machosprüche als Verbrüderungsritual verstehen muss, nur weil er mal Soldat war.
»Hast du dir schon mal von ’ner Zahnlosen einen blasen lassen?«, fragt Cooper. »Geile Nummer.«
»Schwelgst du schon wieder in Erinnerungen an deine Großmutter, Coop?«, fragt Wendy Klein und blickt vom Nachbartisch auf.
»Wenn du nichts Besseres zu tun hast, solltest du lieber ein Profil für Truce erstellen. Oder du nimmst ihn gleich in Therapie. Ich schätze, Rose hat mal wieder ihre Dornen unter Beweis gestellt. Du kennst dich doch aus, was besonders harte Stecher betrifft, hab ich recht, Klein?«
Truce mustert Wendys Gesicht. Sie hat einen hübschen Mund, eine gerade Nase und große blaue Augen. Ihre Locken sind wirklich rot, nicht fahl rotbraun wie bei Leighton. Wendys Haarfarbe ist eine Pracht. Vielleicht ist sie sogar ein wenig zu perfekt. Vielleicht stammt sie aus der Flasche. Jedenfalls sieht Wendy, so viel ist Truce längst aufgefallen, ziemlich niedlich aus, und dank ihrer Augen ist sie eine genetische Seltenheit. Außerdem ist sie die psychologische Profilerin des Teams. Groß und schlank und so meisterhaft im Manipulieren ihrer Gesichtsausdrücke, dass sie täuschend unschuldig wirken kann. Von allen Leuten im Büro ist sie am schwersten zu lesen.
Wendy lehnt sich über den Tisch zu Cooper. »Ich kenne mich mit Kerlen aus, die gewisse Unzulänglichkeiten wettmachen wollen.« Sie senkt die Stimme. »Gravierende Unzulänglichkeiten.«
Cooper lächelt höhnisch. »Fang lieber nicht an, deine Spielchen mit meinem Kopf zu versuchen, Süße. Sonst lernst du Sachen, die du in keinem Lehrbuch findest.« Dennoch verdrückt er sich mit dem Kommentar, dass er Truce viel Spaß mit der Oma wünsche.
Truce schaut zu Wendy. Er sieht, dass ihr dieselbe scharfe Antwort auf der Zunge liegt wie ihm, also schenkt er ihr ein Lächeln.
»Der ist die Energie nicht wert«, sagt Wendy. »Darf ich die Akte mal sehen?«
»Natürlich.« Truce reicht sie ihr. »Nicht gerade spannend.«
Wendy blättert sie durch. »Ich weiß nicht«, sagt sie. »Da drängt sich doch die Frage auf, was jemanden zu so etwas treibt. Will sie möglicherweise ein eigenes Geständnis ablegen, versteckt sich aber hinter dieser lächerlichen Geschichte? Du weißt schon, eines Tages erwähnt sie dann ganz beiläufig die drei Babys, die sie vor zwanzig Jahren unter den Dielenbrettern begraben hat. Oder sie wird von jemandem erpresst und fürchtet sich, die Wahrheit zu sagen. Aber warum würde sie dann riskieren, überhaupt zur Polizei zu gehen? Oder sehnt sie sich verzweifelt nach Aufmerksamkeit – vielleicht auch da wieder, weil sie von Schuldgefühlen für ein längst vergessenes Verbrechen geplagt wird?«
»Oder sie glaubt wirklich, dass sie diesen Mord gesehen hat. Oder sie will die Kollegen so lange belästigen, bis die ihr eine schöne warme Zelle mit drei kostenlosen Mahlzeiten am Tag spendieren.«
»In deiner Welt sind die Menschen wesentlich einfacher gestrickt, habe ich recht?«, fragt Wendy und gibt ihm die Akte zurück.
»Dir ist doch nur langweilig«, sagt Truce. »Du hast schon seit Wochen keinen interessanten Fall mehr gehabt.«
Wendy seufzt. »Da mag was dran sein, aber das wäre ja furchtbar. Das würde bedeuten, dass ich mir etwas Schreckliches herbeiwünsche.«
»Das ist dein Beruf, und in deinem Beruf gehst du nun einmal auf«, sagt Truce. »Außerdem ist es ja nicht so, als würdest du unschuldige Leute dazu nötigen, sadistische Gewaltverbrechen zu begehen.«
Sie antwortet mit einem kleinen Lächeln. »Na gut, aber lass es mich wissen, wenn deine Oma mehr als nur leicht gestört sein sollte. Ich bin immer gern bereit, dir zu helfen, Uneasy.« Ohne ein weiteres Wort steht sie auf und spaziert aus dem Raum, während er ihr mit offenem Mund hinterherstarrt und sich nur fragen kann, wie sie hinter seinen Army-Spitznamen gekommen ist. Oder warum sie sich überhaupt die Mühe gemacht hat.
***
Sein Navigationsgerät behauptet, dass die Fahrt zur fraglichen Wache eine Stunde und zwanzig Minuten dauern wird, wenn er anstatt der umweltschonenden die schnelle Strecke nimmt. Wenn er also ordentlich aufs Gas tritt, sollte er es schaffen, noch vor der Elf-Uhr-Meldung seiner Zielperson vor Ort zu sein.
Eine Stunde und fünfundvierzig Minuten später flucht er wie zu seinen besten Feldjägerzeiten. Gerade hat ihn sein Navigationsgerät schon wieder in eine Einbahnstraße geführt, die es nicht kennt. Als er endlich bei der Wache eintrifft, ist die Frau längst weg. Glücklicherweise verfügt der diensthabende Sergeant, der Bob verblüffenderweise ähnlich sieht wie ein Bruder, über ihre Anschrift.
Als Truce vor June Mills’ Haus hält, muss er an die älteren Sozialbauten in St. Leonards in Edinburgh denken. Dort wie hier sind die Häuser aus verwittertem grauem Stein halbkreisförmig um Gemeinschaftstreppen erbaut und erinnern an eine Zeit, in der sich eine Familie glücklich schätzen konnte, in zwei Zimmern wohnen zu dürfen. Damals hätte man die Gegend wohl als Slum bezeichnet, inzwischen jedoch ist sie aufgewertet worden. Man hat Trennwände eingerissen, Nachbarwohnungen miteinander zu größeren Einheiten verbunden und allerhand Annehmlichkeiten hinzugefügt. Zum Beispiel fließend Wasser.
Er wirft einen Blick in die Akte. June ist fünfundsechzig, also kennt sie die Wohnungen von damals noch. Wahrscheinlich kommt ihr ihre Behausung hier wie der reine Luxus vor. Vor dem Gebäude liegt eine kleine, von einem Eisengeländer umgebene Grünfläche. Eine Handvoll Kinder stolpert um einen Ball herum. Es fehlt jedes Zusammenspiel, was wohl vornehmlich damit zu tun hat, dass hier Kinder in unterschiedlichem Alter herumtoben – sehr kleine und kleine. Er blickt zu dem Wohnhaus hinauf, das sich sanft um das Grün krümmt, und sieht an den Fenstern mindestens zwei Leute, die die Kinder im Blick haben. Das Treppenhaus in der Mitte des Gebäudes steht offen und unten an der Wand lehnen zwei Fahrräder. Ohne Schlösser. Truce kommt sich vor, als wäre er geradewegs in die Vergangenheit gestolpert, mitten hinein in die gute alte Zeit guter Nachbarschaft. Er weiß noch nicht viel über June, aber sie ist offenbar keine Rentnerin, die in einem Betonsilo feststeckt und nur nach einem Vorwand sucht, um mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Im Gegenteil, es würde ihn nicht wundern, wenn der ein oder andere Nachbar von Zeit zu Zeit auf eine Tasse Tee bei ihr vorbeikäme, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen.
Er wirft einen letzten Blick über die Schulter zu den spielenden Kindern und fragt sich, ob die Nachbarschaft immer noch so friedlich sein wird, wenn der Haufen hier in die Pubertät kommt. Der Kleine mit dem Schaumball stopft sich ein gutes Viertel davon in den winzigen Mund und beißt mit ganzer Kraft hinein, um die Besitzverhältnisse zu klären.
Junes Tür ist frisch in sattem Grasgrün gestrichen und auf Hochglanz poliert. Briefschlitz und Türknauf leuchten, nur an den Rändern sind ein paar verräterische Reste des Putzmittels zu erkennen. Truce vermutet, dass Junes Augen nicht mehr ganz so gut sind, wie sie einmal waren. Er klopft bedächtig, um keine Spuren zu hinterlassen. Überraschend schnell schwingt die Tür auf und einen Augenblick schießt ihm »lustige Witwe« so deutlich durch den Kopf, dass er fürchtet, er habe die Worte laut ausgesprochen.
June trägt ihr Haar weiß, allerdings in einem frechen Pixie-Cut, passend zu filigranen Silbercreolen und dezentem Make-up, ganz wie es sich für eine Dame ihres Alters geziemt. Aber das knappe Top im Leoparden-Look, der knielange Lederrock und die bunten Perlenketten überraschen Truce. Da sie dazu flauschige Hasenpantoffeln trägt, ist ihr Outfit in seinen Augen ungewöhnlich. Was natürlich vollkommen in Ordnung ist. Aber könnte es ein Zeichen von Vergesslichkeit und Irrationalität sein? Er zeigt ihr seine Visitenkarte.
»Dürfte ich Sie vielleicht um ein kurzes Gespräch bitten, Ma’am?«
Sie lächelt. Ihr Zahnschmelz ist dünn und angegraut, ihre Haut hingegen nicht schlecht. Truce vermutet dennoch, dass sie sich nicht immer bester Gesundheit erfreut hat. Unter den Augen hängen dunkle Schatten und Lachfalten sind kaum zu sehen. Ihr Blick jedoch ist hell und einladend.
»Kommen Sie herein, Officer«, sagt sie. »Ich will gleich etwas Wasser aufsetzen. Heute Morgen habe ich bereits Shortbread gebacken, für den Pausenhofverkauf in der Grundschule. Sie liefern mir also eine hervorragende Ausrede, es zu kosten. Ich nehme an, Sie wissen gutes Gebäck zu schätzen?«
»Und wie«, sagt Truce erfreut.
»Junge Männer in Ihrem Alter sind ja so oft Radfahrer. Spindeldürr, und trotzdem achten sie auf ihre Kohlenhydratzufuhr. Unter uns gesagt, wer will schon Haut und Knochen auf sich liegen haben? Das stelle ich mir ja nicht besonders gemütlich vor.«
»Ich muss zugeben, ich bin auch kein Fan von Magermodels«, sagt Truce.
June führt ihn in ein behagliches, makellos sauberes Wohnzimmer, in dem zwei Plüschsofas einander gegenüberstehen. Der Rest des Raums ist mit einer Vielzahl an Mustern und grellen Farben dekoriert. Auch wenn sie sich nicht beißen, würde Truce ungern mit Kopfschmerzen hier sitzen. Er kann keine Katzenhaare entdecken. Absichtlich geht Truce an dem kleinen Tisch mit den zwei Stühlen vorbei und steuert auf die Sofas zu, ehe June vorschlagen kann, an besagtem Esstischchen Platz zu nehmen. Er will ihre Füße sehen können.
Er setzt sich und sinkt tief in die Couch ein, von den übermäßig weichen Plüschkissen bedrängt. Die Sprungfedern sind schlaff, also schon länger nicht mehr ersetzt worden, denkt Truce. June ist knapp bei Kasse.
»Bin gleich wieder da«, sagt sie.
Truce nickt, macht aber keine Anstalten, ihr zu folgen. Kaum dass sie den Raum verlassen hat, ist er auf den Beinen und sucht nach dem Beistelltisch, den es hier mit Sicherheit irgendwo gibt. Er findet ihn hinter dem anderen Sofa und stellt ihn zwischen sich und June, ein wenig auf die Seite. Dann inspiziert er rasch die gerahmten Fotos auf dem Kaminsims über dem veralteten Elektroofen, ein Modell mit Holzscheit aus Plastik und einer kleinen Lichtmaschine, die den Anschein eines echten Flammenspiels erwecken soll. Die neuste Mode in den Siebzigern. Er erspäht ein altes Schwarz-Weiß-Foto, ein Hochzeitsporträt. Drumherum steht eine Auswahl an Kinderbildern, einige in Schwarz-Weiß, andere in Farbe. Ihre Geschwister? Kinder? Enkel? Ein großes Farbfoto zeigt eine junge Frau in einem Hochzeitskleid, das nur aus Rüschen und Schnörkeln zu bestehen scheint. Die Hochzeit muss in den Achtzigern stattgefunden haben, denkt er. Wahrscheinlich ihre Tochter.
June kommt mit einem Tablett herein. Er nimmt es ihr aus der Hand, ehe sie den kleinen Tisch zurechtrücken kann, und stellt es rasch darauf ab.
»Wie galant«, sagt sie und nimmt seufzend gegenüber von ihm Platz. »Soll ich Mutti spielen und uns einschenken?«
»Sieht so aus, als wären Sie tatsächlich Mutter.« Er verweist auf die Fotos.
»Ach, ja, meine Tochter, Jeannie. Sie war so eine hübsche Braut. Ihre zwei Kleinen sind inzwischen auch erwachsen. Beide Ärzte.« Sie strahlt vor Stolz.
In Gedanken macht Truce sich eine Notiz, dass sie Zugang zu medizinischem Fachwissen hat. »In Schottland?«, erkundigt er sich.
»Schottischer National Health Service«, sagt June stolz. »Calum hatte ein lukratives Angebot aus den Staaten, entschied sich aber, bei dem Krankenhaus zu bleiben, wo man ihn ausgebildet hat.«
»Harter Beruf«, sagt Truce.
Mit einem Lächeln nimmt June ihre Gastgeberpflichten wahr, versichert sich, dass der Tee genau nach seinem Geschmack ist, nicht zu heiß und nicht zu kalt, und dass er schönes Gebäck auf dem Unterteller hat. Noch immer hat sie ihn nicht gefragt, warum er eigentlich hier ist.
Als habe sie seine Gedanken gelesen, sieht sie ihn mit funkelnden Augen an. »Ich nehme mal an, Sie bringen mir keine schlechten Nachrichten. Dazu sind Sie zu entspannt.«
»Sie sind sehr aufmerksam, Ms Mills.«
»Ach, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich sehe nicht mehr so gut wie früher, aber hier oben bin ich noch so munter wie eh und je.« Sie tippt sich an die Schläfe. »Wahrscheinlich sogar munterer«, fügt sie mit einem Lachen hinzu. »In meiner Jugend war ich eher dusselig.«
Truce hat keine Ahnung, was er dazu sagen soll, also übergeht er die Bemerkung. »Ich bin wegen des Mordes hier, den Sie gemeldet haben.«
»Ich habe mir schon gedacht, dass das der naheliegendste Grund für Ihren Besucht ist. Ich nehme an, Sie wollen mich bitten, meine Meldungen zu unterlassen?«
»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Ach, ich weiß doch, dass ich dämlich klinge. Ihre Kollegen, die meine Aussage aufnehmen, tun mir ehrlich leid. Demnächst werde ich auch denen ein wenig Gebäck anbieten. Ich schaue mir ja mit Leidenschaft diese Backsendungen an. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben mich die Jungs als eine einsame alte Amsel abgestempelt, die ein bisschen Aufmerksamkeit will.«
»Und, haben die Jungs recht?«
»Sie gefallen mir, Officer! Officer – Verzeihung, ich konnte den Namen auf ihrer Karte nicht lesen.«
»Truce, Daniel Truce.«
»Also, Mr Truce, ich bin nicht einsam. Einmal die Woche bin ich beim Bingo. Auch an der Schule, die meine Tochter und meine Enkel besucht haben, nehme ich weiterhin regen Anteil – ich bin so etwas wie ein Ehrenmitglied des Lehrer-Eltern-Ausschusses. Meine Kuchen für den Kuchenbasar sind eine Institution. Außerdem bin ich für viele der jungen Mütter hier Babysitterin und ich habe die Leitung der Nachbarschaftsvereinigung übernommen. Auch an den offenen Gemeinderatssitzungen nehme ich teil und sage immer meine Meinung. Mich kennt hier jeder. Ich will nicht behaupten, dass ich Hunderte von Freunden habe, aber mit meinen vier Freundinnen treffe ich mich regelmäßig. Wir organisieren Mitbringpartys füreinander und machen kleine Ausflüge – Einkaufen, Kino, und zu Weihnachten gehen wir sogar ins Familientheater. Und ich lebe nicht gerade wie eine Nonne. Seit Mr Mills vor zehn Jahren verstarb – er wurde mir ja sehr früh genommen, schwaches Herz –, hat das ein oder andere Paar Herrenschuhe die Nacht unter meinem Bett verbracht. Viele waren es nicht, das möchte ich gleich dazusagen, aber noch bin ich nicht ganz weg vom Fenster.«
Truce lässt ihre Worte über sich hinwegfegen. Sie sitzt ihm direkt gegenüber und hat ihre Tasse abgestellt, ehe sie anfing zu sprechen. Ihr Rücken ist durchgestreckt, sie hat beide Füße fest auf dem Boden, ihre Hände liegen auf dem Schoß und wenn sie nicht gerade damit gestikuliert, ruhen sie dort regungslos. Überhaupt ist sie sehr beherrscht. Angespannt und defensiv, aber nicht nervös. Die Schärfe in ihrer Stimme lässt jedoch vermuten, dass sie sich ärgert.
»Viele hätten mittlerweile aufgegeben«, sagt Truce. »Es muss Ihnen so vorkommen, als höre die Polizei Ihnen überhaupt nicht zu.«
June schüttelt den Kopf. »Nein, man hat mir durchaus zugehört. Der Sergeant in der Wache hat mir sogar erklärt, dass sie der Angelegenheit gründlich nachgegangen seien.« Zum ersten Mal flattert ihre Hand zum Hals, eine Geste, die Truces geübter Blick als eindeutiges Zeichen von Nervosität erkennt. »Der Sergeant sagte, sie hätten mit dem Mann geredet, dessen Ermordung ich gesehen habe. Aber das ist unmöglich, nicht wahr? Tote reden nicht.«
KAPITEL 2
»Meiner Erfahrung nach nicht, nein«, sagt Truce einfühlsam.
Die Hand an Junes Hals flattert noch immer. Ihre Augen schießen von Seite zu Seite. »Ich verstehe das einfach nicht.«
»Warum erzählen Sie mir nicht einfach, was passiert ist?«
»Das habe ich doch schon alles zu Protokoll gegeben. Mehrmals.«
»Mehr als zwanzig Mal«, sagt Truce mit einem Lächeln. »Aber ich würde es lieber von Ihnen hören.«
»Haben Sie es denn gelesen?«, fragt June.
»Gehen Sie davon aus, dass ich kein Wort davon kenne«, sagt Truce. »Stellen Sie sich vor, ich wüsste überhaupt nichts, und fangen Sie ganz von vorne an.«
»Es ging mit Frankies Hund los«, sagt sie. Erneut zucken ihre Augen, diesmal nach links oben. Falls sie Rechtshänderin ist, würde so mancher Experte behaupten, sie schildere das Ereignis definitiv so, wie sie sich daran erinnere. Aber sie könnte sich genauso gut an die Geschichte erinnern, die sie schon so oft erzählt hat. Es verrät Truce also nichts. Was er sehen will, ist, ob sie irgendwelche körperlichen Ticks hat. Die flatternde Hand am Hals deutet darauf hin, dass sie nervös oder gestresst ist. Ein zuckender Fuß wäre ein großartiges Indiz, doch während Truce ihr dabei zuhört, wie sie ein weiteres Mal ihre Geschichte erzählt, bleibt sie nicht nur bei der Aussage, die er bereits in der Akte nachgelesen hat und die keinerlei Ungereimtheiten aufweist. Sondern auch ihre Füße bleiben standhaft, und er findet auch sonst keine offenkundigen Anzeichen, dass sie lügt. Dank des reichhaltigen Angebots an leicht verständlichen Büchern zum Thema Psychologie wissen die meisten Menschen um die Merkmale, anhand derer man Gefühlsregungen und Nervosität erkennen kann – zumindest was den Oberkörper betrifft. Das hat dazu geführt, dass sogar Leute, von denen man es am wenigsten erwartet, gelernt haben, die Bewegungen ihres Oberkörpers bewusst zu steuern, um zu verschleiern, was in ihrem Kopf vorgeht. Das Ganze ist wie ein Partytrick, den jeder kennt. Eine Notwendigkeit beim Speed-Dating und Bar-Flirten. Die wenigsten jedoch wissen, dass auch ihre Füße sie verraten können, und noch weniger Menschen haben die Bewegungen in ihren Füßen und Beinen unter Kontrolle.
»Sein Vater hätte ihm das Tier nie kaufen sollen. Wo seine Mutter doch seit zwei Monaten ein Baby hatte. Sie kriegt es einfach nicht hin, also bot ich ihr an, mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Ein schwarzer Labradormischling, der jeden Tag kräftiger wird, aber dumm wie Bohnenstroh. Kein bisschen boshaft, aber stark bis zum Abwinken! Es war ungefähr sieben Uhr abends, also noch nicht dunkel, aber schon etwas trüber als tagsüber. Ich führte das Vieh in den nächsten Park. Kinder waren keine dort, daher ließ ich es von der Leine. Ich hatte ja meine Tüte in der Tasche, falls es irgendwo hinmachen sollte, und in der anderen hatte ich etwas Hühnchen, um das dumme Ding dazu zu bringen, dass es zurückkommt. Es ist zwar nur ein Bauch auf Beinen, aber ich finde es nicht fair, dass es den ganzen Tag lang in dieser winzigen Wohnung eingesperrt ist. Also denke ich mir, dumm wie ich bin: Armes Vieh, soll er doch ein bisschen Auslauf haben. Aber hallo, die vertrottelte Töle hat Vollgas gegeben. Wenn man das Gewicht bedenkt, ist der Köter ganz schön pfiffig auf den Pfoten, während ich in meinen besten Pantoffeln unterwegs war, und das im Sauseschritt, um auch ja schnell sein Geschäft zu bereinigen.«
Sie streckt sich nach ihrer Teetasse und nimmt einen Schluck. Ihre Hand hat automatisch am Henkel vorbeigegriffen und die Tasse umfasst. Truce begreift, dass sie für ihn das gute Porzellan auf den Tisch gestellt hat. Normalerweise trinkt sie aus Bechern. Was bedeutet es ihr wohl, ihr bestes Service aufzutischen? Er versucht sich zu entsinnen, wann seine eigene Großmutter zu den teuren Tassen griff. Nur zu ganz besonderen Ereignissen, meint er sich zu erinnern.
»Also, was ist passiert?«, fragt er sie aufmunternd.
»Der blöde Köter ist aus dem Park gerannt, die Gasse entlang Richtung Golfplatz. Wahrscheinlich hat er irgendeinen Hasen gesehen.«
»Und Sie sind dem Hund nachgelaufen?«
»So schnell ich konnte, was leider nicht sehr schnell ist.« Sie berührt ihre Hüfte. »Ich möchte zwar meinen, dass ich noch keine neue brauche, aber manchmal tut es doch ein wenig weh.«
»Haben Sie den Hund gerufen?«
»Nein. Ich dachte mir, dass er eh nicht auf mich hören würde, bis er seinen Hasen hatte, oder was er sonst jagte. Allerdings habe ich mich fast in Grund und Boden geflucht, das kann ich Ihnen sagen.« Sie schaut Truce unumwunden in die Augen. »Aber natürlich leise, falls doch Kinder in der Nähe sein sollten. Ich halte nichts davon, vor Kindern zu fluchen. Und das hat mir vermutlich das Leben gerettet.«
Truce legt den Kopf schräg, um zum Ausdruck zu bringen, dass er ihr zuhört. June holt tief Luft. »Ich erinnere mich nicht gerne daran, auch jetzt noch nicht«, sagt sie. Truce wartet und nach einer langen Minute fährt sie tapfer fort. »Ich eilte also den Pfad entlang, der am Golfkurs vorbeiführt. Malte mir schon aus, wie der Hund einen Verkehrsunfall verursacht oder seinen eigenen Tod herbeiführt und Frankie in Tränen ausbricht.«
»Sie waren also zutiefst aufgewühlt.«
»Ganz recht«, sagt June. »Ich habe mich nach allen Regeln der Kunst dafür verflucht, dass ich nicht angeboten hatte, die Kinder zu beaufsichtigen, damit die Mutter selbst mit dem Hund Gassi gehen könnte. Das hätte ihr gutgetan, und ich wäre nicht wie ein blindes Huhn hinter dieser verflixten Promenadenmischung hergelaufen. Verzeihung.« Wieder flattert Junes Hand an ihren Hals, als habe sie Angst, Truce werde sie für ihre harmlose Wortwahl verhaften. Er widersteht der Versuchung, sie zu beschwichtigen, dass er schon wesentlich Schlimmeres gehört hat. Stattdessen wartet er. Es fällt ihm leicht, diese Frau zu mögen. Inklusive Leoparden-Look.
»Hinter einer großen Eiche macht der Pfad eine Biegung. Ich war vom Baum verborgen, als ich darauf zuging, sodass ich den Wagen sah und stehen blieb, bevor man mich sehen konnte. Ein großes silbernes Ding, das mitten auf dem Grünstreifen stand. Die Scheinwerfer waren aus, und fragen Sie mich bloß nicht nach dem Hersteller. Ich habe nie gelernt, Auto zu fahren, da kenne ich mich also nicht im Geringsten aus.«
»Haben Sie das Nummernschild gesehen?«
»Schon möglich, aber ich hatte keinen Grund, darauf zu achten. Ich dachte, da läge ein Liebespaar drin. Beziehungsweise ein verheirateter Mann mit einem jungen Fräulein. Es war ein großer Wagen und Männer sind nun mal so. Wie dem auch sei, ich sprang zurück hinter den Baum. Ich wollte keinen Ärger und aus irgendeinem unerfindlichen Grund sagte mir mein Bauchgefühl, dass ich mir genau den einhandeln würde, sollte ich die Leute in dem Wagen stören.« Sie zögert. »Wir haben hier in der Gegend ein paar Männer, die sich für ganz schwere Jungs halten …«
»Schwere Jungs?«, fragt Truce.
»Die Genugtuung, sie Gangster zu nennen, gönne ich ihnen nicht. Schließlich handelt es sich bloß um ein paar verzogene Lümmel, die zu bösen Männern herangewachsen sind, aber wenn es ihnen in den Kram passt, sind sie sich nicht zu schade, das Gesetz mit Füßen zu treten …«
Truce sieht ein weiteres Handflattern und versteht, dass ihr das Thema zu unangenehm ist, um mehr darüber zu sagen, also belässt er es dabei.
»… und es wäre mein typisches Pech, einen von denen mit einem Schulmädchen zu stören.«
»Konnten Sie denn sehen, ob jemand im Wagen war?«
»Nur den Kopf und die Schultern eines Mannes.«
»Warum sind Sie dann davon ausgegangen, dass er ein Mädchen bei sich hatte?«
»Ich dachte, sie wäre … Sie wissen schon … auf ihren Knien im Fußraum.« Junes rechte Hand flattert vor ihrem Hals herum wie eine Motte vor einer Flamme.
»Auf jeden Fall sind kurz darauf zwei andere Männer dazugekommen.«
»Können Sie die beiden beschreiben?«
»Nicht wirklich. Inzwischen war es ja schon ziemlich dunkel.«
»Haben sich die beiden Männer normal bewegt?«
»Wie meinen Sie das?«
»Hat einer den anderen irgendwie genötigt?«