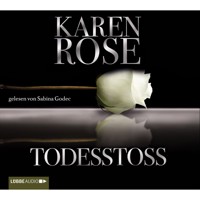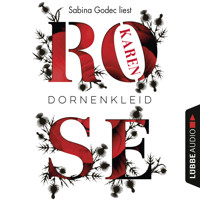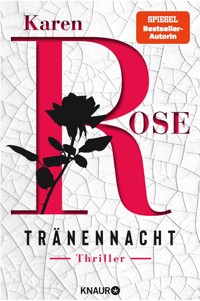
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Sacramento-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein Serienkiller begeht grausame Morde an Frauen – bis er an Daisy Dawson gerät: Der rasante Auftakt der »Sacramento«-Reihe »Tränennacht« ist der erste Thriller der Sacramento-Reihe von der amerikanischen Bestseller-Autorin Karen Rose. Wer harte Thriller-Spannung und eine leidenschaftliche Liebesgeschichte sucht, ist hier genau richtig. Ein Serienkiller geht in Sacramento um, der Jagd auf Frauen macht. Als der Killer jedoch die junge Daisy Dawson als neues Opfer auswählt, gerät er an die Falsche. Daisy weiß sich zu wehren, schlägt ihren Angreifer in die Flucht und reißt ihm dabei ein silbernes Medaillon vom Hals. Dessen Gravur eines Lebensbaums entspricht exakt der Tätowierung, die FBI-Agent Gideon Reynolds einst unfreiwillig zugefügt wurde. Die Spur führt Daisy und Gideon direkt in die Schusslinie des Serienkillers – und zu der verborgenen Sekte »The Church of Second Eden« … Absolute Hochspannung trifft romantisch-prickelnde Liebesgeschichte Die amerikanische Autorin Karen Rose ist mit ihren Thrillern regelmäßiger Gast auf den Bestseller-Listen. Die Bestseller-Autorin verbindet in »Tränennacht«, dem packenden Auftakt der Sacramento-Reihe, schockierende Wendungen und nervenaufreibende Spannung gekonnt mit einer leidenschaftlichen Liebesgeschichte. Ein schonungsloser Thriller, der unter die Haut geht. »Diesen Thriller einen Page-Turner zu nennen, ist noch eine Untertreibung!« USA Today
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 955
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Karen Rose
Tränennacht
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Brandl
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Erst zwingt er sie, ihn um Verzeihung zu bitten, dann ritzt er ihnen Buchstaben in die Haut, bevor er sie brutal ermordet: Sacramento wird von den Taten eines Serienkillers erschüttert, der Jagd auf Frauen macht.
Als er jedoch die junge Daisy Dawson als neues Opfer auswählt, gerät er an die Falsche. Daisy weiß sich zu wehren, schlägt ihren Angreifer in die Flucht und reißt ihm dabei ein silbernes Medaillon vom Hals. Dessen Gravur eines Lebensbaums entspricht exakt der Tätowierung, die FBI-Agent Gideon Reynolds unfreiwillig auf der Brust trägt.
Die Spur führt Daisy und Gideon direkt in die Schusslinie des Serienkillers – und zu der geheimnisvollen Sekte »Church of Second Eden« …
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Epilog
Dank
Karen Rose bei Knaur
Eine Liste aller Karen-Rose-Romane in chronologischer Reihenfolge:
Verzeichnis der auftretenden Figuren in den Romanen von Karen Rose
Für Claire Zion, meine einzigartige Lektorin, mit unserem zehnten gemeinsamen Buch beginnt auch eine neue Serie. Dein aufmerksamer Blick, dein messerscharfer Verstand und dein großes Herz sorgen dafür, dass meine Bücher besser werden. Mit dir befreundet zu sein, ist eine echte Ehre. Danke.
Für Martin. Ich werde dich immer lieben. Danke für sechsunddreißig wundervolle Jahre.
Prolog
Sacramento, Kalifornien
Samstag, 10. Dezember, 23.15 Uhr
Sehr gut. Sie wachte auf. Hat auch lange genug gedauert.
Er zog an seiner Zigarette und blies ihr den Rauch ins Gesicht, woraufhin sie prompt einen Hustenanfall bekam. Als dieser allmählich nachließ, hatte sie die dunklen Augen aufgeschlagen und sah ihn an.
Sie hatte Angst. Das gefiel ihm. Er lächelte sie an. Angst hatten sie alle. Das war das Schöne daran.
Er rutschte auf seinem Stuhl nach hinten und sah zu, wie sie an ihren Fesseln zerrte.
Auch das gehörte dazu. Allerdings gelang es ihnen nie, sich zu befreien. Weil er sehr straffe Knoten band – eines seiner größten Talente.
Er wartete, bis sie es aufgab und ihr Blick neuerlich auf ihn fiel. Diesmal schien sie ihn zu erkennen. »Sie«, flüsterte sie. »Aus dem Diner.«
»Genau. Ich«, bestätigte er freundlich. Sie aus dem alten heruntergekommenen Diner am Stadtrand von Portland herzuschaffen, war fürchterlich umständlich gewesen, weil sie wesentlich mehr Platz benötigt hatte als angenommen – sie war kurviger als die meisten Gäste, die er mit nach Hause brachte. Eine nette Abwechslung.
Wieder zerrte sie an den Fesseln, wenn auch nur halbherzig. Ihre Lippen zitterten. »Wo sind meine Kleider?«
»Verbrannt.«
»Warum?«
Er stand auf und löste beiläufig seine Krawatte, wohl wissend, dass sie jede seiner Bewegungen verfolgte. »Weil du sie nicht mehr brauchst.«
Aufgebracht schüttelte sie den Kopf. »Wieso tun Sie das?«
Langsam knöpfte er sein Hemd auf, während sie den Blick suchend durch den Raum schweifen ließ, nach Hilfe, nach einem Fluchtweg. Aber es gab nichts, weder das eine noch das andere. Er packte ihre ans Kopfende gefesselte Hand und strich mit dem Daumen über ihren linken Ringfinger mit der leichten Einbuchtung, dem einzigen Überbleibsel ihres Eheversprechens.
»Weiß er, dass du abgehauen bist?«, fragte er sanft.
Ihr Blick schweifte umher. Sie versuchte, ihre Hand wegzureißen, was logischerweise nicht ging. Langsam nickte sie.
»Hat er dich freiwillig gehen lassen?«
Wieder nickte sie, nur dass sie diesmal den Blick abwandte. Er drückte ihre Hand so fest, dass sie nach Luft schnappte. »Lüg mich nicht an, Miriam.«
Erstaunt registrierte er die spontan aufflackernde Wut in ihren Augen. »So heiße ich nicht«, stieß sie hervor. »Mein Name ist Eileen.«
»Auf dem Medaillon steht aber Miriam.« Wie ein Hypnotiseur ließ er das Silberherz von seinem Finger baumeln. Es schimmerte im Schein der Nachttischlampe. »Hast du es gestohlen?«
Gebannt starrte sie auf das Schmuckstück und schluckte, dann spannte sie den Kiefer an. »Nein.«
»Tja, wenn es doch dir gehört, bist du Miriam.«
Sie schloss die Augen. »Nein, das bin ich nicht.«
Im Grunde spielte es keine Rolle, trotzdem hatte ihr kleiner Wutausbruch seine Neugier geweckt. »Wer ist dann Miriam?«
Eine einzelne Träne lief ihr über die Wange. »Die Frau, die ich früher war.«
»Ah. Dein Mann sucht also nach Miriam, nicht nach Eileen.«
Sie presste die Lippen aufeinander, was Antwort genug war.
Gut. Er hatte ohnehin keine große Sorge gehabt, dass jemand sie vermissen würde. Die Frau hatte etwas Einsames, fast Gehetztes an sich, als blicke sie bei jedem Schritt über die Schulter. Als verberge sie sich. Was umso besser für ihn war.
Mit dem Daumen strich er über das Medaillon, spürte die Gravur des Namens auf der Rückseite, das Motiv auf der Vorderseite. »Ein Olivenbäumchen mit zwei knienden Kindern, beschützt von diesen wunderschönen ausgebreiteten Flügeln.« Bei dem Wort »beschützt« zuckte sie zusammen. Falls es ein Talisman gewesen sein sollte, hatte er auf der ganzen Linie versagt, denn Schutz hatte er ihr keinen geboten. »Wofür steht es?«
Wieder biss sie die Zähne zusammen und wandte den Blick ab, woraufhin er ihr Kinn packte und ihren Kopf zurückriss. »Wag es nicht, mich zu ignorieren«, warnte er.
Sie kniff die Augen zusammen. Er presste ihr die Hand auf den Mund und hielt ihr die Nase zu. »Sieh mich an«, knurrte er. Schlagartig hatte sie jede Faszination verloren. Stattdessen war er wieder wütend, so wie es sein sollte. Sie riss die Augen auf und begann zu strampeln. Er nahm die Hand weg und sah lächelnd zu, wie sie verzweifelt nach Luft schnappte.
Dann packte er sie neuerlich am Kinn, diesmal brutaler. »Sag, dass es dir leidtut, Miriam.« Er schüttelte sie brutal. »Sag, dass es dir leidtut.«
Stur presste sie die Lippen zusammen.
Ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel. Hervorragend. Bevor er hier fertig war, würde er sie schon noch dazu bringen, es zu sagen. Und er würde jede einzelne Sekunde davon genießen. Denn sie sagten es immer. Früher oder später.
Normalerweise wenn sie so weit waren, dass sie ihn anbettelten, sie sterben zu lassen.
1. Kapitel
Sacramento, Kalifornien
Donnerstag, 16. Februar, 20.15 Uhr
»Daisy?«
Daisy Dawson zuckte zusammen, als Trish ihr den Zeigefinger in den Oberarm bohrte. »Was ist?« Sie richtete ihre Aufmerksamkeit auf ihre Freundin, die mitten auf dem Bürgersteig stehen geblieben war und sie besorgt musterte. »Entschuldige. Was hast du gerade gesagt?«
Trish runzelte die Stirn. »Was ist heute bloß mit dir los? Du bist so fahrig. Ist es wegen Gus? Soll ich Rosemary anrufen?«
Daisy rollte die Schultern, um die Anspannung zu lösen, die jedoch genauso wenig nachließ wie dieses Prickeln im Nacken – das untrügliche Gefühl, dass jemand sie beobachtete. Ihr folgte.
Wieder mal. Herzlichen Dank, dass du Wort gehalten hast, Dad, dachte sie bitter. Eigentlich hatte sie ein ernstes Wörtchen mit ihm geredet und gedacht, er vertraue ihr. Falsch gedacht. Wieder mal. Am liebsten hätte sie ihren Frust laut hinausgeschrien, vor Wut getobt. Ihn auf der Stelle angerufen und ihm an den Kopf geworfen, er solle sich verdammt noch mal aus ihrem Leben heraushalten.
Eine feuchte, raue Zunge zwang sie, ihre Wut zu zügeln. Abwesend griff sie in die Hundetransporttasche, die sie quer über der Brust trug, und kraulte Brutus’ riesige flügelförmige Ohren. »Sch, mein Mädchen«, raunte sie, woraufhin sich das Hündchen sofort beruhigte. »Ist schon gut.« Mir geht’s gut. Was nicht stimmte, aber Brutus glaubte ihr ohnehin nicht. Die kleine Hündin spürte deutlich, wenn Daisy ins Straucheln zu geraten drohte, und tat, worauf sie trainiert war: Daisy aus ihrem Abwärtsstrudel reißen, bevor er zum Zusammenbruch führte. Sie holte tief Luft und lächelte knapp. »Nein, lass Rosemary nach Hause zu ihrer Familie gehen. Sie hat es sich verdient.«
Denn der Abend, der hinter ihnen lag, war ausgesprochen schwer gewesen, vor allem für Rosemary.
Wieder schossen Trish die Tränen in die Augen, die sie nicht zu verbergen versuchte. Sie und Daisy waren allein, und ihrer besten Freundin brauchte sie nichts vorzuspielen. »Der arme Gus.«
»Allerdings.« Mit ihrer freien Hand wischte sie Trish die Tränen ab. »Offensichtlich ist er mit der Trauer um seine Frau einfach nicht zurechtgekommen.«
»Vielleicht wollte er es auch nicht«, flüsterte Trish.
»Keine Ahnung, kann sein.« Daisy wusste nur, dass die Nachricht von seinem Tod nach einer Alkoholvergiftung ein schwerer Schlag für Rosemary gewesen war. Ihre Sponsorin so herzzerreißend schluchzen zu sehen, hatte Daisy zutiefst erschüttert und ein Gefühl der Hilflosigkeit in ihr heraufbeschworen. Und Hilflosigkeit konnte sie auf den Tod nicht ausstehen.
Trish biss sich auf die Lippe. »Er war fünfzehn Jahre lang trocken, DD. Fünfzehn lange Jahre. Und er war sogar selbst Sponsor. Rosemarys Sponsor. Wie sollen wir da erwarten …«
Daisy presste ihren Finger auf Trishs Lippen. »Hör auf. Du kannst dich nicht mit Gus oder sonst jemandem vergleichen. Er war in Trauer. Seine Frau ist gestorben. Die beiden waren fünfzig Jahre miteinander verheiratet. Du hast es selbst gesagt. Vielleicht wollte er ja sterben. Und vielleicht hat er sich genau diesen Weg dafür ausgesucht.«
Trish nickte unglücklich. »Ich weiß.« Sie straffte die Schultern und wischte sich mit dem Ärmel die Augen trocken. »Du hast ja recht.«
Daisy zog sie an sich. »Das habe ich meistens.«
Trish schnaubte. »Träum weiter.«
»Wenn ich jetzt sagen würde, dass wir dringend einen Eisbecher mit Karamellsoße und extravielen Nüssen brauchen, hätte ich dann recht oder nicht?«, fragte Daisy lachend.
»Stimmt, aber das ist ja nichts Neues. Nach einem Meeting gönnen wir uns doch immer einen Eisbecher.«
Daisy hakte sich bei Trish unter, als sie den Weg zum Diner einschlugen. »Also, was hast du vorhin gesagt?«
»Ach ja. Ich wollte wissen, ob du am Wochenende bei der Aktion in der Zoohandlung hilfst.«
»Ja.« Daisy lächelte Trish an, die fast einen halben Kopf größer war als sie. »Wieso? Willst du auch mitmachen oder ein Tier adoptieren?«
»Adoptieren?«, antwortete Trish, wenn auch mit einem Fragezeichen am Ende. »Ich habe überlegt, eine Katze bei mir aufzunehmen. Ich wünsche mir, dass jemand da ist, wenn ich heimkomme, aber Gassigehen ist nicht so mein Ding. Nicht bei meinen Arbeitszeiten.«
»Ich finde, das ist eine super Idee. Und Brutus sieht das genauso. Stimmt’s, mein Mädchen?« Brutus sah zum Anbeißen niedlich aus, als sie den Kopf aus der Transporttasche streckte, die Daisy auch als Handtasche diente. »Siehst du? Sie findet die Idee auch toll.«
Trish lachte. »Na, logo. Aber sie ist ja nicht objektiv, weil sie selbst aus dem Tierheim kommt. Du hattest echt Glück, einen Chion-Welpen in einem Tierheim zu finden. Das ist sie doch, oder? Ein Papillon-Chihuahua-Mischling, habe ich im Internet gelesen.«
»Manche nennen sie auch Papihuahuas«, meinte Daisy. Aber Brutus war einfach perfekt, völlig egal, was sie war und woher sie kam. Und wichtig. »Eigentlich hat mein Dad sie ja gefunden, während ich in der Entzugsklinik war. Einer der Therapeuten hatte einen Therapiehund, der ihm geholfen hat, seine Angststörungen in den Griff zu bekommen. Deshalb hat Dad nach einem Hund gesucht, den man so trainieren kann, dass er dasselbe für mich tut. Sie war die Kleinste im Tierheim, deshalb habe ich sie auch Brutus genannt. Und so ein Winzling, dass ich mir dachte, sie braucht jede Hilfe, die sie kriegen kann.«
»Ich hatte mich schon gefragt, was es mit dem Namen auf sich hat. Obwohl sie für mich eher wie Gizmo aussieht.«
Daisy lachte. Mit ihren großen Fledermausohren erinnerte Brutus tatsächlich an das hinreißende Kerlchen aus Gremlins. »Stimmt. Aber nur wie ein Gremlin vor der Verwandlung. Gizmo war auch der Vorschlag meiner kleinen Schwester Julie, als mein Dad meinen Vierbeiner mit nach Hause gebracht hat.«
»Wenn ich einen so süßen, kleinen Hund fände, würde ich mir das mit der Katze glatt noch mal überlegen, andererseits könnte ich einen Hund nicht mit zur Arbeit nehmen.«
»Zumindest nicht dorthin, wo du gerade arbeitest. Was wir ja aber ohnehin ändern müssen«, erklärte Daisy fest. »Ich könnte unmöglich in einer Bar arbeiten. Das ist einfach nicht das Richtige für dich, Trish.«
»Weiß ich doch. Und ich suche ja auch nach etwas anderem und habe jede Menge Bewerbungen geschrieben. Das Problem ist ja nicht bloß, dass ich ständig von Alkohol umgeben bin, sondern auch von ekligen Suffköpfen, die einen betatschen, auch wenn man ihnen sagt, sie sollen einen in Ruhe lassen. Ich hasse diese Idioten.«
Daisy runzelte die Stirn. »Belästigt dich etwa jemand?«
»Nein, das nicht, aber heute war so ein Typ da, der … keine Ahnung … total aggressiv war. Er war derart hartnäckig und wollte einfach nicht aufhören. Irgendwann habe ich ihn sogar angeschnauzt, weil er ›zufällig‹ meinen Hintern gestreift hat, und ihm gedroht, dass ich ihn vor die Tür setzen lasse. Da ist er so richtig fies geworden, hat mich beleidigt und so. Ein echter Arsch.«
Daisy verdrehte die Augen. »Die Sorte kenne ich.« Weil ihr Co-Moderator beim Radiosender auch einer aus dieser Kategorie war.
»Rückt Tad dir etwa wieder auf den Pelz?«, fragte Trish stirnrunzelnd.
Daisy zuckte die Achseln. Trish war die Einzige, der sie von diesem schmierigen Blödmann erzählt hatte. »Immer dieselbe Tour. Miese kleine Sticheleien, um mich aus dem Konzept zu bringen. Aber ich weiß ihn zu nehmen, zumindest im Moment noch. Sollte mir das Ganze zu viel werden, schalte ich die Chefredaktion ein. Hast du den Mistkerl von heute gemeldet?«
»Ja. Musste ich. Am Ende hat der Manager ihn hochkant rausgeschmissen. Der Typ hat nicht aufgehört, mich blöd anzulabern. Wahrscheinlich wollte er mich bloß provozieren. Normalerweise würde ich ja abwinken, aber heute fehlte mir der Nerv dafür. Ich hatte heute Morgen eine wichtige Prüfung und bin nicht sicher, wie es lief.«
»Ich helfe dir, ein paar Stellenanzeigen durchzugehen, wenn ich am Samstag fertig bin.« Es musste ja nichts Dauerhaftes sein, sondern einfach etwas anderes als der Job in einer Bar. Sobald Trish die Ausbildung zur Dentalassistentin abgeschlossen hatte, würde sie eine anständige Stelle finden. »Ich habe beim Sender nachgesehen, aber gerade ist leider nichts frei«, erklärte sie mit einem Anflug von Gewissensbissen. Ihr war sehr wohl bewusst, dass sie den Job nur bekommen hatte, weil ihr Dad und der Senderchef uralte Freunde waren – eine Tatsache, die Tad sie keine Sekunde lang vergessen ließ. Weshalb sie ihn bislang auch noch nicht bei der Geschäftsleitung hingehängt hatte. Sie wollte ihm nicht noch mehr an die Hand geben, was er gegen sie verwenden könnte.
»Trotzdem danke, dass du gefragt hast«, meinte Trish. »Ich …«
Ein Geräusch hinter ihnen veranlasste Daisy, neuerlich abrupt stehen zu bleiben – das Scharren eines Schuhs auf Asphalt oder etwas in der Art. Sie spähte kurz über die Schulter und sah eine vertraut wirkende Gestalt mit Baseballkappe in einer Gasse verschwinden. Dad lässt allmählich nach. Früher hatte er wenigstens noch Leute engagiert, die diskret genug waren, dass sie sie nicht hörte oder sah.
Wieder runzelte Trish die Stirn. »Was ist denn?«
Daisy senkte die Stimme. »Mein Dad lässt mich schon wieder beschatten. Ich habe gerade etwas gehört. Hinter uns.«
»Schon wieder?« Die Furchen auf Trishs Stirn vertieften sich.
»Ja«, antwortete Daisy düster. »Als ich letzten Sommer mit dem Rucksack in Europa unterwegs war, hat er auch jemanden auf mich angesetzt. Ich war so sauer, dass ich früher zurückgeflogen bin und meinen Dad deswegen zur Schnecke gemacht habe. Er hat mir versprochen, es nie wieder zu tun, aber wie es aussieht, traut er mir nach wie vor nicht über den Weg.«
»Er hat dich beschatten lassen?« Trish war völlig von den Socken. »Aber wieso das denn?«
»Er hatte Angst, ich könnte rückfällig werden. Zumindest war das seine Begründung.« Allerdings hatte Daisy auch jetzt noch Zweifel an der Erklärung. Vielmehr war davon auszugehen, dass ihr Vater schlicht Probleme hatte, seine jahrelange Paranoia in den Griff zu bekommen. Eine Paranoia, die ihre ältere Schwester das Leben gekostet hatte. Und beinahe auch mich. Zumindest hatte sie ihr gestohlen, was von ihrer Kindheit noch übrig gewesen war. Ihr Leben würde dieser Kontrollzwang jedenfalls nicht ruinieren, das würde sie nicht zulassen, auch wenn die Absichten ihres Vaters noch so ehrenhaft gewesen sein mochten.
Trish schnitt eine Grimasse. »Das ist ja die blanke Ironie, dass der Typ dir ausgerechnet nach einem AA-Meeting an den Fersen klebt. Kennst du ihn denn?«
Daisy verdrehte die Augen. »Ja. Es ist Jacob, unser langjähriger Farmarbeiter. Wir sind zusammen aufgewachsen. Er ist wie der Bruder, den ich nie hatte, trotzdem werde ich ihm jetzt anständig in den Hintern treten.« Genauso wie damals, als er sich in einer dunklen Pariser Gasse herumgedrückt hatte.
Trishs Lippen zuckten amüsiert. »Darf ich zusehen? Bei mir funktioniert schon seit zwei Monaten das Kabelfernsehen nicht mehr.« Wieder schnitt sie eine Grimasse. »Anscheinend will der Anbieter Kohle sehen.«
Daisy tätschelte ihr mitfühlend die Schulter. Was Trish in der Bar verdiente, reichte kaum zum Leben. »Geh schon mal rein und gib unsere Bestellung auf. Ich komme gleich nach.«
Trish schüttelte den Kopf. »Vergiss es. Ich lasse dich nicht allein hier draußen, selbst wenn der Typ ein Freund von dir ist.«
»Ich komme schon klar. Jacob ist das reinste Lämmchen … na ja, ein ein Meter neunzig großes, knapp hundert Kilo schweres Lämmchen, das keiner Fliege je etwas zuleide täte. Geh schon. Ich komme in ein paar Minuten nach.«
Kurz überlegte sie, ob sie Jacob gleich zur Rede stellen sollte, doch dann beschloss sie aus purer Wut, Trish scheinbar erst zu folgen, um dann in die nächstbeste Gasse abzutauchen. Sollte Jacob ruhig die Hosen voll haben, schließlich hatte er ihr versprochen, sie nicht länger zu behelligen, genauso wie ihr Vater.
Sie biss die Zähne aufeinander. Elende Mistkerle, alle beide. Sie war kein Kind mehr. Und hatte auch nie eines sein dürfen. Mittlerweile war sie fünfundzwanzig, lebte ihr Leben … und das ziemlich gut, ganz allein. Na ja, das vielleicht nicht, sondern mit der Unterstützung von Menschen, die sie sich selbst als Freunde ausgesucht hatte.
Sie hörte Jacobs Schritte wenige Sekunden, bevor er an der Gasse vorbeiging, machte einen Satz nach vorn, packte ihn an seiner weiten, gefütterten Jacke und riss ihn zurück. Erschrocken fuhr er zu ihr herum. Sein Gesicht war unter der Baseballkappe verborgen.
»Die Giants?«, höhnte sie. »Eine bessere Verkleidung ist dir nicht eingefallen? Du dachtest ernsthaft, ich erkenne dich nicht, wenn du eine Giants-Cap trägst?« Was er in tausend Jahren nicht tun würde, weil sie beide eingefleischte Oakland-Fans waren.
Sie riss ihm die Kappe vom Kopf und registrierte eine Millisekunde später, dass der Weg ihrer Hand zu kurz gewesen war. Er war zu klein.
Weil gar nicht Jacob vor ihr stand.
Mit einem erschrockenen Laut wich sie zurück. Ihr Puls begann zu rasen, als sie in das Gesicht eines fremden Mannes blickte, dessen Züge von der Feinstrumpfhose über seinem Kopf verzerrt wurden.
Sie fuhr herum und wollte loslaufen, doch es war zu spät. Seine Hand schnellte vor und legte sich um ihre Kehle, sodass sie nach Luft schnappte. Instinktiv riss sie die Hände hoch, um die Nägel in seinen Unterarm zu bohren, was die Wattierung seiner Jacke jedoch verhinderte. Panik erfasste sie, ließ schwarze Punkte vor ihren Augen tanzen.
In diesem Moment presste sich kalter Stahl an ihre Schläfe, während er sie in die Gasse zerrte. »Das wird dir noch leidtun.« Seine raue Stimme war dicht neben ihrem Ohr. »Noch bevor ich mit dir fertig bin, wirst du um Verzeihung flehen. Das tun sie alle.«
Ein scharfes Bellen drang durch den dichten Nebel ihres Bewusstseins. Brutus.
Augenblicklich war ihre Panik verflogen, und sie spürte, wie sich ihr Verstand klärte, als das Muskelgedächtnis übernahm und sie der Stimme ihres Vaters in ihrem Kopf folgte, die jede Bewegung dirigierte.
Sie ließ den Arm des Mannes los und drehte den Oberkörper so, dass sie möglichst viel Schwung aufnahm, um ihm den Ellbogen in den Magen zu rammen. Er japste vor Schreck, während sie Luft holte, seinen kleinen Finger um den Griff der Waffe löste und mit einem Ruck nach hinten bog. In derselben Sekunde tauchte sie unter seinem Arm durch, packte seine Hand, grub ihren Daumen in den fleischigen Teil zwischen seinem Daumen und Zeigefinger, wie ihr Vater es ihr beigebracht hatte, und riss ihm die Waffe aus der Hand, ohne seinen Schmerzensschrei zu beachten.
Und dann rannte sie los. Zum Glück hatte sie ihre Lunge mit ausreichend Luft für einen Schrei gefüllt. Doch nun bekam er sie neuerlich zu fassen, presste ihr die Hand auf den Mund und riss sie mit einem Ruck an seine Brust und zurück in die Gasse.
»Nein, nein, nein!« Sie versuchte, das Wort laut hinauszuschreien, doch es kam nur als gedämpftes Stöhnen über ihre Lippen. Erbittert setzte sie sich gegen ihn zur Wehr, trat nach seinen Schienbeinen, aber er war stärker als sie, und es wollte ihr nicht gelingen, ihn irgendwo zu fassen zu bekommen.
Brutus kläffte weiter, doch niemand kam ihnen zu Hilfe.
Er packte ihren Kopf und knallte ihn gegen eine Hauswand, sodass sämtliche Luft aus ihrer Lunge gepresst wurde, ehe er sich neuerlich vorbeugte und ihr den Unterarm um den Hals legte.
»Du machst viel zu viel Ärger«, zischte er und drückte die Waffe an ihre Schläfe, hielt jedoch inne und sah sich verärgert um. »Wo zum Teufel ist dieser beschissene Köter?« Sein Blick fiel auf die Tragetasche um ihren Oberkörper. »Verdammte Scheiße!«, stieß er leise hervor und zögerte für den Bruchteil einer Sekunde, ehe er stocksteif wurde und die Waffe auf die Tasche richtete.
Brutus. »Nein!« Sie packte seinen Jackenärmel und riss mit aller Kraft seinen Arm weg, wobei sich mit einem leisen Ploppen ein Schuss aus der Waffe löste. Ein Schalldämpfer, dachte sie, als winzige Ziegelbröckchen auf sie herabregneten. Brutus. Doch die kleine Hündin bellte immer noch. Befeuert von ihrer Verzweiflung, riss Daisy das Knie hoch und rammte es dem Angreifer in die Leiste.
Sein Stöhnen ging beinahe im Hämmern ihres Herzens unter. Abrupt stieß sie ihn von sich und rannte auf die Straße. In Sicherheit.
»Daisy? O mein Gott, Daisy!« Plötzlich war Trish da, hielt sie fest und legte ihr beide Hände ums Gesicht. »Was ist denn passiert? O Gott. Dein Hals ist ja ganz rot.«
»Ein Überfall«, ächzte Daisy und ließ sich auf die Knie sinken. »Er wollte Brutus erschießen.« Ihre kleine Hündin streckte den Kopf aus der Tasche und begann, Daisys noch immer geballte Faust abzulecken.
Doch der Angreifer hatte es nicht auf ihre Handtasche abgesehen gehabt. Sondern auf mich. Sie schloss die Augen und unterdrückte das Bedürfnis, sich zu übergeben, während sie am Rande mitbekam, wie Trish den Notruf wählte. In Sicherheit. Sie waren in Sicherheit. Es würde alles wieder gut werden.
Trish sank ebenfalls auf die Knie, schlang die Arme um Daisy und wiegte sie liebevoll. »Sch, Süße. Sch. Alles wird wieder gut. Wein doch nicht.«
Erst jetzt stellte Daisy fest, dass sie schluchzte. Mittlerweile hatte sich eine kleine Menschentraube um sie geschart. Sie registrierte, wie Trishs Hand sich in ihre Jackentasche schob. »Was machst du da?«
Trish zog Daisys Handy heraus. »Ich rufe Rafe an. Die Cops sind schon unterwegs, aber es wird leichter für dich, wenn Rafe auch hier ist. Los, entsperr dein Handy, ich rufe ihn an.« Trish wählte die Nummer von Daisys Vermieter, der ebenso wie ein Bruder für sie war wie Jacob.
Im Gegensatz zu ihm war Rafe jedoch Polizist. Er wird wissen, was zu tun ist.
Dann schlang Trish wieder die Arme um sie und hielt sie fest. »Hast du den Typen verletzt?«
Daisy versuchte, sich zu erinnern. »Ich … ich glaube nicht«, stammelte sie, noch immer weinend. »Kann sein.« Sie löste sich von Trish und blickte auf ihre geballten Fäuste. In der einen hielt sie eine silberne Halskette, und etwas Scharfkantiges grub sich in ihre Handfläche. Vorsichtig löste sie die Faust und holte scharf Luft.
Ein Medaillon. In Herzform. Aus Silber und mit einer Gravur. Verwirrt sah sie Trish an, die Daisys Finger eilig wieder um das Schmuckstück schloss.
»Das zeigen wir Rafe, wenn er kommt«, flüsterte Trish.
Sacramento, Kalifornien
Donnerstag, 16. Februar, 21.55 Uhr
Stirnrunzelnd drückte Gideon Reynolds die Pause-Taste seines Fernsehers, wo gerade eine aufgezeichnete Folge von Fixer Upper lief, als sein Handy läutete. Mit einem unterdrückten Stöhnen schnappte er es. Er war hundemüde und hatte keine Lust, sich jetzt noch mit der Arbeit zu beschäftigen. Denn der Anruf bedeutete Arbeit – so gut wie niemand aus seinem Bekanntenkreis benutzte noch das Telefon für Gespräche.
Sein Verdruss schlug in Besorgnis um, als er den Namen auf dem Display sah. Rafe Sokolov. Sein bester Freund rief nie an, schon gar nicht um diese Uhrzeit, sondern schickte grundsätzlich Nachrichten. »Was ist los?«, fragte Gideon ohne eine Begrüßung.
»Vielleicht nichts, aber wahrscheinlich eben doch«, antwortete Rafe. »Du kennst doch meine neue Mieterin? Daisy Dawson?«
Gideon seufzte. »Nein, Rafe. Einfach bloß Nein.« Schon seit Monaten versuchte Rafes Mutter, ihn mit der »süßen kleinen Daisy« zu verkuppeln. Er hatte sogar das sonntägliche Abendessen bei den Sokolovs geschwänzt, um sich Irina Sokolovs beharrlichen Versuchen zu entziehen, ihn und diese Daisy zusammenzuspannen … seit über zehn Jahren war sie wild entschlossen, die richtige Frau für ihn zu finden.
In gewisser Weise liebte er sie dafür, weil es ein Zeichen war, dass er ihr am Herzen lag, aber eigentlich wünschte er, sie möge es sein lassen. »Sag deiner Mutter –«
»Das soll keine Verkuppelungsaktion werden«, unterbrach Rafe knapp.
Gideon setzte sich auf. »Was dann? Was ist mit Miss Dawson?«
»Sie wurde heute Abend auf der J Street überfallen.«
Gideon horchte auf. Rafe war Detective beim Sacramento Police Department. »Ist sie … okay?«
»Ja. Sie hat den Angreifer vertrieben. Sie und diese Ausrede von Hund.«
»Das freut mich zu hören, aber der Überfall fällt weder in meinen noch in deinen Zuständigkeitsbereich.« Rafe hatte nach ihrem College-Abschluss beim SacPD angefangen und arbeitete seit mehreren Jahren im Morddezernat, wohingegen Gideon nach Quantico gegangen war, um eine Ausbildung beim FBI zu beginnen. Mittlerweile war er auf Linguistik spezialisiert, was bedeutete, dass er den Großteil seiner Arbeit vom Schreibtisch aus erledigte.
Seine kürzliche Versetzung nach Sacramento war eine Art Heimkehr – sofern man in seinem Fall von »Heimat« sprechen konnte. »Was ist los?«, fragte er, denn hier ging es nicht bloß um eine Kleinigkeit, ganz klar.
»Sie hat dem Typen zuerst eine Halskette abgerissen und ihm dann das Knie in die Eier gerammt.«
Instinktiv krümmte Gideon sich. »Autsch. Aber gut für sie. Und ist er entkommen?«
»Ja«, antwortete Rafe genervt. »Er hatte eine Waffe und hat versucht, sie in eine Gasse zu zerren.«
»O Gott, sie muss ja völlig durcheinander sein. Also … ich will nicht gemein sein, aber was hat das mit mir zu tun?«
»An der Kette hing ein Amulett. Aus Silber, in Herzform. Mit einer Gravur.«
Gideon stockte kurz der Atem, ehe er scharf Luft holte. Ein ungutes Gefühl machte sich in ihm breit. »Was für eine Gravur?«
»Zwei Kinder, die unter einem Olivenbaum knien …«
»Und darüber schwebt ein geflügelter Engel«, flüsterte Gideon und schluckte gegen die aufsteigende Galle an. »Mit einem flammenden Schwert.«
Rafe ließ die Stille für ein, zwei Sekunden wirken. »Genau. Ich habe das Motiv bislang nur ein einziges Mal gesehen. Auf deiner Haut.«
Gideon blickte zum Fernseher, dessen Bild genauso erstarrt war wie er selbst.
»Gideon?«, fragte Rafe leise. »Bist du noch dran?«
Gideon ließ den Atem entweichen, den er unwillkürlich angehalten hatte. »Ja. Stand auch ein Name auf der Rückseite des Medaillons?«
Rafe zögerte. »Miriam«, antwortete er widerstrebend.
Entsetzt sprang Gideon auf die Füße. Nein. Das konnte nicht sein. Jemand hätte mir Bescheid gesagt. »Wo bist du gerade?«, presste er erstickt hervor.
»Im UC Davis Medical.«
Er schüttelte den Kopf, um seine Gedanken zu klären. Sich zu konzentrieren. Seiner Miriam ging es gut. Es muss ihr einfach gut gehen. »Wieso bist du im Krankenhaus? Hast du nicht gerade gesagt, dass es der kleinen Dawson gut geht?«
»Sie war nicht schwer verletzt, allerdings hat sie Würgemale am Hals, weil der Typ sie wohl zum Schweigen bringen wollte.« Rafe klang … betroffen. Die Sache ging ihm unüberhörbar an die Nieren. Es würde Gideon nicht wundern, wenn sich mittlerweile der gesamte Sokolov-Clan in der Notaufnahme eingefunden hätte. Seit die junge Frau in das Apartment in Rafes historischem Stadthaus gezogen war, hatten sie sie unter ihre familiäre Fittiche genommen.
So wie damals mit Gideon, als er noch ein einsamer, verlorener Teenager gewesen war. Mit einem Mal war er extrem dankbar, dass Daisy Dawson den russischen Einwandererclan hinter sich hatte.
»Wir wollten nur sichergehen, dass ihr auch wirklich nichts passiert ist«, fuhr Rafe fort. »Sobald der Arzt fertig ist, bringe ich sie aufs Revier. Es ist wichtig, dass sie ihre Aussage macht, solange die Erinnerung noch frisch ist. Dann nehmen meine Eltern sie mit zu sich nach Hause. Mom will sie unbedingt im Auge behalten, weil der Kerl ihren Kopf gegen eine Hauswand geknallt hat. Der Arzt glaubt zwar nicht, dass sie eine Gehirnerschütterung erlitten hat, aber du kennst ja meine Mom. Sie macht sich immer Sorgen.«
»Allerdings«, murmelte Gideon, der schon häufig in den Genuss von Irinas Fürsorge gekommen war. Es hatte sich jedes Mal angefühlt, als sei er ihr leiblicher Sohn.
Rafe räusperte sich. »Ich hätte gern, dass du aufs Revier kommst, um einen Blick auf das Medaillon zu werfen und mir davon zu erzählen.«
Nein. Nein. Nein.
»Ich weiß, dass es nicht leicht für dich ist«, fuhr Rafe leise fort. »Aber ich brauche unbedingt deine Hilfe. Er hat zu Daisy gesagt, sie würde ihn schon noch um Verzeihung bitten. Ich zitiere: ›Das tun sie alle‹.«
Verdammt. »Du glaubst also, er ist ein Serientäter?«
»Möglich wär’s. Also, kommst du?«
»Ich bin in einer halben Stunde da.« Gideon legte auf und starrte sekundenlang sein Handy an. Dann wählte er einen Namen aus seiner Favoritenliste. Es läutete, ehe die Voicemail ansprang. Wie meistens.
Er legte wieder auf und wählte ein zweites Mal. Das tat er so gut wie nie. Diesmal wurde beim zweiten Läuten abgehoben. »Was ist, Gideon?«
O Gott. Er war so erleichtert, ihre Stimme zu hören, dass ihm die Beine wegsackten. Eilig sammelte er sich und konzentrierte sich darauf, seinen Puls wieder unter Kontrolle zu bekommen.
»Was ist los, Gideon? Hallo?«
Ein scharfer Schmerz schnitt sich in seinen Magen, als er überlegte, wie er die Frage formulieren sollte.
»Herrgott noch mal, Gideon«, seufzte seine Schwester genervt. »Hier ist es schon nach Mitternacht, und du hast mich geweckt. Ich hoffe für dich, dass es wichtig ist. Also, sag mir jetzt, was passiert ist, und dann lass mich gefälligst weiterschlafen.«
»Tut mir leid. Aber es ist tatsächlich wichtig.« Er strich mit der Hand über seine linke Hemdbrust und glaubte fast den Schmerz wieder zu spüren, als das Tattoo vor all den Jahren gestochen worden war. Aber er hatte sich nicht ein einziges Mal beschwert. Die Mädchen waren gut davongekommen, hatte er damals gedacht, als sich die Nadel in seine Haut gebohrt hatte. Sie hatten bloß die Medaillons bekommen. Was für ein Irrtum! »Hast du dein Medaillon noch?«
Einen Moment lang herrschte entsetzte Stille. »Was?«
»Dein Medaillon? Wo ist es?«
»In meinem Bankschließfach«, antwortete sie barsch. »Wo es immer ist.«
Gideon schluckte. »Wo … Wo ist ihres?«, krächzte er.
Wieder Stille. »Bei meinem. Wieso? Worum geht es hier?«
»Eine Frau wurde heute Abend in Sacramento überfallen. Der Angreifer hatte eines der Medaillons um den Hals. Sie hat es ihm beim Kampf heruntergerissen. Auf der Rückseite ist ›Miriam‹ eingraviert. Ich dachte … es sei vielleicht deines.« Nichts. Schweigen. Er hörte sie noch nicht einmal atmen. »Mercy?«
»Ich … ich kann nicht, Gideon«, sagte sie schließlich mit brüchiger Stimme – es war genau die Antwort, mit der er gerechnet hatte. »Ich kann einfach nicht.«
»Das verstehe ich«, sagte er. »Ich musste nur sichergehen, dass du es nicht weggeworfen hattest. Keines von beiden.«
»Nein.«
Nein. Wie konnte so großer Schmerz in nur einem, so kurzen Wort mitschwingen?
Gideon schluckte. »Eigentlich wollte ich mich bloß vergewissern, dass es dir gut geht.«
Obwohl er ganz genau wusste, dass dem nicht so war. Es würde ihr nie wieder gut gehen. Genauso wenig wie ihnen allen. Wie könnte es auch?
»Ich bin okay«, sagte sie, aber er glaubte ihr kein Wort. Sie klang noch nicht mal, als glaubte sie es selbst. »Und wie geht’s dir?«
»Wie immer.« Er zögerte. »Pass auf dich auf, Mercy«, murmelte er.
»Du auch«, entgegnete sie traurig. »Gute Nacht.«
Ein Klicken ertönte. Gideon blieb einen Moment lang sitzen und wartete, bis sich sein Herzschlag beruhigt, das mulmige Gefühl im Magen nachgelassen hatte, während er gegen die Tränen ankämpfte, die ihm bei jedem Gespräch mit seiner Schwester zu kommen drohten. Und auch jetzt wünschte er nur, es wäre alles ganz anders.
Er trat zum Regal neben dem Fernseher, auf dem noch immer Fixer Upper im Standbild zu sehen war, und nahm die polierte Kirschholzkassette, die Irina und Karl Sokolov ihm vor mindestens fünf Jahren zu Weihnachten geschenkt hatten. Darin lagen seine Handschellen, ein paar Ticketabrisse und eine Handvoll Fotos, in denen er kramte, bis er fand, wonach er suchte. Er steckte die Fotografie ein, nahm seine Glock aus dem Waffensafe, stieg in den Wagen und schlug den Weg in die Innenstadt ein.
Nun würde er Daisy Dawson doch noch kennenlernen, was zumindest Irina Sokolov freuen würde.
Sacramento, Kalifornien
Donnerstag, 16. Februar, 22.30 Uhr
Scheiße. Scheiße. Scheiße. Er öffnete die Haustür noch ein Stück weiter, um sie dann krachend zuschlagen zu können, beherrschte sich jedoch in letzter Sekunde. Lieber kein Aufsehen erregen. Die Nachbarschaftswache hielt Augen und Ohren stets offen und achtete auf jedes noch so kleine Geräusch oder sonstige Anzeichen eines Einbruchs. Die sensationslüsternen Anwohner waren das Einzige, was er in diesem ansonsten perfekten Viertel in Midtown auf den Tod nicht ausstehen konnte. Dass einer die Cops wegen etwas rief, das er noch nicht mal begangen hatte, war so ziemlich das Letzte, was er gebrauchen konnte.
Er ging in den Keller und schlug zumindest diese Tür mit voller Wucht zu, schloss die Welt rings um sich herum aus. Der Keller war sein Lieblingsbereich im Haus – seine eigenen vier Wände, die es ihm ermöglichten, nicht länger unter einem Dach mit Sydney leben zu müssen.
Er hatte den gesamten Bereich schalldicht gemacht, hatte die Türen und Fenster zugemauert und so viel Isoliermaterial angebracht, dass ein kleiner Kokon entstanden war. Kein Schrei konnte nach draußen dringen und auf gespitzte Ohren stoßen, nicht einmal, wenn jemand an der Hauswand kleben sollte. Was ohnehin nicht so ohne Weiteres ginge, denn seine Rosensträucher waren mit langen, spitzen Dornen bewehrt – genau aus diesem Grund hatte er sie ausgewählt. Zum Glück sahen sie auch noch hübsch aus. Jedenfalls konnte sich niemand daran vorbeizwängen, um zu lauschen.
Und nun nutzte er die schalldichte Ausstattung und die dornigen Rosen für sich selbst, weil er ganz laut schreien musste. Er legte seinen gesamten Frust über diesen beschissenen Abend in seinen Schrei, brüllte, bis sein Hals brannte und sein Schädel wehtat.
Aber es war nicht genug. Das war es nie. Nur eines half ihm, Ruhe zu finden. Eine einzige Sache. Und genau die war ihm heute Abend verwehrt geblieben.
Er sah zu dem sorgfältig gemachten Bett hinüber, das für die Besucherin vorbereitet war, die jedoch seine Gastfreundschaft heute nicht in Anspruch nehmen würde. Dieses verdammte blonde Miststück. Er hatte nicht damit gerechnet, dass sie sich derartig wehren würde. Zumindest nicht so erfolgreich. Jemand hatte ihr einiges beigebracht.
Und dieser verdammte Köter! Das Gekläffe hatte ihn völlig verrückt gemacht. Ich hätte das blöde Vieh einfach abknallen sollen. Sein Zögern hatte seine Pläne für den heutigen Abend zunichtegemacht und ihn womöglich noch in Gefahr gebracht. Er würde sich um die Blonde kümmern müssen. Zwar ging er nicht davon aus, dass sie ihn identifizieren konnte, aber er hatte mit ihr geredet. Und sie war viel zu geschickt gewesen, auch wenn sie auf den ersten Blick wie ein harmloser Teenager ausgesehen hatte.
Allerdings war sie nicht mehr so jung gewesen. Aus der Nähe hatte er ihre Augen gesehen, die grimmige Entschlossenheit darin, wie sie nur von einer gewissen Lebenserfahrung herrühren konnte. Alte Augen. Und sie hatte ihn genau genug angesehen, sodass Anlass zur Sorge bestand. Er musste sie eliminieren.
Natürlich musste er erst in Erfahrung bringen, wer sie war. Dafür musste er bis morgen früh warten, um einen Blick auf die Eingangsprotokolle der Notrufe bei der Polizei zu werfen.
Er zog seine Sachen aus und stopfte sie in eine Tüte, die er verbrennen würde. Den Feinstrumpf hatte er längst entsorgt, ebenso wie seine Jacke und die Handschuhe. Er hatte alles mit Benzin übergossen und an der Grillstelle eines verlassenen Parks abgefackelt, bis die Sachen zu stinkenden Plastikklumpen zerschmolzen gewesen waren.
Der Strumpf war ein echter Fehler gewesen. Das hatte er schon gedacht, als er ihn gekauft hatte. Normalerweise hatte er stets mindestens eine Maskierung in seiner Tasche dabei, nur heute Morgen nicht, als er zur Arbeit aufgebrochen war.
Eigentlich hätte es bloß eine ganz normale Mitarbeiterversammlung sein sollen. Nichts Besonderes.
Aber es hatte sich als das genaue Gegenteil entpuppt. Eine Katastrophe. Er war nicht darauf vorbereitet gewesen, wie es sich anfühlen würde, wenn einen alle mitleidig ansahen, weil der eigene Vater die Firma verkaufte und die komplette Belegschaft vor die Tür setzte. Noch dazu hatte sein Vater es nicht mal fertiggebracht, ihnen persönlich gegenüberzutreten, sondern seinen Assistenten vorgeschickt, der verkündet hatte, dass die Firma, die das Unternehmen übernehmen sollte, sie alle vor die Tür setzen und ihre eigenen Leute einstellen würde, allerdings bekämen sie alle eine hübsche Abfindung, gestaffelt nach Dauer der Betriebszugehörigkeit.
Er war nicht darauf gefasst gewesen, wie sehr es ihm zusetzen würde. Seine Welt war schlicht und einfach in sich zusammengefallen. Blanke Wut war in ihm hochgekocht, und er hatte Mühe gehabt, sich zu beherrschen und dem Assistenten seines Vaters nicht an die Gurgel zu gehen.
Er hatte etwas – nein, jemanden – gebraucht, an dem er seinen unbändigen Zorn auslassen konnte. Sofort. Verdammt, auch jetzt war es noch so. Dieses verdammte blonde Miststück.
Er trat in das eigens im Keller eingebaute Badezimmer und blickte in den Spiegel. »Verdammte Scheiße!«
Dunkelrote Striemen zogen sich quer über seinen Hals, was an sich schon übel war. Damit hatten die Kriminaltechniker Hautpartikel von ihm. Seine DNS.
Schlimmer noch … das Medaillon war weg. Er sah den Moment wieder vor sich: Wie die Blonde ihn am Jackenärmel packte, ehe sie ihm das Knie in die Eier rammte.
»Dreckstück.« Das würde ihr noch leidtun. Wenn er sie erst in die Finger bekam … Er sah es förmlich vor sich, wie sie vor ihm kniete, ihn um Vergebung anbettelte, beteuerte, wie leid es ihr tue … Irgendwann sagten sie immer, es tue ihnen leid. Früher oder später.
Noch viel wahrscheinlicher war, dass die Polizei seine Fingerabdrücke auf dem Medaillon finden würde. Es stammte von seinem letzten Opfer, und er hatte es immer wieder berührt, zwischen seinen Fingern hindurchgleiten lassen. Andererseits hatte er vorhin Handschuhe getragen, deshalb waren die Fingerabdrücke womöglich verschmiert und nicht mehr zu erkennen.
Aber sie mussten ihn erst einmal schnappen, ehe sie versuchen konnten, ihn mit handfesten Beweisen festzunageln, was schwierig werden würde, weil er in keiner ihrer Datenbanken auftauchte. Ich lasse mich nicht erwischen. Ganz einfach.
Er trat unter die Dusche und wünschte, er hätte die nächsten Tage keinen Dienst, sonst würde er sich jetzt einen Joint zur Beruhigung genehmigen. Aber es bestand immer die Gefahr, dass die Behörden ihn zu einem Zufallsdrogentest herauszögen, bei dem das Marihuana nachweisbar wäre.
Mit der Hand fuhr er über die Schrammen an seiner Kehle. Er konnte nur hoffen, dass die Hautpartikel unter den Nägeln der Schlampe nicht allzu viel hergaben. Dazu musste er unbedingt herausfinden, wie viel die Cops wussten.
Er war nervös. Fahrig. Musste sich verdammt noch mal einkriegen. Eine Frau in dem Bett in seinem Keller. Genau das war es, was er brauchte. Hätte er die letzte bloß nicht ganz so schnell kaltgemacht. Normalerweise ließ er die Schlampen einige Zeit am Leben, benutzte sie, um seine Wut an ihnen auszulassen, aber Miriam hatte ihn so fuchsteufelswild gemacht. Dann musst du dir eben einen neuen Hausgast besorgen. Klar.
Morgen. Gleich nach der Arbeit. Morgen kannst du auf die Jagd gehen. Dich abreagieren. Dann wäre sein Verstand wieder klar, und er konnte sich überlegen, wie er die Blonde eliminieren würde.
Seit Jahren agierte er im Verborgenen. Deshalb würde er ganz bestimmt nicht zulassen, dass er aufflog, weil jemand ihn gesehen hatte.
Jetzt musste er erst einmal schlafen. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend, eilte er die Treppe hinauf. Eine kleine Laufrunde würde ihm hoffentlich die richtige Bettschwere verschaffen.
Er öffnete die Hintertür und schnalzte mit der Zunge. »Los, Mutt«, rief er leise. »Junge, komm her.« Prompt trottete ein Airedale-Mischling aus dem Garten herein, setzte sich hinter die Küchentür und hob brav die Pfoten, damit er sie abtrocknen konnte. Mutt war ein schlaues Kerlchen – den Dreh hatte er innerhalb weniger Tage nach seinem Einzug hier herausgehabt.
Er fragte sich, ob Mutts frühere Besitzerin wohl dasselbe mit ihm getan hatte. Möglich wäre es. Seattle war berühmt für seine vielen Regentage, und die Frau, Janice Fiddler, die mit ihm Gassi gegangen war, hatte einen ziemlich pingeligen Eindruck gemacht. Leider hatte er Janice nicht in seinen Keller bringen können, sondern war stattdessen gezwungen gewesen, sie in ihrem eigenen zu töten, doch sie hatte ihm ein wunderbares Souvenir mitgegeben.
Mutt war eine nette Gesellschaft.
2. Kapitel
Sacramento, Kalifornien
Donnerstag, 16. Februar, 22.30 Uhr
Rafe Sokolov stand an die Wand gelehnt vor einem der Befragungsräume des SacPD, als Gideon den Korridor entlangkam – groß, blond und mit dieser typischen Surferboy-Lässigkeit, die ihn jünger wirken ließ, als er tatsächlich war. Fest stand, dass Rafe ein erstklassiger, versierter Cop war und es niemanden auf der Welt gab, dem Gideon mehr vertraute als ihm.
Rafe musterte ihn. »Hast du mit Mercy geredet?«
»Ja. Direkt nachdem wir gesprochen hatten.«
»Dachte ich mir schon. Geht es ihr gut?«
Gideon zuckte die Achseln. »So gut es ihr eben gehen kann.«
Rafe wollte etwas sagen, schüttelte jedoch nur den Kopf.
»Was?«, blaffte Gideon, bereute seine Barschheit aber sofort. Rafe konnte nichts dafür, er war schließlich für ihn da gewesen, als sein ganzes Leben in Schutt und Asche gelegen hatte, und hatte ihm geholfen, die Scherben einzusammeln. »Entschuldige. Ich …«
»Schon gut«, sagte Rafe ruhig. »Ist doch klar, dass du durch den Wind bist, nachdem du mit Mercy geredet hast. Das verstehe ich. Eigentlich wollte ich sagen, dass euch beiden eine Therapie guttäte, aber mir war klar, dass du Nein sagen würdest, deshalb habe ich es mir lieber gleich verkniffen.«
Gideon nickte, denn genau das wäre seine Antwort gewesen. »Wo ist Miss Dawson?«
Rafe deutete auf die geschlossene Tür. »Da drin, mit Erin.«
Erin Rhee war seit einem Jahr Rafes Partnerin. Sie schien schwer auf Zack zu sein, und, was noch viel wichtiger war, sie hielt Rafe den Rücken frei. »Ihr beide habt den Fall also übernommen?«
»Genau.«
Gideon musterte ihn argwöhnisch. »Aber besteht da kein Interessenkonflikt?«
Rafes erwiderte seinen Blick. »Weil?«, fragte er provokant.
»Weil sie ›wie eine Schwester‹ ist? Deine Worte, nicht meine.«
Rafe machte eine vage Geste. »Sie ist eine alte Freundin der Familie.«
»So verkaufst du das also? Und was ist damit, dass du ihr Vermieter bist?«
»Ich war als Erster am Tatort«, erwiderte Rafe finster.
»Aber nur, weil sie dich angerufen hat, oder?«
Rafes Miene wurde noch düsterer. »Wir gehen von versuchter Freiheitsberaubung und Angriff mit einer gefährlichen Waffe aus«, erklärte er, ohne auf Gideons Frage einzugehen, was an sich schon Antwort genug war. »Gerade überprüfen wir, ob es Parallelen zu anderen Opfern gibt. Hier. Ich wollte, dass du es als Erster siehst.« Er zog eine kleine Beweismitteltüte mit dem silbernen Medaillon heraus, womit sich jede weitere Frage zu Daisy Dawson erledigt hatte. Gideon bemerkte den besorgten Ausdruck in Rafes Augen, während ihm erst jetzt der wahre Grund bewusst wurde, warum sein Freund darauf bestanden hatte, dass er herkam.
Er will mich beschützen. Weil er genau weiß, wie schmerzhaft das Ganze für mich wird. Dankbarkeit durchströmte ihn und ließ ihn verstummen, doch Rafe verstand auch ohne Worte.
»Daisy hat sie dem Angreifer vom Hals gerissen«, sagte er leise.
Gideon nahm das Tütchen und hielt es ins Licht, während er gegen eine Woge der Übelkeit ankämpfen musste. Ja, er erkannte das Medaillon. Nun ja, nicht speziell dieses, aber … Ja. Er hatte mehr als genug davon gesehen. Und er hatte sie allesamt gehasst, als er groß genug gewesen war, um zu verstehen, wofür sie standen. Sklaverei. Besitztum. Diejenigen, die sie trugen, waren nichts als Bauern in einem Schachspiel, dessen Mechanismen sie erst begriffen, wenn es zu spät war.
»Es ist dasselbe Motiv, stimmt’s? Was du als Tattoo hattest.« Rafe tippte auf Gideons linke Brust. »Es ist so lange her, seit ich es zuletzt gesehen habe, dass ich mir nicht mehr sicher war.«
Ja, es war dasselbe Motiv – bis auf die Zahl der Zweige am Olivenbaum. Der Baum auf dem Medaillon hatte zwölf Äste. Seiner hatte dreizehn gehabt.
Am liebsten hätte er sich übergeben.
»Gid?«, fragte Rafe leise.
Gideon war dankbar, dass Rafe ihm die Möglichkeit gegeben hatte, das Medaillon nicht vor den Augen aller begutachten zu müssen. »Ja«, presste er mühsam hervor. Seine Stimme war rau. »Es ist dasselbe.« Er zog das Foto hervor, das er aus der Holzkassette in seinem Wohnzimmer gekramt hatte. Es zeigte zwei Jungen im Teenageralter, einer blond, der andere dunkelhaarig, beide mit freiem Oberkörper, Arm in Arm in die Kamera grinsend. Das Tattoo auf Gideons Brust war deutlich zu erkennen.
»Ich erinnere mich noch an den Tag«, sagte Rafe. »Es war mein Geburtstag, und wir waren mit dem Schlauchreifen beim Wildwasser-Tubing.«
Auch Gideon hatte den Tag noch klar vor Augen, weil er einer der schönsten seines bisherigen Lebens gewesen war. Gerade einmal einen Monat später hatte er Mercy gefunden, und sein Leben war auf den Kopf gestellt worden – wieder einmal. »Stimmt«, krächzte er.
Rafe sah auf. »Das Motiv ist genau so, wie ich es in Erinnerung hatte. Was kannst du mir über das Medaillon sagen?«
»Die ursprüngliche Besitzerin heißt Miriam.« Gideon konnte nur hoffen, dass sie in Sicherheit war. »Sie hätte es nicht grundlos abgenommen und irgendwo liegen lassen. Es wurde ihr gewaltsam weggenommen, die Kette durchtrennt.« Er bemühte sich um einen leidenschaftslosen Tonfall, weil es die einzige Möglichkeit war, darüber zu sprechen. Über die Männer zu sprechen. »Mit einem Bolzenschneider.«
Rafe riss die Augen auf. »Wie bitte?«
Gideon deutete auf die zarte Silberkette in der Tüte. »Das ist nicht das Original. Das Medaillon hängt normalerweise an einer sehr viel stärkeren Kette, die sich nicht einfach abreißen lässt. Zumindest nicht mit der Hand.«
»Also hatten alle Frauen mit einem Medaillon auch eine ähnliche Kette.«
»Nicht nur alle Frauen mit einem Medaillon. Sondern alle Frauen. Sie trugen alle ein Medaillon.«
Rafe blinzelte. »Als …? Symbol der Mitgliedschaft?«
»Des Besitzes«, korrigierte Gideon. »Das Medaillon hing auf der Höhe ihrer Drosselgrube, wobei die Kette immer bewusst so kurz war, dass die Trägerin sie nicht über den Kopf streifen konnte. Allerdings war sie lang genug, um als ›Lernmittel‹ eingesetzt zu werden«, erläuterte er, wobei er das Wort höhnisch betonte.
»Als Lernmittel?«
»Ihr Ehemann oder jeder andere der Männer konnte die Kette packen und so weit daran ziehen, dass sie keine Luft mehr bekam.«
»Aber warum?«
»Weil sie es konnten«, antwortete Gideon tonlos. »Die Ketten haben keinen Verschluss, sondern sind verschweißt. Üblicherweise behielt die Trägerin eine Narbe am Hals zurück.«
»Eine Brandnarbe?«, fragte Rafe entsetzt. »Vom Verschweißen?«
»Ja. Mindestens eine. Die meisten mussten ihre Kette im Lauf der Jahre immer wieder anpassen lassen, wenn sie größer wurden. Dabei wurden zusätzliche Glieder eingefügt. Miriam hat ihr Medaillon an ihrem zwölften Geburtstag bekommen. Wie oft die Kette neu angepasst werden musste, hängt davon ab, wie sehr sie danach gewachsen ist.«
»Also ist diese Kette eher so was wie das Halsband, das ein Dom seiner Sub anlegt.«
Gideon nickte. »Ja. Allerdings haben die Frauen sie nicht als Sexutensil betrachtet, sondern eher wie einen Ehering, obwohl sie auch einen am Finger trugen.«
»Sie hat das Medaillon also an ihrem zwölften Geburtstag angelegt bekommen. Will ich wirklich wissen, wann man ihr den Ehering angesteckt hat?«
Gideon starrte auf das Medaillon, um den Ausdruck auf dem Gesicht seines Freundes nicht sehen zu müssen. »Auch an ihrem zwölften Geburtstag.«
Rafe holte tief Luft und atmete langsam wieder aus. »Und das Tattoo, das du mal hattest?«
Vergangenheitsform. Denn er hatte es überstechen lassen und diese sichtbare Erinnerung an seine Vergangenheit eliminiert. »Was ist damit?«
»Wann hast du es bekommen?«
Gideon schluckte und verdrängte die Erinnerung, wenn auch nicht an den Vorgang an sich, sondern daran, was später an dem Tag geschehen war, nach der Geburtstagsfeier. Dieser Abend verfolgte ihn auch heute noch in seinen Träumen, siebzehn Jahre danach.
»Als ich dreizehn wurde.«
Rafe schien eine weitere Frage auf der Zunge zu liegen, deshalb fuhr Gideon eilig fort. »Miriam war ihr Vorname, aber vielleicht hatte sie einen Spitznamen.«
»Wie Mercy?«, fragte Rafe.
Wieder nickte Gideon. Aber er wollte nicht an seine Schwester denken. Nicht hier, in aller Öffentlichkeit, und nicht in einem Moment, in dem er jederzeit die Fassung zu verlieren drohte. »Oder Midge, Mir oder Mimi.« Miriam war ein recht beliebter Name gewesen, deshalb hatte man Spitznamen gebraucht, um die Frauen voneinander unterscheiden zu können.
Rafe schwieg einige Zeit. »Ich weiß, dass du nicht gern darüber sprichst.«
Gideon stieß ein bitteres Lachen aus. »Das ist wohl die Untertreibung des Jahrhunderts.« Trotzdem hatte er sich dazu gezwungen. Der Cop, der ihn im Krankenhaus aufgesucht hatte, war der Erste gewesen, dem er sich anvertraut hatte – fünf Tage nach seinem dreizehnten Geburtstag, vier Tage nach seiner Flucht. Einen Tag, nachdem er das Bewusstsein wiedererlangt hatte. Der Cop war nett gewesen. Mitfühlend.
Vielleicht hat er mir sogar geglaubt. Bis heute war Gideon sich darüber nicht sicher.
Rafe hatte er nie davon erzählt. Nicht einmal, nachdem er die völlig traumatisierte und verängstigte Mercy in einer Pflegestelle gefunden hatte. Damals war er siebzehn Jahre alt gewesen, sie dreizehn. Er hatte die Ursache für diesen gequälten Ausdruck in ihren Augen gekannt, hatte verstanden. Und er hatte danach gelechzt, seinen Zorn gegen Gott zu richten, gegen das gesamte Universum, gegen den Mann, der ihr wehgetan hatte – oder, Gott bewahre, die Männer.
Sie hatte nie darüber gesprochen. Nicht in all den Jahren, seit er sie gefunden hatte. Vielleicht hätte er sie ja dazu drängen müssen.
Aber er hatte nicht gewollt, dass sie sich ihm entzog. Was sie am Ende aber trotzdem getan hatte. Inzwischen lebte sie in New Orleans, zweitausend Meilen und zwei Zeitzonen von hier. Sie schickten sich Weihnachtskarten, hinterließen einander steife Sprachnachrichten zum Geburtstag auf der Mailbox. Zwei Jahre war es her, dass er sie zuletzt gesehen hatte, und das auch nur, weil er »zufällig gerade in der Gegend« gewesen war. Was natürlich nicht stimmte. Er hatte die lange Reise gemacht, weil er sie hatte sehen wollen, sie hatte sehen müssen, um sich zu vergewissern, dass es ihr gut ging. Es war am Jahrestag ihrer Flucht gewesen, und natürlich hatte sie ganz genau gewusst, dass er nicht »zufällig in der Gegend« gewesen war.
»Du weißt, dass du mit mir reden kannst«, sagte Rafe sanft. »Jederzeit.«
Den Blick auf die Wand hinter Rafes Schulter geheftet, nickte Gideon. »Ja, ich weiß«, presste er hervor. Er hatte es schon einmal getan. Nachdem er zum FBI gekommen war, hatte er sich überwunden, seinem allerersten Vorgesetzten von der Gemeinschaft zu erzählen, von den Misshandlungen. Sein Chef hatte eine Ermittlung eingeleitet, und mehrere Agents hatten die Gegend abgesucht, in der die Gemeinschaft zum Zeitpunkt von Gideons Flucht ansässig gewesen war, doch man hatte nichts gefunden, weder bei der Überprüfung zu Fuß noch aus der Luft, noch nicht einmal mithilfe von Satellitenaufnahmen.
Die Gemeinschaft war nicht mehr dort gewesen.
»Ich habe deine Privatsphäre immer respektiert, schon von Anfang an, trotzdem muss ich mehr erfahren … über sie.« Er deutete auf das Medaillon in Gideons Hand. »So leid es mir tut.«
Gideon überwand sich zu einem knappen Nicken. Rafe hatte nie mehr von ihm zu erfahren verlangt, als Gideon preiszugeben bereit gewesen war, aber damit war nun Schluss, und das war nicht Rafes Schuld. »Ich werde dir alles erzählen. Aber nicht hier und nicht vor laufender Kamera.« Es würde sehr schwer werden, und Gideon wollte nicht, dass jemand Zeuge der Gefühle wurde, die aus ihm herausbrechen könnten. Rafe alles sagen zu müssen, war schon schlimm genug, selbst wenn er niemandem mehr vertraute als ihm.
Rafe nickte. »Klar. Wie kommt es, dass der Kerl, der Daisy überfallen hat, das Medaillon um den Hals trug?«
»Gute Frage. Habt ihr es aufgemacht?«
Rafe schüttelte den Kopf. »Nein. Ich habe es versucht, bin aber nicht auf den Mechanismus gekommen. Deshalb wollte ich zuerst dich fragen, bevor ich es aufbreche.«
»Es gibt einen Trick.« Wie bei allem in der Gemeinschaft. Alles und jeder hatte sich hinter einer Fassade versteckt. Er reichte Rafe die Plastiktüte. »Gehen wir damit ins Labor, dann zeige ich es dir.«
»Die Kollegin von der Spurensicherung wollte in …«, Rafe sah auf seine Uhr, »… nicht mal einer Minute hier sein, um es zu holen. Wir können es uns in Ruhe ansehen, aber vorher muss ich Daisys Aussage aufnehmen, damit sie nach Hause gehen kann.« Er horchte auf, als Schritte ertönten. Eine Frau von Mitte vierzig trat zu ihnen.
»Sind Sie fertig damit?«, fragte sie mit schief gelegtem Kopf.
»Für den Moment.« Rafe reichte ihr die kleine Tüte. »Cindy, das ist Special Agent Gideon Reynolds. Er weiß etwas über das Medaillon und kann uns helfen. Gideon, das ist Sergeant Cindy Grimes aus unserer Abteilung für forensische Ermittlungen, zuständig für die Spurensicherung.«
Gideon schüttelte ihr die Hand und sah ihr zu, wie sie das Medaillon eingehend betrachtete, ehe sie aufsah.
»Ich liebe diese Dinger«, erklärte sie mit leuchtenden Augen.
Gideon zog die Brauen hoch. »Haben Sie so eines schon mal gesehen?«
Cindy schüttelte den Kopf. »Nicht genau dasselbe, nein, aber die Machart kenne ich. Der Mechanismus funktioniert mit einem Kniff.«
»Und kriegen Sie es auf?«, fragte Gideon.
»Irgendwann schon, klar. Wissen Sie, wie’s geht?« Sie wirkte ein wenig enttäuscht, wie ein Kind, dem jemand sein Spielzeug weggenommen hatte.
»Ich will Ihnen die Freude daran nicht verderben. Dass eines mit einem Selbstzerstörungsmechanismus versehen war, habe ich noch nie erlebt, deshalb wird wohl nichts passieren, wenn Sie etwas falsch machen.«
Sie schnitt eine Grimasse. »Es einfach aufzumachen wäre wohl das Vernünftigste. Also, zeigen Sie es mir«, erwiderte sie mit einem resignierten Seufzer.
Gideon deutete auf die beiden betenden Kinder. »Zuerst auf den Jungen, dann auf das Mädchen drücken, dann auf den Engel. So sollte es aufspringen.«
Cindy musterte ihn scharf. »Patriarchalische Glaubensbewegung?«
Gideon blinzelte. »Stimmt. Woher wissen Sie das?«
»Der Olivenbaum und der Engel? Betende Menschen? Zuerst der Junge? War nicht allzu schwierig.« Sie nickte Rafe knapp zu. »Ich sage Bescheid, wenn ich etwas im Inneren finde.«
»Danke, Cindy.« Rafe wartete, bis sie gegangen war, und deutete auf den Befragungsraum, wo Daisy Dawson immer noch wartete. »Willst du mitkommen?«
Von »wollen« konnte keine Rede sein, doch dann fiel ihm wieder ein, was ihr Angreifer gesagt hatte – Am Ende tun sie es alle. Falls sie es mit einem Serienvergewaltiger zu tun hatten, wollte er es wissen. Und wenn er bei den Ermittlungen helfen konnte, würde er gleich morgen früh seine Vorgesetzte bitten, ihn für eine Weile ans SacPD auszuleihen, auch wenn ihm der Fall ziemliche Bauchschmerzen bereitete. Denn er bezweifelte stark, dass es der Besitzerin des Medaillons gut ging. Miriam hatte das Medaillon höchstwahrscheinlich nicht freiwillig hergegeben. Dafür fehlte ihr vermutlich die innere Stärke.
Nicht einmal Mercy, die stärkste Frau, die er kannte, hatte sie aufgebracht. Zwar war sie geflohen und mit dem Leben davongekommen, trotzdem klammerte auch sie sich bis heute an dieses kleine Silberschmuckstück. Nicht etwa, weil damit so schöne Erinnerungen verbunden gewesen wären. Ganz im Gegenteil.
Nein, das Medaillon hatte Macht. Natürlich nicht die Macht, wie sie sie ihm zuschrieben, aber trotzdem. Er hoffte, dass er sich irrte und Miriam tatsächlich die Stärke besessen hatte, das Ding in den nächsten Mülleimer zu werfen, wo Daisy Dawsons Angreifer es rein zufällig gefunden hatte. Aber das glaubte er nicht. Und seinem Bauchgefühl hatte er stets vertrauen können.
Er drückte die Schultern durch. »Klar. Gehen wir.« Er folgte Rafe in den Befragungsraum … und blieb wie angewurzelt stehen.
Er regte sich nicht. Hörte auf zu atmen. Hörte auf, an Medaillons zu denken, an Mercy und eine Frau namens Miriam.
Denn Irina Sokolov lag falsch. Die Frau, die neben Detective Rhee am Tisch saß, war nicht süß. Und auch nicht klein. Sondern … der Hammer.
Ihr kuscheliger rosa Kaschmirrollkragenpulli schmiegte sich um höllisch attraktive Kurven, um Brüste, die gerade groß genug waren, um perfekt in die Hände eines Liebhabers zu passen. Blondes Haar fiel ihr in weichen Wellen über die Schultern und umrahmte ihr Gesicht, das trotz ihrer geröteten Nase und der verquollenen Augen viel zu hübsch war. Sie war eine Naturschönheit, mit Augen so blau wie der Himmel an einem herrlich klaren Tag.
Besagte Augen weiteten sich für eine Sekunde, als sie ihn wiederzuerkennen schien, ehe sie ihre Züge wieder unter Kontrolle hatte. Automatisch setzte er einen Fuß vor den anderen und trat zum Tisch. Sie musterte ihn, eine blonde Braue fragend hochgezogen. »Sie sind also der viel gerühmte Special Agent Gideon Reynolds«, sagte sie trocken. Der Klang ihrer Stimme jagte ihm einen Schauder über den Körper. Sie war leicht heiser. Sexy. Und seltsam vertraut.
»Irina hat mir mehr Fotos von Ihnen gezeigt als von all ihren Kindern zusammen«, fuhr sie fort, bevor er darüber nachdenken konnte, wo er ihre Stimme schon einmal gehört hatte. »Man hat mir eine Menge über Sie erzählt.«
Höflich lächelnd erhob sie sich mit einer Anmut, die vergessen ließ, dass sie der brutale Angriff ziemlich mitgenommen haben musste. Sie wirkte so gefasst und selbstsicher, dass man sich kaum vorstellen konnte, das Opfer einer Gewalttat vor sich zu haben.
Lediglich die leichten Tränenspuren verrieten sie. Und ihre Hand zitterte kaum merklich, als sie sie ihm hinstreckte. Miss Dawson war nicht so cool und souverän, wie sie wirken wollte, kaschierte ihre Erschütterung jedoch ganz hervorragend, und allein dafür gebührte ihr sein voller Respekt.
»Ja, ich bin Gideon«, sagte er und registrierte erleichtert, dass seine Stimme nicht brach, als wäre er ein pickliger Halbwüchsiger, obwohl er sich seltsamerweise genauso fühlte. Nervös ergriff er ihre Hand und drückte sie sanft. Sie war kühl. Zu kühl, dachte er und widerstand dem Drang, auch seine andere Hand um ihre Finger zu schließen. »Wenngleich ›viel gerühmt‹ ein bisschen zu viel der Ehre ist«, fügte er hinzu, ließ ihre Hand los und bemühte sich vergeblich, ihr Lächeln zu erwidern. Auf Kommando ein Lächeln aufzusetzen zählte nicht gerade zu seinen Stärken. »Freut mich, Sie endlich kennenzulernen. Ich wünschte, die Umstände wären ein wenig angenehmer.«
Ihr höfliches Lächeln verblasste, und sie sah Rafe an. »Wohl wahr. Ich gehe davon aus, dass du nicht der Bitte deiner Mutter folgst und versuchst, uns zu verkuppeln, was absolut unprofessionell wäre, und das passt nicht zu dir. Wieso ist er also hier?«
»Um mir bei dem Fall zu helfen«, antwortete Rafe wahrheitsgetreu.
Daisy runzelte die Stirn. »Aber er arbeitet für das FBI.« In diesem Moment weiteten sich ihre Augen abermals, diesmal allerdings vor Bestürzung. »O mein Gott. Er hat gesagt, sie würden alle um Vergebung flehen.« Die Verzweiflung stand ihr ins Gesicht geschrieben. »Gibt es etwa noch andere? Sind Sie hier, weil es noch weitere Opfer gibt?«
Gideon verspürte den Drang, sie zu beschwichtigen. Die Worte kamen über seine Lippen, noch bevor er einen Gedanken daran verschwenden konnte, welche Auswirkungen sie haben könnten. »Das weiß ich nicht. Ich bin wegen des Medaillons hier.«
Sacramento, Kalifornien
Donnerstag, 16. Februar, 22.50 Uhr
Daisy sah ihn immer noch an. Seine grünen Augen ruhten auf ihr. Sein Gesicht war freundlich, mitfühlend. Seine Stimme sanft und tröstlich.
Und dann drangen die Worte durch den Nebel ihres Bewusstseins. Moment mal. Wie bitte? Sie hatte gedacht, ein FBI-Agent sei hinzugezogen worden, weil sich herausgestellt hatte, dass ihr Angreifer Frauen in Serie vergewaltigte. Oder ermordete. Denn eines stand fest: Ihr Leben war wie ein Film vor ihrem inneren Auge vorbeigezogen, ehe ihr Muskelgedächtnis übernommen hatte. »Das Medaillon? Das er um den Hals trug?«
Sie presste die Lippen aufeinander, denn sie wollte die Worte nicht laut ausgesprochen hören, doch sie hallten ohrenbetäubend laut in ihrem Kopf wider. Das ich ihm vom Hals gerissen habe, als er mich erwürgen wollte?