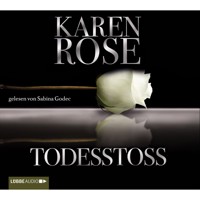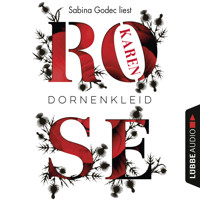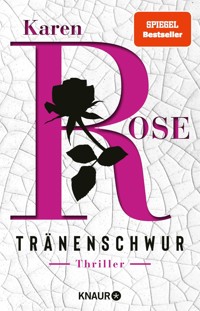
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Sacramento-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wenn das Ende naht, ist die Gefahr am größten »Tränenschwur« ist der 3. Thriller der Sacramento-Reihe von Bestseller-Autorin Karen Rose und das atemraubende Finale der Geschichte um die mörderische Sekte Church of Second Eden. Zwar konnten die ehemaligen Sekten-Opfer Gideon Reynolds und seine Schwester Mercy einen der Gründer der Church of Second Eden überwältigen – doch mit DJ Belmont ist ihnen ein weiterer Sektenführer auf der Spur, der um jeden Preis ihren Tod will, um seine Geheimnisse zu bewahren. Währenddessen wird FBI Special Agent Tom Hunter, einem Freund und Kollegen von Gideon, der Hilferuf zweier Teenager zugespielt, die kürzlich zur Sekte verschleppt wurden. Zusammen mit der ehemaligen Soldatin und Ärztin Liza Barkley, die schon lange Gefühle für den verschlossenen Tom hegt, nehmen die Agents den finalen Kampf gegen Eden auf. Die Zeit läuft ihnen davon, denn es steht auch das Leben einer Schwangeren und ihres ungeborenen Kindes auf dem Spiel … »Knallharte Höchstspannung, gewürzt mit einem Schuss Romantik« (Berliner Lokalnachrichten über »Tränennacht«) liefert die amerikanische Thriller-Autorin Karen Rose auch im 3. Teil ihrer actionreichen Thriller-Reihe aus Sacramento. Die Sacramento-Reihe von Karen Rose ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Tränennacht - Tränenfluch - Tränenschwur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1030
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Karen Rose
Tränenschwur
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Brandl
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Wenn das Ende naht, ist die Gefahr am größten
Zwar konnten die ehemaligen Sekten-Opfer Gideon Reynolds und seine Schwester Mercy einen der Gründer der Church of Second Eden überwältigen – doch mit DJ Belmont ist ihnen ein weiterer Sektenführer auf der Spur, der um jeden Preis ihren Tod will, um seine Geheimnisse zu bewahren.
Währenddessen wird FBI Special Agent Tom Hunter, einem Freund und Kollegen von Gideon, der Hilferuf zweier Teenager zugespielt, die kürzlich zur Sekte verschleppt wurden. Zusammen mit der ehemaligen Soldatin und Ärztin Liza Barkley, die schon lange Gefühle für den verschlossenen Tom hegt, nehmen die Agents zusammen mit Gideon und Mercy den finalen Kampf gegen Eden auf.
»Tränenschwur« ist der 3. Thriller der Sacramento-Reihe von Bestsellerautorin Karen Rose und das atemraubende Finale der Geschichte um die mörderische Sekte Church of Second Eden.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Epilog
Dank
Verzeichnis der Romane von Karen Rose und der darin auftretenden Figuren
Für Sheila, mit viel Liebe. Ich kann mich so glücklich schätzen, dich als Freundin zu haben.
Für Canadian Sarah. Unsere Tür steht dir immer offen, vor allem an Thanksgiving. Leider konnte ich deine Idee nicht in dieses Buch einflechten, hoffe aber, du findest auch, dass dies deiner Vorstellung am nächsten kommt.
Für Martin, wie immer. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber die häusliche Isolation verbringen würde. Ich liebe dich.
Prolog
Eden, Kalifornien
Hayley Gibbs zuckte zusammen, als ihr Bauch den Rahmen der Eingangstür zur Ambulanz streifte. Verdammt. Wieder einmal hatte sie ihren aktuellen – und stetig wachsenden – Körperumfang falsch eingeschätzt. Diese verflixte Schwangerschaft.
Beruhigend tätschelte sie die ausladende Wölbung. Nicht du, sagte sie stumm zu ihrem ungeborenen Kind. Ihrer Tochter. Auf dich bin ich nicht böse, Jellybean. Niemals.
Aber auf ihre Mutter. Auf sie war sie stinkwütend. Gleichzeitig fürchtete sie sich vor ihr. Die Wut war nichts Neues, die Angst hingegen schon, zumindest in dieser Form. Bisher hatte sich die Angst darauf beschränkt, nicht genug zu essen zu haben oder nicht zu wissen, wo sie nächste Woche wohnen würden, oder wie ihre Mutter reagieren würde, wenn sie erfuhr, dass Hayley Sex mit Cameron hatte, ihrem Highschool-Freund, oder dass ihr jüngerer Bruder Graham im Elektromarkt regelmäßig Sachen klaute.
Dann hatte Hayley herausgefunden, wie es war, wenn ihre Mutter reagierte.
Sie hat uns hierhergeschleppt. In dieses Drecksloch mitten in der beschissenen Einöde.
Aus dem Hayley abhauen würde, und wenn es sie das Leben kostete.
Sie musste nur in den Arbeitsraum der Ambulanz gelangen.
Mit einem tiefen Atemzug zwängte sie sich durch die Tür und schloss sie leise hinter sich, dann blieb sie einen Moment lang reglos stehen und lauschte. Doch alles war still.
Danke, hauchte sie, ohne recht zu wissen, an wen der Dank gerichtet war. An Gott wohl eher nicht, zumindest nicht an den ihrer Mutter. Der Gott, dem Hayley danken wollte, war einer, der dafür sorgte, dass es ihrem Baby gut ging. Und der diese Ungeheuer, die hier lebten, ganz bestimmt nicht gutheißen würde.
Eden war voller Ungeheuer, und sie und ihr Bruder waren unter lautstarkem Protest hierhergeschleppt worden.
Mit dem Finger strich Hayley über die dicke Kette, die um ihren Hals geschmiedet war.
Geschmiedet! Um meinen Hals!
Trotz des Medaillons, das daran hing, war die Kette kein Schmuckstück, sondern ein Zeichen von Besitztum.
Gerade war das Medaillon leer. Aber sobald das Baby geboren wäre, würde ihr Hochzeitsfoto hineingelegt werden. Genau genommen war sie sogar schon verheiratet – seit dem Tag, als sie an diesem grauenvollen Ort angekommen war. Zum Glück wollte ihr »Ehemann« die Ehe nicht »vollziehen«, solange sie den »Bastard« eines anderen unter dem Herzen trug, deshalb war ihr der erzwungene Sex erspart geblieben. Noch.
Er wollte nicht, dass ihr Hochzeitsfoto durch ihre Sünde besudelt wurde, deshalb sollte es erst nach der Geburt des »Bastards« aufgenommen werden. Was ihr etwas mehr als sechs Wochen Aufschub verschaffte.
Hayleys Magen rebellierte beim Gedanken daran, die vierte Ehefrau von Brother Joshua zu werden – gleichzeitig mit den anderen. Polygamie war in Eden an der Tagesordnung, und Hayley wollte unter keinen Umständen daran beteiligt sein.
Nichts von alldem hatte sie je gewollt. Stattdessen wollte sie bloß mit ihrem Freund zusammen sein und so leben, wie sie es seit dem ersten Schulball in der neunten Klasse gemeinsam geplant hatten.
Na schön, das Baby war nicht geplant gewesen, zumindest noch nicht jetzt, schließlich waren Cameron und sie erst siebzehn. Aber seine Eltern hatten sich hinter sie gestellt und angeboten, dass sie nach der Geburt erst einmal bei ihnen wohnen und trotzdem aufs College gehen könnten.
Nur ihre Mutter hatte nicht mitgespielt. Und ehe Hayley sichs versehen hatte, waren sie und Graham gezwungen worden, in den Pick-up irgendeines Fremden zu steigen. Und jetzt bin ich hier.
In der Ambulanz von Eden, die gerade geschlossen war. Wenn sie erwischt wurde … Allein bei der Vorstellung erschauderte sie. Trotzdem musste sie es versuchen. Ihre Angst, in Eden bleiben zu müssen, war größer als die vor einer Bestrafung, wie auch immer sie aussehen mochte. Und Pastor – der gruselige Anführer dieser gruseligen Sekte mitten in den beschissenen Bergen – jagte ihr eine Heidenangst ein. Die Leute hier gehorchten ihm, als wären sie Roboter.
Sie rieb sich den Magen, der neuerlich rebellierte. Los jetzt. Keine Angst, Jellybean. Ich schaffe uns hier raus, bevor du zur Welt kommst. Versprochen.
Jetzt gab es kein Zurück mehr. Sie hatte es ihrer kleinen Tochter offiziell versprochen.
Ihre Tochter. Sie würde ein kleines Mädchen bekommen. Sie und Cameron hatten das Baby in der Frauenarztpraxis in San Francisco auf dem Ultraschall gesehen, seinen Herzschlag gehört. Cam hatte geweint und nach ihrer Hand gegriffen, als sie auf den kleinen Monitor gestarrt hatten.
Ich liebe dich, Cam, dachte sie. Ich liebe euch beide.
Noch hatten sie sich nicht für einen Namen entschieden, deshalb nannte Hayley sie für den Moment Jellybean.
Und sie würde alles tun, um sie zu beschützen, mit anderen Worten, sie würde von hier verschwinden, weg aus Eden und dieser Ambulanz mit ihrer Ausstattung, die selbst nach Unsere kleine Farm-Standards mittelalterlich gewesen wäre.
Hayley sah sich in dem in tiefe Schatten getauchten Raum um. Es gab kein Ultraschallgerät, keinen Sauerstoff, falls das Baby welchen brauchen würde, keine Schmerzmittel, nichts dergleichen. Nur eine Liege mit Fußhalterungen und ledernen Riemen.
Sie wollte lieber nicht wissen, wofür die Riemen benutzt wurden.
In diesem Raum starben Frauen bei der Geburt. Sie hatte das Getuschel gehört.
Es wäre Gottes Strafe für ihre Sünde, hatte eine der Frauen gesagt.
Sie ist eine Hure, hatte eine andere ihr beigepflichtet.
Die Worte einer dritten, einer giftigen alten Schabracke, hatten Hayley das Blut in den Adern gefrieren lassen. Sister Rebecca wird das Baby nehmen und als ihr eigenes großziehen.
Selbst wenn sie überlebt?, hatte die erste Frau geflüstert.
Selbst wenn die kleine Hure überlebt, hatte die alte Schachtel erwidert. Gott würde nicht wollen, dass ein Kind von so einem Flittchen aufgezogen wird.
Schützend legte Hayley beide Arme um ihren Bauch. Eher friert die Hölle zu, dachte sie. Dazu würde es nicht kommen, selbst wenn Sister Rebecca eine freundliche, anständige Frau wäre, was sie nicht war. Sie war Brother Joshuas »erste« Frau und stand damit in der Hierarchie seiner restlichen Angetrauten ganz oben, wohingegen Hayley als Nummer vier auf der untersten Stufe stand und sowohl den anderen Frauen als auch ihrem »Ehemann« gehorchen musste.
Am liebsten würde Hayley das Wort ausspeien. Er ist nicht mein Ehemann.
Brother Joshua war ein Unmensch, grausam und gemein, und auch Sister Rebecca war eine grauenvolle Person und dazu nicht einmal gebärfähig. Genau dieses Wort hatten die anderen Frauen benutzt. Nicht gebärfähig.
Es war, als sei sie mitten in einem Schauerdrama aus dem 19. Jahrhundert gelandet.
Sister Rebecca hatte drei Kinder, die allesamt von anderen Frauen in Eden zur Welt gebracht worden waren. Zwei der Frauen waren offenbar im Kindbett gestorben, das dritte Kind stammte von einer Unverheirateten. So wie ich. Keine der Frauen hatte erwähnt, was aus der ledigen Mutter geworden war, und Hayley fragte sich, um wen es sich handelte.
Niemand nimmt mir meine Tochter weg. Niemand. Vorher müssen sie mich töten.
Was durchaus im Bereich des Möglichen war, falls sie sie in der Ambulanz erwischten.
Also, beeil dich, Hayley. Geh in den Arbeitsraum und …
Sie unterdrückte einen Aufschrei, als die Tür auf- und sofort wieder zuging, drehte sich um und atmete erleichtert auf. »Graham«, zischte sie. »Was machst du denn hier?«
Ihr Bruder schlich quer durch den Raum auf sie zu. Obwohl er gerade einmal zwölf war, überragte er sie um ein gutes Stück und erinnerte sie mit seinen dürren, sehnigen Armen und Beinen stets an eine Spinne.
Bald wurde er dreizehn, was bedeutete, er würde einem der Handwerker der Gemeinschaft als Lehrjunge zugeteilt werden. Was an jedem anderen Ort nicht die schlechteste Perspektive wäre.
Doch auch in diesem Punkt gab es Getuschel, einigen Jungen widerführen »üble Dinge«.
Üble Dinge. Die Worte wurden im Flüsterton ausgesprochen, so wie Frauen über den Sex raunten, zu dem sie selbst oder die »in Ungnade Gefallenen«, die aus diesem Drecksloch zu fliehen versuchten, gezwungen wurden.
Hayley hatte keine Ahnung, was diese üblen Dinge sein sollten, trotzdem würde sie unter keinen Umständen zulassen, dass Graham Opfer davon wurde. Nicht solange sie noch am Leben war.
»Was machst du hier?«, zischte Graham zurück. »Ich bin dir nachgegangen, weil du ein Gesicht gemacht hast, als würdest du etwas im Schilde führen. Wegen dir kommen wir noch in die Kiste.«
Die Kiste. Das war im Grunde ein nahezu unbelüftetes Plumpsklo, in das man für einen dem Vergehen entsprechenden Zeitraum gesperrt wurde. Was auch immer das heißen mochte.
»Ich versuche, in den Arbeitsraum zu gelangen«, flüsterte Hayley.
Graham hob die Brauen. »Wieso? Da gibt es aber keine Drogen.«
Sie verdrehte die Augen. »Als würde ich in der Schwangerschaft etwas nehmen. Nein, da drinnen steht ein Computer, Schwachkopf. Ganz sicher.«
Grahams Augen wurden groß. »Hier? Am Arsch der Welt?«
»Hier, in der Hölle.« Sie deutete auf die Tür zum Arbeitsraum der Heilerin. »Ich war gestern für die Untersuchung hier.« Die ein reiner Witz gewesen war. Die Heilerin hatte sie lediglich gewogen und ermahnt, mehr Gemüse zu essen. »Ich habe einen Drucker gehört. Ganz sicher. Die Tür stand einen Spaltbreit offen, und die Heilerin ist auf einmal ganz still geworden, als hätte sie es auch gehört und Angst, dass ich es mitbekommen habe. Ich habe so getan, als würde ich nichts merken, aber irgendetwas ist da drin. Und wenn es einen Drucker gibt, muss es auch einen Computer geben.«
Graham runzelte die Stirn. »Aber wie soll der funktionieren? Es gibt keinen Strom, kein Kabel, kein WLAN. Wie soll er angeschlossen sein?«
Hayley hätte vor Frust am liebsten geschrien. Ihr Bruder und sein ewiges Warum. »Weiß ich doch nicht, und es ist mir auch egal. Wenn in dem Zimmer ein Computer steht, kann ich Cam eine Nachricht schicken, und er kann uns rausholen.« Sie schluckte. »Ich kann mein Baby nicht hier bekommen, Graham. Die nehmen es mir weg. Ich habe die Frauen gehört. Selbst wenn ich überlebe, nehmen sie es mir weg und geben es Sister Rebecca.«
Grahams Mund wurde zu einer schmalen Linie, die Hayley nur zu gut kannte. Es war sein Sturkopf-Gesicht, was bedeutete, dass er fest entschlossen war – wozu auch immer.
»Ich brauche deine Hilfe«, flüsterte sie flehend. »Bitte, Graham. Du darfst niemandem etwas sagen.«
Er nickte knapp. »Geh von der Tür weg.«
Sie gehorchte und sah verblüfft zu, wie ihr kleiner Bruder vor der Tür auf die Knie ging und das Schloss beäugte. »Kinderspiel«, sagte er leise, zog seinen Schuh aus und nahm etwas heraus.
»Sind das Dietriche?«, fragte sie, obwohl sie die Antwort bereits kannte.
Er sah auf, verdrehte die Augen. »Was wohl sonst?«
Hayley schüttelte den Kopf. »Ich will es lieber gar nicht wissen.« Zu Hause hatte Graham sich mit einer Handvoll übler Kids eingelassen und war wegen Ladendiebstahls einen Monat im Jugendknast gelandet. Es stellte sich heraus, dass ihre Mutter unterdessen ihren Umzug hierher geplant und eingefädelt hatte. Und jetzt waren sie beide eingesperrt, nur eben anderswo.
»Das willst du echt nicht«, bestätigte Graham kameradschaftlich.
»Danke«, sagte sie leise. »Ich hatte keine Ahnung, wie ich da reinkommen sollte.«
»Wie bist du überhaupt in die Ambulanz gekommen?«
»Es war nicht abgeschlossen.« Sie zuckte die Achseln.
Sekunden später stand Graham auf und öffnete die Tür. »Tadah!« Er schlüpfte in den Raum und stöhnte leise beim Anblick des Computers auf dem Schreibtisch der Heilerin. »Er ist alt«, murmelte er, »aber so alt auch wieder nicht. Verdammte Scheiße noch mal! Nehmen uns die Handys weg, aber selber haben sie so ein Ding hier herumstehen. Alles miese Schweine!«
»Sei doch leise. Und hör auf zu fluchen. Auch dafür sperren sie dich in die Kiste.«
Er hob eine Schulter. »Wenn die uns hier erwischen, ist Fluchen unsere geringste Sorge.«
Damit hatte er allerdings recht. »Verschwinde jetzt. Geh zurück zu Mom. Ich erledige das mit dem Computer.«
»Schon klar«, ätzte er kopfschüttelnd. »Halt den Mund, und lass mich machen. Noch besser – geh zurück in deine Hütte, bevor Joshua oder eines seiner Weiber merkt, dass du weg bist.«
»Die sind alle beim Gebetskreis, der mindestens noch zwanzig Minuten dauert.«
Graham verzog das Gesicht. »Ich verstehe gar nicht, wieso die alle so tun, als würden sie für DJ beten. Es gibt doch niemanden hier, der nicht froh wäre, wenn er verblutet.«
»Graham«, tadelte sie, dabei hatte ihr Bruder durchaus recht. Brother DJ war der Einzige, der die Gemeinschaft verlassen durfte, um Vorräte zu beschaffen oder Waren zu verkaufen. Und um verschwundene Gründerväter zu suchen, wie es schien. Einer dieser Founding Elders, Brother Ephraim, wurde vermisst, und bislang wusste niemand, was mit ihm war, sondern nur, dass DJ es früher am Abend mit Mühe und Not zurückgeschafft hatte. Vor wenigen Tagen war er mit dem Pick-up der Gemeinschaft aufgebrochen, jedoch in einem größeren Lieferwagen zurückgekehrt und dann zusammengebrochen, da er mindestens zwei Schüsse abbekommen hatte.
Zumindest ging so das Gerücht. Der Gebetskreis wurde für DJs Genesung abgehalten, obwohl Graham durchaus recht hatte: Keiner konnte DJ leiden, auch Hayley nicht, obwohl er eigentlich attraktiv war, zumindest äußerlich. Er war mindestens einen Meter achtzig groß, mit hellblondem Haar und Grübchen, wenn er lächelte. Doch sein Lächeln wirkte immer … unheimlich. Der Kerl hatte etwas Schmieriges an sich, das Hayley Angst machte. Er mochte schöne tiefdunkle Augen haben, doch in seinem Blick lag eine distanzierte Abgeklärtheit, als schätze er jeden daraufhin ab, inwieweit der- oder diejenige ihm von Nutzen sein könnte.
Graham seufzte. »Passwortgeschützt. Ich hatte gehofft, die wären zu blöd dafür.«
Hayley hatte dieselbe Hoffnung gehabt. »Was jetzt?«
»Wir müssen eben raten. Oder …« Er hob die Kalenderschreibunterlage an und grinste. »Oder wir hoffen, dass die Heilerin vergesslich ist und deshalb die Passwörter aufschreiben muss.« Er zeigte auf die Haftnotiz auf der Unterseite der Schreibunterlage und schnaubte abfällig. »Das Passwort ist ›Eden87‹. Darauf hätte man kommen können.«
Die Gemeinschaft war 1987 gegründet worden, daher war das Passwort nachvollziehbar.
»Und ich bin schon … drin.« Sekunden später öffnete Graham ein Browser-Fenster. »Das wäre so viel einfacher gewesen, wenn die uns die blöden Handys nicht abgeknöpft hätten. Eine SMS kannst du ihm nicht schicken, sondern nur ganz altmodisch eine E-Mail.«
Er tippte auf ein paar weitere Tasten, dann hatte Hayley ihren Gmail-Account vor sich auf dem Bildschirm, mit Dutzenden ungeöffneten Mails, von denen mindestens neunzig Prozent von Cameron stammten.
Sie schnappte nach Luft. »Wie hast du … Graham Gibbs, du hast mich gehackt!«
Er lachte leise. »Deine Liebesmails habe ich nicht gelesen, keine Angst. Ich wollte nur sehen, ob ich einen Account knacken kann. Deiner war der erste. Es wäre schlauer, Cams Namen nicht als Teil des Passworts zu benutzen. Das macht es viel zu leicht. Also, was willst du dem künftigen Daddy denn gern sagen?«
»Außer HILF MIR in Großbuchstaben?«
Grinsend begann Graham zu tippen: ›Betreff: HILF MIR‹ in Großbuchstaben. »›Lieber Cam‹«, murmelte er. »›wir sind bei einer Sekte namens Eden.‹« Er rief Google Maps auf und blickte mit zusammengekniffenen Augen auf den Bildschirm. »Es gibt eine Möglichkeit, die Koordinaten zu ermitteln. Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein.« Er klickte mit der rechten Maustaste auf den leuchtend blauen Punkt mitten im Wald und übertrug die Ziffern in die E-Mail an Cam. »Das hier sind die Koordinaten«, schrieb er. »Bitte komm so schnell wie möglich und bring die Cops mit. Es ist der reinste Irrsinn hier, und wir werden gegen unseren Willen festgehalten.«
»Wir könnten auch der Polizei direkt eine Mail schreiben«, schlug Hayley leise vor. »Oder sogar dem FBI.«
»Machen wir auch. Aber wenn Cam persönlich zur Polizei geht, wirkt es glaubwürdiger, als wenn wir denen bloß eine Mail schicken. Die halten uns doch für durchgeknallte Spinner.« Er drückte auf »Senden« und öffnete eine neue E-Mail. »Die hier schicke ich direkt an die Polizei. Laut Karte ist die nächstgelegene Stadt –«
Eine Stimme draußen ließ sie erstarren.
»Ich muss alles in der Ambulanz zusammenpacken«, sagte die Heilerin.
»Dafür ist später noch Zeit«, erwiderte eine Männerstimme. »Geh zurück zum Gebetskreis.«
Mist! Panisch sah Hayley Graham an. »Joshua«, formte sie mit den Lippen. Wenn ihr sogenannter Ehemann sie hier fand … Er bringt mich um. Und Graham auch. »Wir müssen hier raus«, fügte sie lautlos hinzu.
Mit einem knappen Nicken schloss er die Browser-Fenster und löschte die Suchhistorie, ehe er den Computer herunterfuhr, sich leise erhob und zu ihr trat.
»Pastor will dich an seiner Seite haben, wenn er allen sagt, dass wir von hier fortgehen«, erklärte Joshua der Heilerin.
Fortgehen?
Hayleys Herz schlug schneller, als es dem Baby guttat. Gerade hatten sie Cameron geschrieben, wo er sie finden konnte, und nun sollten sie von hier fortgehen?
Sie machte einen Schritt auf den Computer zu, doch Graham packte sie am Arm und schüttelte den Kopf.
»Ich bin in ein paar Minuten da«, hörten sie Joshua sagen. »Vorher muss ich noch dieses neue Mädchen finden. Als wir zum Gebetskreis aufgebrochen sind, hat sie geschlafen, aber jetzt ist sie weg, sagt Rebecca.«
Das neue Mädchen. Damit bin ich gemeint. Sie wissen also, dass ich verschwunden bin. Ich muss dringend hier raus.
»Sie könnte versuchen, abzuhauen«, sagte die Heilerin zögernd. »Der Typ dafür wäre sie. Sie hat sich nicht besonders gut eingelebt.«
»Weiß ich.« Joshua klang grimmig. »Wenn sie das versucht, bringe ich sie um und reiße ihr bei Gott dieses Baby aus dem Leib, ich schwöre es. Ich habe Rebecca versprochen, dass sie es bekommt.«
Hayley presste sich die Hand auf den Mund, um ihren Aufschrei zu unterdrücken. Grahams Griff um ihre Hand wurde so fest, dass ihr die Tränen in die Augen traten. Er schien außer sich vor Wut zu sein.
Und voller Angst. Wegen mir. Beeil dich, Cam. Du musst hier sein, bevor wir weggehen. Oder bevor Graham eine Dummheit beging und mit dem Leben dafür bezahlte.
Die Stimmen wurden leiser. Graham öffnete die Tür des Arbeitsraums und bedeutete Hayley, ihm zu folgen, was sie mit einem letzten fieberhaften Blick auf den Computer tat. Es war sinnlos. Sie hatte keine Ahnung, wohin die Gemeinschaft ziehen würde, deshalb konnte sie es Cam nicht mitteilen. An der Eingangstür blieb Graham stehen, zeigte auf sich und nach links, dann auf Hayley und nach rechts.
Sie lebten nicht länger in derselben Hütte, deshalb wäre es logischer, wenn sie aus verschiedenen Richtungen auftauchten. Danke, kleiner Bruder, dachte sie. Dafür, dass du nicht so von der Rolle bist wie ich.
Sie sah in beide Richtungen und stellte erleichtert fest, dass sich alle bereits auf dem Hauptplatz eingefunden hatten und zu Pastor hinaufblickten, der auf einem Podest stand. Pastor war ein durchschnittlich aussehender Mann von etwa einem Meter zweiundsiebzig mit ergrauendem braunem Haar, einer runden Brille, die ihm etwas Professorenhaftes verlieh, und einem zumeist wohlwollenden Lächeln auf dem Gesicht – kein Mann, der wie eine Führungsfigur wirkte, dennoch hatte er etwas an sich, das die Gemeinschaftsmitglieder anzog wie das Licht die Motten. Sie vertrauten ihm vorbehaltlos.
Allerdings hielt er Hayley gegen ihren Willen in Eden fest, daher würde sie ihm niemals trauen. Sie schlüpfte vollends aus der Hütte und glitt in die hinterste Reihe der versammelten Gemeinschaft, als sich magere Finger um ihren Oberarm schlossen, wo gerade noch Grahams Hand gelegen hatte.
»Wo warst du?«, fragte Rebecca mit leiser, unheilvoller Stimme. Ihr Alter war schwer zu schätzen, womöglich war sie sogar jünger als Hayleys Mutter, doch die vielen Jahre in diesem Drecksloch hatten sie ausgezehrt und ihre Haut fahl und faltig werden lassen. Noch viel wichtiger waren jedoch ihre Kraft und ihre Größe. Sie überragte Hayley um ein gutes Stück, deshalb hätte sie nicht die geringste Chance, sollte Rebecca ihr ernsthaft wehtun wollen. »Als ich losgegangen bin, hast du nicht in deinem Bett gelegen.« Rebecca drückte noch fester zu und schüttelte Hayley so heftig, dass ihre Zähne klapperten. »Lüg mich nicht an, Mädchen.«
Sie sprach so leise, dass keiner der Umstehenden sie hören konnte, zumindest hatte es nicht den Anschein. Alle Augen waren auf Pastor gerichtet, der das Gebet sprach.
Hayley öffnete den Mund und schloss ihn wieder. »Ich war hier«, stammelte sie. »Auf dem Weg hierher.«
Rebeccas Augen wurden schmal. »Du lügst. Nicht mal darin bist du gut.«
»Sie war bei mir«, ertönte eine leise Stimme hinter ihnen.
Rebecca und Hayley fuhren herum und sahen Sister Tamar mit einem sanften Lächeln dastehen. »Ich bin sie wecken gegangen, Sister Rebecca, weil ich wusste, dass sie noch eine Weile schlafen wollte. Schwanger zu sein ist ziemlich anstrengend.« Tamars Lächeln wurde süßlich. »Aber das kannst du natürlich nicht wissen, hab ich recht?«
Rebeccas Kiefer wurde hart, und die Sehnen an ihrem Hals traten hervor, als sie gegen ihre Wut anzukämpfen schien. Mit einem finsteren Blick schob sie Hayley weg. »Haltet euch von mir fern. Alle beide.«
Hayley wandte sich Tamar mit weit aufgerissenen Augen und hämmerndem Herzen zu. Wieso?, lag ihr auf der Zunge. Wieso deckst du mich?
Tamar war noch jung, vielleicht zwanzig, und Weberin. Mehr wusste Hayley nicht über sie. Tamar gehörte nicht zu Joshuas Ehefrauen, und sie und Hayley hatten nie ein Wort miteinander gewechselt. Sie wusste noch nicht einmal, mit wem Tamar verheiratet war, nur, dass sie einen Ehemann hatte.
Das war ein Muss in Eden. Alle Mädchen wurden unmittelbar nach ihrem zwölften Geburtstag verheiratet.
Tamar schüttelte den Kopf so diskret, dass Hayley es entgangen wäre, hätte sie sie nicht direkt angesehen. Tamar ließ die Schultern fallen, faltete die Hände und senkte den Kopf, während Pastor um den Segen des gütigen Herrn für ihre bevorstehende Übersiedlung betete, darum, sie in diesen »trügerischen Zeiten« zu beschützen, in denen die Regierung sie ihrer »religiösen Freiheit« berauben wolle. Er betete, dass alle Mitglieder der Gemeinschaft sicher und unbeschadet den neuen Standort erreichten und Brother DJ sich von seinen »schweren Verletzungen« erholte, die ihm das FBI erst vor wenigen Stunden zugefügt hatte. Er bat Gott darum, sie vor den übel gesinnten Männern zu beschützen, die so viele in Waco getötet hatten.
Der fehlgeschlagene Versuch des FBI, die Siedlung der Branch Davidians im texanischen Waco zu stürmen, wurde häufig von jenen erwähnt, die in Eden das Sagen hatten. Es war eine bewusste Taktik, den Mitgliedern Angst zu machen, die ihre Wirkung nie verfehlte. »Amen«, murmelten mehrere der Männer prompt.
Nach Pastors abschließendem Amen blickten alle wie auf ein Stichwort auf. Hayley hatte sich immer noch nicht an die Synchronizität dieser Geste gewöhnt, die die Mitglieder wie eine perfekt abgestimmte Revuegruppe erscheinen ließ.
»Im Morgengrauen brechen wir auf«, verkündete Pastor. »Packt, was ihr gut transportieren könnt. Seid pünktlich. Dies ist keine Übung. Jeder, der bei Tagesanbruch nicht bereit ist, wird verstoßen.«
Ein kollektives Keuchen ging durch die Menge.
Verstoßen. Das war schlimm, so viel wusste Hayley. Sie sah zu Tamar hinüber, die flüsterte: »In den Wäldern zurückgelassen, wo die Wölfe sie zerfleischen.«
Hayley erschauderte. Was für ein Albtraum. Nein, schlimmer. Schlimmer noch, als die Hölle jemals sein könnte. Bitte, Gott, hilf mir, hier rauszukommen. Hilf mir, mein Baby zu retten.
»In unserem neuen Zuhause wird es nicht so angenehm werden wie hier«, fuhr Pastor fort. »Es wird eine gewisse Umstellung nötig sein, aber ihr werdet dort glücklich sein, das verspreche ich. Wir werden zusammen sein, und mit Gottes Hilfe und seinem Schutz werden wir es schaffen. Jetzt geht und trefft eure Vorkehrungen. Es bleibt nicht viel Zeit bis Tagesanbruch.«
Nicht so angenehm wie hier? Dabei war das hier schon die pure Hölle. Ihr Blick begegnete Grahams über die Menge hinweg. Mit einem Mal wirkte er größer, erwachsener. Und voll grimmiger Entschlossenheit.
Während sich die Menge auflöste, wandte Tamar sich ab und hastete zu ihrer Hütte, ohne Hayley Gelegenheit zu geben, ihr auch nur eine Frage zu stellen. Hayley machte sich auf den Weg zu der Hütte, die sie mit Joshua, seinen drei anderen Frauen und deren sieben Kindern teilte, wobei sie gegen ihre aufsteigende Panik ankämpfte.
Bald würden sie weggehen. Cameron würde die Polizei herführen, aber sie wären längst weg, und sie würde ihr Baby an einem noch viel grauenvolleren Ort zur Welt bringen müssen. Bevor Sister Rebecca es ihr wegnehmen würde.
Graham trat zu ihr und nahm sie am Arm, als wollte er ihr über den unebenen Untergrund helfen. »In deinem Zustand solltest du nicht hinfallen«, sagte er so laut, dass alle ihn hören konnten, ehe er im Flüsterton fortfuhr: »Es wird schon. Wir schaffen das.«
Hayley nickte beklommen. Ihr zwölfjähriger Bruder beteuerte, alles würde gut werden, aber das würde es nicht. Konnte es gar nicht.
Sie würden an einen sehr viel schlimmeren Ort übersiedeln. Sie konnte sich nicht einmal annähernd ausmalen, wie es dort sein würde.
Aber das werde ich schon bald herausfinden. Sie strich sich mit der freien Hand über den Bauch. Keine Angst, Jellybean. Dein Daddy wird uns finden. Er muss es einfach tun.
1. Kapitel
DJ Belmont überflog die Liste in seiner Hand. »Es wird eine Ewigkeit dauern, die ganze Scheiße zu besorgen.«
Sister Coleen zuckte entschuldigend die Achseln, ohne sich an seiner schmutzigen Ausdrucksweise zu stoßen. Sie waren allein in der Ambulanz, DJ, Coleen und Pastor, daher galten die Benimmregeln der Gemeinschaft nicht.
Regeln, mit denen er groß geworden war. Und die er abschaffen würde, sobald er in Eden das Ruder übernahm. Brother Ephraim vor einem Monat getötet zu haben, hatte ihn seinem Ziel einen erheblichen Schritt nähergebracht. Wäre er dabei nicht selbst angeschossen worden, hätte er all seine Probleme bereits in Angriff genommen, doch auch jetzt noch, nach einem ganzen Monat, schmerzte seine linke Schulter, und sein Arm war nahezu unbrauchbar.
Der erste Schuss hatte höllisch wehgetan, und allein dafür würde er das Miststück, das den Abzug gedrückt hatte, zur Strecke bringen. Daisy Dawson. Ihr Tod wäre in zweifacher Hinsicht zweckdienlich: als Rache für die Verwundung und um diesem Kerl, mit dem sie das Bett teilte, das Herz zu brechen.
Gideon Reynolds. Allein bei dem Namen schäumte DJ vor Wut, allerdings unterdrückte er sie, weil er keine Lust hatte, Coleen oder Pastor seine Gefühlslage darlegen zu müssen. Denn eigentlich sollte Gideon längst tot sein. Beseitigt durch seinen eigenen Vater, Waylon Belmont.
Das Problem war nur, dass Waylon Gideon laufen gelassen hatte. Mit seiner Hilfe war Gideon die Flucht aus Eden gelungen. Bei seiner Rückkehr hatte Waylon den Mitgliedern erzählt, Gideon habe sich durch den Mord an einem Founding Elder, Edward McPhearson, versündigt und sei bei dem Versuch, nach der Tat zu flüchten, umgekommen. Das war eine glatte Lüge gewesen, aber alle hatten ihm geglaubt.
Sogar ich. Die Wut flackerte neuerlich in ihm auf. Wieder verdrängte er sie. Das Ausmaß dieses Verrats war ihm erst letzten Monat bewusst geworden, als er erfahren hatte, dass Gideon noch am Leben war.
Doch Waylon hatte seine Strafe bekommen. Er war DJs erstes Opfer gewesen, und zuzusehen, wie das Licht in seinen Augen erlosch, hatte sich verdammt gut angefühlt. DJ war damals gerade erst siebzehn gewesen und hatte endlich verstanden, dass wahre Macht darin lag, über das Leben eines Menschen zu entscheiden. Oder dessen Tod.
Und bei DJ fiel die Entscheidung häufig auf den Tod.
»Es ist über ein Monat vergangen, seit du das letzte Mal unterwegs warst«, erklärte Coleen, ohne zu ahnen, welche Wut in DJ schlummerte. »Und bei deiner Rückkehr warst du schwer verletzt, deshalb konntest du nicht mehr los und Vorräte besorgen. Wir hatten zwar Notrationen, aber die sind mittlerweile aufgebraucht. Die Frauen haben die Rationen gestreckt so gut sie konnten, aber hundertfünfzehn Personen verbrauchen eine Menge Lebensmittel. Selbst die Grundnahrungsmittel sind uns ausgegangen.«
»Jaja, ich verstehe schon.« Sie kratzten die letzten Reste zusammen, und DJ konnte das Dörrfleisch, das ihnen noch als einzige Proteinquelle diente, schon nicht mehr sehen. »Ich besorge die Vorräte und suche nach einem neuen Standort für uns.«
Das war der Plan. Gerade hockten die Mitglieder frierend und hungrig in Erdhöhlen, die nie als langfristige Behausungen angelegt gewesen waren, doch DJs Verwundung hatte sie gezwungen, länger auszuharren, als ihnen guttat. Vor allem mir.
Seine Prioritäten bei dieser Fahrt lagen jedoch anderswo. Nach einem neuen Standort würde er nur suchen, wenn ihm Zeit bliebe.
Coleen betrachtete seinen linken Arm, der immer noch in der Schlinge hing. »Bist du sicher, dass du fahren kannst?« Sie war eine zierliche Brünette von Anfang fünfzig und in ihrer Funktion als Heilerin die einzige medizinische »Expertin«. Soweit er wusste, verfügte sie über keine richtige Ausbildung, allerdings hatte sie seine Verletzung so gut sie konnte versorgt.
Zumindest war er nicht tot, obwohl es verdammt knapp gewesen war.
»Mir geht’s gut«, brummte er und ließ zuerst die linke Schulter, dann den ganzen Arm kreisen, wobei er gegen den Schmerz ankämpfte. »Siehst du? Der komplette Bewegungsradius.«
Was nicht einmal ansatzweise stimmte. Zum Glück hatte er jahrelang geübt, um mit beiden Händen schießen zu können. Damit wäre er nicht komplett hilflos, wenn er das Lager verließe, trotzdem waren die Schmerzen auch jetzt noch höllisch, und die Nächte auf kaltem, feuchtem Steinboden machten es nicht gerade besser. Er konnte es kaum erwarten, in die Zivilisation zurückzukehren, um zur Abwechslung in einem anständigen Bett zu schlafen.
»Nicht ganz«, murmelte Coleen. »Aber ich habe schon vor Jahren aufgegeben, dir zu sagen, was du tun sollst.«
Weil sie nicht dumm war und am Leben hing. DJ konnte Dummköpfe nicht ertragen, und schon gar nicht ließ er sich von ihnen Anweisungen erteilen.
Niemand tat das, mit Ausnahme des älteren Mannes im Sessel. Pastor war Edens Hirte, der Anführer und derjenige, der sagte, was getan wurde. Zwar missachtete DJ seine Anweisungen oft, doch davon ahnte Pastor nichts.
Wie Waylon vor ihm war DJ der Einzige, der das Gelände verlassen durfte – zumindest der Einzige, von dem die Mitglieder wussten. Früher waren die Founding Elders vier Mal im Jahr losgezogen, angeblich, um »in den Bergen zu beten«, doch in Wahrheit waren sie in die nächstbeste Stadt gefahren, um zu saufen, zu zocken und herumzuhuren wie eine Horde Matrosen auf Landgang.
Inzwischen war nur noch Pastor als echtes Gründungsmitglied übrig, und DJ hatte den Platz seines Vaters nach dessen verfrühtem Ableben eingenommen, von dem bis zum heutigen Tag keiner ahnte, dass es auf DJs Konto ging.
Weil ich verdammt gut bin. Was er anfing, brachte er auch zu Ende.
Zumindest war das seine Überzeugung gewesen, bis er vor einem Monat erfahren hatte, dass die Frau, von der er geglaubt hatte, sie vor dreizehn Jahren getötet zu haben, am Leben war. Dabei hätte er schwören können, dass sie tot gewesen war, als er sie in einer Blutlache an einem Busbahnhof zurückgelassen hatte.
Mercy Callahan. Gideons Schwester. Nur hatte ihr Name damals Mercy Burton gelautet, und sie war Ephraims Ehefrau gewesen. DJ hatte sie und ihre Mutter in dem Glauben gelassen, er verhelfe ihnen zur Flucht. Er hatte gewollt, dass sie sich Hoffnungen machten.
Er hätte beide Frauen gleich in den Wäldern vor Eden abknallen sollen, doch er war jung und dumm gewesen und hatte sich an die Idee seines Racheakts im Stil eines Cartoon-Bösewichts geklammert. Mercys Mutter war eindeutig tot gewesen, und er hatte ihre Leiche zurück nach Eden gebracht, bei Mercy war er allerdings mittendrin unterbrochen worden. Jemand war aufgetaucht, weshalb er hatte abhauen und sie zurücklassen müssen. Zwar konnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie sie mit zwei Kugeln im Bauch hatte überleben können, aber offenbar war es so.
Weshalb er jetzt ein Riesenchaos an der Backe hatte, das er beseitigen musste. Er hatte Pastor damals erzählt, er hätte Mercy eigenhändig verscharrt. Sollte Pastor jemals erfahren, dass sie am Leben war, würde DJ alles verlieren.
Deshalb galt es nun, die Sache endgültig zu Ende zu bringen. Vor einem Monat wäre es ihm beinahe gelungen, doch ein zweiter Schuss hatte die Nerven in seinem linken Arm in Mitleidenschaft gezogen und ihm eine heftige Blutung beschert. Er wusste nicht, wem er die zweite Wunde zu verdanken hatte, doch wenn er es herausfand, war der Drecksack tot. Er hatte es nur mit Mühe und Not geschafft, lebend zurück ins Lager zu gelangen, und gerade noch Pastor erklären können, dass sie dringend ihre Zelte abbrechen mussten, ehe er das Bewusstsein verloren hatte.
Zum Glück hatte Pastor ihm blindlings vertraut. Der alte Narr.
DJ ließ ihn nur so lange am Leben, weil der Alte ein gewiefter Mistkerl war – er hatte die Kontonummern und Passwörter der Online-Konten, auf denen Edens fünfzig Millionen Mäuse lagen, im Kopf.
Und genau die brauchte DJ, bevor der Alte ins Gras biss, auch wenn er sich nach wie vor erstaunlich gut hielt. Er war zweiundsiebzig, hatte aber offenbar das Herz eines Ochsen.
Coleen sah Pastor an, der streng genommen ihr Ehemann war. In den dreißig Jahren, seit sie in Eden war, hatte sie drei Ehemänner überlebt. Zwei waren eines natürlichen Todes gestorben, einer war ermordet worden.
Aber nicht von mir. Obwohl es DJ öfter in den Fingern gejuckt hatte, Ephraims Bruder Edward das Licht auszublasen, als er zählen konnte. Aber Edwards Tod ging auf Gideon Reynolds’ Konto. Er hatte behauptet, es sei ein Unfall gewesen, was DJ ihm glaubte. Mit seinen dreizehn Jahren war Gideon ein Musterknabe gewesen. Und so kräftig, dass er Edward McPhearson ohne Weiteres hätte niederstrecken können.
Bei ihrer nächsten Begegnung würde er Gideon umbringen, langsam und qualvoll. Er würde dafür sorgen, dass er grauenvolle Schmerzen litt – teils, weil er DJ die Genugtuung genommen hatte, McPhearson selbst das Licht auszublasen, aber hauptsächlich, weil er abgehauen war. Und ein richtiges Leben führen konnte, wohingegen DJ in diesem Drecksloch festsaß und vor einem Narzissten katzbuckeln musste, der sich für den lieben Gott hielt.
Und davon abgesehen, musste Gideon aus dem einfachen Grund sterben, weil er ein beschissener FBI-Agent geworden war, der offenbar seit dem Tag seiner Flucht nach Eden suchte.
Pastor räusperte sich leise. »Du wirkst aufgebracht, DJ. Ist deine Heilung noch nicht weit genug fortgeschritten, um in die Stadt zu fahren?«
»Mir geht’s gut«, blaffte DJ und atmete beim Anblick von Pastors säuerlicher Miene durch. Ihn wütend zu machen, war nie ratsam. »Tut mir leid. Es tut noch weh, aber wir brauchen dringend Vorräte.«
Und ich muss ein paar Dinge zu Ende bringen.
Er musste Gideon aufstöbern und ihn kaltmachen, und er musste Mercy finden und sie auf die Art leiden lassen, wie sie vor dreizehn Jahren hätte leiden sollen.
Dann musste er Amos Terrill finden, Edens einstigen Tischler und Gideons und Mercys Stiefvater. Dieser Dreckskerl war vor einem Monat gemeinsam mit seiner kleinen Tochter auf der Ladefläche von DJs Pick-up geflohen. Und hatte ihm die Kiste dann auch noch gestohlen. Elender Drecksack.
Hoffentlich würde er Amos auf einem Friedhof finden, weil eine von DJs Kugeln ihn am Hals getroffen hatte. Fest stand, dass er sterben musste, weil er Gideon und Mercy aufgestöbert und ihnen wahrscheinlich alles erzählt hatte, was sich in den letzten Jahren in Eden ereignet hatte. Allein dafür würde er bezahlen, sollte er noch am Leben sein.
Und dann komme ich zurück und zwinge Pastor, mir endlich diese verdammten Kontonummern und Passwörter zu verraten. Er steckte schon viel zu lange in diesem toxischen Muster fest und war sich erst darüber klar geworden, als er angeschossen worden war.
Es ging doch nichts über ein Nahtoderlebnis, um seine Prioritäten neu zu ordnen.
»Schon gut«, erwiderte Pastor mit einer tonlosen Ruhe, die keinen Zweifel daran ließ, dass er DJs Ausbruch keineswegs für vertretbar hielt. Dieser verdammte Saftsack. »Finde die kleine Abigail. Vielleicht ist sie inzwischen bei einer Pflegefamilie untergebracht.«
Dies vermutete Pastor nur, weil DJ ihm erzählt hatte, er habe Amos getötet und verscharrt, nachdem er ihn auf der Ladefläche seines Pick-ups versteckt gefunden hatte. Abigail hatte er dabei mit keiner Silbe erwähnt, wobei er nicht sagen konnte, weshalb. Vielleicht weil sie noch ein Kind war und für sein Dafürhalten keine Gefahr darstellte. Pastor war davon ausgegangen, dass sie entkommen war.
»Ich werde es versuchen«, erwiderte er.
Pastor schürzte die Lippen, ein weiteres Zeichen seiner Missbilligung. »Sie wird irgendjemandem von uns erzählen. Glücklicherweise ist sie noch so klein, dass ihr keiner glaubt, und glücklicherweise ist sie die Einzige, die fliehen konnte.«
Für einen Berufsverbrecher war Pastor erstaunlich naiv. Er glaubte allen Ernstes, alle, die über die Jahre aus Eden abgehauen waren, seien rechtzeitig aufgestöbert worden. Fairerweise musste DJ einräumen, dass er getrickst hatte, so wie sein Vater zuvor: Konnte ein Entflohener nicht gefunden werden, suchte er sich einen Ersatz – üblicherweise einen Obdachlosen oder eine Ausreißerin – mit ähnlicher Statur sowie Haar- und Hautfarbe, tötete sie oder ihn und verstümmelte die Leiche so sehr, dass eine Identifikation ausgeschlossen war.
Pastor war fest davon überzeugt, dass in den dreißig Jahren niemandem die Flucht aus Eden gelungen war.
Pastor war ein Idiot.
»Glücklicherweise«, bestätigte DJ. »Ich besorge die Vorräte, suche nach einem neuen Standort und versuche, Abigail Terrill zu finden. Möchtest du dem noch etwas hinzufügen?«
Pastor schüttelte den Kopf. »Nein, aber ich möchte, dass du die Satellitenschüssel reparierst, bevor du aufbrichst. Seit wir uns hier in die Höhlen zurückgezogen haben, konnte ich nicht mehr ins Internet gehen.«
Dieser Umzug war notwendig gewesen, weil Amos Terrill und das FBI neuerdings dicke Freunde waren. Wenn Ephraim nicht schon alles ausgeplaudert hatte, dann hatte Amos es ganz bestimmt getan. Daher hatten sie die Gemeinschaft in ihr ultimatives Versteck bringen müssen, eine Höhlensystem direkt hinter dem Lassen National Forest, einem Nationalpark.
Die Höhlen hatten seit Jahren zuerst DJs Vater und dann ihm selbst als Lagerstätte für ihre Drogenernte gedient, da die Felsen sie vor neugierigen Blicken der Regierung schützten. Weder die konventionellen Satelliten- noch die Infrarotkameras aus der Luft vermochten das Lager zu erfassen.
»Ich werde es versuchen«, beteuerte DJ, doch das war eine glatte Lüge. Während seiner Genesung hatte er Pastor bewusst vom Internet ferngehalten, indem er behauptet hatte, er sei noch zu schwach, um sich um die Reparatur und die Wiederherstellung zu kümmern. Doch in Wahrheit durfte Pastor nicht erfahren, dass Mercy und Gideon noch am Leben waren, und nach der Schießerei vor einem Monat war es durchaus möglich, dass ihre Namen immer noch in den Medien auftauchten. »Aber beim letzten Umzug wurde die Schüssel beschädigt.« DJ warf Coleen einen vorwurfsvollen Blick zu. »Sie hat sie nicht richtig eingepackt.«
Coleens Kiefer war angespannt, als sie den Kopf senkte. »Wenn man bedenkt, wie schwer das Ding war, habe ich mich ganz gut geschlagen, schließlich musste ich es ganz allein auf den Lieferwagen heben. Um Hilfe konnte ich ja niemanden bitten, weil du verletzt warst und Ephraim tot war und sonst keiner wissen darf, dass wir eine Schüssel haben.«
In Wahrheit hatte sie ihre Sache sogar gut gemacht, und mit der Schüssel war alles in Ordnung, aber das konnte er ihnen nicht auf die Nase binden.
»Wir müssen einen weiteren Ältesten berufen«, meinte Pastor nachdenklich. »Einen, der jung und kräftig genug ist, um uns bei solchen Dingen zu helfen, aber auch eine gewisse Reife mitbringt.«
»Und einen, der vor Wut nicht den Kopf verliert, wenn er erfährt, dass wir sie all die Jahre belogen haben«, warf Coleen ein.
Pastor lachte leise, weil niemand außer Coleen so freimütig und offen mit ihm sprechen durfte, ein Recht, das sie sich in den dreißig Jahren als sein Schoßhündchen erworben hatte. Trotzdem bewegte selbst sie sich gelegentlich wie auf rohen Eiern in seiner Gegenwart, weil man nie wissen konnte, in welcher Stimmung er gerade war.
»Das stimmt.« Pastor betrachtete seine manikürten Nägel, ein sicheres Zeichen, dass DJ nicht gefallen würde, was er gleich zu hören bekäme. »Ich überlege, ob wir Brother Joshua nehmen sollen. Er hat sich als extrem große Hilfe bei der Koordination des Umzugs erwiesen, und da wir ja nur den Lieferwagen zur Verfügung hatten, den du zurückgebracht hast, DJ, war es der anstrengendste Umzug von allen. Wir mussten die Gemeinde wie Vieh hineinpferchen, trotzdem waren bei über hundert Personen und der schweren Ausrüstung mindestens zehn Fahrten notwendig, die von ihm durchgeführt wurden.«
»Und ich musste dafür sorgen, dass keine Panik ausbrach, weil keiner in diesen Höhlen leben wollte«, warf Coleen ein. »Es herrschte ein ungewohnter Aufruhr unter den Leuten, und wir haben vier ganze Tage gebraucht, bis wieder Ruhe einkehrte. Was du natürlich nicht mitbekommen hast, weil du ja bewusstlos warst.«
»Brother Joshua hat sich unter dem Druck bewundernswert geschlagen«, endete Pastor. »Er würde einen hervorragenden Elder abgeben.«
Auf einen Unbeteiligten mochte es wirken, als bitte Pastor um eine Meinungsäußerung, doch DJ wusste es besser. Er tauschte einen Blick mit Coleen, gerade lange genug, um zu sehen, wie sie für den Bruchteil einer Sekunde das Gesicht verzog. Sie mochte Joshua nicht, vor allem aber seine erste Frau nicht, die, wenn die Wahl auf ihn als Ältesten fiele, automatisch ebenfalls in der Rangordnung aufsteigen würde. Doch als Pastor von seinen Händen aufblickte, war ihre Miene wieder neutral. Genau dies hatte er mit der Geste beabsichtigt – dem Empfänger seiner Anweisungen die Zeit zu geben, den Anschein von Zustimmung zu erwecken.
»Ich werde ihn in alles einweihen, sobald ich zurück bin«, sagte DJ. Nur dass es niemals dazu kommen würde. Sobald er die Kontrolle über das Eden-Vermögen erlangt hatte, konnten Joshua, Coleen und all die anderen Mitglieder ihn kreuzweise.
Pastor musterte ihn mit zusammengekniffenen Augen. »Finde Amos’ Tochter und bring sie zu mir. Ich werde nicht zulassen, dass ihretwegen Besorgnis oder gar Unmut innerhalb der Gemeinschaft aufkommt. Sie zu finden, muss für dich oberste Priorität haben.«
DJ biss die Zähne zusammen. Was ihm andernfalls blühte, blieb wie üblich unausgesprochen. »Ja, Pastor. Sollte sie in einer Pflegefamilie oder einem Kinderheim sein, könnte es eine Weile dauern, sie zu finden, und sie da rauszubekommen, wird heikel werden.«
Aber natürlich wusste DJ, dass das Mädchen nicht in einer Pflegefamilie war. Amos war mit Mercy und Gideon wiedervereint, und die beiden würden niemals zulassen, dass mit Abigail so etwas passierte. Hätte er Mercy erst einmal gefunden, wäre auch Abigail nicht weit, doch offiziell verschaffte ihm die Suche nach ihr etwas mehr Zeit, um alles zu Ende zu bringen.
Pastor seufzte verärgert. »Das ist wohl wahr. Wie lange wirst du brauchen?«
DJ tat, als dächte er nach. »Eine Woche? Vielleicht länger.«
Pastor sah Coleen stirnrunzelnd an. »Haben wir noch ausreichend Vorräte für eine Woche?«
Coleen wand sich unbehaglich. »Es wird knapp. Wir haben noch die Hühner, die uns bisher die Eier geliefert haben. Im Notfall können wir sie schlachten. Uns geht auch das Futter aus, deshalb könnten wir sie ohnehin bald nicht mehr ernähren. Aber wir brauchen frisches Gemüse und Milch. Die Kinder haben seit Wochen keine Milch mehr bekommen.«
Pastor nickte grimmig. »Also gut, eine Woche, DJ. Dann bist du zurück. Mit Vorräten und Abigail. Oder zumindest der Nachricht, ob sie tot ist oder noch lebt.«
»Und einem neuen Standort«, fügte Coleen leise hinzu.
Wieder nickte Pastor. »Genau. Das auch. Auf Wiedersehen, Brother DJ. Möge Gott mit dir sein.«
DJ hatte Mühe, nicht die Augen zu verdrehen. Pastor glaubte nicht an Gott. Sondern bloß an sich selbst. Doch der Segen war seine pastorale Fassade und das Signal, dass die Unterredung beendet war.
Wortlos neigte DJ den Kopf. Erst als er in seinem Quartier war, flüsterte er: »Auf Wiedersehen, Pastor.« Denn dies war der Anfang vom Ende des Alten. Sobald Mercy und Gideon beseitigt waren, würde DJ zurückkehren und die Herrschaft über Eden an sich reißen.
Er wollte nur das Geld. Über den Rest konnten sich gern die anderen streiten.
Zum ersten Mal seit einem Monat würde er die Gemeinschaft wieder verlassen. Mit ein bisschen Glück fühlte Mercy Callahan sich mittlerweile so sicher, dass ihre Wachsamkeit allmählich nachließ.
»Also?«
Special Agent Tom Hunter blickte auf und sah Special Agent in Charge Molina im Türrahmen stehen. Was keine Überraschung war, denn er hatte den Besuch der Leiterin des FBI-Büros in Sacramento durchaus erwartet. Heute war ihr erster Arbeitstag nach der Schießerei, bei der mehrere Beamte getötet worden waren und sie selbst eine Verletzung davongetragen hatte. Sie war blasser als sonst und wirkte müde. Aber entschlossen.
Automatisch erhob er sich – seine Mutter hatte ihn zu einem höflichen Mann erzogen –, wodurch er sie um rund dreißig Zentimeter überragte, was sie mit einem verärgerten Blick zur Kenntnis nahm. Hier im Büro waren fast alle kleiner als er, was eine neue Erfahrung war. Während der drei Jahre als NBA-Profi war er mit seiner Körpergröße von einem Meter achtundneunzig Durchschnitt gewesen, einige hatten es locker auf über zwei Meter gebracht. Er zog die Schultern ein wenig ein, um den Unterschied auszugleichen, doch Molinas Blick blieb hart.
Sie hob das Kinn und sah ihn aus ihren dunklen Augen durchdringend an. »Was wissen Sie?«, fragte sie.
Tom lächelte sie freundlich an. »Guten Morgen.« Die Frau war nicht das kaltschnäuzige Miststück, das sie zu sein vorgab. In den letzten Monaten hatte er sie zweimal in Krisensituationen erlebt und festgestellt, dass sie auch ein großes Herz hatte, ungeachtet ihres messerscharfen Verstands und ihrer noch schärferen Zunge. Vielleicht hatte sie sogar ein zu weiches Herz und versteckte sich deshalb hinter einer barschen Fassade.
Er kannte diesen Typ, denn er war inmitten von bemerkenswert klugen und scharfsinnigen Frauen aufgewachsen. Die Freundinnen seiner Mutter waren Polizistinnen, Sozialarbeiterinnen und Anwältinnen, die exakt dieselbe Miene aufsetzten, sobald der Druck stieg und mit ihm die Gefahr, dass jemandem, den sie liebten, etwas passieren könnte.
Einladend deutete er auf den Stuhl neben seinem Schreibtisch.
Wieder bedachte sie ihn mit einem finsteren Blick, nahm jedoch Platz und zupfte ihre ohnehin perfekt sitzende Kostümjacke zurück. Kein Stoff an Tara Molinas Körper besäße je die Frechheit, Falten zu werfen.
»Ich weiß eine Menge über eine Menge Dinge«, sagte er und setzte sich ebenfalls wieder. »Aber ich nehme an, Sie sprechen von Eden.«
Eden. Die Sekte, nach der sie seit Mitte April fieberhaft suchten. Und die Sekte, in der während der letzten dreißig Jahre eine ganze Reihe von Schwerverbrechern Unterschlupf gefunden hatten. Gemeine Mörder, die zwei der Menschen übel misshandelt hatten, die Tom in kurzer Zeit ans Herz gewachsen waren. Gideon Reynolds und seine Schwester, Mercy Callahan, waren bei ihrer Flucht aus Eden noch Kinder gewesen, doch die Erlebnisse hatten lebenslange sowohl emotionale als auch physische Narben hinterlassen.
Denn die Mörder hatten sich nicht bloß in Eden versteckt, sondern eine Sekte ins Leben gerufen, in der die Vergewaltigung zwölfjähriger Mädchen durch Männer mittleren Alters unter dem Deckmantel der »Ehe« nicht nur geduldet, sondern sogar bewusst vorangetrieben wurde. Währenddessen wurden Dreizehnjährige als »Lehrjungen« Meistern zugeteilt und ebenfalls systematisch vergewaltigt.
Gideon und Mercy waren nur zwei ihrer vielen Opfer.
»Ja, ich spreche von Eden.« Agent Molina verdrehte die Augen. »Und alle hier bezeichnen Sie als Wunderknaben«, fügte sie hinzu, wenn auch mit einem lässigen, fast neckenden Tonfall.
»Dazu kann ich nichts sagen«, erwiderte Tom, dessen Wangen heiß wurden. Er war gut in dem, was er tat – Computer zu hacken, war sein Spezialgebiet, worin er sogar ganz besonders gut war.
Dass es ihm auch nach mehreren Monaten nicht gelungen war, den Standort der Sekte zu finden, ärgerte ihn, aber immerhin hatten sie Fortschritte gemacht.
»Ich habe mich in das Offshore-Konto gehackt«, erklärte Tom. Was unter den gegebenen Umständen Anlass für Glückwünsche oder sogar eine Beförderung geboten hätte. Oder die Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe, würde er nicht für die Guten arbeiten. Jedenfalls war es ein verdammt schwieriges Stück Arbeit gewesen.
»Das war vor drei Wochen«, bemerkte Molina nur, was jede Hoffnung auf ein Lob im Keim erstickte. »Mein vorübergehender Stellvertreter hat mich jede Woche auf dem Laufenden gehalten. Aber was haben Sie in jüngster Zeit über Eden herausgefunden?«
Tom konnte nur spekulieren, was Molinas Stellvertreter ihr erzählt hatte. Er und Agent Raeburn waren nicht gerade dicke Freunde gewesen. »Was das Konto angeht, nicht viel«, räumte er ein. »Es wurde weder Geld abgehoben noch eingezahlt, seit sie drei Tage vor Ephraims Tod sein Vermögen von seinem Privatkonto auf das Hauptkonto von Eden transferiert haben.«
Molina verzog das Gesicht. »Ich muss zugeben, dass ich allein den Klang seines Namens hasse. Aller seiner Namen«, fügte sie verbittert hinzu.
Ephraim Burton, einer der Gründerväter von Eden, war als Harry Franklin geboren und als Bankräuber und Mörder gesucht worden, ehe er vor dreißig Jahren untergetaucht war. Er hatte sich mehrere Decknamen zugelegt, die es ihm gestatteten, sich in der realen Welt zu bewegen, wann immer er die Sekte verließ.
Doch damit war nun Schluss. Tom wünschte, er wäre derjenige, der sich ans Revers heften konnte, Burton ausgeschaltet zu haben, doch ein anderer Sektenältester hatte ihn getötet, vermutlich, um zu verhindern, dass er dem FBI Edens Standort verriet. Viele Menschen waren im Zusammenhang mit Eden umgekommen. Aber es stand auch eine Menge auf dem Spiel. Das Vermögen der Sekte belief sich auf über fünfzig Millionen Dollar.
Höchstwahrscheinlich hatte der Kerl Ephraim jedoch getötet, damit dieser nicht das größte Geheimnis ausplaudern konnte: dass zwei der Ausreißer beim Versuch zu entkommen nicht gestorben waren, sondern seit etlichen Jahren in Freiheit lebten.
Gideon und seine Schwester Mercy waren in ihrer Jugend in Eden aufs Schlimmste misshandelt worden, setzten sich nun jedoch zur Wehr, indem sie das FBI bei der Suche nach der Sekte unterstützten, um ihr ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Toms Respekt für die Geschwister war enorm.
»Ich habe einen Alert für die Konten eingerichtet, dann bekommen wir über jede Bewegung Bescheid«, sagte Tom.
»Aber noch ist nichts passiert.«
»Das stimmt. Allerdings hat ein Mann, der wie DJ Belmont aussah, eine Stunde nach Ephraim Burtons Erschießung von einem anderen Konto in der Nähe des Mount Shasta Bargeld abgehoben.«
»Belmont?« Wut flackerte in Molinas Augen auf.
Belmont war die Nummer zwei nach dem Sektenführer, einem charismatischen Mann, der seiner Gefolgschaft lediglich als »Pastor« bekannt war. Doch zum Glück hatte das FBI ein wenig mehr über ihn in Erfahrung gebracht. Vor der Gründung von Eden hatte Pastor sich Herbert Hampton genannt, davor hatte er als Benton Travis wegen Betrugs und Geldwäsche im Gefängnis gesessen.
Die Identitäten der Sektenführer waren dem FBI also bekannt, nur wusste niemand, wo sich die Sekte niedergelassen hatte. Die Gemeinschaft war ziemlich klein und bewegte sich hauptsächlich in den abgelegenen Gebieten Nordkaliforniens. Bislang war es ihnen gelungen, sich verborgen zu halten.
Belmont, sofern er noch am Leben sein sollte, war nicht nur Pastors Nummer zwei, sondern ein gefährlicher, abgebrühter, erschreckend versierter Mörder, der fünf Bundesbeamte getötet hatte, die meisten davon Mitglieder eines SWAT-Teams. Und er hatte auch Molina so schwer verletzt, dass sie einen Monat lang dienstunfähig gewesen war, was ihre Reaktion auf seinen Namen erklärte.
Tom rief eine Akte im Computer auf und drehte den Bildschirm so, dass Molina die Aufnahmen der Überwachungskameras erkennen konnte. »Die Auflösung der Kamera des Drive-in-Bankschalters ist ziemlich gut, aber er hatte sich ein Tuch über die Nase gezogen, trug eine Sonnenbrille und eine Kappe mit breitem Schirm. Statur und Körpergröße passen allerdings auf Belmont.«
»Aber von welchem Konto hat er dann das Geld abgehoben, wenn es nicht Edens Offshore-Konto war?«
Tom warf ihr einen Blick zu. »Ich dachte, Agent Raeburn hätte Ihnen wöchentlich Bericht erstattet?«
Molinas Augen wurden schmal. »Hat er auch, aber ich will Ihre Version hören.«
Tom gelang es, nicht zusammenzuzucken. »Meine Version?«
»Genau«, erwiderte Molina kühl. »Agent Raeburns Ausführungen waren alles andere als zufriedenstellend.«
Tja, blöd gelaufen. »Das dachte ich mir fast«, murmelte er. »Er ist … nun ja, nicht sehr flexibel.«
Sie zog die Brauen hoch. »Er ist ein verdammt guter Agent.«
Vorsicht! »Ich habe nie etwas anderes behauptet.«
»Aber gedacht.«
Tom schürzte die Lippen. Wie so oft war es schwer einzuschätzen, ob Molina belustigt oder verärgert war. Aber natürlich hatte sie recht. Raeburn war ein Aktenhengst, wie er im Buche stand, und erlaubte keinerlei zwischenmenschlichen Spielraum, aber das würde er ihr nicht auf die Nase binden. Gleichzeitig war ihm klar, dass Molina von seiner eigenen Neigung wusste, es mit den Vorschriften nicht ganz so genau zu nehmen.
Tatsächlich hatte er das seit dem ersten Arbeitstag getan, der gerade einmal fünf Monate zurücklag, sich aber anfühlte wie ein Jahr. Etwas an Gideon Reynolds und Mercy Callahan hatte das Bedürfnis ausgelöst, ihnen zu helfen und ihre Ängste zu lindern, obwohl es ihm eigentlich nicht zustand. Doch die beiden hatten zu viel Schlimmes durchgemacht.
Mit Misshandlung kannte Tom sich aus, denn er trug bis heute die Narben der Grausamkeiten seines leiblichen Vaters am Körper und wusste auch, wie es sich anfühlte, seelische Qualen zu leiden. Vor allem in letzter Zeit. Er wusste, dass die Grenzen von Vorschriften strapaziert oder gar gänzlich missachtet werden mussten, um das Richtige zu tun.
Doch ihm war auch klar, dass er Molinas Autorität nicht untergraben durfte, wenn er Gideon und Mercy weiterhin helfen wollte. Oder wenigstens den Anschein erwecken sollte, ihre Linie zu respektieren. Was bedeutete, dass er sich mit Kommentaren über ihren Stellvertreter, der streng genommen immer noch sein direkter Vorgesetzter war, zurückhalten musste.
Er verzog das Gesicht zu einem Lächeln, von dem er wusste, dass es sein Gegenüber überzeugte – allein schon, weil er es zahllose Male geprobt hatte … ein Nebeneffekt von tiefem Kummer. Die Leute löcherten einen nicht mit Fragen, wenn man immer schön lächelte und glücklich wirkte.
»Bei dem Konto handelt es sich um ein privates Girokonto auf den Namen John Smith«, erklärte er. »Wenn wir davon ausgehen, dass er der Mann auf dem Foto ist, hat er das Geld etwa neunzig Minuten nach seiner Flucht vom Tatort in Dunsmuir abgehoben.«
DJ Belmonts wilde Schießerei im Wald zweihundert Kilometer nördlich hatte fünf Menschen das Leben gekostet – vier Mitglieder des FBI-eigenen SWAT-Teams und Special Agent Schumacher. Molina hatte noch Glück gehabt, denn die von Belmont verursachten Verletzungen hatten ihr »nur« eine Woche Krankenhaus eingebracht, gefolgt von drei weiteren Wochen physiotherapeutischer Behandlung.
Leider hatte Belmont an dem Tag auch Ephraim Burton getötet, dabei hatten sie alle gehofft, Burton würde sie nach Eden führen, zu jenen religiösen Fanatikern unter Pastors autoritärer Führung.
Seine erwachsenen Anhänger mochten fehlgeleitet sein, hatten jedoch ihre eigene Wahl getroffen, im Gegensatz zu den Kindern, von denen viele bis zum heutigen Tag missbraucht und misshandelt wurden.
Die FBI-Beamten und Burton waren nicht Belmonts einzige Opfer an diesem Tag gewesen. Tom deutete auf das Foto vom Geldautomaten. »Belmont fuhr einen alten Lieferwagen, der später von der Familie eines vermissten Landarbeiters, eines Obstpflückers, als gestohlen gemeldet wurde. Dem Mann war mit Agent Schumachers Dienstwaffe zweimal in den Kopf geschossen worden.«
»Also hat er nicht aus größerer Entfernung auf Schumacher geschossen, so wie auf uns.« Er hatte von einem Baum aus gefeuert, so weit entfernt, dass das SWAT-Team ihn erst bemerkt hatte, als er das Feuer bereits auf sie eröffnet hatte. Und weit entfernt genug, um ihnen einen Eindruck seiner bemerkenswerten, wenn auch beängstigenden Fähigkeiten als Scharfschütze zu vermitteln. »Er hat sie erschossen und danach ihre Dienstwaffe an sich genommen.« Molina schluckte schwer. »Sie war eine gute Beamtin. Und ein guter Mensch.«
»Ich weiß. Danach hat er den Landarbeiter getötet, dessen Lieferwagen gestohlen und ist spurlos verschwunden.«
»Vielleicht ist er ja tot«, sagte Molina hoffnungsvoll.
»Vielleicht.«
Sie sah ihn an. »Aber Sie glauben es nicht.«
»Keine Ahnung«, erwiderte Tom wahrheitsgetreu. »Wir können jedoch nicht davon ausgehen. Er wollte Mercy und Gideon an dem Tag töten. Wenn er am Leben ist, steht zu viel auf dem Spiel, als dass er es nicht noch einmal versuchen würde.«
»Sie haben recht, davon können wir nicht ausgehen. Hatte der Lieferwagen des Landarbeiters GPS?«
»Nein, der Wagen war fünfundzwanzig Jahre alt.« Beim Gedanken an die verzweifelte Familie des Mannes zog sich Toms Brust zusammen. Er hatte Agent Raeburn begleitet, um die Frau und fünf Kinder des armen Opfers zu informieren. Es war das erste Mal, dass er Hinterbliebenen eine Todesnachricht überbringen musste, und Agent Raeburn war nicht gerade feinfühlig vorgegangen. Vermutlich war es seine Art und womöglich gesünder als die Albträume, die Tom auch jetzt noch regelmäßig verfolgten. »Die Familie ist sehr arm, und der Lieferwagen war alles, was sie hatten.«
Molina schwieg eine Sekunde länger als nötig. »Agent Raeburn meinte, die Familie hätte ein paar Tage danach einen Geldbetrag von einem anonymen Spender bekommen, ausgehändigt vom Priester der Gemeinde.«
Tom ließ sich nichts anmerken. Dass das Geld von seinem Konto stammte, würde er nicht zugeben. »Davon habe ich nichts gehört«, sagte er. Und da er streng genommen tatsächlich nichts davon gehört hatte, war es auch keine Lüge.
»Raeburn meinte, die Summe sei so hoch gewesen, dass die Familie mehrere Monate davon leben und dazu noch bequem die Beerdigung bezahlen könne.«
Er spürte ein Prickeln auf der Haut, als könnte Molina geradewegs in ihn hineinsehen, doch er zuckte mit keiner Wimper. Natürlich konnte er nicht jedes Mordopfer entschädigen, aber zumindest dieser Familie hatte er helfen können. Also hatte er es getan. Nach den drei Jahren als NBA-Spieler hatte es ihm nicht wehgetan. Menschen aus einer Notlage helfen zu können, war einer der größten Vorteile, die ihm seine Zeit als Profi-Basketballspieler beschert hatte. Er hatte nie eine Karriere als Sportler geplant, sondern stets gewusst, dass er zum FBI gehen wollte, doch damals war er noch jung und ein ziemlich guter Spieler gewesen. Sein Talent – und den damit einhergehenden Verdienst – zu vergeuden, wäre eine Schande gewesen, also hatte er einen Großteil davon gespendet und den Rest behalten.
Er war dankbar für die Jahre, auch wenn er nach dem Tod seiner Verlobten nicht mehr die Energie zum Weitermachen aufgebracht und seine Karriere an den Nagel gehängt hatte. »Eine sehr nette Geste«, sagte er nun betont beiläufig.
Molina verdrehte die Augen, doch ihr Tonfall war beinahe freundschaftlich. »Machen Sie es sich nur nicht zur Gewohnheit, Tom.«
Er blinzelte beim Klang seines Vornamens. »Was denn?«
Sie schüttelte den Kopf. »Als ich erfahren habe, dass man mir einen Hacker-Neuling frisch von der Academy unterstellen würde, war ich nicht gerade glücklich darüber, und noch viel weniger, als ich mitbekommen habe, dass Sie früher Profisportler waren. Ich habe nicht die Zeit für einen Agent, der noch grün hinter den Ohren ist. Oder für jemanden mit einem Ego so groß wie Texas.«
Tom. »Mein Ego ist so groß wie Texas?«
»Nein. Ich hatte bloß Angst, es wäre so, aber Sie haben mich positiv überrascht.« Sie hob einen Mundwinkel. »Ich bin froh, Sie hier zu haben, und sei es nur, um Ihr weiches Herz ein bisschen abzuhärten, damit Sie es bis zur Rente schaffen. Und ich meine das ernst, Agent Hunter.«
Tom verbiss sich ein Lächeln. »Ich werde es mir merken, Ma’am.« Seine Uhr summte. »Morgenbriefing«, sagte er. »Kommen Sie mit?«
Sie sah ihn scharf an. »Ich habe es einberufen.«
Er grinste. Wenn sie das Morgenbriefing wieder übernahm, bedeutete das, dass Agent Raeburn Geschichte war. Und damit sein Leben erheblich leichter und stressfreier. »Sie sind also wieder zurück. Voll und ganz?«
»Weitgehend«, erwiderte sie kryptisch. »Aber Raeburn ist trotzdem noch Ihr direkter Vorgesetzter.«
Mist. Toms Grinsen wich einer düsteren Miene.
Noch einmal musterte Molina ihn scharf. »Agent Raeburn meinte, Sie hätten Agent Reynolds und seine Schwester mit Informationen über diesen Fall versorgt. Damit ist jetzt Schluss. Habe ich mich klar ausgedrückt?«