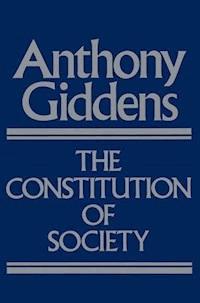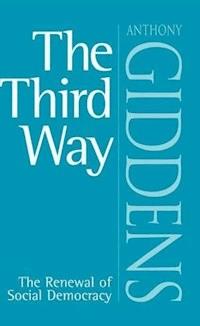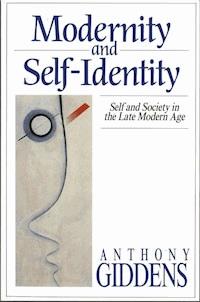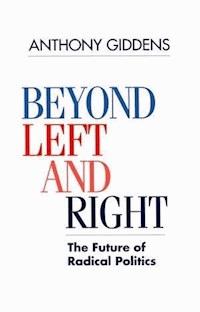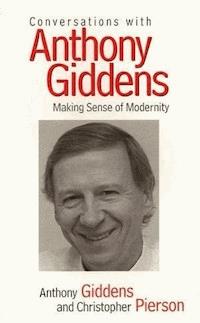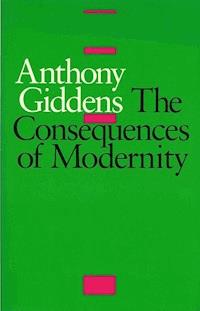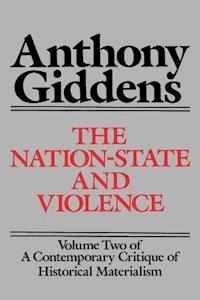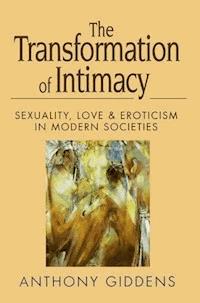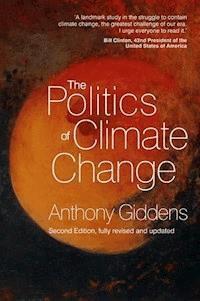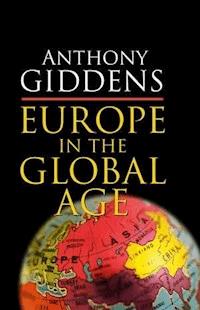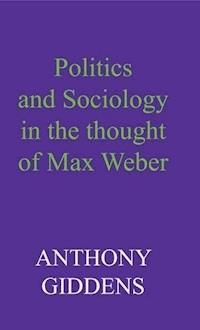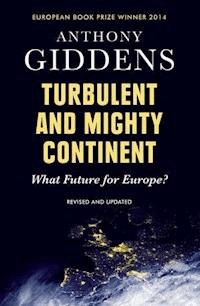Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Neue Kritik
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Klimawandel stellt die bestehenden demokratischen Institutionen und das Instrumentarium herkömmlicher Politik vor nie gekannte Herausforderungen. Zum einen in räumlicher und zeitlicher Hinsicht: der Klimawandel ist ein globales, ebenso akutes wie langfristiges Phänomen, dem nur mit Maßnahmen beizukommen ist, die die nationalen Grenzen und den nur bis zu den nächsten Wahlen reichenden Horizont von Parteipolitik überschreiten; zugleich wirft er die Frage nach globaler Gerechtigkeit und Generationengerechtigkeit auf. Zum andern in struktureller Hinsicht: der Klimawandel macht Denken in politischen Ressorts obsolet, denn er hat nicht nur ökologische, sondern untrennbar davon auch ökonomische, soziale und sicherheitspolitische Konsequenzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Transit wird herausgegeben am Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien und erscheint im Verlag Neue Kritik, Frankfurt am Main
Herausgeber: Krzysztof Michalski (Wien/Boston)
Redaktion: Klaus Nellen (Wien)
Redaktionsassistenz: Sven Hartwig
Redaktionskomitee: Jan Blonski (Krakau), Peter Demetz (New Haven), Timothy Garton Ash (Oxford), Jacqueline Hénard (Paris), Tony Judt (New York), Cornelia Klinger (Wien), Janos Matyas Kovacs (Budapest/Wien), Claus Leggewie (Gießen), Jacques Rupnik (Paris), Aleksander Smolar (Warschau/Paris), Josef Wais (Wien, Photographie)
Beirat: Lord Dahrendorf (London), Bronislaw Geremek † (Warschau), Elemer Hankiss (Budapest), Petr Pithart (Prag), Fritz Stern (New York)
Redaktionsanschrift: Transit, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Spittelauer Lände 3, A-1090 Wien, Telefon (+431) 31358-0, Fax (+431) 31358-30, E-Mail: [email protected]
Website Transit und Tr@nsit online: www.iwm.at/transit
Verlagsanschrift: Verlag Neue Kritik, Kettenhofweg 53, D-60325 Frankfurt/Main, Telefon (069) 72 75 76, Fax (069) 72 65 85, E-mail: [email protected]
Wir danken der Kunstsektion des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur für die Förderung des photographischen Beitrags in diesem Heft.
ISSN 0938-2062 / ISBN 978-3-8015--0588-2 (epub) / 978-3-8015--0589-9 (mobi)
© 2008 für sämtliche Texte und deren Übersetzungen Transit / IWM
Transit 36 (Winter 2008/2009)
Editorial
Klimapolitik und Solidarität
Anthony Giddens
Klimapolitik
Nationale Antworten auf die Herausforderung der globalen Erwärmung
Claus Leggewie und Harald Welzer
Können Demokratien den Klimawandel bewältigen?
Ingolfur Blühdorn
Klimadebatte und Postdemokratie
Zur gesellschaftlichen Bewältigung der Nicht-Nachhaltigkeit
Wolfgang Sachs
Wem gehört, was übrig bleibt?
Ressourcenkonflikte und Menschenrechte
Lukas Meyer
Klimawandel und Gerechtigkeit
Dirk Messner
Klimawandel, globale Entwicklung und internationale Sicherheit
Nadine Pratt
Ich kaufe, also bin ich gut?
Nachhaltiger Konsum – eine Kontextbestimmung
Oliver Geden
Strategischer Konsum statt nachhaltiger Politik?
Ohnmacht und Selbstüberschätzung des »klimabewussten« Verbrauchers
*
Bronislaw Geremek
Sozialgeschichte – Ausgrenzungen und Solidarität
(Collège de France, Leçon inaugurale 1993)
Stefan Troebst
Vom Bevölkerungstransfer zum Vertreibungsverbot – eine europäische Erfolgsgeschichte?
Zu den Autorinnen und Autoren
Chris Niedenthal
Greetings from Hel. Photographien
EDITORIAL
Die Umweltbewegung hat in ihrer relativ jungen Geschichte viel erreicht. Grün ist Mainstream geworden, und die Qualität der Umwelt hat sich signifikant verbessert. Doch gilt diese Bilanz nur für unsere Region. Global gesehen steuert die Umwelt und mit ihr die Menschheit auf eine Katastrophe zu. Dass diese Prognose nicht mehr als Alarmismus abgetan werden kann, zeigt sich an der Karriere des Themas Klimawandel. Inzwischen hat es einen festen Platz in der öffentlichen Diskussion, und die Politiker quer durch das politische Spektrum müssen sich ihm stellen.
Spätestens der Report des früheren Weltbank-Chefökonomen Nicholas Stern hat den Gemeinplatz vom Widerspruch zwischen Ökologie und Ökonomie obsolet werden lassen: Eine Klimakatastrophe würde enorme Kosten für die Volkswirtschaften bedeuten, während Klimaschutz sie durch die Entwicklung energiesparender Technologien kräftig beleben könnte. Klimaschutz scheint nicht mehr ›nur‹ eine moralische Verpflichtung, sondern auch eine wirtschaftliche Chance.
Diese Entwicklung kann als Bestätigung des ursprünglichen Programms der grünen Politik gelesen werden. Zugleich zwingt sie die grünen Parteien dazu, sich neu zu positionieren, den Stellenwert der Ökologie in ihrer Politik neu zu bestimmen und ihren Führungsanspruch in Sachen Umwelt zurückzuerobern. Denn die Grünen sind mit ihrem »Kerngeschäft« schon lange nicht mehr allein: Nicht nur haben so gut wie alle Parteien Umweltpolitik in ihre Programme geschrieben, sondern es sind zahlreiche, oft politisch bewegte Ökologie-Institute und mächtige nationale und transnationale Umwelt-Verbände entstanden.
Die schiere Dimension des zu erwartenden Klimawandels und des damit verbundenen gesellschaftlichen und politischen Konfliktpotentials sprengt allerdings den Rahmen dessen, was man bisher gemeinhin unter Umweltpolitik verstanden hat. Der Klimawandel stellt die bestehenden demokratischen Institutionen und das Instrumentarium herkömmlicher Politik vor nie gekannte Herausforderungen. Zum einen in räumlicher und zeitlicher Hinsicht: der Klimawandel ist ein globales, ebenso akutes wie langfristiges Phänomen, dem nur mit Maßnahmen beizukommen ist, die die nationalen Grenzen und den nur bis zu den nächsten Wahlen reichenden Horizont von Parteipolitik überschreiten; zugleich wirft er die Frage nach globaler Gerechtigkeit und Generationengerechtigkeit auf. Zum andern in struktureller Hinsicht: der Klimawandel macht Denken in politischen Ressorts obsolet, denn er hat nicht nur ökologische, sondern untrennbar davon auch ökonomische, soziale und sicherheitspolitische Konsequenzen.
Die Beiträge im vorliegenden Heft setzen sich mit diesen Herausforderungen auseinander.
Während Anthony Giddens meint, dass es bis heute keine schlagkräftige Politik gegen den Klimawandel gebe, und für eine Erneuerung staatlicher Planung plädiert, setzen Claus Leggewie und Harald Welzer dagegen, dass die Zukunft der westlichen Demokratie in der Revitalisierung von Teilhabe und Mitsprache der Bürger liege: nicht mehr Planung, sondern mehr Demokratie sei gefordert. Welche Rolle dabei dem Einzelnen zukommt, diskutieren Nadine Pratt und Oliver Geden: Kann man Klimapolitik auf die wachsende Macht des aufgeklärten Verbrauchers gründen? Oder würde ein zum Konsumenten geschrumpfter Bürger nicht eine weitere Aushöhlung institutionalisierter Politik bedeuten, die gerade angesichts der gegenwärtigen Krisen unverzichtbar ist? Ingolfur Blühdorn sieht in der demokratiepolitischen Debatte eine Illusion am Werk: Weder haben die westlichen Gesellschaften die strukturelle Fähigkeit noch den politischen Willen zu der von ihnen so lauthals geforderten Wende zur Nachhaltigkeit.
Von einem vorsichtigen Optimismus getragen ist hingegen der Beitrag von Wolfgang Sachs, der in dem Aufstieg der Idee der Menschenrechte eine Chance für jene sieht, die am wenigsten für die Klimakrise verantwortlich sind und am meisten unter ihr leiden: die Armen. Ihr Überleben muss Vorrang haben vor unserem Besserleben. Über die Folgen unseres Handelns für die in der Zukunft lebenden Menschen denkt Lukas Meyer nach. Auch er kommt in seinen gerechtigkeitstheoretischen Überlegungen zu dem Schluss, dass Klimaschutz Einschränkungen verlangt, und zwar von jenen heute Lebenden, die sich durch ihre umweltbelastenden Aktivitäten Begünstigungen verschaffen.
Die Frage der Klimagerechtigkeit ist nicht abstrakt. Der Klimawandel kann Verteilungskonflikte in und zwischen Ländern auslösen und damit neue Spannungslinien erzeugen. Die Implikationen des Klimawandels für die internationale Politik untersucht Dirk Messner. Worin besteht in diesem Szenario die Verantwortung Europas?
Wie kaum ein anderes politisches Gebilde heute verfügt die Europäische Union über Instrumente und Mittel zur Entwicklung, Durchsetzung und Finanzierung nachhaltiger klimapolitischer Lösungen. Sie hat hier bereits eine internationale Vorreiterrolle übernommen. Wird sie ihr weiterhin gerecht werden? Werden ihre Mitglieder den notwendigen politischen Willen und ihre Bürger die notwendige Solidarität aufbringen?
Inzwischen überschattet die Finanzkrise die Debatte um das ehrgeizige EU-Klimaschutzpaket. Der Widerspruch zwischen Ökologie und Ökonomie wird neuerlich beschworen: Angesichts der Reparaturkosten für das kollabierte Finanzsystem und die in Mitleidenschaft gezogene Wirtschaft können wir uns Klimapolitik angeblich nicht mehr leisten. Dies wäre ein fataler Fehlschluss. Messner schreibt: »Die Klimapolitik sollte (…) eine zentrale Arena werden, in der Europa eine wichtige Rolle als global mitgestaltende Macht des 21. Jahrhunderts spielen kann. Diese Strategie sollte trotz – oder gerade wegen – der globalen Finanzmarkt-krise 2008 zielstrebig verfolgt werden, um nach dem Scheitern kurzfristigen Denkens auf den Finanzmärkten denselben Fehler in der Klimapolitik zu vermeiden.« Und warum, fragen Leggewie und Welzer, soll der darniederliegende Markt nicht eben durch Klimainvestitionen zu beleben sein?
Der britische Außenminister David Miliband hat die Europäische Union kürzlich aufgefordert, sich ihrer Verantwortung für die Lösung des Klimaproblems zu stellen. »Diese Organisation, der es mit ihrer Zusammenarbeit im Kohle- und Stahlsektor gelang, Frieden in Europa zu garantieren, muss zu ihren Wurzeln zurückkehren. Heute sollte sie das gesamte ihr zur Verfügung stehende Instrumentarium einsetzen, um globale Standards festzulegen. (…) Die EU wird sich daran messen lassen müssen, ob es ihr gelingt, die für das Jahr 2020 gegebenen Zusagen einzuhalten. Alles andere würde ihren globalen Führungsanspruch untergraben. Wir können uns die Abhängigkeit von CO2-Energieträgern unter wirtschaftlichen, ökologischen und geopolitischen Gesichtspunkten nicht länger leisten. Die Finanzkrise ist kein Argument, um den Übergang zur CO2-armen Energiewirtschaft zu verzögern, sondern ein Grund mehr, ihn voranzutreiben.« (Süddeutsche Zeitung vom 18.12.2008)
Ein Teil der genannten Beiträge ist hervorgegangen aus der Vortragsreihe »Umweltpolitik und Solidarität – eine Herausforderung für Europa«, die das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Zusammenarbeit mit der Grünen Bildungswerkstatt veranstaltet. Wir danken für die Unterstützung.
Am 13. Juli 2008 verunglückte der polnische Historiker und Politiker Bronislaw Geremek tödlich. Er war ein Freund des IWM und Mitglied des Redaktionskomitees von Transit. Im Gedenken an diesen großen Europäer publizieren wir hier einen Auszug aus seiner Antrittsvorlesung am Collège de France.
Stefan Troebst setzt die Diskussion über europäische Gedächtnispolitik im vorigen Heft fort mit einem Kapitel europäischer Erfolgsgeschichte, das die Entwicklung von der Vertreibung als weithin akzeptiertem Instrument staatlicher Politik zu deren internationaler Ächtung nachzeichnet.
Den Photoessay über die polnische Halbinsel Hel hat der in Warschau lebende Photograph Chris Niedenthal beigetragen, der den Stil von Transit seit den ersten Jahren mitgeprägt hat.
Wien im Dezember 2008
Anthony Giddens
KLIMAPOLITIK
Nationale Antworten auf die Herausforderung der globalen Erwärmung1
Der Klimawandel ist auf bemerkenswerte Weise und in kürzester Zeit ins Zentrum der öffentlichen Debatte gerückt. Naturwissenschaftler äußern schon seit einem Vierteljahrhundert ernsthafte Sorgen über die globale Erwärmung, und Umweltaktivisten bemühen sich seit mindestens ebenso langer Zeit darum, Regierungen und Bürger dazu zu bewegen, dieses Thema ernst zu nehmen. Doch erst in den letzten Jahren hat der Klimawandel massive Präsenz in der politischen Diskussion gewonnen, und zwar nicht nur in vereinzelten Ländern, sondern weltweit.
Warum, ist nicht ganz klar. Gewiss hat die Wissenschaft vom Klima-wandel Fortschritte gemacht. Einen großen Teil der entsprechenden Erkenntnisse hat der Weltklimarat, das International Panel on Climate Change (IPCC) der Vereinten Nationen, ein sehr einflussreiches Gremium, in seinen Veröffentlichungen zusammengefasst. Auch die Aktivitäten des ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore haben mitgeholfen, das öffentliche Bewusstsein in Sachen globaler Erwärmung zu schärfen. Beide sind für ihre Leistungen mit dem Nobelpreis belohnt worden. Mehrere Naturkatastrophen, die innerhalb weniger Jahre eintraten, haben das ihre zur Bewusstseinsbildung beigetragen. Es ist keineswegs erwiesen, ob der Wirbelsturm Katrina etwas mit der globalen Erwärmung zu tun hatte, doch der Umstand, dass eine Großstadt im reichsten Land der Welt von einem Tag auf den anderen untergehen konnte, war ein unübersehbares Signal dafür, dass uns noch Schlimmeres bevorstehen könnte. Während der Hitzewelle im Sommer 2003 starben in Europa 30 000 Menschen. Der Tsunami in Südostasien am Jahresende 2004, in dem zehnmal so viele Menschen umkamen, hatte mit dem Klimawandel überhaupt nichts zu tun, war aber eine machtvolle Erinnerung an die Urgewalt der Natur und unsere eigene Verwundbarkeit.
Was immer auch den Ausschlag gegeben haben mag, irgendwann wurde ein Hebel umgelegt. Der Klimawandel ist zu einem in den Medien allgegenwärtigen, fast täglich behandelten Thema geworden, dem sich eine immens anschwellende Flut von Büchern, Artikeln und Sendungen widmet, verfasst von Wissenschaftlern und Journalisten. Die meisten Staaten haben in Absichtserklärungen oder Programmen dargelegt, wie sie auf die Herausforderung antworten wollen.
Die Literatur zum Klimawandel lässt sich in mehrere Kategorien einteilen. Es gibt viele von Wissenschaftlern und anderen Autoren geschriebene Bücher zum Phänomen an sich und zu den damit einhergehenden Gefahren. Umfangreich ist auch die Literatur zu möglichen technischen Lösungen des Problems. Viele von denen, die über den Klimawandel schreiben, propagieren ihre Lieblings-Technologie, die in ihren Augen die größte Chance eröffnet, das sich abzeichnende Problem in den Griff zu bekommen. Für manche ist es die Solarstrom-Technik, für andere die Kernkraft oder die Kernfusion, die Brennstoffzelle, die Erdwärmenutzung, eine »saubere Kohleverstromung« oder ähnliches. Für die meisten liegt die Lösung in einem intelligenten Mix aus einigen oder allen diesen Technologien. Es liegen auch zahlreiche Veröffentlichungen vor über die verschiedenen Bemühungen um internationale Vereinbarungen zur Eindämmung der für die globale Erwärmung verantwortlichen Treibhausgase. Diskutiert werden dabei vor allem die Verträge von Kyoto und später Bali sowie die innerhalb der Europäischen Union ausgearbeiteten Pläne.
Die meisten Bücher und Artikel, die über »Klimapolitik« geschrieben worden sind, handeln von solchen internationalen Vereinbarungen. Ich möchte hier die vielleicht provozierende Behauptung aufstellen, dass es bis heute keine schlagkräftige Politik gegen den Klimawandel gibt, insbesondere nicht auf nationaler Ebene, wo die Mehrzahl der nötigen Maßnahmen ergriffen werden müssten. Will sagen: Es gibt keine ausgearbeitete Analyse der politischen Veränderungen, die wir vornehmen müssen, wenn unsere Bestrebungen, den Klimawandel zu stoppen, Wirklichkeit werden sollen. Ich möchte im Folgenden versuchen, einige der Fragen zu klären, die gestellt und beantwortet werden müssen – ohne dass ich einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe. Danach werde ich einen genaueren Blick auf Großbritannien werfen, als Beispielfall für die Probleme und Chancen, wie sie sich in mehr oder weniger allen Industrieländern darstellen, soweit diese sich um politische Lösungen bemühen, die tatsächlich etwas bewirken. Zunächst einmal scheint es mir jedoch ratsam, kurz auf den Stand der Dinge in der Klimadebatte als solcher einzugehen.
Der Klimawandel: die Debatte
Nur sehr wenige Aspekte des Klimawandels sind unumstritten, und die Kontroversen zwischen den Protagonisten sind oft heftig und teils sogar bitter. Drei unterschiedliche Positionen lassen sich ausmachen. Auf der einen Seite gibt es Klimawandel-Skeptiker, die sagen, die These, dass die derzeit beobachtbaren Phänomene der globalen Erwärmung durch den Menschen verursacht seien, sei nicht erwiesen. Sie berufen sich darauf, dass es in der Erdgeschichte Klima-Fluktuationen als Folge natürlicher Vorgänge schon immer gegeben hat. Was gegenwärtig passiere, sei im Prinzip nichts anderes. Andere Skeptiker räumen ein, dass wir gegenwärtig einen Klimawandel erleben und dass menschliche Aktivitäten dazu beitragen, behaupten jedoch, die damit einhergehenden Gefahren würden übertrieben. Für diese Leute stellen andere globale Probleme wie Armut, AIDS oder die potentielle Verbreitung von Atomwaffen akutere und größere Bedrohungen dar als der Klimawandel. Die Zahl dieser Skeptiker ist in den letzten Jahren in dem Maß, wie die wissenschaftliche Erforschung des Klimawandels vorangekommen ist, erheblich geschrumpft, aber sie finden nach wie vor eine gehörige Resonanz.
Die zweite Position möchte ich als die Mainstream-Meinung bezeichnen (oder genauer als den Fächer der Mainstream-Meinungen), repräsentiert vor allem durch die Veröffentlichungen des IPCC. Das IPCC hat einen enormen Einfluss auf das weltweite Denken in Sachen Klimawandel entfaltet. Wenn heute ein Konsens über dessen Ausmaß und Gefahren besteht, so hat das IPCC einen großen Anteil an seinem Zustandekommen. Das entspricht auch dem erklärten Ziel des Gremiums, so viel wissenschaftliches Belegmaterial wie möglich zusammenzutragen, es einer rigorosen Prüfung zu unterziehen und zu umfassenden Schlussfolgerungen über den Stand der wissenschaftlichen Meinung zu gelangen. In seinen sukzessiven Veröffentlichungen hat das IPCC verschiedene mögliche Zukunfts-Szenarien skizziert und versucht, ihnen Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen. Die Klimawandel-Skeptiker sehen im IPCC den Erzfeind eines freien und einzig der Wahrheit verpflichteten wissenschaftlichen Denkens. Für sie ist der Weltklimarat zu einer Herrschaftsinstanz geworden, die entschlossen ist, die Welt durch eine bestimmte Brille zu sehen, zum Gralshüter einer neuen Orthodoxie. Die Skeptiker sehen sich selbst gern als freie Geister, die den Mut haben, das konventionelle Wissen ihrer Zeitgenossen in Frage zu stellen.
Die Schlacht zwischen den Skeptikern und der vorherrschenden wissenschaftlichen Meinung dauert an, wobei jede Seite dazu neigt, die Argumente der Gegenseite für unsinnig zu erklären. Es lässt sich heute jedoch noch eine weitere Meinungsdifferenzierung erkennen, nämlich die zwischen dem Mainstream und denjenigen Autoren und Forschern, nach deren Auffassung der Klimawandel sogar größere und akutere Gefahren heraufbeschwört als gemeinhin angenommen. Diese Leute, die ich hier als die »Radikalen« bezeichnen will, erklären, die Erforschung früherer, naturbedingter Klimafluktuationen zeige, dass man es bei Prozessen der Klimaveränderung mit Schwellen-Effekten zu tun habe. In früheren Erdzeitaltern hätten sich abrupte Klimaveränderungen vollzogen, manchmal innerhalb von nur zehn Jahren. Die Radikalen halten es zumindest für möglich, dass der aktuelle, menschlich induzierte Klimawandel etwas Ähnliches bewirkt. Es gebe mehrere potentielle »Auslösepunkte«. Dazu gehöre die Möglichkeit, dass die Eispanzer, die den antarktischen Kontinent und die Insel Grönland bedecken, schneller abschmelzen, als die Wissenschaft es bis heute für möglich hält, oder dass das Abschmelzen der gefrorenen Torfmoore im westlichen Sibirien und in Kanada Methan in großen Mengen freisetzt. Methan ist ein weitaus wirksameres Treib-hausgas als CO2.
Manche Radikalen – wie der Naturwissenschaftler James Lovelock – sind der Überzeugung, es sei bereits zu spät, einen gefährlichen Klimawandel noch abzuwenden, und die Menschheit täte besser daran, das Gros ihrer Energien in den Versuch zu investieren, sich bestmöglich darauf vorzubereiten und Überlebensstrategien für diesen Fall zu entwickeln. Andere glauben, wir könnten die schlimmsten Folgen eines Klimawandels noch verhüten, müssten dann aber hier und jetzt weitreichende Maßnahmen ergreifen.
Wie sollen wir diese divergierenden Positionen einschätzen? Offensichtlich ist es von erheblicher Bedeutung, welche der drei skizzierten Auffassungen der Wahrheit am nächsten kommt. Die Skeptiker dürfen wir nicht ignorieren, und sei es nur, weil sie die öffentliche Meinung beeinflussen. Interessengruppen, die eine Politik gegen die Klimawandel-These betreiben, und gewöhnliche Bürger, die nicht willens sind, ihre Denk- und Lebensgewohnheiten zu ändern, können einfach sagen: »Was soll’s, nichts davon ist bewiesen, oder?« Man könnte den Skeptikern auch zugute halten, dass sie eine nützliche Rolle spielen, insofern sie die Klimawandel-Orthodoxie immer wieder auf den Prüfstand stellen und so verhindern, dass sie zu einem neuen Dogmatismus erstarrt. Das IPCC hat sich ein hohes Maß an Autorität verschafft, doch auch die Radikalen verdienen unsere Aufmerksamkeit, denn wenn sie recht haben, stehen wir womöglich schon in absehbarer Zeit vor gefährlichen Herausforderungen. Politische Führer sind verpflichtet, den Gang der Debatte zu verfolgen und neue wissenschaftliche Befunde kontinuierlich zu bewerten.
Wenn wir über Antworten auf den Klimawandel nachdenken, müssen wir unsere Aufmerksamkeit zu einem guten Teil dem Staat zuwenden. Internationale Vereinbarungen à la Kyoto oder Bali, die Klimaziele der EU, der Handel mit CO2-Emissionsrechten, die Aktivitäten von Unternehmen und NGOs, all dem kommt zweifellos größte Bedeutung zu. Unbestreitbar ist trotzdem, dass in allen Ländern der Staat eine bedeutsame Rolle zu spielen haben wird als die Instanz, die Rahmenbedingungen für diese Anstrengungen setzt. Die Rolle, die in fortgeschrittenen Gesellschaften dem Staat zukommt, ist besonders wichtig, weil diese Länder eine Vorreiterrolle bei der Reduzierung ihrer Emissionen spielen müssen.
Auf nationaler Ebene stellt sich in solchen Gesellschaften ein ganzes Bündel von Problemen, die in Angriff genommen werden müssen. Wir können hier institutionelle von politischen Fragen unterscheiden. Ich mache erst gar nicht den Versuch, die große Zahl der zu diesem Thema erschienenen Arbeiten zusammenzufassen, sondern will die Gelegenheit nützen, einige Kernfragen zu stellen.
Institutionen: Staat und Planung
Demokratische Länder neigen, so könnte man argumentieren, von Natur aus dazu, sich von den kurzfristigen (oder kurzsichtigen) Interessen und Bedürfnissen der Wähler treiben zu lassen. Wie können wir langfristig denken und handeln in Gesellschaften, die tendenziell von kurzfristigen Entscheidungszyklen beherrscht werden? Sicher müssen wir uns auf irgendeine Form der Planung zurückbesinnen, doch wie soll die aussehen? Wie lassen sich in einem demokratischen System verbindliche Entscheidungen treffen, die auch einen Regierungswechsel überdauern? Es muss ein parteienübergreifender Konsens über eine langfristige Politik in Sachen Klimawandel erreicht werden – jenseits rot-grüner Koalitionen oder der Rede, Grün sei das neue Rot –, aber wie kann ein solcher Konsens aussehen und wie kann er dauerhaft gemacht werden angesichts der Neigung politischer Parteien, ständig nach dem nächsterreichbaren politischen Vorteil zu streben?
Staatliche Planung war in den Ländern der westlichen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg für zwei oder drei Jahrzehnte en vogue – besonders auf Seiten der politischen Linken. Und natürlich war staatliche Planung die Grundlage der Wirtschaft in den Gesellschaften sowjetischen Typs. Legendär ist der Marshall-Plan, der eine entscheidende Rolle für den Wiederaufbau der Wirtschaft und des Wohlstands im westlichen Nachkriegs-europa spielte. Damals verstand man unter »Planung« normalerweise eine hochgradig zentrale Lenkung durch den Staat im Interesse des allgemeinen wirtschaftlichen Wohlstandes und der sozialen Gerechtigkeit. In den gemischten Volkswirtschaften des Westens bedeutete das eine zum erheblichen Teil verstaatlichte Wirtschaft, insbesondere in den Branchen, die als strategisch bedeutsam galten, wie die Bereiche Energieversorgung, Kommunikation und die Montanindustrie. Diese Variante der Planwirtschaft geriet jedoch später in Verruf, ebenso wie die »Städteplanung«, namentlich die Projektierung ganzer Stadtviertel, die dann gleichsam über Nacht hochgezogen wurden.
Als die Gegenrevolution einsetzte, die mit weitreichenden Privatisierungen und einer nur noch minimalen makroökonomischen Steuerung einherging, geriet das bloße Wort »Planung« unter Verdacht und ist es bis vor kurzem geblieben. Doch wenn wir auf systematische Weise über die Zukunft nachdenken – im Sinne eines Bemühens, diese Zukunft zu gestalten oder ihr eine Richtung zu geben –, ist Planung, in welcher Form auch immer, unverzichtbar. Die Nachkriegszeit war eine Phase des Wiederaufbaus, in der große Investitionen getätigt werden mussten, um eine durch immense materielle Schäden gekennzeichnete Situation zu überwinden. Der Marshall-Plan war in der Tat ein großer Erfolg – vor allem deshalb beruft sich Al Gore so ausdrücklich auf ihn. Planung wird oft mit einer Neigung zum Utopismus assoziiert. So wie die politische Stimmung sich zu einer gewissen Zeit gegen die Wirtschaftsplanung kehrte, drehte sie sich auch gegen »utopistische« Zukunftsentwürfe. Wenn wir uns freilich aller utopistischen Entwürfe enthalten würden, gäbe es keine Ideale mehr, nach denen wir streben könnten.
Viele Spielarten staatlicher Wirtschaftsplanung wurden tatsächlich noch in der Zeit praktiziert, in der die Idee der Planung schon weitgehend diskreditiert war. So sahen und sehen sich Staaten verpflichtet, demographische Veränderungen im Auge zu behalten, um in Bereichen wie Bildung, medizinische Versorgung und Renten künftige Bedarfs-größen abschätzen zu können. Staaten müssen ebenfalls den Ausbau von Schienenwegen und Straßen gemäß dem voraussichtlichen Verkehrsaufkommen planen. Notfallpläne müssen bereitliegen für den Fall dieser oder jener denkbaren Katastrophe. Und während »Retortenstädte« aus der Mode kamen, wurde Stadtplanung in der einen oder anderen Form weiterhin praktiziert. (Und selbst die »Retortenstadt« feiert inzwischen ein Comeback, diesmal in Gestalt von Öko-Siedlungen.) Natürlich lassen sich Lehren aus den Erfolgen und Misserfolgen solchen Planens wie auch ehrgeizigerer Projekte ziehen.
Es ist heute ein Gemeinplatz, über den modernen Staat zu sagen, er solle ein »aktivierender Staat« (enabling state) sein, und dieses Postulat passt sicher auf die politische Bewältigung des Klimawandels. Wenn der Planungsgedanke eine Renaissance erlebt, dann sicher nicht in Form einer Rückkehr zum grobschlächtigen Staatsinterventionismus alter Machart mit all den Problemen, die er nach sich zog. Der Staat sollte seine Auf-gabe darin sehen, einen zweckmäßigen regulatorischen Rahmen bereitzustellen, der geeignet ist, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kräfte zu lenken, die wir brauchen, um Maßnahmen gegen den Klimawandel in Gang zu setzen. Ich ziehe das Konzept des »Gewährleistungsstaats« (ensuring state) dem des »aktivierenden Staates« vor. Letzteres suggeriert die Vorstellung eines Staates, der sich darauf beschränkt, andere zum Handeln zu stimulieren und sie dann machen zu lassen. Der Gewährleistungsstaat hingegen ist ebenfalls aktivierend, jedoch angehalten oder verpflichtet, sicherzustellen, dass die in Gang gebrachten Prozesse auch die gewünschten Resultate haben – im Fall des Klimawandels etwa, dass beschlossene Ziele für die Verringerung von Emissionen auch erreicht werden.
Was ist unter einer »Rückkehr zur Planung« im Kontext des Klimawandels zu verstehen? Vor allem, dass man die Dinge langfristig betrachtet, mit einem Zeithorizont, der sich drei oder mehr Jahrzehnte in die Zukunft erstreckt. Wenn der Klimawandel wirklich, wie es im Stern-Report heißt, »das größte Beispiel aller Zeiten für Marktversagen« ist,2 dann vor allem deshalb, weil der Markt keine Zukunftsvision kennt. Gewiss lassen sich Marktkräfte für die Steuerung langfristiger Prozesse nutzen – man denke etwa an Rentensysteme oder Lebensversicherungen –, aber es bedarf dafür immer eines regulatorischen Rahmens, den normalerweise der Staat bereitstellt.
Planung impliziert des weiteren, dass die Anliegen des Umweltschutzes in alle staatlichen Instanzen eingebracht werden, sei es auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene, und dass alle staatlichen Institutionen die Belange des Umweltschutzes zur Kenntnis nehmen und darauf reagieren. Anders ausgedrückt: Antworten auf den Klimawandel zu geben, ist nicht bloß eine staatliche Aufgabe unter vielen, die man einer spezielle Behörde zuweisen könnte; vielmehr muss diese Aufgabe in das gesamte Regierungshandeln integriert werden, quer durch alle Kompetenzbereiche.
In Kombination mit anderen Einrichtungen wird der Staat das Schlüsselmedium für die Schaffung internationaler Vereinbarungen sein (einschließlich der Errichtung einer transnational funktionierenden Emissionsbörse für Treibhausgase), die wir zur Bekämpfung des Klimawandels brauchen – und auch für deren Durchsetzung, weil es (teilweise mit Ausnahme der EU in Bezug auf ihre Mitgliedsstaaten) keine andere Instanz gibt, die die Macht dazu besäße. Da die Rede von Planung in so vielerlei Hinsicht missverstanden werden könnte, möchte ich noch einmal betonen, dass in keinem dieser Bereiche der Staat alleine vorgehen würde; seine Rolle würde sich vielmehr im Normalfall darauf beschränken, anderen Anreize zum Handeln zu geben und durch die Bereitstellung notwendiger Instrumente die Wirksamkeit dieses Handelns hinsichtlich beschlossener Klimaschutzziele sicherzustellen.
Wie planen wir für eine Zukunft, die ihrem Wesen nach ungewiss ist, und wie können wir es auf eine Weise tun, die geeignet ist, Risiken zu minimieren, die wir im Voraus nicht genau kennen und daher nicht exakt berechnen können (oder erst dann, wenn es zu spät ist und die antizipierten Gefahren bereits eingetreten sind)? Eines der Dinge, die wir eindeutig nicht machen sollten, ist zu versuchen, die Zukunft in eine Zwangsjacke zu stecken, wie es die sowjetischen Planer einst vorexerziert haben. Der Staat muss, um diesen Irrweg zu vermeiden, primär als katalytische Kraft agieren, um Innovationen und Experimente zur Milderung des Klimawandels zu fördern, muss sich aber auch der Verantwortung stellen, diese Entwicklungen zu überwachen und, wo nötig, zu gestalten. Wir können (hoffentlich) mit einem gewaltigen Output an Innovationen durch Privatunternehmen und Gruppen des Dritten Sektors rechnen.
Technologien werden bei der Bekämpfung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung sein. Wir haben freilich gelernt, dass der Verlauf technischer Innovationsprozesse schwer vorhersehbar ist – viele der wichtigsten Innovationen, die heute unser Leben prägen, wie das Internet, kamen aus unvermuteter Richtung. Eine Schlüsselfrage, der wir uns stellen müssen, lautet: Wie können Staaten Innovationen fördern, ohne »verlorene Wetten« auf Technologien abzuschließen, die sich vielleicht irgendwann als Sackgassen entpuppen?
Wir werden eine Politik des Adaptierens brauchen, denn die Auswirkungen des Klimawandels haben uns schon erreicht und werden sich wahrscheinlich noch verstärken, selbst wenn es gelingt, die Treibhausgas-Emissionen weltweit zu senken, denn diese Gase haben eine lange Verweildauer in der Erdatmosphäre. Jedes Land sollte über eine detaillierte Abschätzung seiner Verwundbarkeiten verfügen und Notfallpläne für den Katastrophenfall in der Schublade haben. Eines der größten Probleme verbindet sich jedoch mit der Frage, woher der Versicherungsschutz kommen soll. Der Staat ist schon heute der Versicherer letzter Instanz für manche Schadensfälle. Wenn er künftig diese Rolle auf neue und größere Risiken ausweitet, muss man sich fragen, woher die Mittel für deren Abdeckung kommen sollen. Eines der auffälligsten Phänomene, die sich nach dem Wirbelsturm Katrina in New Orleans beobachten ließen, war, dass die staatlichen und behördlichen Instanzen, die mit der Bewältigung der Katastrophe befasst waren, jeweils versuchten, die primäre Verantwortung auf die jeweils anderen abzuwälzen. Die bisher aufgebrachten Geldmittel, einschließlich der Zahlungen privater Versicherungsunternehmen, bewegen sich weit unterhalb dessen, was nötig wäre, um die Stadt wieder zu dem zu machen, was sie vor dem Wirbelsturm war.
Es ist absehbar, dass eine Politik, die auf eine Renaissance des Planens setzt, auf große Widerstände stoßen wird. Das Planungsgesetz, das derzeit im britischen Parlament debattiert wird (Planning Bill 2007-08)3, hat bereits viel Widerspruch auf sich gezogen, obwohl es darin hauptsächlich um Planungen auf kommunaler Ebene geht. Es ist nicht klar, wie sich die Bestimmungen dieses Gesetzes zu dem Bekenntnis der britischen Regierungen zu Dezentralisierung und lokaler demokratischer Selbstbestimmung verhalten. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Antworten, die wir darauf geben müssen, erscheint die Logik, die dem Gesetz innewohnt, freilich folgerichtig – es wird schlicht und einfach nötig sein, Wege zu finden, um Planungsprozesse zu beschleunigen und Planungen durchzusetzen (eine Aussage, hinter der sich, wie ich wohl weiß, ein ganzer Rattenschwanz von Problemen verbirgt).
Einen parteienübergreifenden Konsens für eine Klimawandel-Politik zustandezubringen und aufrechtzuerhalten, würde sehr helfen, eine Langzeitperspektive in die Politik einzubringen. Die »All Party Parliamentary Climate Change Group« ist in dieser Frage mit sehr hilfreichen Aussagen hervorgetreten, die auf einige der hier bereits benannten Dilemmata verweisen.4 Ein auf der Konkurrenz zwischen Parteien beruhendes politisches System lässt sich nicht ohne weiteres mit langfristigem Denken vereinbaren, denn überall dort, wo aus sachlichen Gründen gebotene Maßnahmen zum Klimaschutz unpopulär sind, könnte die eine oder andere Partei um des politischen Vorteils willen dem Populismus verfallen. Ähnlich wie Kritiker es dem IPCC vorhalten, könnte ein parteienübergreifender Konsens sich zu einem Dogma verhärten, das womöglich zum Hemmschuh für neue, radikalere Ideen würde. Wir müssen versuchen, zu entscheiden, was für einen Konsens wir erreichen wollen. Colin Challen, der Vorsitzende der Allparteiengruppe, hat detaillierte Vorschläge dafür unterbreitet, wie sich die verschiedenen strittigen Fragen lösen ließen. Er spricht sich dafür aus, eine permanente parteienübergreifende Kommission einzusetzen mit dem Auftrag, einen Rahmen für künftige Klimaschutz-Politik zu erarbeiten. Die Sitzungen dieser Kommission sollen öffentlich stattfinden und ihre Empfehlungen zu einem geeigneten Zeitpunkt einem Referendum unterworfen werden, um dem gesamten Prozess Legitimität zu verleihen.
Auf jeden Fall werden wir eine übergreifende Perspektive brauchen, um die aufgeworfenen Fragen in ein stimmiges Konzept integrieren zu können. Wie könnte eine politische Philosophie, die sich der Bekämpfung der globalen Erwärmung verschreibt, aussehen? Auf den ersten Blick könnte es scheinen, als biete die Umweltschutzbewegung diese Philosophie bereits an. »Grün werden«, lautet heute das anerkannte Motto, wann immer es um Maßnahmen zur Begrenzung der globalen Erwärmung geht. Begriffe aus dem gedanklichen Repertoire der Umweltbewegung, wie beispielsweise das Vorsorgeprinzip, erfreuen sich weiter Verbreitung. Tatsächlich jedoch ist das Verhältnis zwischen dieser Bewegung und der ergrünenden orthodoxen Politik durchaus problematisch. Viele grüne Gruppierungen haben der politischen Betätigung im herkömmlichen Sinn eine Absage erteilt. So stritten die deutschen Grünen jahrelang darüber, ob sie eine klare politische Führung haben und im Parlament repräsentiert sein sollten. Und das Vorsorgeprinzip ist von Kritikern weitgehend ausgehöhlt worden.
Einige dieser Gruppen haben ihre Wurzeln im Naturschutz – in der Idee, dass wir die Natur vor der zerstörerischen Ausbeutung durch den Menschen bewahren müssen. Freilich kann es ein »Zurück zur Natur« als Leitidee einer künftigen Umweltpolitik nicht geben. Wir leben in einer Welt, die in vielerlei Hinblick jenseits der Natur liegt, in der die menschlichen Eingriffe in das, was einmal die natürliche Welt war, so tiefgreifend sind, dass es keinen Weg zurück gibt. Die politischen und philosophischen Implikationen des Rückzugs der Natur sind erheblich. Sie erstrecken sich weit über die Folgen des Klimawandels hinaus, wirken aber in mehrfacher Hinsicht auf unser Denken darüber zurück. Die Naturwissenschaft drängt sowohl die Natur in uns als auch die Natur um uns herum zurück. Manche dieser Eingriffe haben heftige Abwehrreaktionen ausgelöst, weil sie tief in unsere Körperlichkeit und unseren Reproduktionszyklus eingreifen – man denke zum Beispiel an die Kontroversen über die Embryologie.
Ich habe kein Problem mit der Idee, dass wir uns schrittweise auf einen grünen Staat zubewegen sollten. Prinzipiell lässt sich ein grüner Staat einfach definieren. Er ist ein Staat, der in Übereinstimmung mit grünen Werten handelt. Das Schlüsselproblem besteht darin, diese Werte zu institutionalisieren, und zwar so, dass sie mit anderen Werten (wie etwa dem der sozialen Gerechtigkeit) harmonieren. Wir müssen aber auch festlegen, was grüne Werte eigentlich sind. Die meisten grünen Parteien und Organisationen äußern sich zu dieser Frage diffus. »The Global Greens« ist der Name eines internationalen Netzwerks grüner Parteien und politischer Bewegungen. Es hat eine Charta veröffentlicht, die in Anlehnung an die Positionen seiner Mitglieder definiert, was grüne Werte sind. Die angeführten Werte haben eine enorme Bandbreite, sie reichen von ökologischen Bekenntnissen (»Wir erkennen die Weisheit der eingeborenen Völker dieser Welt an«) bis zu Forderungen nach partizipatorischer Demokratie, nach Respekt vor der Artenvielfalt und nach Nachhaltigkeit und Gewaltlosigkeit. Einige dieser Ideale haben offensichtlich nicht das Geringste mit grünen Werten zu tun. Selbst grüne Schlüsselbegriffe wie Nachhaltigkeit sind notorisch schwer zu definieren. Hier herrscht ein hoher Klärungsbedarf.
Ein grundlegendes Problem besteht darin, Änderungen unseres Lebensstils durchzusetzen, die zu niedrigeren Emissionen führen. Wie können Regierungen und andere Akteure die Menschen dazu bringen, Lebensgewohnheiten zu ändern oder aufzugeben, die ihnen womöglich zur zweiten Natur geworden sind? Zwei Probleme erscheinen besonders schwer lösbar: Wie können wir die Neigung der Menschen zum Trittbrettfahren reduzieren, wo es doch so leicht ist, zu sagen: »Das Problem sollen andere lösen.« Und wie können wir der Neigung der meisten Menschen entgegenwirken, die Zukunft auf die leichte Schulter zu nehmen – wo es ihnen doch, wie psychologische Studien gezeigt haben, schwer fällt, der Zukunft einen vergleichbaren Realitätswert beizulegen wie ihren gegenwärtigen Bedürfnissen und Interessen?
Die Debatte über den Klimawandel handelt auf ganz grundlegende Weise von Risiken und deren Einschätzung. Wir wissen nämlich nicht und können nicht wissen, wie die Welt in zwanzig, dreißig oder vierzig Jahren aussehen wird, und müssen daher (wie das IPCC es tut) von Wahrscheinlichkeiten und möglichen Szenarien reden. Aus meiner Sicht sind die Gefahren, die die Radikalen unter den Klimawandel-Warnern an die Wand malen, real; wir können indes keine apodiktischen Aussagen machen – nicht ehe es schon zu spät ist und die Katastrophe sich schon ereignet hat. Doch wie können wir der breiten Öffentlichkeit eine Vorstellung von den Feinheiten der Risikoanalyse vermitteln? Welche Rolle können und sollen dabei die Medien spielen?
Es ist wenig wahrscheinlich, dass die Öffentlichkeit sich dazu bewegen lässt, sich voll hinter die Klimawandel-Politik zu stellen, wenn eine solche Politik sich ausschließlich auf Negatives stützt – will sagen auf die Reduzierung abstrakter künftiger Gefahren. Könnten wir nicht positivere Umweltwerte entwickeln? Es gibt genug Überschneidungen zwischen umwelt- und gesundheitspolitischen Zielvorstellungen, wie etwa die Forderung, weniger zu fahren und mehr zu Fuß zu gehen. Wie lassen sie sich auf eine Weise zusammenspannen, die dem Wahlvolk einleuchten und gefallen würde?
Politische Lösungen
Jeder Versuch, den Klimawandel einzudämmen, wirft eine große Zahl politischer Fragen auf, darunter die vielleicht grundlegendste: Bis zu welchem Grad sind Wachstum und Nachhaltigkeit (wie immer wir diesen vertrackten Begriff definieren) miteinander vereinbar? Ich möchte ein paar Anmerkungen zu lediglich drei Aspekten dieser Frage wagen: Was sollte die Rolle einer grünen Steuerpolitik sein? Inwieweit sind grüne Steuern mit dem Gebot vereinbar, soziale Gerechtigkeit zu bewahren oder zu verbessern? Und welche Konsequenzen ergeben sich aus den Überlappungen zwischen Klimawandel und Energiepolitik?
Was genau sind grüne Steuern? Die Antwort ist nicht so einfach, wie man meinen könnte.
– Wir können eine Unterscheidung treffen zwischen Steuern, deren Aufkommen ganz oder teilweise für Zwecke des Umweltschutzes ausgegeben wird, und solchen, deren Aufgabe darin besteht, das Verhalten von Menschen in Richtung auf größere Vereinbarkeit mit grünen Zielen zu beeinflussen. Steuern, die zum Beispiel in die Entwicklung von umweltfreundlichen Technologien investiert werden, fallen in die erstgenannte Kategorie. Steuern, mit denen Menschen dazu gebracht werden sollen, auf Fahrzeuge mit günstigeren Verbrauchswerten umzusteigen, die Zahl ihrer jährlich im Auto zurückgelegten Kilometer zu verringern, ihre Häuser besser zu isolieren etc., fallen in die zweite.
– Wir sollten anerkennen, dass bestehende Steuern, die ursprünglich nicht im Hinblick auf grüne Ziele eingeführt worden sind, solchen Zielen dennoch dienlich sein können – in diesem Sinn können wir sie als grüne oder »grünliche« Steuern bezeichnen. So können Steuern, deren Erträge in den Schienenverkehr investiert werden, wünschenswerte Auswirkungen für die Umwelt zeitigen, auch wenn dieser Gesichtspunkt bei ihrer Einführung keine Rolle spielte.
– »Antigrüne« Steuern müssen, wenn man die Implikationen einer bestehenden Steuerstruktur für die Umwelt bewertet, ebenso aufmerksam betrachtet werden wie grüne Steuern. Wir dürfen uns nicht ausschließlich auf letztere konzentrieren, sondern müssen auch solche Aspekte der gegenwärtigen Steuerpolitik untersuchen, die grünen Zielen zuwiderlaufen. Manche »antigrünen« Steuerregelungen mögen auf den ersten Blick erkennbar sein, wie die Tatsache, dass Flugzeugbenzin von den Steuern befreit ist, die auf die Treibstoffe anderer Verkehrsmittel erhoben werden. Anderswo wirkt die »antigrüne« Tendenz vielleicht eher im Verborgenen, etwa dort, wo der Staat die Plazierung von Einkaufszentren und Supermärkten dem freien Markt überlässt, ohne dass die Implikationen für den Autoverkehr mitbedacht werden.
– Im Licht dieser Überlegungen sollten wir grüne Steuern nicht isoliert vom fiskalischen System als Ganzem betrachten, wie es in Diskussionen oft der Fall ist. Anders gesagt, die Überprüfung des Steuersystems auf seine Grün-Verträglichkeit ist genauso wichtig wie die Einführung neuer grüner Steuern.