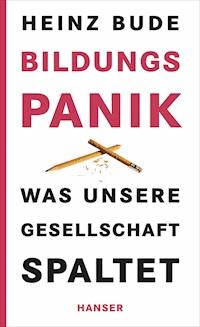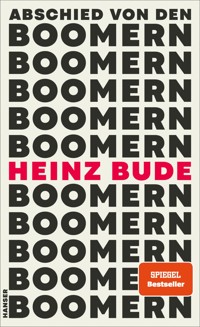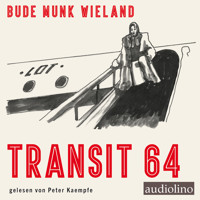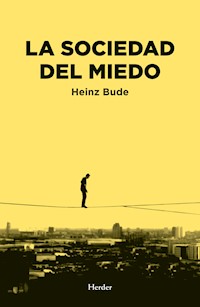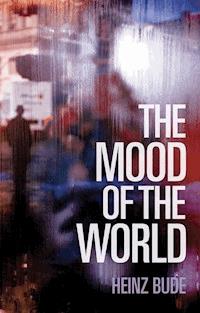Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marlene Dietrich als Bundespräsidentin? Das geteilte Berlin ist Schauplatz eines Verwirrspiels von Fakten und Fiktionen Es ist kalt in Ostberlin, als Marlene Dietrich im Januar 1964 für einen Zwischenstopp in ihrer früheren Heimatstadt landet. Mit Deutschland hat sie gebrochen und möchte so schnell wie möglich nach Warschau weiterreisen. Doch in Westberlin warten zwei Männer auf sie: Der Regierende Bürgermeister Willy Brandt und sein Sprecher Egon Bahr wollen sie bei der Wahl des Bundespräsidenten gegen den Alt-Nazi Heinrich Lübke antreten lassen. Was, wenn es so passiert wäre? Auf der Bühne des Kalten Krieges entwickeln BudeMunkWieland aus Fiktionen, Fakten und Bildern eine irrwitzige Geschichte. Sie handelt von Freiheit, Diktatur, Widerstand, Exil und Anpassung und verlängert das 20. Jahrhundert in die Gegenwart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Marlene Dietrich als Bundespräsidentin? Das geteilte Berlin ist Schauplatz eines Verwirrspiels von Fakten und FiktionenEs ist kalt in Ostberlin, als Marlene Dietrich im Januar 1964 für einen Zwischenstopp in ihrer früheren Heimatstadt landet. Mit Deutschland hat sie gebrochen und möchte so schnell wie möglich nach Warschau weiterreisen. Doch in Westberlin warten zwei Männer auf sie: Der Regierende Bürgermeister Willy Brandt und sein Sprecher Egon Bahr wollen sie bei der Wahl des Bundespräsidenten gegen den Alt-Nazi Heinrich Lübke antreten lassen. Was, wenn es so passiert wäre? Auf der Bühne des Kalten Krieges entwickeln BudeMunkWieland aus Fiktionen, Fakten und Bildern eine irrwitzige Geschichte. Sie handelt von Freiheit, Diktatur, Widerstand, Exil und Anpassung und verlängert das 20. Jahrhundert in die Gegenwart.
Bude Munk Wieland
Transit 64
Roman | Hanser
»Und was man ist, das blieb man andern schuldig.«
Johann Wolfgang von Goethe, Torquato Tasso, I,1
15. Januar 1964
DDR, Zentralflughafen Berlin-Schönefeld
Um die Wahrheit zu sagen, weiß sie vom ersten Moment an nicht, was sie hier eigentlich soll. Hier, in dieser Stadt, in der sie gefühlt vor zwei Jahrhunderten geboren worden ist und jetzt angeblich von einer Regierungsdelegation empfangen werden soll. Sie versucht sich zu erinnern, ob sie jemals schon in diesem Schönefeld gewesen ist. In Schöneberg geboren, aber Schönefeld? Eine Zigarette, ich brauche dringend eine Zigarette. Ich muss nur noch heil die Gangway runterkommen, im Flughafengebäude wird man wohl rauchen dürfen. War Lenin nicht Kettenraucher?
Sibirien ist das da draußen nicht, aber eiskalt wird es sein. Sie ist froh, dass sie den gefütterten Lammfellmantel anhat. Ihre Nerze sind verhökert, um Hotelrechnungen bezahlen zu können, aber dieser Lammfellmantel ist ihr geblieben, und der tut auch seine Dienste. Das Rollfeld sieht nass aus. Sie bindet sich ein Chiffonkopftuch um, knotet es unterm Kinn. Auf einmal hat Marlene Dietrich ein ganz kleines, trauriges Gesicht.
Das Empfangskomitee besteht aus drei Männern. Erwartungsvoll stehen sie im Nieselregen. Ihr Anführer, zu erkennen an seiner Teddy-Thälmann-Mütze, ist ein baumlanger Kerl mit der Figur eines Schwimmers. Seine tellergroßen Handrücken sind mit dunklen Haaren übersät. Mit dem Kopf noch in den Wolken, schreckt sie zurück, als er ihr mit einem schiefen, verunglückten Lächeln die noch eingepackten Blumen überreicht. Der Arme ist ganz nervös. Es war ein Fehler. Ich hätte keinen Zwischenstopp einlegen sollen. Von Paris nach Warschau, das wäre es gewesen. Die Franzosen und die Polen sind sich nah. Was mach ich nur bei diesem Scheißvolk, das sich sowieso nie ändern wird.
»Gnädige Frau, gestatten, mein Name ist Wolf Kaiser. Ich spiele den Mackie Messer und bin der Ersatz für Helene Weigel, die es ausdrücklich bedauert, dass sie Sie nicht persönlich in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik willkommen heißen kann. Als Künstlerin werden Sie sicher Verständnis dafür haben, dass die Arbeit Vorrang hat. Übermorgen ist Premiere von Mann ist Mann, sie leitet die Proben und ist unabkömmlich. Also hat sie mich gebeten, Ihnen zum Zeichen ihrer Hochachtung für Ihren Kampf gegen den Faschismus diese Blumen zu überreichen.«
Schade, dass sie nicht gekommen ist. Wir hätten zusammen eine rauchen können. So wie damals. Ob sie noch immer so stolz und scheu ist wie in den Zwanzigern? Waren wir nicht zusammen bei Schwannecke? Bein hat sie nie gezeigt, konnte dafür aber laut sprechen. Den Brecht hat ja keiner verstanden mit seinem Krächzen und seinem seltsamen Dialekt. Der konnte froh sein, dass er die Weigel hatte. »Danke.« Leise singt sie: »Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht, und Macheath, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.«
Es ist noch nicht einmal vier Uhr nachmittags, doch im Flughafengebäude, einem lang gestreckten Bau, brennt schon Licht. Wie schnell es hier im Winter dunkel wird. Als Kind mochte ich diese langen Dämmerungen, zarten Wintermorgenröten und nüchtern hellen Tagesfarben. Auf dem Schulweg frühmorgens, im Winter, kniff ich die Augen zusammen, und meine Tränen verwandelten das blasse Licht der Straßenlaternen in glitzernde Sterne. Wann habe ich damit aufgehört? Und wo sind eigentlich meine Zigaretten?
Die Empfangshalle gefällt ihr. Schnörkellos, klar, funktional, irgendwie preußisch. Marlene Dietrich findet sich im Transit wieder. Eine Heimatlose in der Heimat. Angekommen in einem Land, das ihr vollkommen fremd ist und das es noch nicht lange gibt. Ich gehöre nicht zu denen. Zu denen auf der anderen Seite aber auch nicht. Was haben die im Westen für ein Theater gemacht, als ich überlegte, ob ich nicht im Friedrichstadt-Palast auftreten soll.
»Gnädige Frau, im Namen des Deutschen Fernsehfunks und seiner Millionen Zuschauer diese Blumen. Wären Sie so freundlich und würden einige Worte an unsere Zuschauer richten?« Der eilfertige junge Mann mit dem kleinen Schnurrbart beugt sich zu ihr herunter und hält ihr das Mikrofon vor die Nase. »Nun, ich sage Grüß Gott, Guten Tag, wie geht’s euch.«
Grüß Gott, warum sagt sie denn Grüß Gott? Was soll das denn? Kein Berliner und erst recht kein Ostberliner sagt je Grüß Gott. Dem jungen Mann bricht der Schweiß aus. Schnell schiebt er die nächste Frage nach.
»Gnädige Frau, ist Ihnen bekannt, dass zurzeit Ihr Film Das Urteil von Nürnberg hier in den Filmtheatern läuft?«
»Nein, das weiß ich nicht«, antwortet sie mit gelangweiltem Dietrich-Unterton.
»Er läuft hier in Ostberlin, und viele Zuschauer können Sie darin bewundern. Hatten Sie große Freude an dieser Rolle?«
»Mmmmmm, nein, ich mach ja Filme nicht sehr gerne. Viel lieber mach ich, was ich jetzt mache.«
»Ahhh ja. Dürfte ich fragen, wohin Sie reisen und was Sie dort vorhaben?
»Ich fahre für drei Tage nach Warschau und singe dort zwei Vorstellungen am Tag.«
Dass sie im Mai und Juni Konzerte in Moskau und Leningrad geben wird, behält sie lieber für sich. Das hat ihr Rudi, ihr Mann, geraten. Der hat Angst um sie, wenn sie in den Osten reist. Rudi versteht auch nicht, warum sie sich das antut. Sie hat doch genug Angebote in der freien Welt, aber nein, es muss ausgerechnet Warschau sein. Das soll er mal ihr überlassen. Sie weiß genau, was sie tut.
Marlene Dietrich würde jetzt gerne aufstehen und gehen, aber das hat keinen Sinn. The show must go on. Im Hotelzimmer verdämmere ich nur den Tag, fühle mich nutzlos und einsam.
»Mackie Messer, haben Sie Feuer für mich?«
Warum schmeckt diese Zigarette so scheußlich? Das Kratzen im Hals — in Paris habe ich das nie. Wird wohl die Berliner Luft sein. Judgment at Nuremberg, das war doch mit dem jungen Maximilian Schell. Kam der sich wichtig vor. Setzte sich in den Drehpausen demonstrativ abseits und las Proust. Das passt doch überhaupt nicht zusammen: ein Filmstar und Proust. Ist eben ein Schweizer. Der ganze Film war eine einzige Zumutung. Immer diese schreckliche Marschmusik! Habe ich etwa mitgeschunkelt in der Rheinweinkneipe? Trink, Brüderlein, trink, so ein Quatsch. Nicht mal einen Vornamen hatte ich, spielte nicht die Witwe Bolte, sondern die Witwe Berthold, die an das bessere Deutschland glaubt. Wir müssen vergessen, war mein wichtigster Satz. Was für ein Quatsch! Pah! Alle Deutschen sind Ungeheuer. Boni fand mich großartig als Preußin. Schön, kalt, arrogant, abscheulich, genau so hat er es gesagt. Mit aristokratischer Haltung. Na ja. Noch großartiger wäre ein Oscar gewesen, aber den haben sie dem Schell zugeschanzt. Nicht einmal nominiert haben sie mich. Als Naziwitwe gewinnt man eben keinen Oscar.
Sie sind jetzt in einem Hinterzimmer gelandet. Sitzen leicht verlegen um einen viereckigen Tisch herum. Die Dietrich, Mackie Messer, der junge Mann mit dem kleinen Schnurrbart, der sein Mikrofon nicht aus der Hand legen mag, und mehrere Frauen und Männer, die sich als Journalisten vorstellen oder nichts sagen und eifrig fotografieren. Während die Dietrich, noch immer im Mantel mit Kopftuch, die beklommene Stimmung im Blitzlichtgewitter ignoriert, werden die anderen zusehends unruhiger. Ist diese elegante, leicht hochmütige Frau wirklich eine Antifaschistin? Sie hat einen US-amerikanischen Pass, vermutlich unendlich viel Geld und bestimmt noch nie eine Zeile Marx gelesen. Kann so eine überhaupt Antifaschistin sein? Über was sollen sie denn mit der reden? Vielleicht ist sie eine Spionin? Warum ist die Weigel nicht da? Die ist auch Schauspielerin und hätte die Situation im Griff.
Marlene Dietrich hat gar keine Lust, sich so kämpferisch antifaschistisch zu geben, wie die anderen gern glauben wollen, dass sie es sei. Sie sitzt da, lächelt in sich hinein und schaut dem bläulichen Rauch ihrer Zigarette nach, der sich in eleganten Schleifen im Raum verteilt. John ist im letzten Sommer hier gewesen, oder? Im Sommer ein Berliner und im Herbst erschossen in Dallas. Poetry and Power, das war einmal.
Erst als die Sektkorken knallen, lockert sich die Stimmung ein wenig auf. Hinter dem Eisernen Vorhang leben die doch sehr vergnügt. Was für ein Willkommen with the flowers and the excellent Russian Champagne.
»Nein, nein, von Straßenkämpfen zwischen Nazis und Kommunisten oder so habe ich nichts mitbekommen. Ich stand auf der Bühne oder war im Studio, hatte ein kleines Kind, musste arbeiten, Geld verdienen, hatte keine Zeit für solche Scherze. Politik hat mich nicht interessiert. Als der Stresemann starb, da war vielleicht was los. Überall Trauerflor, Trauermarsch, Trauermusik. Man wurde schon ganz kirre vor so viel Trauer. Der Stresemann sah ja noch nie sonderlich gesund aus, hab mich also nicht gewundert, dass der plötzlich umfiel — beim Zähneputzen, oder? — und tot war. Ich kann mich deshalb erinnern, weil das um die Zeit war, als der Sternberg mich als Lola engagiert hat. Die Dreigroschenoper, da hat der Stresemann noch gelebt, beim Blauen Engel, da war er schon tot. Und dann kam bald auch schon der Hitler. Aber da war ich nicht mehr in Berlin. Bin gleich nach der Premiere vom Blauen Engel am Bahnhof Zoo in den Zug nach Bremerhaven gestiegen. Die Nacht habe ich dann bereits auf dem Schiff nach Amerika verbracht. Der Sternberg hat ja in Hollywood auf mich gewartet. Wie der Brecht gewesen ist? Na, dazu kann ich nicht viel sagen. Kurz geschoren war der, hatte ’ne Drahtbrille auf wie mein alter Geschichtslehrer. Der Brecht saß eher am Rande, war jedoch der eindeutige Mittelpunkt. Er war ein Genie, das wussten alle und er am besten. Mit uns vom Film und der Revue hat der sich nicht abgegeben.«
Sie nippt an ihrem Glas. Auf einmal steht der junge Mann mit dem kleinen Schnurrbart wieder neben ihr. Was hat der denn da? Die werden mir doch nicht noch einen Orden verleihen wollen.
»Gnädige Frau, gestatten Sie, wenn Sie eine Nacht mal nicht schlafen können, dann haben Sie jetzt einen Begleiter.«
Dietrich fummelt mit ihren schwarz behandschuhten Händen ein Sandmännchen aus dem weißen Stoffbeutel. Sie hat keine Ahnung, wie stolz man beim Deutschen Fernsehen Ost darauf ist, dass dieses Sandmännchen noch vor dem Sandmännchen-West auf Sendung gegangen ist. Sandmännchen-Ost hat einen Spitzbart wie Walter Ulbricht, der Chef der DDR.
»Vorsicht, da ist noch einer drin.«
»Ach, der Kleine! Wie süß.«
Hilfe! Gleich klatschen die in die Hände und feiern mit mir Kindergeburtstag.
Marlene Dietrich hat zwei Spitzbart-Sandmännchen und das antifaschistische Blumengestrüpp vor sich liegen. Die DDR-Bürger sitzen erwartungsvoll um sie herum. Sie lächelt steif.
»Frau Dietrich, wir müssen unsere heitere Runde leider auflösen. Wie ich höre, ist der Wagen, der Sie zum Hotel bringen wird, vorgefahren«, schmettert Mackie Messer in die Runde.
Januar 1964
Westberlin, Marinesteig 14, Schlachtensee
Nach dem Aktenstudium bis tief in die Nacht, nachdem er alle Schriftstücke in Mappen gelegt und diese nach ihrer Wichtigkeit für den nächsten Morgen geordnet hatte, kam ihm der Gedanke, dass es Zeit sei, sich hinzulegen. In der Siedlung war er der Letzte, bei dem noch Licht brannte. Gern hätte er ruhig und mit halb geschlossenen Augen eine letzte Zigarette zum Abschluss des Tages geraucht. Aber dann ließ er es doch bleiben.
Willy Brandt hat es in der Zeit der Emigration verlernt, von selbst einzuschlafen. Es braucht den Gedanken dazu. Er muss sich einen Ruck geben für diesen Übergang in einen anderen Zustand des Bewusstseins. Im Schlaf kann er den Eindrücken und Einfällen nachgehen, die bei Tage unter all den Menschen über ihn gekommen sind. Wie das geht, weiß er nicht. An Träume kann er sich nur ganz selten erinnern.
Nach traumloser Nacht wird er von dem Wecker gegen 6:30 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Rut, die in der Nacht nicht mehr auf ihn gewartet hatte, schläft neben ihm in ruhigen Zügen. Noch zu benommen, um sich zu rühren, versucht er sich an die Stellung zu erinnern, in der er eingeschlafen war. Von da aus lässt sich vielleicht die Richtung der Wand, der Platz des Nachttischs und die Größe der Tür ableiten. So könnte er das Schlafzimmer und die Teile seiner Einrichtung im Geiste wiederherstellen und benennen. Es ist ihm ein Rätsel, wie man schon am frühen Morgen zu aufmunternden Bemerkungen aufgelegt sein konnte, als hätte es keine Nacht gegeben. Im Moment des Aufwachens kann einem alles entgleiten, wenn man den Zipfel der Realität nicht zu fassen bekommt, der einen aus dem Nichts zieht, aus dem man von selbst nicht herausfinden würde.
Allen am Frühstückstisch ist klar, dass es für ihn ein sehr langer Abend in der Mansarde gewesen ist. Um wieder auf die Beine zu kommen, lässt er sich von der Haushälterin, Frau Litzl, die sofort Bescheid weiß, einen tiefschwarzen Kaffee bringen.
Im Garten des Siedlungshauses in Schlachtensee hatten grau uniformierte Polizisten in der Nacht Wache geschoben. Junge Männer, die zum Objektschutz abgeordnet worden waren. Man hatte ihr Gemurmel hören können, das manchmal von leisem Lachen unterbrochen wurde und sich gegen Morgen mit dem beginnenden Gezwitscher der Rotkehlchen mischte. Das sahnefarbene Telefon mit dem schweren Hörer und der Lochscheibe, die nach jeder gewählten Zahl gleichmütig in die Ruhestellung zurücksurrte, war in dieser Nacht still geblieben. Nur die Vorkriegsschreibmaschine der Marke Erika, die mit Typen für das Norwegische versehen war, wartete darauf, bedient zu werden.
Man konnte den Vater noch weit nach Mitternacht tippen hören, aber keines der Kinder hätte sich getraut, danach zu fragen, was er da zu schreiben hatte. Was in seinem Kopf vorging, so das Gesetz der Familie, geht niemanden etwas an. Schon die Tatsache, dass die Eltern zu Hause Norwegisch miteinander sprechen, macht klar, dass ihr gemeinsames Leben in Berlin Teil eines Lebens ist, das ganz woanders begonnen hat.
Alle waren froh, wenn der Vater morgens mit am Tisch saß, zwar so gut wie nichts sagte, aber seiner Nacht entronnen war.
Vor dem Haus steht schon der Chauffeur Holly vor dem blitzblanken schwarzen Mercedes 190 mit dem Stern auf dem Kühler. Mit seiner ebenfalls schwarz glänzenden Schirmmütze auf dem bis zur Schädeldecke geschorenen Kopf wirkt er wie ein Mann mit Position. Georg Holly kennt sich aus mit seinem Chef. Man darf nichts erwarten, muss ihn in Ruhe lassen beim Studium der Akten und vor allem, wenn er mit einem Mal wie erstarrt nach draußen schaut, ohne irgendetwas im Blick zu haben. Mit einem schnellen Witz allerdings kann man ihn danach für einen unverbindlichen Moment amüsieren. Wenn sich dann die Lachfalten auf seinem Gesicht abzeichneten, war Holly zufrieden. Der Fahrer akzeptiert, dass er zur Ausstattung gehört, das macht ihm aber nichts aus, denn er spürt, dass dieser Regierende, der so gar nichts von einem hellen und bissigen Berliner hat, einen Pakt mit Berlin und den Berlinern eingegangen ist.
Willy Brandt hat nie Geld in der Tasche. Nicht um damit anzugeben, dass andere für ihn bezahlen müssen, sondern weil ihn Geld ganz einfach nicht interessiert. Als er sich mit neunzehn Jahren 1933 dem organisierten Widerstand gegen die Nazis anschließt und mit 100 Reichsmark von seinem Großvater und dem ersten Band des Kapitals von Karl Marx heimlich das Land verlässt, verabschiedet er sich auch von den Vorstellungen einer bürgerlichen Existenz. Wechselnde Wohnsitze, geheime Treffen, illegale Grenzübertritte und die Anfertigung von Berichten aus dem Untergrund lassen keine Zeit für einen regelmäßigen Broterwerb. Man schätzte die Qualität seiner Informationen, die Klugheit seiner Einschätzungen und vor allem den ungeheuren Mut, den dieser junge Deutsche bei der Organisation des Widerstands gegen Nazideutschland an den Tag legte. Widerstand bedeutete für ihn eine Existenz der Beweglichkeit, der Tarnung und der Verwandlung. Mal sieht man ihn mit der Schlägermütze als jungen klassenbewussten Proletarier, dann mit Schlips und Kragen als ehrgeizigen Studenten und wieder im Trench als Emissär der Auslandszentrale, der die Zellen des Widerstands stärken soll.
1938 wird Willy Brandt als Feind des deutschen Volks von den Nazis ausgebürgert und muss als Staatenloser sehen, wo er bleibt. Die Tatsache, dass er nach dem Sieg über die Nazis seinen Geburtsnamen Herbert Ernst Karl Frahm durch seinen Kampfnamen Willy Brandt ersetzt, stellt den Versuch dar, sein persönliches Leben mit einem politischen Namen zu beglaubigen. Den ersten Namen verdankt er dem Zufall seiner Geburt, der zweite ist Ausdruck seiner Freiheit.
Als der Regierende und sein Chauffeur in der Staatskarosse davonfahren, sieht man zwei Gestalten, die sich Tag für Tag treffen, aber anscheinend nichts miteinander zu tun haben. Was sie verbindet, ist die Situation einer Stadt, die von Feindesland umgeben ist.
Georg Holly hat sich warm angezogen und am Morgen seinen dicken Wintermantel im Kofferraum des Dienstwagens deponiert. Er wird, gleich nachdem er seinen Chef abgeliefert hat, zu der Schule um die Ecke fahren, um sich in der Schlange für einen Passierschein anzustellen. Zu Weihnachten hatte es nicht geklappt, aber jetzt will er unbedingt seine Mutter besuchen, die in Buchholz hinter der Zonengrenze auf ihn wartet.
Es gibt eine Fotografie aus dem Jahre 1947, die Willy Brandt und Rut Bergaust im Englischen Garten in Berlin zeigt. Das war ein Jahr vor ihrer Heirat. Sieben Jahre sind die beiden auseinander. Sie haben sich nach dem Tee, den man dort üblicherweise zu sich nimmt, in der Sonne noch ein Gläschen Weißwein genehmigt. Es ist eine verführerische Aufnahme aus dem Frühjahr. Willy im leger sitzenden Anzug mit Krawatte, die Zigarette freihändig lässig zwischen den schmalen Lippen, schaut ohne Vorbehalt in die Kamera, und Rut steht ihm mit ihrer metallenen Vollrandsonnenbrille und der schwingenden Lockenfrisur in nichts nach. Die beiden wollen etwas darstellen. Misstrauen und Angst hinter sich lassen.
April 1963
Paris, 25 Avenue Montaigne, Hôtel Plaza Athénée
Der General sah aus, als ob er verzaubert worden sei. Alles an ihm war lang geraten. Der Kopf, der Hals, die Beine und selbst die Ohren. Ruckartig riss er die Arme hoch, seine Uniformjacke bauschte sich wie ein Röckchen, und unter dem schwarz lackierten Schirm seiner Offiziersmütze stach seine lange Nase hervor. Er stand krumm, redete in eigentümlich monotonem Englisch. Eine halbe Million New Yorker hatte sich auf den Straßen Manhattans versammelt, um einen Vorgeschmack auf den Sieg über Nazideutschland zu bekommen. Unter dem Anführer der Free French Forces hatten sie sich ein anderes Kaliber vorgestellt. Doch selbst dieser komische Vogel, der für einen Militär eigentümlich ungelenk wirkte, konnte sie in ihrer Begeisterung nicht bremsen.
Dietrich war in Algier gewesen, hatte die Befreiung Roms miterlebt und am D-Day die Landung der Alliierten in der Normandie bekannt gegeben, aber dem General war sie noch nie begegnet. Seit einem Monat war sie wieder in New York.
Die Diva kam aus siegreicher Schlacht. Auf allen wichtigen Zeitungen prangte das Foto, wie sie, in einen Armeefliegeroverall gekleidet, aus der Flughafenkontrolle stürmte. Der Krieg hatte sie offensichtlich vitalisiert. Als ausrangierter movie star eingezogen und als taufrische Kämpferin gegen den Faschismus retour. Mit Soldatenstiefeln, in Offiziersuniform mit Krawatte, die Zigarette im Mundwinkel balancierend, schwirrte sie durch die New Yorker Nachtclubs. Ihre Fingernägel waren blutrot lackiert, ihr blondes Haar glatt nach hinten gebürstet und ihre Marschrichtung eindeutig: zurück an die Front! Keine, die sie nicht heimlich bewundert hätte. Und so war sie im Juli 1944 zum Empfang für Charles de Gaulle nicht als Hollywoodstar, sondern als Antifaschistin geladen gewesen. In einem lächerlich prunkvollen, heillos mit 19.-Jahrhundert-Scheußlichkeiten überladenen Hotelballsaal an der Park Avenue absolvierte Marlene Dietrich ihren ersten Auftritt auf dem politischen Parkett.
Gut zwanzig Jahre später — vor dem Badezimmerspiegel in ihrem Pariser Appartement in der Avenue Montaigne sich den Lidstrich nachziehend — fragt sie sich, ob der General sie wohl noch erkennen wird. Denn eigentlich müsste er sich heute Abend blicken lassen, wenn deutsche Kunst und Kultur zu Gast in Paris sind. Vor allem jetzt, nachdem sich Franzosen und Deutsche unverbrüchliche Freundschaft geschworen haben. Für Dietrichs Geschmack ist Adenauer — noch dazu im Vergleich mit ihrem Freund, Präsident Kennedy — viel zu alt für solch eine junge Freundschaft. Aber sie versteht die Deutschen sowieso nicht.
Sie kann das einfach. Sie betritt einen Raum, und alle Augenpaare sind sofort auf sie gerichtet. Die Gespräche verstummen. Selbst Malraux, der alte Poseur, hält inne, als er sie in der Tür stehen sieht, und eilt ihr mit kleinen Schritten entgegen. »Chère Marlène!«