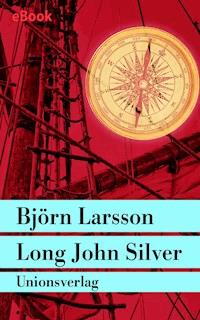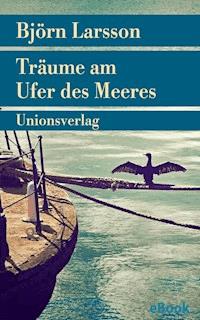
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit einem kleinen Küstenfrachter fährt der geheimnisvolle Kapitän Marcel um die Welt. Rastlos zieht er umher, ohne jemals wirklich irgendwo anzukommen. In vier Häfen begegnet er vier Menschen, deren Leben er für immer verändert. Er schenkt ihnen Hoffnung – und verschwindet dann spurlos. Ohne voneinander zu wissen, versuchen die Zurückgelassenen, ihn aufzuspüren. Schon bald wird die Suche nach Marcel zur Suche nach sich selbst und zur größten Herausforderung, der sie sich jemals stellen mussten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch
In vier Häfen begegnen vier Menschen einem geheimnisvollen Kapitän. Er verändert ihr Leben – und verschwindet dann spurlos. Ohne voneinander zu wissen, versuchen sie, ihn aufzuspüren. Schon bald wird die Suche nach dem Kapitän zur Suche nach sich selbst und zur größten Herausforderung, der sie sich jemals stellen mussten.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Björn Larsson (*1953) ist Professor für Französisch in Schweden, seine Leidenschaft ist aber das Segeln, das er mit der Schriftstellerei verbindet. Im Sommer lebt er auf einem Segelboot. Björn Larsson wurde u. a. 2004 mit dem schwedischen Literaturpreis Östrabopriset ausgezeichnet.
Zur Webseite von Björn Larsson.
Jörg Scherzer ist als Übersetzer aus dem Dänischen, Norwegischen und vor allem aus dem Schwedischen tätig.
Zur Webseite von Jörg Scherzer.
Knut Krüger, geboren 1966, ist freier Autor, Lektor und Übersetzer für englische und skandinavische Literatur. Nach seinem Germanistik-Studium arbeitete er im Buchhandel und im Verlagswesen. Krüger lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in München.
Zur Webseite von Knut Krüger.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Björn Larsson
Träume am Ufer des Meeres
Roman
Aus dem Schwedischen von Jörg Scherzer und Knut Krüger
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1998 bei Norstedts Förlag AB, Stockholm.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 im Berlin Verlag.
Originaltitel: Drömmar vid havet
© by Björn Larsson 1998
Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit der Nordin Agency AB, Schweden.
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Tyler Wanlass (Unsplash)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-30997-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.05.2024, 01:28h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
TRÄUME AM UFER DES MEERES
Erster Teil1 – Es gab Tage auf dem Atlantik, an denen …2 – Es gab Wintertage in Villagarcía de Arousa …3 – Es gab Wintertage in Tréguier, die leblos und …4 – Es gab Wintertage in Kinsale, die von einer …5 – Es gab Wintertage in Marstal, an denen die …6 – Rosa Moreno betrachtete sich im Spiegel. Ihre Augen …7 – Den dritten Tag hintereinander ging Peter Sympson auf …8 – Madame Le Grand stellte ihren Citroën auf dem …9 – Es hatte Jacob Nielsen erschüttert, was er nach …10 – Auf See gab es Sonnenuntergänge von schmerzlicher Schönheit …Zweiter Teil11 – In Villagarcía war Weihnachtsmorgen, ein ganz normaler Weihnachtsmorgen …12 – Es war am Heiligen Abend. Den ganzen Morgen …13 – Es war einer der letzten Tage vor Weihnachten …14 – Jacob Nielsen hatte beschlossen, einen letzten Versuch zu …15 – Rosa Moreno wachte mit einem Ruck auf und …16 – Die Luft war so klar, dass sie fast …17 – Den ganzen Morgen waren Autobusse in Tréguier angekommen …18 – Am Morgen des ersten Weihnachtstages, rotäugig und übernächtigt …19 – Es gab auf See Morgendämmerungen von seidiger Sanftheit …Dritter Teil20 – Um drei Uhr morgens lag der Hafen von …21 – Madame Le Grand traf ihre Entscheidung nach einer …22 – Jeweils spät am Vormittag ging Jacob Nielsen hinunter …23 – Es war Sonntag. Peter Sympson saß im Pub …24 – Verstohlen beobachtete Tim seine vier Gäste, von denen …25 – Zum ersten Mal seit vielen Jahren blieb Marcel …26 – Die vier standen auf dem Kai und sahen …27 – Peter Sympson schloss seine Ladentür auf und bat …28 – Madame Le Grand und Jacob Nielsen trafen sich …29 – Um Punkt sechs Uhr öffnete sich die Tür …30 – Sundgren fragte sich besorgt, was eigentlich los war …31 – Die Passagiere kamen. Maman zuerst, mit ihrem Koffer …Vierter Teil32 – Es war der erste Abend, den sie in …33 – Der Kopf drehte sich Rosa Moreno, als sie …34 – Es war an ihrem ersten Tag in Baltimore …35 – Bereits am ersten Tag, den sie in Baltimore …36 – Es war der zweite Abend, den sie in …37 – Am zweiten Morgen vor Anker, noch bevor er …38 – Als Sundgren sich nach dem Lunch erbot …39 – Es war der dritte Abend, den sie in …40 – Es war der dritte Morgen, den sie in …41 – An diesem dritten Morgen, den sie in Baltimore …42 – Es war der vierte Abend, den sie in …43 – Rosa Moreno ging langsam die Treppe hinunter …44 – Peter Sympson fühlte sich zugleich bedrückt, beschwingt und …45 – So ist das also, dachte Madame Le Grand …46 – Jacob Nielsen hatte Marcels Geschichte mit wachsender Verwunderung …47 – Nachdem alle Passagiere die Kabine verlassen hatten …48 – Rosa Moreno hatte das Bewusstsein zu keiner Zeit …49 – Marcel kam um zwei Uhr morgens auf die …50 – Es gibt Tage auf dem Nordatlantik, die im …Mehr über dieses Buch
Über Björn Larsson
Über Jörg Scherzer
Über Knut Krüger
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Björn Larsson
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Irland
Zum Thema Spanien
Zum Thema Dänemark
Zum Thema Liebe
Zum Thema Meer
Erster Teil
1
Es gab Tage auf dem Atlantik, an denen sich der Horizont nach allen Seiten ins Unendliche erstreckte. Tage, an denen Himmel und Meer dieselbe tiefblaue Farbe hatten, an denen eine scharfe Sonne aufgebrachte Wassermassen beleuchtete und kreideweiße Brecher zu Schaumstreifen auseinandergeblasen wurden. Tage, an denen das Schiff sich in den gewaltigen Wellenbergen wälzte, während ein felsenharter Wind Wasserdampf aufrührte, der am Bug kurzlebige Regenbogen aufblitzen ließ. So mancher hätte für solche Tage sein Leben gegeben, bildlich gesprochen zumindest. Die meisten hätten allerdings alles gegeben, um sie gerade nicht erleben zu müssen, und das vermutlich aus Furcht vor dem Tod. Oder vor dem Leben.
An einem solchen Tag passierten sie die Insel Salvore an der Mündung des Ría Arousa und kamen endlich in Lee. Die Reise war in den letzten Stunden großartig gewesen, allerdings auch schwierig. Langsam und stetig hatte der Wind den ganzen Morgen über zugenommen, gegen Mittag hatte er dann volle Sturmstärke erreicht. Die Brecher auf dem Atlantik hatten sich zu Ungeheuern ausgewachsen, die ihr Schiff mit seinen dreißigtausend Tonnen herumwarfen wie ein Spielzeugboot. Glücklicherweise fuhren sie mit voller Ladung, die nach allen Regeln der Kunst unter Deck festgezurrt und verkeilt war. Und wenn nur jeder tat, was er zu tun hatte, gab es eigentlich keinen Grund zur Besorgnis.
Steuermann Sundgren hatte das Schiff geschickt geführt.
Nicht ein einziges Mal hatte er eine Schwäche gezeigt. Die Wende zur Mündung des Ría Arousa war meisterhaft ausgeführt worden; klar, entschieden, rasch, mit exakten Ruderbewegungen in genau dem richtigen Augenblick zwischen zwei Serien besonders hoher, steiler Wogen. Darum wäre es ein Fehler gewesen, wenn Marcel, der Kapitän, jetzt, da die schlimmste Strecke hinter ihnen lag, das Ruder übernommen hätte. Sundgren sollte das Gefühl auskosten können, dass er die Aufgabe, die ihm übertragen worden war, auch gelöst hatte: Und diese Aufgabe war, sie sicher in den Hafen zu bringen.
Marcel und Sundgren fuhren fast fünfzehn Jahre miteinander zur See. Einst war Marcel sogar Steuermann unter Sundgren gewesen, bis der eines Tages auf eigenen Wunsch einen niedrigeren Dienstgrad übernommen hatte. Sundgren war ein erstklassiger Seemann, der selten oder niemals Fehler machte. Aber um welchen Preis? Da war ein nagendes Gefühl der Angst vor jedem Manöver und jeder Entscheidung, eine zehrende Furcht vor allen möglichen Unfällen und unerwarteten Ereignissen an Bord und eine ständige quälende Sorge, was sich am Kai und beim Festmachen wieder ereignen könnte. Ein Außenstehender hätte wohl gedacht, Sundgren wäre ein Mann, der es mit allen Schwierigkeiten der Welt aufnehmen konnte, aber so war er nicht. Wirkliche Unfälle, vor allem jene, die sich an Land ereigneten, nahm er meist gleichmütig hin, doch gerade der Gedanke an das, was sich womöglich ereignen konnte, erfüllte ihn mit tiefer Unruhe und schlimmen Ahnungen. Sundgren hätte in jedem beliebigen Hafen und unter allen denkbaren Bedingungen spielend leicht anlegen können. Aber um seines Seelenfriedens willen war es ihm lieber, dass Marcel das Steuer übernahm, wenn die Verantwortung am schwersten wog.
Sundgren blickte Marcel an, als sähe er ihn zum ersten Mal. Während seines langen Lebens auf See hatte Sundgren viele Menschen kennengelernt, aber noch keinen, dem Sorgen und Grübeleien so fremd schienen wie Marcel. Wie stellte er das nur an?
Er war ein kompetenter Offizier, natürlich, und sogar einer der besten. Doch es war mehr, es schien, als könnte ihm einfach überhaupt nichts etwas anhaben. Marcel war wie ein Kind – oder jedenfalls so, wie man es von Kindern gewöhnlich erwartet. Sundgrens eigenen beiden Kinder waren, so gesehen, ziemlich missraten. Was im Grunde gar nicht so erstaunlich war. Er selbst war auch nicht gerade, was man eine Frohnatur genannt hätte.
»Du nimmst die Dinge zu schwer«, hatte Marcel schon häufig zu ihm gesagt.
»Vielleicht«, hatte Sundgren ebenso häufig geantwortet. »Aber was soll ich dagegen tun?«
Darauf hatte Marcel keine Antwort als: die Dinge eben einfach nicht zu schwernehmen, mehr nicht. Daran schien sich auch Marcel selbst zu halten. Er war Kapitän zur See, mit den entsprechenden Balken auf den Schulterklappen, mit einer Position und mit Verantwortung, doch im Grunde schien es, als sei ihm das alles völlig gleichgültig, und als könnte er das Schiff jeden Augenblick verlassen und auf einer Insel in der Karibik oder sonst irgendwo in einer Hütte leben. Sundgren durchschaute Marcel nicht, er wusste fast nichts von seinem Leben und seiner Vergangenheit, nur, dass er in Jakarta geboren und ein halber Holländer war und dass er, Sundgren, ihn über alles schätzte. Ohne Marcel an Bord wäre er selbst das reinste Nervenbündel gewesen, außerdem ein griesgrämiger, ängstlicher Tyrann, und er hätte sich aus all diesen Gründen selbst gehasst.
Aber was war an Marcel, das so vielen anderen fehlte?, fragte sich Sundgren, als er sah, wie Marcel in Hemdsärmeln bei schweren Sturmböen draußen auf der Brücke stand und das Anlegen des Schiffs dirigierte, ohne auch nur das geringste Zeichen von Unruhe oder Nervosität zu zeigen. Wie in aller Welt gelang es Marcel, die Dinge so verdammt leicht zu nehmen, als wäre das Leben ein Spiel oder eine gute Geschichte, die man sich vor dem Mast erzählte? Sundgren wusste es nicht, und vielleicht wollte er es auch gar nicht wissen. Ihm selbst ging es am besten, wenn sein Leben in festen und vorhersagbaren Bahnen verlief, wenn er wusste, wo er hingehörte, und auch nichts anderes anstrebte. Es genügte ihm vollkommen, wenn er mit Marcel fahren durfte. Er musste nicht auch noch sein wie er.
2
Es gab Wintertage in Villagarcía de Arousa, da brüllte das Meer all seinen Zorn aus sich heraus und schien sich an den Menschen rächen zu wollen, weil sie es für ihre eigenen Zwecke ausbeuteten. Tage, an denen der Südwestwind zwischen den Häusern heulte und tobte und die kurzen, steilen Wogen draußen auf dem Ría einen irrsinnigen Kampf darüber austrugen, welche von ihnen sich als erste auf den Strand stürzen durfte. Tage, an denen man das ohrenbetäubende Grollen der gewaltigen Dünung zu hören glaubte, die unablässig auf die Felsenhänge weiter im Westen hämmerte.
An solchen Tagen wurde Rosa Moreno von Furcht überwältigt. Sie stand hinter einer Häuserecke, ein Platz, von dem aus sie auf das weiß schäumende Wasser blickte, und fragte sich, ob sie in ihrem Leben noch jemals fortgehen würde. Ob sie also überhaupt jemals zu leben wagen würde.
Solange sie denken konnte, hatte sie diese brennende Sehnsucht in sich gespürt. Was konnte sie? Außer vier Semestern Jura hatte sie nicht viel vorzuweisen. In dem Café, in dem sie arbeitete, behaupteten manche, sie habe Ähnlichkeit mit Ingrid Bergman, sie, Rosa Moreno, habe das Lächeln der Bergman.
Möglich war es. Sie war mit dem Zug nach Vigo gefahren, um sich einen Film mit Ingrid Bergman anzusehen, aber sie war nicht Ingrid Bergman und würde es niemals sein. Vielleicht hatte sie ihr Lächeln, aber das war alles. Sie war nicht dumm, aber wen interessierte das? Was allein zählte, war, dass man die Beste war, und sie wusste mit absoluter Sicherheit: Das war sie nicht. Sie war beliebt bei den Gästen des Cafés, das schon, und vielleicht würden sie sie sogar eine Zeit lang vermissen, wenn sie kündigte. Doch sie würden ihretwegen nicht in ein anderes Café gehen, und was nützte es ihr, wenn man sie eine Zeit lang vermisste? Die Schmerzen, die sie im Körper und in ihrer Seele empfand, konnte es nicht lindern.
Wenn sie sich selbst für den Rest ihres Lebens im selben Lokal stehen, das gleiche Bier servieren, die gleichen Scherzworte rufen hören, die gleichen Scheiben jámon serrano abschneiden sah und dazu die immer gleichen Kommentare über all die Fußballspiele im Fernsehen hörte, dann war ihr, als werde alles schwarz um sie herum, als habe es gar keinen Sinn zu leben, sosehr sie sich auch bemühte.
Am schlimmsten war es an jenen Tagen, an denen eine Laune des Wetters die Fischerflotte von Villagarcía zwang, im Hafen zu bleiben, nicht nur die großen Trawler, die auf die offene See hinausfuhren, sondern auch die kleinen, flachen Boote, die nur ihre viveros absuchten, ihre Muschelbänke, die wie ein Flickenteppich im normalerweise ruhigen Wasser des Ría lagen. Dann duckten sich die Fischerboote wie erschrockene Hühner hinter dem Pier, der von weißem Schaum überspült wurde. Die Fischer lehnten wie sie selbst an den Häuserecken und taten nichts als warten.
Denn so war es einfach. Wenn im Winter der Sturm aus Südwesten kam, hörte in Galizien das Leben auf. Als hätte man die Nachrichten im Fernsehen einen Augenblick auf dem unscharfen Bild eines Bankräubers angehalten. Wer?, fragte sich Rosa Moreno. Wer trug die Verantwortung? Sie selbst, Gott, die Sterne oder irgendjemand sonst?
Sie hoffte, dass der Sturm sich bald legen werde, damit sie noch zusehen konnte, wie sich die Fischer aufs Meer hinauskämpften, ehe sie selbst ihren Dienst im Café antrat. Sie wollte sehen, wie sie die Leinen losmachten und auf den Horizont zufuhren. Mit eigenen Augen musste sie sehen, dass zumindest ein paar Menschen die Freiheit besaßen, zu kommen und zu gehen, wie sie wollten.
Sie sah auf die Uhr. Bald musste sie los. Gerade wollte sie sich umdrehen, als sie hinter der Nordspitze der Isla Arousa den Bug eines Schiffs sah. In das eingefrorene Standbild kam Leben. Die Fischer traten einen Schritt vor, um zu sehen, was für ein Schiff es war, das sich da offensichtlich auf dem Weg in ihren Hafen befand, um Schutz zu suchen. Sie alle wussten, dass Schiff und Mannschaft um das nackte Überleben gekämpft haben mussten, ehe sie in den Ría Arousa einfuhren.
Rosa Moreno blieb stehen, wo sie gerade stand, obwohl sie sich auf den Weg zum Café hätte machen müssen. Der schwarze Rumpf stampfte und rollte in der unruhigen See. Sie hielt den Atem an. Auch ihr war klar, dass es kein Kinderspiel war, ein Schiff bei Südweststurm in den Hafen von Villagarcía zu legen. Erst in der vergangenen Woche war vor La Coruña ein Tanker auf Grund gelaufen – dann war er entzweigebrochen, explodiert und hatte das Meer in Brand gesteckt. Und drei Wochen vorher war ein dänisches Schiff vor Kap Finisterre aufgelaufen und hatte den größten Teil der Besatzung mit in die Tiefen des Atlantiks gerissen. Vor den Gästen war sie im Café in Tränen ausgebrochen, als sie im Fernsehen gezeigt hatten, wie die Rettungsmannschaften den Steuermann und drei andere Besatzungsmitglieder an Land brachten.
Die Gäste hatten sie fragend angesehen, und einer hatte schließlich gefragt, warum sie weinte. Sie hatte gesagt, dass sie an ihren Bruder denken musste. Dass sie auch um ein paar Dänen und ein Dutzend Filipinos weinte, die für immer von dieser Erde verschwunden waren, sagte sie lieber nicht. Niemand hätte es verstanden.
Das Schiff draußen auf dem Ría kam näher. Jetzt, wo es ruhigeres Wasser erreicht hatte, stampfte es weniger. Aber die Wellen waren kabbelig und schickten Wasserkaskaden bis hinauf zur Kommandobrücke. Sie kniff die Augen zusammen. Träumte sie, oder stand dort ein Mensch auf der Brücke? Natürlich, ein Mann. Im Hemd.
Sie eilte zum Hafen hinunter, denn eigentlich hatte sie jetzt wirklich keine Zeit mehr. Sie ging so weit hinaus auf den Pier, wie sie es wagen konnte, ohne fürchten zu müssen, dass sie durchweicht oder einfach ins Meer gewaschen wurde.
»Er hat nur eine Chance«, hörte sie einen der Fischer sagen. »Wenn er die Leinen nicht gleich beim ersten Mal belegt, treibt er durch das Hafenbecken. Gott weiß, was dann passiert.«
Was redeten die? Sie ballte erschrocken die Fäuste, dass die Knöchel weiß wurden.
Zwei Fischer kämpften sich durch den Wind und die Wasserkaskaden bis zum Vertäuungspoller ganz draußen auf dem Pier vor. An Land musste jemand mit den Leinen helfen, wenn alles gut gehen sollte. Wie gern hätte sie geholfen! Aber sie wäre ja doch nur im Weg gewesen.
Jetzt war der Mann auf der Brücke deutlich zu erkennen. Zu ihrem Erstaunen sah sie, dass er gelassen lächelte. Konnte das denn wahr sein? Ja, der Kapitän, falls es der Kapitän war, sah gerade so aus, als wäre das Ganze nur ein Spiel für ihn. Mit einem Mal legte sich ihre Furcht. Mit einem Mal war sie sich sicher, dass dem Schiff nichts geschehen würde.
Sie hob den Arm halb und winkte schüchtern.
»Meinst du, der Kapitän hat jetzt Zeit, an Weiber zu denken?«, rief einer der Fischer, und die anderen lachten laut.
Rosa Moreno hörte kaum, was sie sagten. Sie verfolgte die geringste Bewegung des Kapitäns mit dem Blick, und mitten in all dem Trubel schien er sie tatsächlich gesehen zu haben. Sie traute ihren Augen nicht: Der Kapitän hob den Arm und winkte zurück.
»Ein Mädchen in jedem Hafen«, brüllte Pedro gehässig. »Hab gar nicht gewusst, dass es solche Mädchen in Villagarcía gibt.«
Ebenso gut hätte er sie Hure nennen können. Nicht, dass ihr das etwas ausgemacht hätte. Wichtig war nur, dass sie dem Kapitän aufgefallen war und nicht bloß irgendeine unbedeutende Zweiundzwanzigjährige war, die nutzlos auf dem Kai stand, während alle anderen herumrannten und ihre Arbeit taten.
Plötzlich befand sich der Bug des Schiffs auf gleicher Höhe mit ihr. Ging das nicht zu schnell? Sie hörte die Maschine aufbrüllen und sah, wie der Rumpf bebte, als der Kapitän volle Kraft zurück befahl. Zwei Führungsleinen wurden vom Bug und von achtern geworfen, sie ringelten sich durch die Luft und landeten genau vor den Füßen der Fischer, die auf dem Pier bereitstanden. Sie holten ein, als sei ihr letztes Stündlein gekommen. In der Klüse tauchten jetzt die großen Trossenschlaufen auf, und es dauerte nicht lang, bis sie um die Poller lagen und sich mit den Bewegungen des Schiffs streckten. Sobald es am Kai stilllag, wurden weitere Führungsleinen geworfen und neue Trossen an Land gezogen und belegt. Binnen weniger Minuten war das Schiff eingesponnen in ein Spinnennetz aus Tauen, die so straff gespannt waren, dass sie zitterten. Aber es lag sicher. Und die ganze Zeit hatte der Kapitän ungerührt auf seiner Brücke gestanden. Rosa Moreno war ganz sicher, dass er ihr ein besonderes Lächeln zuwarf, als alles beendet war.
»Teufel auch!«, rief einer der Fischer und warf bewundernde Blicke hinauf zur Brücke. »Und ohne Schlepper!«
Rosa Moreno freute sich für den Kapitän. Sie allein hatte recht behalten, und die anderen hatten sich getäuscht.
»Du bist hier?«, fragte eine Stimme hinter ihr.
Sie drehte sich um. Es war Mario.
»Hättest du nicht schon vor einer Viertelstunde bei der Arbeit sein sollen?«
Sie nickte, sah aber vielsagend hinüber zum Schiff.
»Ich sehs«, sagte Mario. »Aber Mercedes wartet auf die Ablösung. Ich denke, das ist wichtiger als ein Schiff, das zufällig nach Villagarcía kommt. Du nicht?«
Rosa Moreno warf einen raschen Blick zurück. Bevor sie ging, sah sie noch, wie der Kapitän an der Reling auftauchte. »Tut mir leid«, sagte sie zu Mercedes, sobald sie das Café betrat. »Ich hab zugeschaut, wie ein Schiff in den Hafen eingelaufen ist.«
»Ach ja! Und ich?«, fragte Mercedes.
»Ich weiß«, sagte Rosa Moreno. »Aber es war spannend. Die Fischer haben nicht geglaubt, dass der Kapitän bei diesem Sturm würde anlegen können. Aber das hättest du sehen sollen! Er hatte sogar Zeit, mir zuzuwinken.«
»Du bildest dir was ein«, sagte Mercedes. »Ich kapier nicht, warum du dir hier keinen Verlobten zulegst, statt den Seeleuten nachzulaufen.«
Rosa Moreno gab keine Antwort und grüßte stattdessen die wenigen Gäste. Immerhin war sie bei ihnen beliebter als Mercedes. Vielleicht tat Mercedes darum alles, um sie als leichtfertiges, verrücktes Ding hinzustellen.
Rosa Moreno setzte sich auf den blank gescheuerten Hocker neben der Kasse. War das das Leben? Auf einem Hocker sitzen, aus dem Fenster sehen, auf eine Bestellung warten, und dann auf noch eine, bis man heiratete, Kinder bekam, alt wurde und starb? Wenn wenigstens ab und zu neue Gäste gekommen wären! Aber das Café lag in einer dunklen Seitenstraße, und nicht einmal die Touristen fanden im Sommer den Weg dorthin. Und wer doch die Nase hineinsteckte, kam selten ein zweites Mal.
Manchmal hatte sie sich überlegt, dass sie sich in den großen Cafés unten am Hafen Arbeit suchen sollte, oder vielleicht sogar im Restaurant des Jachtklubs. Dorthin kamen wenigstens Menschen, die nicht durch allerlei Zwänge gefesselt waren – Segler und Seeleute, von allen Enden der Welt, auf dem Weg zu allen Enden der Welt.
Aber bei der herrschenden Arbeitslosigkeit etwas anderes zu bekommen, war nicht leicht. In Spanien gab es Millionen von Arbeitslosen. In ganz Europa über zehn Millionen, mehr, als Galizien Einwohner hatte. Wie viele mochten es auf der ganzen Welt sein? Unter so vielen war sie noch bedeutungsloser, jemand, den man gar nicht sah.
Außerdem war ihr Ruf auch nicht der beste. Sie war beliebt, das wohl, aber sie war unbedacht, eine Träumerin, eine, die nicht mit beiden Beinen auf der Erde stand, und wer stellt schon einen solchen Menschen ein? Mario behielt sie aus Mitleid, das wusste sie, weil ihr Bruder ertrunken war und sie beide Findelkinder gewesen waren. Aber Mitleid half ihr nicht zu leben.
Als der Kapitän des Schiffs in der Tür des Café Sport stand, war sich Rosa Moreno sofort sicher, dass es kein Zufall war. Alle ihre Horoskope hatten es vorausgesagt. Gerade in dieser Woche würde sie höchstwahrscheinlich eine neue Bekanntschaft machen und Gefahr laufen, sich zu verlieben, vermutlich in einen Steinbock.
Rosa Moreno glaubte nicht, dass die Horoskope immer die Wahrheit sagten. Aber wie oft behielten denn die Ökonomen mit ihren Vorhersagen über die Entwicklung von Zinsen und Aktienkursen und Defiziten recht? Und wie oft lagen die Politiker richtig, wenn sie von der Zukunft sprachen?
Im Übrigen war sie nicht die Einzige, die dumm und gutgläubig war, wenn sie es überhaupt war. In der Zeitung hatte sie gelesen, in Frankreich gebe es zehntausend Berufsastrologen, und hunderttausend Franzosen gingen regelmäßig zu einem von ihnen. Unter zehn Firmen zog eine einen Astrologen hinzu, wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt werden sollte. Waren das alles Dummköpfe? Warum sollte sie nicht an die Sterne glauben?
Aber als im letzten Jahr der Vatikan den neuen Katechismus veröffentlichte, war Mercedes ins Café Sport gerannt, obwohl sie an dem Tag gar keinen Dienst hatte. Sie hatte das siebenhundert Seiten dicke Buch aufgeschlagen und laut daraus vorgelesen, damit alle die kraftvollen Worte hörten, mit denen die katholische Kirche die Astrologie und andere Irrlehren dieser Art verdammte.
»Gott hat doch auch die Sterne geschaffen«, hatte Rosa Moreno einzuwenden gewagt. »Wer weiß, ob er sie nicht auch benutzt, um zu uns zu sprechen?«
»Glaubst du nicht, dass der Papst das besser weiß als du?«, hatte Mercedes sie abgefertigt.
Rosa Moreno hatte nicht geantwortet. Sie konnte nicht sagen, dass sie nicht an Gott glaubte, weil Gott ihr nicht geholfen hatte zu leben. Gott hatte ihre Mutter nicht daran gehindert, sie und ihren Bruder Cecilio im Stich zu lassen, weshalb sie zuerst in einem Kinderheim und anschließend bei Adoptiveltern gelandet waren. Gott hatte nicht verhindert, dass Cecilio von dem Fischerboot, auf dem er arbeitete, über Bord gespült wurde. Und Gott hatte auch Mercedes nicht geholfen, glücklich zu werden. Missgünstig und kleinlich war sie, trotz ihres Glaubens. Und wozu brauchte man Gott, wenn nicht, um glücklich zu werden?
Der Kapitän lächelte sie an und setzte sich auf den Barhocker schräg gegenüber der Registrierkasse, als wüsste er, dass auch Rosa Moreno immer genau dort saß, wenn auch auf der anderen Seite der Theke und nur, wenn sie gerade nicht servierte.
»Ich heiße Marcel«, sagte er in gutem Spanisch, obwohl er das R nicht rollte. »Und Sie?«
»Rosa Moreno.«
Marcel sprach es ihr nach, und ihr gefiel, wie er ihren Namen sagte. Es klang, als komme er von irgendwo anders, als sei es ein irgendwie exotischer Name.
Marcel öffnete einen weißen Leinwandbeutel und nahm eine große Dose Rolltabak heraus, die er auf den Tisch stellte. Noch nie hatte Rosa eine so große Tabaksdose gesehen. Sie fasste sicher einen halben Liter. Sie fragte, ob das nicht unpraktisch sei, mit einer so großen Dose herumzulaufen, wo es doch kleinere Tabakpäckchen gab, die in einer Hosentasche Platz fanden.
»Daran habe ich noch nie gedacht«, antwortete Marcel. »In meinem Beutel habe ich alles, was ich brauche, meinen Tabak, mein Geld, Zahnbürste, Rasierapparat, Stift, Papier. Man kann nie wissen.«
»Was kann man nie wissen?«, fragte Rosa Moreno.
»Ob man nicht plötzlich fortwill. Oder einfach bleiben, wo man ist. Hier zum Beispiel.«
»In Villagarcía?«, rief Rosa Moreno ungläubig.
»Nein, im Café Sport. So heißt es doch, oder?«
»Warum sollten Sie hierbleiben wollen? Sie sind Kapitän. Sie haben ein Schiff.«
»Na und? Wäre es nicht ebenso gut, hier zu sitzen und ein schönes Mädchen wie Sie anzusehen?«
Rosa Moreno fühlte, dass sie rot wurde. »Das sagen Sie nur so«, sagte sie. »Zu allen Mädchen in allen Häfen. Aber Sie meinen es nicht ernst.«
»Doch«, sagte Marcel. »Das tue ich. Sie sind schön. Sie haben ein schönes Lächeln.«
»Wie Ingrid Bergman?«, fragte Rosa Moreno beiläufig.
»Möglich, aber ich vergleiche nicht. Wie es ist, ist es schön.«
Zum ersten Mal hatte jemand zu ihr gesagt, es sei genug, wenn sie so war, wie sie war. Trotzdem glaubte sie nicht, dass er auch meinte, was er sagte.
»Ich bin immer darauf gefasst zu bleiben oder fortzugehen«, erklärte er. »Ich habe das in Indonesien gelernt, da bin ich geboren. Stellen Sie sich vor, ich komme eine Woche lang jeden Abend hierher, während mein Schiff gelöscht wird, und in dieser Zeit verliebe ich mich in Sie. Würde ich dann wieder wegfahren? Würde ich nicht viel glücklicher werden, wenn ich hierbliebe? Ein Schiff findet immer einen neuen Kapitän. Aber ein Mädchen, in das man sich verliebt hat, kann man nicht einfach austauschen.«
»Sie können das Mädchen doch mit an Bord nehmen«, hörte Rosa Moreno sich sagen. »Vielleicht möchte sie genau das.«
Marcel lachte. »Ja, vielleicht. Aber ich glaube, die meisten Mädchen wollen, dass die Seemänner auf See sind. Nicht der eigene vielleicht, aber doch alle anderen.«
»Warum?«, fragte Rosa Moreno.
»Sonst hätten sie keinen, von dem sie träumen können«, antwortete Marcel.
Rosa Moreno dachte, daran könnte womöglich etwas Wahres sein. Sie selbst hatte noch nie von einem Seemann geträumt. Nur davon, dazuzugehören und so richtig wirklich zu sein. »Ich«, sagte sie entschlossen, »käme gerne mit Ihnen an Bord.«
Als Rosa Moreno drei Tage später morgens in ihrem Bett aufwachte, war sie überzeugt, dass Kapitän Marcel noch neben ihr lag und sie in den Armen hielt. Sie presste sich sogar an ihn und versuchte, ihn mit ihrem ganzen Körper zu spüren – erst dann wurde ihr klar, dass sie allein im Bett war. Mit einem Ruck setzte sie sich auf. War sie für ihn nur ein Abenteuer gewesen? Ein Tautropfen, der rasch verdunstete – kurz, die, die sie war, eine unansehnliche Zweiundzwanzigjährige, mochte sie auch ein schönes Lächeln haben. Sie war eine unter Millionen und Abermillionen vom selben Schlag, die die Erde bevölkerten.
Aber dann, und mit großer Erleichterung, erinnerte sie sich an das, was Marcel gesagt hatte: »Wenn du aufwachst, bin ich fort. Bis zur Morgendämmerung muss ich wieder auf dem Schiff sein.«
Das verstand Rosa Moreno. Sie hatte die ganze Zeit gut zugehört. Sie wusste sehr genau, dass sie Marcel weder in Villagarcía festhalten noch zu ihm an Bord kommen konnte. Im Innersten war sie sich sicher, dass es für sie nichts zu hoffen gab.
Gerade darum hatte sie alle Vorsicht über Bord geworfen.
Wer weiß, wie lange sie von der Erinnerung an Marcel würde leben müssen? Oder wann ihre Gefühle das nächste Mal zum Himmel stiegen wie Feuerwerksraketen, glitzernd wie Sterne im glasklaren portugiesischen Nordwind? Wenn irgendetwas Rosa Moreno messerscharf vor Augen stand, dann war es dies: Sie musste diese Gelegenheit nutzen. Sie musste von Marcel alles stehlen, was es zu stehlen gab, all seine Gefühle, seine Erlebnisse, seine Geschichten.
Schon an diesem Morgen empfand sie eine tiefe Dankbarkeit für ihn. Sie hatte zum ersten Mal mit einem Mann geschlafen, und er war genauso sanft und aufmerksam gewesen, wie sie sich das vorgestellt hatte. Ganz behutsam hatte Marcel ihr geholfen, zur erwachsenen Frau zu werden, und sie hatte es genossen.
Nach dem Frühstück saß sie mit ihren astrologischen Büchern im Bett. Sie wollte herausfinden, wie es kam, dass sie sich in einen Steinbock verliebt hatte, genau wie das Horoskop es prophezeit hatte. Mit etwas List hatte sie Marcels Geburtsdatum in Erfahrung gebracht, weil sie das Gefühl hatte, dass Marcel nicht an die Sterne glaubte und sie zu nichts anderem benutzte als zum Navigieren. Tatsächlich hüteten die Steinböcke ihre Unabhängigkeit wie ihren Augapfel und mussten immer alles alleine machen. Sie wollten sich nichts und niemandem unterwerfen, Sternen nicht und anderen Menschen auch nicht!
Marcel war am 28. Dezember geboren, sie selbst war Fisch, geboren am 20. März, um sieben Uhr morgens. Das hatte zumindest auf ihrem Geburtsschein gestanden, den ihre Mutter im Kinderwagen zurückgelassen hatte, wobei Rosas Geburtsort und der Name der Mutter fein säuberlich entfernt worden waren, so, dass es unmöglich war, sie aufzuspüren. Ihre Mutter hatte sorgfältig alle Spuren verwischt und nur das Geburtsdatum übrig gelassen, als hätte sie gewusst, dass Rosa es eines Tages brauchen würde.
Aber, so redete Rosa Moreno sich gut zu, welche Rolle spielte es überhaupt, ob man eine Mutter hatte oder nicht, wenn ja doch die Sterne regierten? Es war bestimmt kein Zufall, dass die echten Astrologen niemals Synastriehoroskope für Kinder und ihre Eltern erstellten: Nur zwischen Verliebten, Freunden und Arbeitskollegen stellten sie eine Beziehung her. In der Welt der Sterne waren Eltern nicht sonderlich wichtig. Zumindest hoffte Rosa Moreno das.
Ehe sie mit der mühsamen Arbeit begann, Marcels und ihr Horoskop zu erstellen, las sie über die allgemeinen Charakterzüge der Steinböcke:
»Der Steinbock ist das ehrgeizigste, zielstrebigste und ausdauerndste unter den Sternzeichen. Er ist kühl, prinzipientreu und stark von gesundem Menschenverstand geprägt. Steinböcke sind praktisch, logisch und eigensinnig und besitzen viel Selbstdisziplin. Sie sind introvertiert und sehen sich selbst als einsame, isolierte Menschen. Aus diesem Gefühl des Ausgeschlossenseins von der Welt und ihrer Gemeinschaft resultiert der Wunsch des Steinbocks, ›auf dieser Welt etwas aus sich zu machen‹. Wenige andere Sternzeichen sind sich so bewusst wie der Steinbock, dass Menschen einander im Allgemeinen ziemlich gleichgültig gegenüberstehen. Sie kennen den Zusammenhang der Dinge und wissen, was im gesellschaftlichen Leben das Richtige ist. Bereits früh erkennen sie den Wert von Beruf, Geld, Aussehen und gesellschaftlichem Rang. Sie gelten als Streber. Gefühlsbindungen scheitern häufig am Karrierestreben des Steinbocks. Sein Ernst, seine Zielstrebigkeit und sein Pflichtgefühl sollten aber nicht nur negativ gewertet werden, auch wenn viele Menschen sich im Zusammenleben mit einem Steinbock gezwungen fühlen, kaum erträgliche und sinnlose Opfer zu bringen. Setzt der Steinbock sein Konzentrationsvermögen und seine enorme Energie bei einem Projekt ein, kann er große Ergebnisse erzielen. Es ist das Schicksal dieses Sternzeichens, dass es sich durch harte, intensive Arbeit hocharbeitet. Häufig gelingt es Steinböcken am Ende, eine Machtposition einzunehmen. Ihre eigentliche Domäne sind all jene Berufe, die ihnen die Möglichkeit geben, anderen Menschen Befehle zu erteilen.«
Passte das auf Marcel? War er ein Streber? Gehörte er zu den Leuten, die anderen mit Statussymbolen imponieren wollten? Als Kapitän hatte er selbstverständlich eine Machtposition und gab anderen Befehle. Und um Kapitän zu werden, hatte er Selbstdisziplin und logisches Denken gebraucht. Bestimmt war er durch harte, intensive Arbeit Kapitän geworden. Und einsam war er womöglich trotzdem. Zumindest hatte er niemanden von seiner Besatzung ins Café mitgebracht, und Freunde und Bekannte hatte er ebenfalls nicht erwähnt. Es konnte auch sein, leider, dass er seiner Karriere eine Gefühlsbindung opferte, das heißt: dem Schiff, auch wenn er sagte, er sei immer bereit, wegen eines schönen Mädchens an Land zu bleiben. Das zumindest glaubte sie ihm nicht. Und Kaltblütigkeit und kühle Gelassenheit hatte er wirklich unter Beweis gestellt, als er sein Schiff im Sturm an die Kaimauer legte!
Je mehr sie darüber nachdachte, umso deutlicher wurde ihr, dass Marcel sehr wohl ein typischer Steinbock sein konnte. Aber er war mehr, das wusste sie ganz sicher. Wie sonst sollte sie sich denn seine Großzügigkeit, seine Hilfsbereitschaft, sein Taktgefühl, seine Wärme, sein ansteckendes Lächeln erklären? Da gab es nur eine Antwort: Sie kamen vom Aszendenten, vom Deszendenten und vom Aspekt. Vom Mond und den Planeten, dem Veränderlichen und Flüchtigen, und nicht vom unerschütterlichen Glitzern der Sterne, die über das Leben und vielleicht auch den Tod bestimmten.
3
Es gab Wintertage in Tréguier, die leblos und grau waren. Tage, an denen jedes Geräusch die Stille durchbrach und an denen das Echo von Schritten zwischen den Steinhäusern geradezu taktlos erschien, an denen der Himmel so trist sein konnte, dass man das Gefühl hatte, er wäre gar nicht da, und an denen das Licht in der Abenddämmerung so wenig Kraft besaß, dass man die Spiegelbilder der Baumkronen im rasch fließenden Wasser des Jaudy kaum erkennen konnte. Tage, an denen alles diesig und feucht war und fast ganz aus hoffnungslosem Nebel bestand.
An einem dieser Tage griff Madame Le Grand zum Feldstecher, öffnete das Fenster, beugte sich hinaus über die Rue de Renan und stellte die Schärfe ein, sodass der Fluss sich aus dem Dunst hob. Sie sah ein Stück des Kais, den man als Hafen bezeichnete, obwohl man dort nur bei Flut festmachen konnte und die Schiffe bei Ebbe auf trockenem Grund lagen. Sie erkannte auch zwei Kranarme, über Kreuz wie ein schiefes Kruzifix, das zum freudlosen Himmel aufragte.
Ein Fremder auf der Durchreise hätte sich vielleicht gefragt, ob dieser Hafen tatsächlich in Betrieb war. Doch Madame Le Grand wusste Bescheid. Ein Liegeplatz in Tréguier war pro Tag zwanzigtausend Francs billiger als in jedem anderen Hafen an der von den Gezeiten gepeinigten Nordküste der Bretagne. Obendrein ließen sich Sand und Saatgut mit den beiden veralteten Kränen in Tréguier genauso schnell löschen wie mit diesem neuen technischen Wunderwerk in St. Malo, einem grotesken Staubsauger, dessen Schlauch sich wie ein Python in die Laderäume der Schiffe wand.
Sicher, wenn man die beiden rostzerfressenen Kräne der Stadt sah, dann mochte man nicht recht glauben, dass Tréguier sich in Sachen Effizienz durchaus mit anderen Orten messen konnte. Aber Chevalier, der Kranwärter, war ein Meister seines Fachs. Für Madame Le Grand gab es keinen Zweifel, dass Chevalier alle Liebe, zu der er fähig war, in die beiden Dieselmotoren gesteckt hatte, das Herz der Kräne. Es gab eben solche Menschen, die keine andere Zärtlichkeit kannten als eine, die sich auf Kurbelwellen übertragen oder mit der Präzision einer Zehntelsekunde in einen Zylinder spritzen ließ. Unter den Skippern auf den Schiffen, die Tréguier anliefen, war Madame Le Grand solchen Menschen begegnet.
Aber nicht einmal Chevalier konnte auf die Dauer von der Befriedigung leben, die ihm der zufriedene Wohlklang eines Motors verschaffte. Wie die meisten anderen brauchte er eine Anerkennung seiner Leistung hier auf Erden, wenn diese auch nur zum Funktionieren der Kräne beitrug. Vor allem in dieser trostlosen winterlichen Dunkelheit musste er einfach spüren, dass wenigstens ein Mensch seine Arbeit schätzte, und dieser eine Mensch musste ihm auch sagen, dass sie durchaus ihren Sinn hatte. Darum lud Madame Le Grand ihn einmal im Monat zum Abendessen ein und lobte ihn für seine fleißige Arbeit.
Durch ihren Feldstecher konnte sie jetzt erkennen, wie Chevalier den Kai entlangeilte. Natürlich hatte die Nachricht auch ihn erreicht, dass ein Schiff erwartet wurde, und er war unterwegs, um dafür zu sorgen, dass die Dieselmotoren brummten wie immer, wenn die Löscharbeiten begannen.
Madame Le Grand ging ins Badezimmer und griff nach dem blutroten, glänzenden Lippenstift, den sie immer benutzte, wenn sie ein neues Schiff und eine neue Besatzung kennenlernte. Zusammen mit dem reichlich aufgetragenen Lidschatten, dem geschlitzten Rock, den hochhackigen Schuhen und den schwarzen Netzstrümpfen verlieh ihr dieser Lippenstift genau das ein wenig anrüchige Aussehen, welches, wie sie wusste, die Neugier der Seeleute weckte.
Außerdem amüsierte es sie, ihre verblüfften, etwas verlegenen und dabei auf verstohlene Weise lüsternen Blicke zu sehen, wenn sie auf dem Kai auftauchte. Sie verstand das sehr gut. Sie war fünfzig Jahre alt, aber ihr Bauch war flach wie eine Planke. Ihre Beine waren ansehnlich, und ihre mittlerweile schlaffen Brüste wurden von einem Büstenhalter mit Halbschalen gestützt, sodass ihre Spitzen unter der dünnen Bluse zum Horizont wiesen. Am Verlangen dieser Männer war darum überhaupt nichts auszusetzen, so wenig wie an ihrer Verwirrung und ihrer Verlegenheit.
Nach Beendigung ihrer Toilette kehrte sie ans Fenster zurück und sah hinaus. Einige Minuten später tauchte der Bug eines Schiffs im Dunst des Flusses auf. Sie schloss das Fenster und ging die Treppe hinunter und über den Hof, wo sie die beiden großen Torflügel öffnete, die den Einblick von der Straße verwehrten. Sie setzte sich in ihren schwarzen Citroën, stieß zurück und fuhr langsam die kurze Wegstrecke hinunter zum Hafen.
Sie kannte das Schiff nicht, so wenig wie die Besatzung. Sie hatte gehört, das Schiff liefe unter nigerianischer Flagge, habe seinen Heimathafen aber eigentlich in Holland. Nicht, dass das eine Rolle gespielt hätte. Die Männer an Bord, mit Ausnahme des Kapitäns, konnten aus jedem Winkel dieser Erde kommen. Keine Besatzung glich der anderen.
Als sie auf den Kai fuhr, warfen zwei Matrosen gerade die Trossen an Land. Chevalier fing sie wie immer geschickt auf und warf die Schlaufen um die Poller. Unmittelbar vor dem ausgelegten Landungssteg hielt Madame Le Grand ihren Wagen an und stieg aus. Sie notierte unter gesenkten Lidern die Blicke, mit denen man sie bedachte, war aber erstaunt, als sie sah, dass der Kapitän ihr zuwinkte. Die meisten Kapitäne nahm das Anlegemanöver so in Anspruch, dass sie für nichts anderes ein Auge hatten, zumindest nicht für eine Landratte in einem schwarzen Citroën. Mit den Jahren hatte sie eines gelernt: Seeleute waren schwer zu beeindrucken. Verglichen mit einem heulenden Sturm auf dem Nordatlantik, bedeuteten ein schwarzer Citroën und ein Paar Netzstrümpfe nicht gerade viel. Solange sich ein Seemann an Bord seines Schiffs befand, verneigte er sich vor keinem Landbewohner.
Madame Le Grand lehnte sich an ihr Auto und wartete, bis das Schiff festgemacht war. Dann rief sie der Besatzung etwas zu. Sie richtete sich an niemanden im Besonderen, sah aber zum Kapitän hinauf, der grüßend die Hand hob und die Brücke verließ. Gleich darauf stand er bei seinen Matrosen an der Reling.
»Heute Abend kommen Sie zu mir nach Hause!«, rief Madame Le Grand in ihrem französischen Englisch.
Die Seeleute sahen ihren Kapitän an, und der erwiderte ihren Blick.
»Ja«, fuhr sie fort, »Sie kommen alle zu mir nach Hause, auf ein Glas und etwas Essbares. Um sieben hole ich Sie ab. Einverstanden?«
Es war deutlich, dass die Matrosen nicht recht wussten, was sie davon halten sollten.
»Nennt mich ›Maman‹«, fügte sie hinzu. »In Ordnung? Ich komme um sieben!«
Der Kapitän lächelte. Wie lange war es her, dachte Madame Le Grand, dass sie ein solches Lächeln gesehen hatte.
»Für meine Leute kann ich nicht sprechen«, sagte er, »aber ich komme mit dem größten Vergnügen, Madame.«
»Maman!«, berichtigte sie.
Sie sah, dass die Seeleute etwas zu ihrem Kapitän sagten.
»Also abgemacht, Madame, wir kommen alle, alle fünf. Mit dem größten Vergnügen. Um sieben Uhr.«
Sie setzte sich ins Auto und fuhr langsam zurück. Im Rückspiegel sah sie, wie die Seeleute ihr mit den Blicken folgten. Was mochten sie denken? Dass sie eine Puffmutter war, die sie alle zu ihrer Unterhaltung zu sich einlud? Vielleicht, aber dann dürften sie sich auch gewundert haben, dass es in einer verschlafenen Stadt von dreitausend bretonischen Seelen, deren Hafen – wenn es hochkam – einmal in der Woche von einem Schiff besucht wurde, überhaupt einen Puff gab, in einer Stadt also, in der für ein solches Gewerbe kaum ein Kundenstamm zu finden sein dürfte.