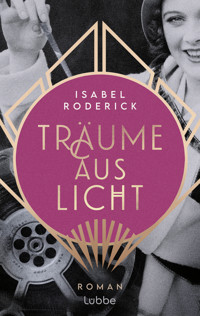
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große Roman über die Stummfilm-Ära der Weimarer Republik
Wiesbaden, 2000: Was hat es mit den alten Filmrollen auf sich, die Buchhändlerin Ariane unter dem Bett ihrer Großmutter findet? Eigentlich hatte Ariane dort nach Hinweisen auf ihre viel zu jung verstorbene Mutter Vera gesucht. Und nun findet sie stattdessen diese mysteriösen Filme. Anscheinend gibt es auch im Leben der Großmutter Dinge, von denen Ariane nichts weiß. Gemeinsam mit dem Filmvorführer Julian versucht sie, dem Geheimnis ihrer Großmutter auf die Spur zu kommen. Dabei stößt sie auf die Geschichte der jungen Drehbuchautorin Eva, die im Berlin der 1920er Jahre lebte und arbeitete. Was hat Eva mit Arianes Familie und den fast 80 Jahre alten Filmrollen zu tun? Und was ist damals wirklich mit Arianes Mutter Vera passiert?
Eine Geschichte über die Anfänge des Kinos, eine schicksalhafte Liebe und ein Geheimnis, das bis in die Gegenwart reicht
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Epilog
Nachwort und Dank
Über das Buch
Wiesbaden, 2000: Was hat es mit den alten Filmrollen auf sich, die Buchhändlerin Ariane unter dem Bett ihrer Großmutter findet? Eigentlich hatte Ariane dort nach Hinweisen auf ihre viel zu jung verstorbene Mutter Vera gesucht. Und nun findet sie stattdessen diese mysteriösen Filme. Anscheinend gibt es auch im Leben der Großmutter Dinge, von denen Ariane nichts weiß. Gemeinsam mit dem Filmvorführer Julian versucht sie, dem Geheimnis ihrer Großmutter auf die Spur zu kommen. Dabei stößt sie auf die Geschichte der jungen Drehbuchautorin Eva, die im Berlin der 1920er Jahre lebte und arbeitete. Was hat Eva mit Arianes Familie und den fast 80 Jahre alten Filmrollen zu tun? Und was ist damals wirklich mit Arianes Mutter Vera passiert?
Eine Geschichte über die Anfänge des Kinos, eine schicksalhafte Liebe und ein Geheimnis, das bis in die Gegenwart reicht
Über die Autorin
Isabel Roderick wurde 1981 in Wiesbaden geboren. Nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin studierte sie Anglistik und Buchwissenschaft in Mainz. Seit 2013 arbeitet sie als freie Literaturübersetzerin und Autorin. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Frankfurt am Main.
Neben mehreren Kurzgeschichten in Anthologien hat sie bisher zwei Romane veröffentlicht. Ihr Debütroman wurde 2015 für den Indie–Autor– Preis der Buchmesse Leipzig nominiert.
ISABEL RODERICK
ROMAN
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Gefördert durch ein Stipendium der VG WORT im Rahmen von NEUSTART KULTUR.
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Langenbuch & Weiß Literaturagentur. Copyright © 2023 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten. Textredaktion: Anne Schünemann, Schönberg Covergestaltung: Sandra Taufer, München unter Verwendung von Illustrationen von © Everett Collection / shutterstock; Serge Zimniy / shutterstock; Allgusak / shutterstock Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-7517-4801-8
Sie finden uns im Internet unter luebbe.de Bitte beachten Sie auch: lesejury.de
Prolog
Berlin-Charlottenburg, Ende Januar 1927
Jacob kniff die Augen zusammen und sah genauer hin. Stand dort hinten etwa jemand auf der Brücke? Er näherte sich. Ja, tatsächlich, es war eine Frau, und dank der modernen elektrischen Beleuchtung konnte er sie gut erkennen. Was hatte sie so spät und ganz allein auf dem Siemenssteg zu suchen?
Bis eben hatte er noch in einer Kneipe um die Ecke ausgeholfen. Zufrieden fasste er sich an den Mantel und spürte das Gewicht seiner vollen Geldbörse in der Innentasche. Der Abend hatte sich gelohnt. Zu Hause würde er sich erst einmal in Ruhe hinsetzen und ausrechnen, wie lange er damit über die Runden käme – sofern er vorher nicht überfallen wurde. Zwar sah er mit seinem geflickten Mantel, an dem ein Knopf fehlte, gewiss nicht wie jemand aus, bei dem man fette Beute machen würde, doch Diebe konnten Geld riechen, das wusste er aus eigener, bitterer Erfahrung.
Wieder sah er zu der Frau, die noch immer reglos auf der Brücke stand. Noch während er überlegte, wie er den hart verdienten Lohn am schnellsten in Sicherheit bringen könnte, umfasste die Fremde das stählerne Brückengeländer und stieg langsam hinüber.
Sie würde doch nicht …
Ein Trick, schoss es ihm durch den Kopf. Wenn ich zu ihr hingehe, kommen ihre Kumpane aus ihrem Versteck und rauben mich aus.
Sein Herz hämmerte. Panisch schaute er sich um. Kein Mensch außer ihm, beide Uferseiten leer. Und jetzt? Sollte er einfach tatenlos zusehen? Was, wenn die Frau nun wirklich sprang?
»Verdammt«, zischte er und rannte los. Schon hatte er den Brückenaufgang erreicht, eilte die Stufen zwischen den beiden steinernen Pylonen hinauf und blieb oben atemlos stehen.
Die Frau stand so reglos da wie zuvor, doch nun befand sie sich hinter dem Geländer auf einer der breiten Stahlstreben, die längs auf beiden Seiten der Brücke verliefen. Ihr langer Mantel flatterte im eisigen Wind, ein Hut verdeckte ihr Gesicht.
Vorsichtig setzte Jacob einen Fuß vor den anderen, um keinen Lärm zu machen. Nicht springen. Nicht springen. Er wiederholte die Worte in Gedanken wie eine stumme Beschwörungsformel.
Die Frau hatte ihn noch nicht bemerkt, doch er konnte nun ihr Schluchzen hören. Einige Schritte von ihr entfernt blieb er stehen und sah, dass sie ihre Handtasche vor dem Geländer abgestellt hatte. Ihre Schuhspitzen ragten bereits über den Rand der Stahlstrebe.
Oh Gott, dachte er. Was sollte er tun? Sie ansprechen? Er durfte sie auf keinen Fall erschrecken, vielleicht sprang sie dann erst recht.
Ihm blieb keine Zeit mehr zum Nachdenken. Die Frau breitete die Arme aus und verlagerte ihr Gewicht.
Unaufhaltsam kippte ihr Körper nach vorn.
Kapitel 1
Wiesbaden, Anfang Juni 2000
Tief im Herzen hatte ich immer geglaubt, Oma würde ewig leben. Wie sehr ich mich geirrt hatte, wurde mir erst an diesem Nachmittag klar.
Am Telefon hatte sie mir erzählt, dass sie nur mich und Silke zu ihrer Feier am Samstag einladen wollte. Zuerst hatte ich mir krampfhaft Ausreden überlegt. Wir drei zusammen an einem Tisch, das ging selten gut. Aber so war Oma eben. Wir sollten uns brav gemeinsam hinsetzen, Kuchen essen und unbeschwert miteinander plaudern wie eine normale Familie. Und irgendwann würde die unsichtbare Mauer, die zwischen mir und meiner Halbschwester stand, wie durch ein Wunder bröckeln, und wir würden uns selig in den Armen liegen.
So oder so ähnlich stellte Oma es sich vermutlich vor, und das schon, seit ich denken konnte. Ganz egal, wie oft ich ihr zu erklären versuchte, dass sie sich etwas vormachte, sie hielt beharrlich an der Hoffnung fest, dass Silke und ich eines Tages doch noch miteinander warm werden würden.
Ich brachte es trotzdem nicht übers Herz, Oma abzusagen. Immerhin war es ihr Geburtstag. Ihr zuliebe würde ich mich zusammenreißen, obwohl es mir schwerfiel.
»Ein Buch!«, rief sie strahlend, als sie mir die Tür öffnete. Die Form des Päckchens in meinen Händen war eindeutig, aber wer mich kannte, wusste sowieso, dass ich eigentlich immer nur Bücher verschenkte. Wenn Oma und ich eines gemeinsam hatten, dann unsere Leidenschaft fürs Lesen.
Ohne Umschweife bat sie mich hinein. Oma war nur knapp eins sechzig groß und hatte ein kleines Gesicht mit freundlichen braunen Augen, denen nichts entging. Ich hatte sie schon immer nur als agile, starke Frau gekannt, und selbst mit dreiundneunzig Jahren hatte sie kaum etwas von ihrer Energie eingebüßt.
Ich bot ihr an, in der Küche zu helfen, aber sie winkte nur ab und schickte mich stattdessen ins Esszimmer, um den Tisch zu decken. Sobald ich den Raum betrat, spürte ich förmlich, wie die Temperatur darin sank.
Meine Schwester Silke stand vor dem offenen Geschirrschrank und suchte nach irgendetwas. Wie immer, wenn sie in der Nähe war, fühlte ich mich klein und unbedeutend, und das nicht nur, weil sie siebzehn Jahre älter war als ich oder weil sie mich fast um einen ganzen Kopf überragte, sondern vor allem, weil sie so etwas wie Omas offizielle Thronfolgerin war. Jeder kannte Feinkost Klein in der Wilhelmstraße, Wiesbadens vornehmer Prachtmeile, und viele Kunden hatten die alte Geschäftsführerin noch bestens in Erinnerung: Margarete Klein, meine Oma. Nach Opas Tod hatte sie das Familiengeschäft jahrelang allein weitergeführt, bis sie es schließlich an Silke übergeben hatte. Inzwischen leitete Silke längst nicht mehr nur das Geschäft in der Wilhelmstraße. Unter ihrer Führung hatte sich das Unternehmen zu einer richtigen Kette entwickelt, und inzwischen gab es Filialen in zahlreichen Städten.
Wie so oft war ich mir nicht sicher, ob Silke mich bloß nicht bemerkt hatte oder ob sie mich absichtlich ignorierte. Aber ich war es nicht anders von ihr gewohnt. Wir sahen uns nur selten, und selbst wenn, redeten wir kaum miteinander. Wahrscheinlich waren wir einfach zu unterschiedlich. Das Einzige, was wir gemeinsam hatten, waren die blonden Haare und die graublauen Augen, die wir beide von unserer Mutter geerbt hatten.
Es war still im Zimmer. Nur aus der Küche drang Omas Stimme. Fröhlich summte sie irgendeinen alten Schlager vor sich hin, während sie Kaffee kochte.
»Hallo, Silke«, sagte ich endlich.
Sie warf einen Blick in meine Richtung und tat überrascht. »Ach. Hallo, Ariane.«
Noch immer galt ich in den Augen meiner Halbschwester als Eindringling. Das hatte sie mir zwar nie so direkt gesagt, aber ich spürte, dass es ihr bei jeder unserer Begegnungen auf der Zunge lag. Sie war die Erstgeborene, ich das Ärgernis. Die Nachzüglerin, die ihr erst die Mutter gestohlen und sich anschließend auch noch bei ihrer geliebten Oma eingenistet hatte.
»Kann ich dir irgendwie helfen?«
Sie öffnete eine weitere Schranktür. »Bring doch schon mal den Kuchen und die Sahne nach draußen.«
Ich öffnete die Terrassentür, trug die Sachen hinaus und stellte sie auf den Tisch. Zu dieser Jahreszeit fand ich den Garten am schönsten. Der große weiße Fliederstrauch stand in voller Blüte, und wenn man über die dichte Hainbuchenhecke blickte, sah man den Neroberg, Wiesbadens Hausberg, und die goldenen Zwiebeltürme der russisch-orthodoxen Kirche.
»Oma?«, rief Silke drinnen. »Ich kann das Milchkännchen nirgends finden.«
Ich kehrte ins Esszimmer zurück. Vor siebzig Jahren hatte Oma das kostbare Porzellanservice zur Hochzeit geschenkt bekommen, und sie bildete sich viel darauf ein, dass ihr in all den Jahren kein einziges Teil kaputt oder verloren gegangen war.
Oma kam herein, stellte die volle Kaffeekanne auf dem Esstisch ab und suchte nun selbst im Schrank. Ich fragte mich, ob sie darin irgendetwas erkennen konnte. Ihre Augen waren nicht mehr die besten, aber als ich ihr helfen wollte, winkte sie nur wieder ab.
Seufzend schloss sie den Schrank und ging zur Kommode am anderen Ende des Zimmers. »Das Fräulein muss sie falsch eingeräumt haben.«
In letzter Zeit geschah es häufiger, dass die Haushaltshilfe Dinge falsch einräumte, obwohl sie seit fast zwanzig Jahren für Oma arbeitete und eigentlich ganz genau wusste, wo alles hingehörte. Vielleicht war es gar nicht die Schuld des inzwischen fünfzigjährigen »Fräuleins«? Aber davon wollte Oma bestimmt nichts hören. Genauso wenig, wie sie hören wollte, dass man heutzutage nicht mehr »Fräulein« sagte.
Sie wühlte in der Kommode. Ein kleines Stück Papier fiel heraus und landete vor ihren Füßen. Silke bückte sich, um den Zettel aufzuheben, und richtete sich wieder auf. Schweigend betrachtete sie ihn, und ich sah, dass sie schlucken musste.
Oma nahm ihr den Zettel aus der Hand und starrte ebenfalls darauf. Ich fragte mich schon, was sie da bloß gefunden hatten, als Oma plötzlich ein Seufzen ausstieß.
Erschrocken stellte ich fest, dass sie ganz blass geworden war. »Oma? Geht es dir nicht gut?«
Mit zitternden Händen griff sie nach einer Stuhllehne, um sich abzustützen. »Es ist nichts. Ich muss mich nur kurz –«
Sie schaffte es nicht mehr, den Satz zu beenden. Mit einem Mal gaben ihre Knie nach.
Ich sprang nach vorn und fing sie auf.
»Oma?«, fragte ich und tätschelte ihre Wange, doch sie reagierte nicht.
Silke und ich tauschten einen entsetzten Blick. Zusammen schafften wir es, Oma ins Wohnzimmer zu tragen und sie vorsichtig auf das Sofa zu legen.
»Bleib bei ihr«, meinte Silke und eilte in den Flur. »Ich rufe den Notarzt!«
Der Nachmittag, der so harmlos begonnen hatte, hatte im Bruchteil einer Sekunde eine schreckliche Wendung genommen, und nun schnürte mir die Angst um Oma die Kehle zu. Noch nie zuvor war sie zusammengebrochen. Noch nie zuvor hatte ich das Gefühl gehabt, dass es wirklich ernst um sie stand.
Ich besaß kein Auto, hatte nicht mal einen Führerschein, darum war ich heilfroh, dass Silke mich mitnahm. Gemeinsam fuhren wir dem Krankenwagen hinterher. Fluchend lenkte sie ihren sportlichen Zweisitzer-BMW durch den zähen Stadtverkehr, wechselte ungeduldig die Spur, wann immer sich eine Lücke auftat. Jedes Mal, wenn sie aufs Gaspedal trat, wurde mein Körper in den geschmeidigen Ledersitz gedrückt. Was für eine Angeberkarre, dachte ich, aber Silke mochte eben alles, was schick und teuer war.
Im Krankenhaus angekommen, setzten wir uns in den Wartebereich. Immer wieder fragte ich mich, ob ich das alles nur träumte. Ich fühlte mich wie gelähmt und war zu nichts anderem fähig, als die weiße Wand anzustarren.
Silke hielt es keine Minute auf ihrem Stuhl aus. Ungeduldig sprang sie auf und ging auf und ab, bis sie auch das nicht mehr aushielt. Schließlich entschuldigte sie sich bei mir und verschwand.
Nach einer Weile hörte ich ihre Stimme durch das gekippte Fenster und warf einen Blick nach draußen. Sie stand zwischen ein paar Blumenkübeln, in einer Hand eine Zigarette, in der anderen ihr Handy, und telefonierte wild gestikulierend. Erzählte sie gerade ihrem Freund, was passiert war? Ich war mir nicht sicher, ob sie momentan überhaupt einen hatte. Silke lebte für ihren Beruf. Noch etwas, worin wir uns ähnlich waren.
Irgendwann kehrte sie zurück, und kurz darauf kam endlich eine junge Ärztin auf uns zu.
»Ihre Großmutter ist wieder bei Bewusstsein«, erklärte sie uns und rückte sich die Brille zurecht. »Sie erhält gerade eine Infusion –«
»Was ist denn passiert?«, fiel Silke ihr ins Wort. »Warum ist sie zusammengebrochen?«
»Vermutlich hat sie zu wenig getrunken. So etwas kann sich belastend auf den Kreislauf auswirken, erst recht bei so einem Wetter. Ob mehr hinter ihrem Schwächeanfall steckt, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.«
»Dann ist es also doch etwas Ernsteres?«, fragte ich erschrocken.
»Zuerst sind ausgiebige Untersuchungen notwendig«, antwortete die Ärztin. »Sie müssen das Alter Ihrer Großmutter bedenken.«
Ich glaubte, herauszuhören, was sie eigentlich damit meinte: Wer weiß, ob sie sich überhaupt wieder erholen wird …
Wir erkundigten uns nach Omas Zimmernummer und fuhren mit dem Aufzug zwei Stockwerke nach oben. Vor der Zimmertür angekommen, klopften wir leise an und traten ein.
Klobige, kompliziert aussehende Geräte standen um das Bett herum und blinkten und piepsten unablässig. Der Anblick schüchterte mich ein. Und wie klein und zerbrechlich Oma zwischen den ganzen Apparaten wirkte. Mit geschlossenen Augen lag sie da. Eine Nadel war mit einem dicken Klebestreifen in ihrer Armbeuge befestigt, und eine klare Flüssigkeit tropfte aus einem Infusionsbeutel.
Zögerlich trat ich an ihr Bett.
»Oma?«, fragte ich leise und griff nach ihrer Hand, die auf der Bettdecke ruhte.
Silke ging auf die andere Seite des Bettes, nahm ihre andere Hand und streichelte sie sanft.
In diesem Moment flatterten Omas Lider. Sie öffnete die Augen, musterte erst mich und dann Silke.
»Wie geht es dir?«, fragte ich.
Oma entzog mir ihre Hand und ließ den Blick durch das Zimmer schweifen. »Wo bin ich hier? Ich will wieder nach Hause.«
Sie klang ängstlich und hilflos, wie ein Kind. Genauso, wie ich mich gerade fühlte. Verwirrt sah ich zu Silke. Hatte die Ärztin nicht gesagt, Oma wäre bei Bewusstsein gewesen? Hatte denn niemand mit ihr gesprochen und ihr erklärt, was los war?
Silke winkte mich zu sich und sprach mit gesenkter Stimme. »Wie wäre es, wenn du zurückfährst und ein paar Sachen für Oma einpackst? Ich bleibe solange bei ihr und erzähle ihr, was passiert ist.«
Erleichtert über ihren pragmatischen Vorschlag nickte ich. Ja, so konnte ich mich wenigstens nützlich machen.
Ich verließ das Klinikgebäude. Vor dem Krankenhaus stieg ich in den nächsten Bus Richtung Innenstadt. Zwar wäre Silke mit dem Auto schneller gewesen, aber im Moment war es wohl wirklich besser, wenn sie bei Oma blieb. Silkes Nerven waren stärker als meine, und in ihrem angeschlagenen Zustand konnte Oma kein heulendes Häuflein Elend an ihrem Bett gebrauchen.
Omas Haus befand sich in einer der schicksten Gegenden von Wiesbaden, ganz in der Nähe der grünen Nerotal-Anlagen, in denen sie so gerne spazieren ging. Ich schloss die Tür auf, schnappte mir einen Koffer und suchte rasch das Nötigste zusammen: Wechselwäsche, Waschlappen, Zahnputzzeug, Medikamente … Wenn ich rechtzeitig vor dem Ende der Besuchszeit zurück sein wollte, durfte ich nicht zu lange trödeln.
Zurück im Krankenhaus, half mir Silke unter den ungeduldigen Blicken der Schwestern, den Koffer auszupacken und alles zu verstauen.
Zum Abschied gab ich Oma noch einen Kuss auf die Wange. »Mach’s gut, Oma. Morgen kommen wir dich wieder besuchen. Versprochen.«
Ich klang zuversichtlicher, als ich mich fühlte. Was, wenn sich die Andeutung der Ärztin bewahrheitete? Wenn Oma ernsthaft krank war und sich nicht wieder erholte? Erneut brannten Tränen in meinen Augen, aber ich riss mich zusammen.
Anschließend brachte mich Silke zu meiner Wohnung in der Innenstadt. Wie in Trance stieg ich die Treppe in den ersten Stock hinauf. Ich schloss die Tür auf, und kaum war ich drinnen, ließ ich mich erschöpft aufs Sofa fallen.
Endlich allein. Endlich konnte ich heulen, ohne dass es jemand mitbekam. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, Oma zu verlieren. Meine Mutter war gestorben, als ich drei war, und seitdem war Oma immer für mich da gewesen. Sie hatte mich großgezogen. Sie war alles, was ich hatte.
Natürlich gab es auch noch André, meinen Vater, aber der Kontakt zwischen uns war schon seit vielen Jahren weitestgehend eingeschlafen. Er lebte und arbeitete noch immer in derselben Künstlerkolonie an der Nordsee, in der er meine Mutter damals kennengelernt hatte. »Es ist das Beste, wenn du bei mir aufwächst«, hatte Oma mir einmal erklärt, als ich noch sehr klein gewesen war. »Dein Papa und ich haben es so beschlossen. Schließlich muss er arbeiten und hätte nicht genug Zeit, um auf dich aufzupassen.«
Als Kind und Jugendliche hatte ich André immer in den Ferien besucht, und an den Wochenenden war er häufig nach Wiesbaden gefahren, um mich zu sehen. Eine Weile funktionierte das auch ganz gut. Bis er irgendwann eine neue Frau kennenlernte. Und diese Frau schon bald darauf ein Baby von ihm erwartete.
Ich war damals vierzehn gewesen. André erzählte es mir während eines Besuchs. Ganz schonend und einfühlsam brachte er es mir bei und betonte immer wieder, dass sich dadurch nichts ändern würde und dass er mich immer noch genauso lieb hatte.
Im Grunde hatte er alles richtig gemacht. Und trotzdem war an jenem Tag etwas zwischen uns kaputtgegangen. Mit jedem Brief und jedem Foto, das er mir von seiner neuen Frau und seiner kleinen Tochter schickte, wuchs in mir das Gefühl, dass für ihn ein neues Leben begonnen hatte. Eines, in dem es keinen Platz mehr für mich gab, obwohl er ständig das Gegenteil beteuerte.
Vielleicht war es Neid. Ja, ich war neidisch auf dieses andere Kind, dessen Mutter noch lebte. Ich war eifersüchtig auf dieses kleine Mädchen, das im Gegensatz zu mir bei meinem Vater aufwachsen durfte. Das ihn täglich sah und am selben Tisch saß wie er, während mir nur ein paar Besuche im Jahr blieben.
Irgendwann reagierte ich nicht mehr auf seine Anrufe. Ich öffnete seine Briefe nicht mehr, weigerte mich, zu ihm an die Nordsee zu fahren, und als er dennoch nach Wiesbaden kam, um mich zu sehen, verhielt ich mich abweisend und einsilbig ihm gegenüber.
Inzwischen war ich längst kein Teenager mehr, und im Laufe der Jahre war mir klar geworden, dass mein Verhalten damals nicht nur unreif, sondern auch verdammt unfair gewesen war. Meine Mutter hätte sicher gewollt, dass André nach ihrem Tod eine neue Partnerin fand und wieder glücklich wurde. Warum nur war es mir damals so schwergefallen, es meinem Vater zu gönnen?
Ich ging in die Küche, um mir einen Tee zu kochen. In unregelmäßigen Abständen schickte André mir immer noch kurze Briefe oder Ansichtskarten. Erst vor zwei Tagen hatte ich wieder eine aus dem Briefkasten gefischt. Ein Leuchtturm war darauf abgebildet, und ich hatte sie mit einem Magneten an meinem Kühlschrank befestigt.
Nachdenklich nahm ich die Karte in die Hand. Wie gut es jetzt getan hätte, meinen Vater anzurufen und mir alles von der Seele zu reden. Meine Scham und die Eifersucht zu vergessen, wenn auch nur für einen Moment. Ich hatte seine Nummer – aber hatte ich durch mein Verhalten nicht längst das Recht verwirkt, ihm meine Ängste und Sorgen anzuvertrauen? Seit Jahren schon war er kein Teil meines Lebens mehr.
Hatte ich es nicht selbst so gewollt?
Am Sonntagmittag holte mich Silke vor meiner Wohnung ab. Zusammen fuhren wir zu Omas Haus, um ein paar weitere Sachen für sie zu packen und ein wenig Ordnung zu schaffen, denn in der gestrigen Aufregung hatten wir völlig den Kuchen vergessen. Noch immer stand er auf dem Terrassentisch, und inzwischen hatte sich eine ganze Heerschar von Fliegen und Wespen darüber hergemacht. Angeekelt scheuchten wir die Viecher weg und entsorgten alles in der Biotonne.
Silke half mir, den Rest aufzuräumen und das Geschirr abzuspülen. Wir sagten kein Wort, während wir die Arbeit verrichteten, aber trotzdem tat es gut, dass Silke da war. So fühlte ich mich in meiner Angst um Oma wenigstens nicht allein. Kaum zu glauben, dass es gestern noch meine größte Sorge gewesen war, zwei oder drei Stunden mit Silke an einem Tisch sitzen zu müssen. Jetzt kam mir das ziemlich albern vor.
Beim Abtrocknen fiel mir mein Geburtstagsgeschenk ein. Ich hatte Oma die Großdruckausgabe eines alten Romans von J. D. Engelhardt besorgt. Er war unser absoluter Lieblingsschriftsteller. Engelhardt schrieb quer durch verschiedene Genres, und ich hatte alle seine Werke verschlungen, obwohl seine Bücher schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatten. Die allerersten stammten aus den Dreißigern, die letzten waren Ende der Siebziger erschienen. Heutzutage kannte kaum noch jemand Engelhardts Namen, obwohl seine Romane weltweite Bestseller gewesen waren. Ich fand das sehr schade. Für mich waren sie zeitlos.
Vor allem aber faszinierte mich, dass über den Autor selbst kaum etwas bekannt war. Er sollte gebürtiger Amerikaner gewesen sein und später in England gelebt haben. Mehr wusste man nicht. Sein Aussehen, sein Geburtsdatum oder ob er noch lebte – alles um ihn schien ein einziges großes Geheimnis zu sein.
Dabei hätte ich so gerne erfahren, wer hinter den Geschichten steckte, hinter den vielschichtigen Charakteren und lebhaften Details. Nur ein Mensch mit außergewöhnlicher Beobachtungsgabe konnte so etwas zu Papier bringen, davon war ich überzeugt. Ich fragte mich, wie er zum Schreiben gekommen war. Was er erlebt haben mochte, das ihn zu seinen Romanen inspiriert hatte.
Ich entschuldigte mich bei Silke, verließ die Küche und sah mich um. Wo hatte Oma das Buch nur hingelegt? Nach kurzer Suche fand ich es auf der Kommode im Esszimmer, unter dem Zettel, der zu Boden gefallen war, als Oma gestern nach dem Milchkännchen gesucht hatte.
Ich nahm ihn in die Hand. Überrascht stellte ich fest, dass es gar kein Zettel war, sondern ein altes Foto. 1974, stand auf der Rückseite. Neugierig drehte ich es um und erstarrte.
Eine wunderschöne Frau lächelte mir entgegen. Ihr offenes Haar wehte im Wind, eine blonde Strähne bedeckte halb ihren Mund, Sonnenstrahlen streiften ihre gebräunte Haut. Die schlanken Arme hatte sie um ein kleines, ebenfalls blondes Mädchen geschlungen, und das Kinn der Frau ruhte zärtlich auf dem Scheitel des Kindes.
Verwirrt starrte ich das Foto an und rätselte ein paar Sekunden lang, wer die beiden waren, bis es mir schlagartig klar wurde.
»Mama«, flüsterte ich.
Das Mädchen auf dem Foto war ich, und die schöne Frau war Vera, meine Mutter. Das Bild musste kurz vor ihrem Tod aufgenommen worden sein, vermutlich von meinem Vater. Ich war damals drei gewesen.
Fassungslos musterte ich es. Die meisten Fotos, die ich von meiner Mutter kannte, stammten von den Titelseiten alter Hochglanzmagazine. Noch nie war mir eines begegnet, auf dem sie so … normal wirkte. Es war ein Schnappschuss, der ausnahmsweise einmal kein perfekt geschminktes und frisiertes Mannequin, sondern die echte Vera zeigte. Und mich. Angestrengt versuchte ich, mich an den fröhlichen Moment zu erinnern, in dem das Foto entstanden war, aber es wollte mir einfach nicht gelingen.
Hinter mir hörte ich Silkes Schritte. Mein erster Impuls war es, das Foto gleich wieder wegzulegen. Ein alberner Reflex, denn wir sprachen nie über unsere Mutter. Gestern hatte Silke das Foto gleich wieder weggelegt, als wäre darauf irgendetwas Verbotenes abgebildet. Nur schnell weg damit, und bloß nicht darüber reden.
Nein, dachte ich mir, dieses Mal nicht, und behielt es in der Hand.
Silke sah mir über die Schulter.
»Mama war wunderschön, oder?«, fragte ich.
Wie sehr ich Silke beneidete. Sie war bei Vera aufgewachsen, war bei ihrem Tod alt genug gewesen, um sich noch richtig an sie erinnern zu können. Unser Altersunterschied war so groß, dass es mir manchmal vorkam, als wären ihre und meine Mutter zwei verschiedene Menschen gewesen, mit zwei völlig verschiedenen Leben.
Ich rang mit mir, überlegte, ob ich mich trauen sollte, Silke nach Vera zu fragen. Mich interessierte brennend, was sie für ein Mensch gewesen war. Wie es sich angefühlt hatte, sie als Mutter zu haben. Wie es zu ihrem schrecklichen Unfall gekommen war. Sonst war Oma immer dabei, wenn Silke und ich uns sahen. Nun hatte ich endlich einmal die Gelegenheit, ganz ungestört mit meiner Schwester zu reden.
»So. Ich kümmere mich mal um den Garten. Schau du solange, ob du für Oma noch ein paar Sachen einpacken kannst.« Mit diesen Worten wandte sich Silke ab, öffnete die Terrassentür und ging hinaus.
Schon war der Moment verstrichen. Ich ärgerte mich über mich selbst, weil ich es einfach nicht schaffte, mich zu überwinden. Dabei hatte ich so viele Fragen. Zur Vergangenheit, zu meinen Eltern. Fragen, die ich mich noch nie wirklich zu stellen getraut hatte, denn wann immer ich anfing, von meiner Mutter zu sprechen, hatte ich gespürt, dass Oma traurig wurde. Die beiden hatten ein schwieriges Verhältnis zueinander gehabt, so viel wusste ich immerhin, auch wenn ich den Grund dafür nicht kannte.
Irgendwann würde schon der richtige Zeitpunkt kommen, hatte ich mir eingeredet. Eines Tages, wenn ich alt genug war, würden Oma und ich ganz offen über alles reden.
Aber wie lange sollte ich noch warten? Wie alt war »alt genug«? Himmel, ich war fast dreißig!
Vielleicht ist der richtige Zeitpunkt ohnehin schon längst verstrichen, schoss es mir unweigerlich durch den Kopf. Wenn Oma sich nicht mehr von ihrem Zusammenbruch erholt … Nein, der Gedanke war einfach zu schrecklich. Ich verdrängte ihn so schnell, wie er gekommen war.
Draußen plätscherte der Rasensprenger. Ratlos sah ich mich im Zimmer um. Nichts im Haus erinnerte an meine Mutter. Nein, das stimmte nicht ganz. Im Wohnzimmer öffnete ich den großen Schrank und zog einen der Ordner heraus. Oma hatte darin mehrere Vogue-Ausgaben aus den Fünfzigern und Sechzigern gesammelt. Vorsichtig blätterte ich sie durch.
Auf sämtlichen Titelseiten war meine Mutter zu sehen. Vera im Abendkleid. Vera im Pelzmantel. Die Bilder waren wunderschön und makellos, genau wie die Frau, die darauf abgebildet war. Mit ihren langen Gliedern, den feinen Zügen und dem verträumten Blick ihrer hellen Augen hatte Vera fast schon etwas Feenhaftes. Ganz fremd erschien sie mir, wie ein Wesen aus einer anderen Welt.
Enttäuscht klappte ich den Ordner wieder zu und stellte ihn zurück. Sollte das denn alles gewesen sein, was von ihr übrig geblieben war? Ein paar Fotos und zwei ungleiche Töchter, die sich ihr Leben lang nur anschwiegen? Ich wollte es nicht glauben. Irgendwo mussten noch mehr Dinge von ihr existieren, das hatte das Foto von uns beiden bewiesen, das gestern überraschend aufgetaucht war. Noch mehr private Schnappschüsse, Erinnerungsstücke … egal, Hauptsache irgendetwas, das mir mehr über den echten Menschen hinter der Hochglanzfassade verriet. Mehr, als mir Oma oder Silke verraten wollten.
Ich blätterte durch die anderen Ordner im Schrank. Nichts. Ich kehrte ins Esszimmer zurück, öffnete die Kommode, aus der das Bild gefallen war, und durchstöberte die Fotoalben darin. Wenn Oma wüsste, was ich hier tat! Einfach so in ihren Sachen zu wühlen … Ich hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen, aber ich wollte endlich Antworten.
Enttäuscht schloss ich den Schrank wieder. Auch hier hatte ich nichts gefunden, außer alten Kinderfotos von mir, die ich längst kannte. Ich warf einen flüchtigen Blick auf die Uhr: zwanzig nach eins. Bald war Besuchszeit im Krankenhaus, und Silke würde sicher gleich mit dem Gießen draußen fertig sein. Rasch ging ich ins Schlafzimmer, öffnete den Schrank und suchte noch ein paar frische Wechselsachen heraus. Als ich sie aufs Bett legte, das ordentlich mit einer blassrosafarbenen Tagesdecke bezogen war, fiel mir etwas ein: die Kiste. Seit ich denken konnte, stand eine alte Holzkiste unter Omas Bett. Schon immer hatte ich mich gefragt, was sich wohl darin befand, aber Oma hatte jedes Mal fürchterlich geschimpft, wenn sie mich beim Spielen im Schlafzimmer erwischt hatte.
Ich sah aus dem Fenster. Silke lief immer noch mit der Gießkanne zwischen den Beeten herum. Kurzerhand kniete ich mich auf den Boden, hob die Tagesdecke an, tastete nach einem der metallenen Griffe, die an den schmalen Seiten der Kiste befestigt waren, und zog sie unter dem Bett hervor.
Es war überhaupt keine Kiste, wie ich nun feststellte, sondern eine richtige kleine Truhe aus poliertem dunklem Holz. Kunstvoll geschnitzte Blütenmuster zierten die Vorderseite. Sie war ein echtes Schmuckstück, eigentlich viel zu schade, um hier im Schlafzimmer unter dem Bett herumzustehen. Ein Schlüssel steckte in dem filigranen Schloss. Vorsichtig drehte ich ihn um und öffnete den schweren Deckel.
Im Inneren stapelten sich unbeschriftete Briefumschläge. Ich nahm den obersten und stellte fest, dass er offen war. Ganz vorne steckten mehrere Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen eine junge Frau mit Federboa und Zigarettenspitze posierte. Kess lächelte sie in die Kamera. Ein paar Sekunden lang starrte ich die Fotos an, dann wurde mir klar, dass es sich bei der koketten jungen Frau mit dem kinnlangen blonden Haar um Oma handelte.
Halb amüsiert, halb verwundert drehte ich das Bild um. Atelier Rotermund, Potsdamer Platz, März1927 stand in Druckschrift auf der Rückseite. Weitere Bilder zeigten Oma vor dem Reichstag, vor dem Brandenburger Tor … Sie trugen ganz unterschiedliche Daten: April, Mai, August 1927.
Ich fiel aus allen Wolken. Oma hatte als junge Frau in Berlin gelebt? Die Fotos stammten wohl noch aus der Zeit, bevor sie Opa kennengelernt hatte. Sie musste damals zwanzig gewesen sein. Komisch, dass sie uns nie davon erzählt hatte. Zumindest mir nicht. Vielleicht wusste Silke ja etwas darüber.
Als ich tiefer in die Truhe griff, stießen meine Fingerspitzen auf etwas Metallisches. Vorsichtig schob ich die Umschläge beiseite und entdeckte mehrere flache, kreisrunde Dosen, insgesamt sechs Stück. Auf den Deckeln klebten Schilder mit einer laufenden Nummer. Daneben war etwas handschriftlich notiert worden, aber irgendjemand hatte mit einem schwarzen Stift darübergekritzelt. Ich kniff die Augen zusammen und versuchte, es zu entziffern: PI…RA…
Der Rest war beim besten Willen nicht zu erkennen. Vorsichtig hob ich den Deckel der obersten Dose an, und sogleich stieg mir ein eigentümlicher Geruch in die Nase. Eine herbe Note lag darin und zugleich auch etwas Süßliches. Ich musste an etwas Dunkles denken, an etwas Warmes, an … Schokolade?
Ich nahm den Deckel komplett ab. Eine große, säuberlich aufgewickelte Filmrolle lag darin, braun und glänzend.
»Ariane?«, ertönte Silkes Stimme aus dem Flur.
»Bin gleich fertig!«
Hastig schloss ich den Deckel, verstaute die alten Umschläge und Fotos wieder in der Truhe, klappte sie zu und schob sie zurück unters Bett. Dann schnappte ich mir eine Tasche, packte die Wechselsachen ein, die auf dem Bett lagen, nahm noch den Roman mit, den ich Oma zum Geburtstag geschenkt hatte, und verließ das Haus.
Silke wartete bereits draußen vor der Tür. Wir stiegen ins Auto, und während wir zum Krankenhaus fuhren, fragte ich mich, was das wohl für alte Filme waren. Vielleicht ein paar von Opas alten Super-8-Urlaubsfilmen? Nein, die hatten ja ein ganz anderes Format. Eigentlich sahen sie eher wie Filmrollen fürs Kino aus. Aber das konnte nicht sein. Was um Himmels willen hätte so etwas bei Oma unterm Bett verloren?
Enttäuscht ließ ich den Blick aus dem Fenster schweifen. Unabsichtlich war ich bei meiner Suche ganz tief in Omas Vergangenheit gelandet. Was auch immer es mit den alten Fotos aus Berlin und dem seltsamen Film auf sich haben mochte, warf nur noch mehr Fragen auf.
Ich nahm mir vor, bei nächster Gelegenheit weiterzusuchen. Vielleicht stieß ich doch noch auf etwas, das mir mehr über das Leben meiner Mutter verriet, aber jetzt würde ich erst einmal Oma besuchen.
Sie musste wieder gesund werden. Alles andere war unwichtig.
Kapitel 2
Berlin-Mitte, Oktober 1920
Endlich Samstagabend. Rasch tippte Eva die letzte Zeile des Briefs und zog das Blatt aus der Schreibmaschine. Erleichtert sprang sie auf, nahm Mantel und Handtasche von der Garderobe, setzte sich ihren breitkrempigen Filzhut auf und reihte sich in die Schlange vor der Stechuhr ein.
Seit dem frühen Morgen hatte sie auf die schwergängige Tastatur eingehackt. Ihre Augen brannten vom stundenlangen Starren auf das Papier, und ihr Kopf dröhnte vom unaufhörlichen »Klack-Klack-Klack« im Großraumbüro der Versicherung, in dem sie von Montag bis Samstag als Schreibkraft schuftete.
Normalerweise freute sie sich auf den freien Sonntag, doch seit ihr Vorgesetzter sie an diesem Vormittag zu sich gerufen und ihr einen Briefumschlag in die Hand gedrückt hatte, lastete ein unsichtbares Gewicht auf ihren Schultern.
Draußen wehte ihr kühler Wind entgegen. Sie zog sich den Hut tiefer in die Stirn, als erste kalte Tropfen vom Himmel fielen. Am Potsdamer Platz stieg sie in den Omnibus Richtung Gesundbrunnen und zwängte sich zwischen die anderen Angestellten.
Der Bus fuhr mit knatterndem Motor los. Eva klammerte sich an eine Haltestange. An anderen Tagen liebte sie es, die anderen Fahrgäste zu beobachten. Sie dachte sich Geschichten über sie aus, entwickelte im Kopf ganze Biografien von interessant aussehenden Leuten und grübelte darüber nach, was wohl ihre geheimen Wünsche und Sehnsüchte waren.
Heute aber war ihr nicht danach. Stattdessen schloss sie die Augen und stellte sich vor, an einem anderen Ort zu sein. Das konnte sie gut: sich Dinge vorstellen. Sich in eine andere Welt träumen, die nicht trüb und regnerisch war, sondern fröhlich, hell und bunt. Die Stimmen der Leute verschwammen zu einem Murmeln im Hintergrund, und anstatt in einem vollen Bus stand Eva plötzlich auf dem schwankenden Deck eines Segelschiffs. Sie spürte den Wind im Haar, roch keine muffigen Mäntel mehr, sondern salzige Meeresluft. Wie sich das wohl anfühlte? Draußen auf dem offenen Meer zu segeln, unter sengender Sonne, einfach frei zu sein …
Der Bus rumpelte über ein Schlagloch, und die Erschütterung holte sie in die Realität zurück. Sie verlor den Halt, stieß mit einem korpulenten älteren Mann zusammen und murmelte eine Entschuldigung.
»Von Ihnen lass ick mir doch jerne anrempeln«, antwortete er und lachte in seinen grauen Bart hinein. Dann beugte er sich zu ihr. »Na, wat hat ein junges Frollein wie Sie denn Schönes vor am Sonnabend?«
Eva antwortete nicht. Was ging ihn das an? Am liebsten wäre sie ihm ausgewichen, doch der Bus war voll.
»Wat denn? Keen junger Mann?«
»Doch, natürlich«, log sie, in der Hoffnung, dass er es endlich aufgeben würde, blöde Fragen zu stellen. Mit aufdringlichen Männern im Bus hatte sie schon ab und zu Bekanntschaft machen müssen, dabei wollte sie einfach nur ihre Ruhe haben. Gegen einen netten und gut aussehenden hätte sie ja gar nichts einzuwenden gehabt, aber die waren selten geworden seit dem Großen Krieg, und aus irgendeinem Grund schien sie nur die unangenehmen Exemplare magisch anzuziehen.
Zu ihrer Erleichterung stieg der Alte an der nächsten Haltestelle aus, wobei er sich noch einmal zu ihr umdrehte und grinsend den Hut hob. Schaudernd wandte Eva sich ab und war froh, als der Bus endlich weiterfuhr.
Nach einer Weile ließen sie die wohlhabenden Vorzeigeviertel mit ihren gepflegten Alleen und Grünanlagen hinter sich und drangen in Gegenden vor, in denen die Straßen eher dunklen Gassen glichen und sich blasse Menschen in überfüllten, finsteren Mietskasernen drängten. In Gesundbrunnen stieg Eva aus.
Nachdenklich befühlte sie den Umschlag in ihrer Tasche. Keinesfalls wollte sie ihre Familie mit der schlechten Neuigkeit belasten. Zumindest noch nicht. Sie hoffte inständig, dass ihre Mutter und ihre Schwestern ihr nichts anmerken würden – wenigstens nicht die beiden jüngeren, aber Johanna würde ihr gewiss sofort ansehen, dass irgendetwas nicht stimmte.
Im ersten Hof der Wohnanlage spielte eine Kinderschar »Himmel und Hölle«. Eva betrat das Hinterhaus. Auf der knarrenden Treppe wehte ihr bereits der Geruch nach Bratfett entgegen. Sie durchquerte den fensterlosen Flur, tastete sich an den feuchten Wänden entlang und klopfte an ihre Wohnungstür.
Ilse öffnete ihr und kehrte sogleich an den Herd zurück. Kochen war meist die Aufgabe der schlaksigen Fünfzehnjährigen, und gerade briet sie Kartoffeln für das Abendessen. Am schmalen Esstisch neben dem Fenster, durch das um diese Uhrzeit kaum noch Licht drang, saß ihre Mutter Maria und beugte sich über die Kleidungsstücke ihrer Kundschaft. Eine Petroleumlampe auf dem Tisch spendete etwas Licht. Bisher wusste niemand, wann man das Haus endlich an das wachsende Stromnetz anschließen würde.
»Da bist du ja endlich«, bemerkte ihre Mutter knapp und wies mit dem Kinn auf den Kleidungsstapel. »Setz dich. Das muss alles bis Montag fertig werden.«
Eva stellte ihre Handtasche ab und hängte Hut und Mantel an den Haken hinter der Tür. Ihre Finger schmerzten vom vielen Tippen, doch niemals wäre es ihr eingefallen, ihre Mutter mit der Arbeit allein zu lassen. Sogleich nahm sie sich Nadel und Faden und griff sich ein Hemd vom Stapel.
Während Ilse in der brutzelnden Pfanne rührte, fiel Evas Blick auf die Wanduhr: kurz nach sechs. Um diese Zeit war Johanna normalerweise längst zu Hause. Sie wüsste bestimmt, was zu tun war. Nur ein knappes Jahr trennte die beiden ältesten Schwestern voneinander. Eva konnte Johanna alles anvertrauen, was die beiden Jüngeren noch nicht verstanden und worüber ihre Mutter nur den Kopf geschüttelt hätte.
Endlich klopfte es an der Wohnungstür. Eva ließ das Nähzeug fallen, sprang auf und riss die Tür auf.
»Johanna!«, rief sie und fiel ihrer jüngeren Schwester um den Hals.
»Na, das ist mal eine Begrüßung«, erwiderte Johanna lachend und schloss Eva in die Arme. »Hab dich auch vermisst, Schwesterherz!« Sie löste sich von Eva und musterte sie. Mit ihrem rötlichen Haar und den Sommersprossen war Johanna ganz das Ebenbild ihres verstorbenen Vaters. Doch ihr Lächeln verblasste, als sie Evas Blick bemerkte.
Zum Glück hatten sie jahrelange Übung darin, sich wortlos miteinander zu verständigen. Johanna räusperte sich, fasste sich ans Ohrläppchen und tat erschrocken. »Mensch, ich glaub, ich hab draußen nen Ohrring verloren! Eva, kommst du kurz mit und hilfst mir suchen?«
Ilse sah von der Pfanne auf. »Seit wann trägst du denn Ohrringe?«
Johanna fasste Eva am Ellbogen und zog sie mit sich. Eva nahm rasch ihren Mantel vom Haken und streifte ihn sich über.
»Ihr beiden und eure ewige Geheimniskrämerei«, seufzte Maria, bevor die Tür von außen ins Schloss fiel.
»Warum kommst du so spät?«, zischte Eva im Treppenhaus.
»Hab mich bei einer Kundin verschnitten. Zur Strafe musste ich anschließend noch den ganzen Salon putzen. Wieso, was ist denn?«
Gerade als Eva antworten wollte, kam ein Nachbar die Treppe herauf und hob zum Gruß seine Schiebermütze. Aus der benachbarten Wohnung ertönte Kindergeschrei, dazwischen die zornigen Rufe einer Frau.
»Nicht hier.« Eva nahm ihre Schwester an der Hand. »Komm mit.«
Gemeinsam eilten sie die Treppe hinunter, verließen das Haus, durchquerten den Hof und traten auf den Bürgersteig. Inzwischen war es dunkel geworden. Im Licht einer Straßenlaterne zog Eva den Brief ihres Vorgesetzten aus der Manteltasche.
Johanna riss den Umschlag auf und überflog das Schreiben. Dann knüllte sie es zusammen und schloss ihre Schwester in die Arme. »War sowieso eine beschissene Stelle.«
»Ich war heilfroh um diese beschissene Stelle! Was soll denn jetzt werden?« Eva schluchzte. Von Johannas Gehalt und dem bisschen, was Mutti und Ilse mit dem Nähen dazuverdienten, wurden sie nicht satt. Sie musste so schnell wie möglich etwas Neues finden – aber wie lange würde sie die neue Stelle wohl behalten? Einer ledigen Zwanzigjährigen wie ihr wurde doch immer zuerst gekündigt.
»Ach, Evchen«, seufzte Johanna, löste sich von ihr und lächelte sie aufmunternd an. »Uns fällt schon etwas ein. Wir müssen einfach ganz fest zusammenhalten.«
Eva schniefte. Johanna ähnelte ihrem Vater nicht nur aufgrund des rötlichen Haars, sie hatte auch seinen unerschütterlichen Optimismus geerbt. Den hatte er selbst dann nicht verloren, als er zum Kriegsdienst eingezogen worden war. »Bis Weihnachten ist alles vorüber«, hatte er ihnen versprochen, bevor er damals in den Zug an die Front gestiegen war.
»Ich habe keine Ahnung, wie ich es Mutti beibringen soll.« Eva wischte sich die Tränen fort. Nach Vaters Tod hatte Maria seinen florierenden Malerbetrieb in Charlottenburg auflösen müssen, und auch die Wohnung dort hatte sie nicht halten können. Seit Kriegsende kletterten die Preise unaufhaltsam in die Höhe. Lebensmittel, Kohle, Miete, alles wurde immer teurer. Wenn sie sich bald auch die kleine Wohnung hier nicht mehr leisten konnten, was dann? Sie erschauderte beim Gedanken an die städtischen Obdachlosenunterkünfte, in denen Diebstahl und Krankheiten grassierten.
In diesem Moment kam die fünfjährige Leni um die Ecke gerannt. Die jüngste der vier Schwestern hatte den ganzen Tag draußen mit den anderen Kindern aus dem Wohnblock gespielt. Ihre Hände und Wangen waren schwarz vor Schmutz, und Strähnen lösten sich aus ihren blonden Zöpfen. Mit einem Juchzen stürmte sie auf Eva zu und schlang ihr die Arme um die Hüften.
Eva schluckte ihren Kummer hinunter, drückte Leni fest an sich und gab ihr einen Kuss auf den Scheitel. »Na, du kleiner Dreckspatz«, sagte sie liebevoll. »Lass uns hineingehen. Gleich gibt es Abendessen. Aber vorher musst du dich waschen, sonst schimpft Mutti.«
Zu dritt kehrten sie in die Wohnung zurück. Eva füllte eine Emailleschüssel mit Wasser und half Leni dabei, sich Gesicht und Hände zu waschen. Das Mädchen erzählte lebhaft von einem neuen Spiel, das sie gespielt hatten, doch Eva war zu sehr in Gedanken versunken, um zuzuhören.
Nach dem Abendessen gingen die Schwestern zu Bett, und Leni kuschelte sich an Eva. Die Kleine liebte es, neben ihrer ältesten Schwester einzuschlafen. Johanna und Ilse teilten sich das zweite Bett in dem schmalen Schlafzimmer. Mutti saß wie jeden Abend noch nebenan in der Küche und nähte.
»Erzählst du mir ein Märchen?«, flüsterte Leni.
Eva musste lächeln, und wie jeden Abend erfand sie eine Geschichte über die kleine Prinzessin mit den blonden Zöpfen, die zufällig verblüffende Ähnlichkeit mit Leni besaß. Sie war keine gewöhnliche Prinzessin, denn sie hatte keine Lust, auf einen Prinzen zu warten, sondern zog lieber selbst aus, um Abenteuer zu erleben. Sie schloss Freundschaft mit Drachen und flog mit ihnen über den Himmel, und das langweilige graue Schloss ihres Vaters malte sie in den schönsten Farben an.
Anschließend lag Eva noch lange im Dunkeln wach und lauschte den Atemzügen ihrer Schwestern, bis sie sich sicher war, dass alle schliefen. Dann zündete sie die Kerze auf ihrem Nachttisch an und holte das Buch hervor, das schon seit ein paar Tagen unter ihrem Kopfkissen lag: Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson.
Endlich. Seit gestern Nacht freute sie sich darauf, zu erfahren, wie das Abenteuer weiterging. Wenn sie las, konnte sie für kurze Zeit die Sorgen des Alltags verdrängen.
»Hör mal, Evchen«, flüsterte Johanna plötzlich und regte sich im benachbarten Bett. »Mir ist da was eingefallen.«
Seufzend ließ Eva ihr Buch sinken. »Ich dachte, du schläfst längst.«
»Von wegen. Ich hatte ne prima Idee.« Johanna setzte sich auf. »Ja, das ist die Idee überhaupt. Warum ist mir das nicht gleich eingefallen?«
»Was denn?«, fragte Eva.
Johannas Augen leuchteten. »Na, deine Geschichten.«
Eva bedachte ihre Schwester mit einem fragenden Blick.
»Du denkst dir doch immer so tolle Gutenachtgeschichten für Leni aus.«
»Ja. Und?«
Johanna sah sie hoffnungsvoll an. »Hast du noch nie darüber nachgedacht, sie aufzuschreiben und irgendwo einzuschicken? Du könntest bestimmt viel Geld damit verdienen.«
Eva runzelte die Stirn. »Mit ein paar Gutenachtgeschichten? Ich weiß nicht.«
»Wieso denn nicht? Es müssen ja keine Kindergeschichten sein. Du hast so viel Fantasie, dir fällt bestimmt auch etwas für Erwachsene ein. Ich meine … denk doch nur an Hedwig Courths-Mahler. Die war mal ein armes Waisenkind, und dann ist sie durch ihre Bücher reich und berühmt geworden.«
»Um Gottes willen«, murmelte Eva. Nichts lag ihr ferner, als der Lieblingsschriftstellerin ihrer Mutter nachzueifern.
»Was denn? Wenn die es geschafft hat, dann schaffst du es vielleicht auch. Also, ich mag deine Geschichten.«
»Du bist ja auch meine Schwester.« Eva nahm sich wieder ihr Buch vor. Eine Geschichte schreiben … Warum eigentlich nicht? Johanna hatte recht, Fantasie besaß sie wahrlich genug. Aber ob sie sich jemals trauen würde, irgendwo etwas einzuschicken?
Verträumt ließ ihre Schwester den Blick über die zahlreichen Postkarten schweifen, die an der Wand über dem Fußende ihres Bettes klebten. Porträts von berühmten Schauspielern wie Asta Nielsen, Conrad Veidt und Henny Porten hingen neben Bildern von Hollywoodstars wie Charlie Chaplin, Mary Pickford und Elizabeth Davenport. »Und wenn du es mal beim Film versuchst?«, fragte sie und setzte sich auf. »Ich hab gehört, die Filmfirmen suchen ständig nach guten Geschichten.«
Eva musste lächeln. Sie erinnerte sich noch genau an ihren allerersten Kinobesuch, damals in Charlottenburg. Mit klopfenden Herzen hatten sie sich zu zweit unter das Publikum in dem stickigen Zuschauerraum gemischt. Eva war zwölf gewesen, Johanna sogar erst elf. Der Zutritt war nur Erwachsenen gestattet, aber zum Glück hatte es der Mann an der Kasse nicht so genau genommen.
Drinnen war es dunkel geworden, das Publikum verstummte, und aus dem Vorführraum hörte man leises Surren. Schon erklang die monotone Stimme des Filmerklärers, begleitet von einem Klavier, und die Vorstellung begann: Zuerst war eine Frau mit langen Wimpern auf der Leinwand zu sehen, die in den Armen eines Mannes lag und ihm verliebt in die Augen schaute. Eva und Johanna mussten kichern. Dann zwei Männer in Frauenkleidern, die vor einem dicken Polizisten mit buschigen Augenbrauen und gezwirbeltem Schnauzbart quer durch die Stadt flohen. Die beiden Schwestern hielten sich die Hände vors Gesicht, lachten und schrien abwechselnd, genau wie die anderen Leute im Kino. Arm und Reich, Alt und Jung, Dienstboten und Herrschaften, sie alle wurden für kurze Zeit in eine andere Welt entführt – bis das Licht wieder angegangen war und der Kinobesitzer die Anwesenden aufgefordert hatte, Platz für die nächsten Zuschauer zu machen.
Seitdem liebten sie beide das Kino. Besonders die Filme mit Elizabeth Davenport hatten es Eva angetan. Einmal so mutig, einmal so schön zu sein wie all die Heldinnen, die sie auf der Leinwand verkörperte – was hätte Eva darum gegeben.
Sie grübelte über Johannas Vorschlag nach. Beim Film konnte man viel Geld verdienen, das sagte jeder. Und genau deshalb versuchte es wohl auch so gut wie jeder.
»Ach, Johanna. Ich glaube nicht, dass sich irgendeine Filmfirma für die Ideen eines dahergelaufenen Tippfräuleins interessiert …«
»Willst du denn gar nichts aus deinem Talent machen? Es nicht einmal versuchen? Mensch, Evchen, eine von uns muss es doch mal zu etwas bringen, und du hast den nötigen Grips dafür. Willst du etwa ewig hier in diesem Loch festsitzen?«
Natürlich wollte Eva das nicht. Weder für sich selbst noch für ihre Familie. Doch Luftschlösser halfen ihnen nicht weiter, wenn es darum ging, ein Dach über dem Kopf und genug zu essen zu haben.
»Zum Monatsende bin ich arbeitslos«, beharrte sie. »Jetzt brauche ich erst einmal eine neue Stelle, und zwar so schnell wie möglich.«
»Mach dir darum keinen Kopf.« Johanna lächelte. »Ich hab schon eine Idee, wie ich genug Geld für uns beide verdienen kann.«
»Und wie willst du das anstellen?«
In diesem Augenblick regte sich Leni und seufzte. Eva und Johanna warteten ab, bis die Kleine wieder fest eingeschlafen war.
»Ich kann Kundinnen nach Feierabend zu Hause besuchen und ihnen dort die Haare frisieren«, flüsterte Johanna. »Conni aus dem Salon macht es auch so, um sich ihr Gehalt aufzubessern. Und sie kriegt jedes Mal ein saftiges Trinkgeld.«
»Und was, wenn deine Chefin davon Wind bekommt?«, wandte Eva ein. »Du nimmst ihr ja quasi die Kundschaft weg. Was, wenn sie dich entlässt? Dann sind wir beide arbeitslos.«
»Du solltest dich mal reden hören. Für dich besteht das Leben immer nur aus Katastrophen. An jeder Ecke lauert das Unglück darauf, dich anzuspringen.«
Eva senkte den Kopf. Es stimmte, sie konnte nicht anders. Sie war die Älteste, darum musste sie die Vernünftige sein, die Starke. Diejenige, die auf die Jüngeren achtgab und ihrer Mutter einen Teil der Last abnahm, so gut es ging.
Johanna zuckte mit den Schultern. »Versuch es doch einfach mal. Schreib eine Geschichte. Und dann suchst du dir die Adressen aus dem Telefonbuch heraus und schickst sie ein. Was hast du denn zu verlieren? Eine Stelle als Tippse kannst du dir immer noch suchen.«
Eva sah den begeisterten Glanz in den Augen ihrer Schwester. Für einen Moment erlaubte sie es sich, sämtliche Bedenken zu ignorieren. Eine eigene Geschichte. Bloß worüber? Sie überlegte angestrengt.
Was wäre, wenn sie die Art von Geschichte schrieb, die sie selbst am liebsten mochte? Die einen abwechselnd zum Lachen und zum Weinen brachte und die man gar nicht mehr aus der Hand legen wollte. Und mehr noch. Sie würde eine Geschichte schreiben, in der endlich einmal eine Frau im Mittelpunkt stand und ein echtes Abenteuer erlebte. So ähnlich wie Lenis kleine Prinzessin – nur für Erwachsene.
Plötzlich fiel ihr etwas ein, und ihr Herz klopfte schneller. Natürlich. Sie wusste, worüber sie schreiben würde!
»Piraten«, flüsterte sie und musste an das Geschichtsbuch über Anne Bonny und Mary Read denken, das sie sich neulich in der Bücherei ausgeliehen hatte. Zwei Frauen, denen es gelungen war, sich als Freibeuterinnen in einer rauen Männerwelt durchzusetzen. Ungläubig hatte Eva das Vorwort überflogen. Tatsächlich, es war keine Erfindung, es hatte diese Frauen wirklich gegeben.
Johanna sah sie verständnislos an.
»Ich weiß, worum es in meiner Geschichte gehen wird«, erklärte Eva strahlend. »Um eine Frau, die Kapitänin eines Piratenschiffs wird.«
»Ich dachte, du willst etwas für Erwachsene schreiben.«
»Will ich ja auch.« Eva klemmte sich das ausgeliehene Exemplar der Schatzinsel vor die Brust und drückte es fest an sich. Die offensichtliche Enttäuschung in der Miene ihrer Schwester verunsicherte sie. Doch sie fühlte sich, als wäre ein Feuer in ihrem Inneren entfacht worden. Ja, sie würde eine Piratengeschichte schreiben. Eine, wie es sie noch nie gegeben hatte!
Sie wusste nur noch nicht, wie.
Kapitel 3
Berlin, Oktober 1920
Am Montag stürmte Eva gleich nach Feierabend in die Bücherei. Sie lieh sich alles aus, was mit Piraten und den englischen und spanischen Kolonien in der Karibik zu tun hatte. Sie suchte auch nach Büchern zum Thema Film, und als sie die Karteikästen durchstöberte, fiel ihr ein Buch mit einem ganz besonderen Titel ins Auge: Wie ein Film geschrieben wird und wie man ihn verwertet von einem gewissen Ewald André Dupont. Eine Anleitung für Filmschriftsteller? So etwas gab es?
In den darauffolgenden Wochen wartete sie ungeduldig im dunklen Schlafzimmer, bis Leni und die anderen eingeschlafen waren. Dann zog sie ihr Notizbuch unter dem Kopfkissen hervor und schrieb im Licht der Petroleumlampe ihre Geschichte nieder. Mit jedem Satz, den sie zu Papier brachte, entfaltete sich die bunte Welt ihrer Erzählung vor ihren Augen: Schauplatz war die Karibik im siebzehnten Jahrhundert. Im Mittelpunkt stand eine wunderschöne und tapfere Heldin. Sie wuchs in Jamaika als Tochter eines wohlhabenden Plantagenbesitzers auf und sollte nach dem Willen ihres Vaters mit einem englischen Adeligen verheiratet werden.
Heimlich aber gehörte ihr Herz einem spanischen Piraten namens Joaquín. Eine Dienstmagd erfuhr davon und verriet es dem Plantagenbesitzer, der daraufhin vor Wut schäumte und seine Tochter verstieß. Kurzerhand verkleidete sich die Heldin als Mann, um auf Joaquíns Schiff anzuheuern. Endlich war sie mit ihrem Geliebten vereint, aber das Glück der beiden währte nicht lang, denn bald darauf wurde das Piratenschiff von einem englischen Kriegsschiff attackiert. Joaquín erlitt schwerste Verletzungen, und die gesamte Besatzung geriet in englische Gefangenschaft.
Schon sahen sie der Hinrichtung entgegen, doch der englische Gouverneur unterbreitete der Heldin ein Angebot: Als Freibeuter sollte sie fortan für die englische Krone zur See fahren, und wenn es ihr gelänge, genug Gold von den Spaniern zu erbeuten, würde er der gesamten Mannschaft die Freiheit schenken.
In Wahrheit aber verfolgte er einen gänzlich anderen Plan. Längst hatte er die Verkleidung der Heldin durchschaut und sich dabei heimlich in sie verliebt. Um sie ganz allein für sich zu haben, hielt er sie durch die ständigen Raubzüge von Joaquín fern, der mit jedem Tag im Kerker schwächer und schwächer wurde.
Als der Gouverneur der Heldin schließlich Avancen machte, begriff sie, dass er sie die ganze Zeit nur für seine Zwecke manipuliert hatte. Es kam zu einem erbitterten Fechtkampf, doch es gelang ihr, den Gouverneur zu besiegen. Anschließend befreite sie ihren verletzten Geliebten und die restliche Mannschaft aus dem Kerker, heiratete Joaquín, und mit ihren erbeuteten Reichtümern führten sie ein freies und glückliches Leben bis ans Ende ihrer Tage.
Eva musste lächeln. Oh ja, das gefiel ihr! Ein richtiger Abenteuerfilm mit Schlachten, Kämpfen und Intrigen, einer Liebesgeschichte und einem glücklichen Ende. Und endlich einmal mit einer mutigen Heldin, die ihr Schicksal selbst in die Hand nahm. Genau so einen Film hatte sie schon immer im Kino sehen wollen. Aber vielleicht brauchen die Piraten noch ein edles Motiv, damit sie sympathischer wirken, dachte sie. Eine Weile überlegte sie, und schließlich fiel ihr Robin Hood ein. Ja, das war die Lösung. Die Piraten teilten ihre erbeuteten Reichtümer mit den Armen.
Während sie schrieb, sah sie immer wieder zu den Postkarten mit den Schauspielerporträts an der Zimmerwand, und in ihrer Fantasie nahmen ihre Figuren das Aussehen der Stars an. Allen voran die große Betty Davenport. Schon als junges Mädchen hatte sie in zahlreichen Hollywoodfilmen mitgespielt. Inzwischen war aus der kleinen Betty von früher eine erwachsene Frau geworden, die sich nur noch Elizabeth Davenport nannte und sich endgültig vom Image des unschuldigen Fräuleins losgesagt hatte. Überhaupt ließ sie sich auf kein Rollenfach mehr festlegen, wie es schien. Mutter, Mörderin, Hure, Heilige – sie spielte einfach alles. Eva hatte sie schon immer bewundert und beschloss, ihre tapfere Piratin nach ihr zu benennen: Elisabeth.
Jeden Morgen schmuggelte sie ihr Notizbuch ins Büro und tippte die handgeschriebenen Seiten der letzten Nacht heimlich ins Reine. In Rekordtempo flogen ihre Finger über die Tasten. Sobald ihr Chef das Zimmer betrat, wechselte sie rasch das Papier. Ein paar Kolleginnen warfen ihr komische Blicke zu, aber sie ließ sich nichts anmerken. Wenn sie einen guten Eindruck machen wollte, durfte sie den Produktionsfirmen kein handschriftliches Gekritzel vorlegen.
»Und, wie läuft es mit deiner Geschichte?«, erkundigte sich Johanna drei Wochen später. Zu zweit hängten sie die Wäsche auf dem Dachboden auf – eine willkommene Gelegenheit, um ungestört zu reden.
»Ich bin fertig«, verkündete Eva stolz.
»Was? So schnell?«
Eva nickte. »Ich habe mir die Adressen von mehreren Produktionsfirmen aufgeschrieben. Morgen werde ich gleich nach Feierabend hinfahren und meine Unterlagen abgeben.«
»Donnerwetter. Wie oft hast du deine Geschichte denn abgetippt?«
»Doch nicht die ganze Geschichte!« Eva lachte und erklärte, dass sich die Filmfirmen normalerweise mit einer zehnseitigen Inhaltsangabe und vielleicht noch einer ausformulierten, spannenden Stelle begnügten. Das reichte ihnen, um sich ein Bild vom Drehbuch zu machen. Inzwischen kannte sie Duponts Ratgeber beinahe auswendig.
Am nächsten Abend machte sich Eva nach der Arbeit auf den Weg. Die erste Adresse befand sich in der Köthener Straße, in der Nähe des Potsdamer Platzes. Hier lagen die Büros der Universum Film AG, der größten Filmproduktion in Berlin.
Eva schluckte, als sie an der Fassade des Gebäudes emporblickte. Für einen Moment fragte sie sich, was in sie gefahren war, ausgerechnet hier ein Manuskript einreichen zu wollen. Sie, das Tippfräulein, das sich einbildete, Schriftstellerin zu sein. Bestimmt würde man sie auslachen.
Sie atmete tief durch, nahm ihren ganzen Mut zusammen und betrat das Gebäude. Zum Glück war der Pförtner am Eingang sehr freundlich und wies ihr den Weg zum Sekretariat. Mit klopfendem Herzen trat sie an das Pult heran, stellte sich kurz vor und bat darum, ihr Manuskript zur Prüfung einreichen zu dürfen.
»Legen Sie es hin, ich reiche es an unsere Dramaturgen weiter«, meinte die Sekretärin seufzend, nahm den Umschlag entgegen und warf ihn in einen Korb hinter dem Schreibtisch, der bereits vor Papieren überquoll. Im selben Moment klingelte das Telefon. Sie nahm den Hörer ab und wandte Eva den Rücken zu.
Eva verharrte unschlüssig, während die Dame telefonierte, ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen. Schließlich murmelte sie einen Abschiedsgruß und verließ das Büro wieder.
Die restlichen Filmfirmen auf ihrer Liste hatten ihren Sitz allesamt in der belebten Friedrichstraße, in der sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Nachtlokale befanden. »Decla-Bioscop AG« lautete der Name der nächsten Firma, bei der sie vorsprechen wollte.
Eva trug ihre einstudierten Sätze vor, aber auch hier nickte die Empfangsdame nur und ließ den Umschlag mit dem kostbaren Inhalt in irgendeiner Kiste verschwinden.
»Na, kiek mal an. Mal wieder jemand mit nem janz besonderen Einfall«, spottete eine kräftig gebaute Sekretärin mittleren Alters, als Eva ihr Anliegen bei einer weiteren Firma vortrug. »Na, dann jeben Se mal Ihr Briefchen her, Frollein. Landet allet auf unserm Stapel der Hoffnungslosen.«
Zögerlich reichte Eva ihr den Umschlag. »Ich kann doch davon ausgehen, dass mein Manuskript geprüft wird?«
»Sicher, sicher«, polterte die Dame. »Wir ham hier nüscht anderet zu tun, dit können Se mir aber glauben. Angestellte, Beamte, Dienstmädchen – alle haben se Einfälle, nicht wahr?«
Als Eva spät am Abend im Bett lag und Leni und Ilse eingeschlafen waren, setzte sich Johanna auf. »Und?«, flüsterte sie. »Hast du dein Drehbuch schon verkauft?«
Eva musste prusten, woraufhin sich Leni mehrmals unruhig hin und her warf. Als Leni wieder fest schlief, schüttelte Eva verdrossen den Kopf. »Die Firmen werden mit Einsendungen überhäuft. Ich habe die Stapel gesehen, Johanna. Ach was, Stapel … ganze Kisten! Es ist hoffnungslos. Und bald ist der Monat rum. Dann stehe ich auf der Straße.«
Johanna kratzte sich nachdenklich am Kinn. »Dann müssen wir eben etwas anderes versuchen.«
»Was denn?«
Ein Lächeln umspielte Johannas Lippen. »Ich glaube, ich habe schon wieder eine Idee.«
Am Sonntag trat Eva hinter Johanna durch die Drehtür des Romanischen Cafés, das sich schräg gegenüber der Gedächtniskirche befand. Es war der allseits bekannte Treffpunkt für Künstler und Kreative jeglicher Couleur: Maler, Komponisten, Schriftsteller, Journalisten – und natürlich auch Leute vom Film. Zwischen Kaffee und Tageszeitung mit Menschen zu plaudern, die im besten Fall bekannter und einflussreicher seien als man selbst, das gehöre zum Pflichtprogramm eines jeden, der es in der Kreativbranche zu etwas bringen wolle, hatte ihre Schwester erzählt. Und wer es bereits zu etwas gebracht hatte, der kam, um bestehende Kontakte zu pflegen und sich von Normalsterblichen bewundern zu lassen, die dort regelmäßig nach bekannten Gesichtern Ausschau hielten. Sehen und gesehen werden, lautete die Devise. Wer nicht ins Café ging, blieb unsichtbar.
Sogleich schwappten Eva bläuliche Rauchschwaden und ohrenbetäubendes Stimmengewirr entgegen. Hilfesuchend klammerte sie sich an Johanna und sah sich um. Links und rechts gab es Gästeräume mit zahlreichen Tischen.
»Verzeihung«, bat eine Stimme hinter ihnen.
Eva begriff erst jetzt, dass sie noch immer direkt vor der unablässig rotierenden Drehtür standen und den Eingang blockierten. Augenblicklich wichen die beiden Schwestern einen Schritt zur Seite, um die anderen Leute vorbeizulassen. Hier herrschte eine Atmosphäre wie in einem Bahnhof!
»Bist du dir sicher, dass die Idee wirklich so gut ist?«, fragte Eva.
»Die Idee ist großartig.« Johanna sah sich um. »Wenn du mit deinem Drehbuch Geld verdienen willst, darfst du dich nicht von den Vorzimmerfräuleins abwimmeln lassen. Du musst mit den wichtigen Leuten sprechen.«
Ein älterer Mann mit länglichem Gesicht und markantem Kinn blieb vor ihnen stehen. Er trug eine Ausgabe des Berliner Tageblatts bei sich. »Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Sie sehen so aus, als wäre dies Ihr erster Besuch hier.«
Eva öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch Johanna kam ihr zuvor.
»Sie haben uns durchschaut«, erwiderte sie lachend. »Ziemlich voll heute, was?«
Der Mann musterte sie abwechselnd durch sein Monokel. »Das ist nur der ganz normale Betrieb hier. Dann sind Sie beide also Nichtschwimmer.«
»Wie bitte?«, fragte Eva.
Er lächelte gönnerhaft. »In diesem Café gibt es ein paar ungeschriebene Regeln. Der kleinere Raum ist das Bassin für Schwimmer.« Er deutete nach links. »Das ist etwas für die Arrivierten. Sie wissen schon – die großen Namen. Ohne einen solchen wird man Sie dort kaum vorlassen.« Dann wies er nach rechts. »Das Nichtschwimmer-Bassin befindet sich auf der anderen Seite. Der richtige Ort für die jungen Hoffnungsvollen, so wie Sie beide.«
»Ah, verstehe«, meinte Johanna.
Der Mann nickte und reichte erst Johanna und dann Eva die Hand. »Gestatten, Julius Altendorf mein Name. Ich bin Maler und Schriftsteller.«
»Na, so ein Zufall! Meine Schwester ist auch Schriftstellerin!«, platzte Johanna heraus.
Eva spürte, wie ihre Wangen heiß wurden.
Altendorf ging gar nicht erst auf die Bemerkung ein. Stattdessen hielt er die Hand auf. »Sagen Sie, meine Damen – es ist mir etwas peinlich, aber unglücklicherweise habe ich meinen Geldbeutel vergessen. Wären Sie wohl so liebenswürdig, mir fünfzig Pfennig zu leihen, damit ich meinen Kaffee bezahlen kann?«





























