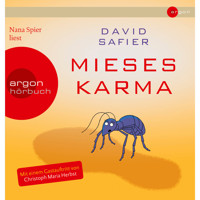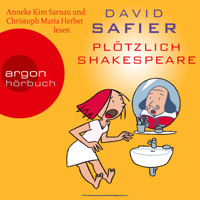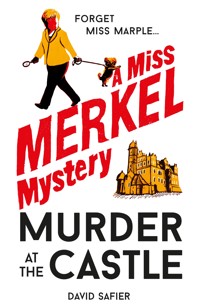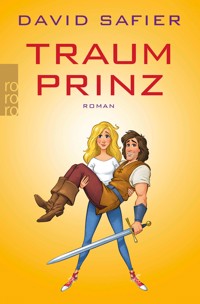
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Welche Frau würde sich nicht gerne den perfekten Mann malen? Die verträumte Comiczeichnerin Nellie hat schlimmen Liebeskummer, als ihr zufällig eine alte tibetische Lederkladde in die Hände fällt. In die zeichnet Nellie ihren Traumprinzen: stark, edel und dreitagebärtig. Als sie am nächsten Morgen aufwacht, hat der Prinz das Zeichenblatt verlassen und steht leibhaftig vor ihr. Mit Schwert und Kettenhemd. Gemeinsam mit dem ungestümen Prinzen namens Retro macht Nellie sich in Berlin auf die Suche nach dem Geheimnis der magischen Kladde. Denn alles, was man in sie hineinzeichnet, erwacht zum Leben. Dabei erlebt das ungleiche Paar jede Menge Abenteuer: Nellie und Retro kämpfen gegen Skinheads, sie fliehen vor der Polizei und stellen fest, dass böse Kräfte mit der Magie der Lederkladde die Welt zerstören wollen. Das größte Abenteuer jedoch, das die beiden zu bestehen haben, ist das der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
David Safier
Traumprinz
Roman
Über dieses Buch
Welche Frau würde sich nicht gerne den perfekten Mann malen? Die verträumte Comiczeichnerin Nellie hat schlimmen Liebeskummer, als ihr zufällig eine alte tibetische Lederkladde in die Hände fällt. In die zeichnet Nellie ihren Traumprinzen: stark, edel und dreitagebärtig. Als sie am nächsten Morgen aufwacht, hat der Prinz das Zeichenblatt verlassen und steht leibhaftig vor ihr. Mit Schwert und Kettenhemd. Gemeinsam mit dem ungestümen Prinzen namens Retro macht Nellie sich in Berlin auf die Suche nach dem Geheimnis der magischen Kladde. Denn alles, was man in sie hineinzeichnet, erwacht zum Leben. Dabei erlebt das ungleiche Paar jede Menge Abenteuer: Nellie und Retro kämpfen gegen Skinheads, sie fliehen vor der Polizei und stellen fest, dass böse Kräfte mit der Magie der Lederkladde die Welt zerstören wollen. Das größte Abenteuer jedoch, das die beiden zu bestehen haben, ist das der Liebe.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, November 2017
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke und Cordula Schmidt
Umschlagabbildungen Oliver Kurth
ISBN 978-3-644-31461-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Marion, Ben und Daniel – ihr seid
mein Traum!
(Und du natürlich auch, Max)
1
Ich war noch nie ein Fan von der Realität. Die war mir immer schon viel zu realistisch. Besonders wenn es um die Liebe geht. Und um die Männer.
Doch wider besseres Wissen träumte ich mit Ende zwanzig immer noch von der großen Liebe und dem ganz besonderen Mann. Für eine kurze Zeit hatte ich gehofft, beides mit Bendix endlich gefunden zu haben. Bis zu jenem Augenblick, als er fluchte: «Mist, da kommt meine Freundin!»
Dass wir dabei gerade proseccobeschwingt in der Riesenbadewanne seiner hippen Berliner Altbauwohnung saßen, machte die Sache nicht gerade besser.
«Du … du hast eine Freundin?», stotterte ich entsetzt und hörte, wie die Wohnungstür geöffnet wurde.
«Ja …», antwortete er mit Panik im Gesicht und Badeschaum auf dem süßen Lockenkopf und in dem gepflegten Hipster-Bärtchen.
«Ich … ich dachte, wir wären zusammen», stammelte ich.
«Oh …», staunte er.
«Oh … mehr hast du dazu nicht zu sagen?»
«Na ja …»
«Das ist auch nicht viel besser!»
Ich hatte tatsächlich gedacht, Bendix und ich wären so etwas Ähnliches wie ein Paar. Wir hatten uns vor drei Wochen via Dating-App kennengelernt. Ich mochte sein freundliches Lächeln auf dem Profilfoto, während er – wie er mir gestand – von meiner blonden Mähne, die keine Bürste je bändigen konnte, auf Anhieb fasziniert war. Bei unserem ersten Date hatten Bendix und ich die ganze Nacht durchgequatscht, am Ende des zweiten kam ein wundervoller Abschiedskuss unter Vollmondhimmel hinzu, und beim dritten Date landeten wir im Bett, wo wir richtig guten Sex hatten. Noch vor wenigen Augenblicken hatte Bendix mir tief in die Augen geschaut, und ich hatte seit vielen Jahren wieder gespürt, wie wundervoll es sein kann, verliebt zu sein.
«Eigentlich ist sie nicht meine Freundin, Nellie», erklärte Bendix. Im Flur wurde ein Koffer abgestellt, eine Wohnungstür fiel ins Schloss.
«Nicht?», fragte ich irritiert und auch ein klein wenig hoffend, vielleicht hatte ich mich ja verhört.
«Sie ist meine Verlobte.»
«SIE IST WAS?», rief ich.
«Meine Verlobte …», wiederholte er, und mein Magen zog sich zusammen, als wolle er schon mal ankündigen, dass er die nächsten Wochen vor lauter Liebeskummer keine feste Nahrung zu sich nehmen würde.
Wie hatte ich nur so dumm sein können zu glauben, ein Mann wie Bendix würde sich ernsthaft in jemanden wie mich verlieben? Wir waren doch so verschieden: Er lief jeden Morgen zehn Kilometer durch Berlin, mein Fitnesszustand hingegen war nur als erbarmungswürdig zu bezeichnen. (Nach unserer ersten Verabredung hatte ich gedacht, ich sollte auch mal wieder mit Sport anfangen, und wurde beim Joggen im Park von einer Zwölfjährigen überholt. Und von einer Sechzigjährigen. Und auf den letzten Metern noch von einer Gruppe Nordic Walker.) Bendix war stets lässig schick im Hipster-Style gekleidet, ich trug öfter mal zwei verschiedene Socken, wenn ich in meinem Wäschechaos keine zusammenpassenden fand. Und er arbeitete als Projektleiter für UNICEF Deutschland, während ich als Verkäuferin in einem Comicladen jobbte und davon träumte, eine professionelle Comiczeichnerin zu werden. Meinem Traum war ich seit Jahren keinen Schritt näher gekommen. Ich hatte lediglich ein paar Geschichten im Selbstverlag veröffentlicht mit Titeln wie: Single-Woman rettet die Liebe, Single-Woman erobert Manhattan oder Single-Woman trifft Ehe-Man.
Captain Bindungsangst war bei meinen 84 Stammlesern so beliebt, dass ich darüber nachdachte, noch mehr Figuren wie ihn zu erfinden: Fremdgeh-Boy, Bad Dancer und Florian, der Barbar.
Bendix mochte meine Comics sehr und fand meinen Traum, mit ihnen Leser in andere Welten entführen zu wollen, kein bisschen lächerlich. Ganz im Gegensatz zu etwa 99 Prozent der anderen Menschen in meinem Leben inklusive meiner ehemaligen Kommilitonen aus meinem abgebrochenen Lehramtsstudium, die mittlerweile allesamt verbeamtet waren und fröhlich Familien gründeten. Auch meine Eltern sagten in regelmäßigen Abständen Dinge wie: «Nellie, wann machst du mal was Anständiges?», «Soll das ewig so weitergehen?» und «Was haben wir nur falsch gemacht?» Aktuell gab es nur zwei Menschen auf der ganzen Welt, die meinen Traum vom Comiczeichen verstanden: Der eine war Lenny, mein stets bekiffter Kollege im Comicladen, und der andere war Bendix. Auch das machte ihn so liebenswert.
«Warum hast du mir nie von deiner Verlobten erzählt?», fragte ich das Naheliegende und zitterte dabei am ganzen Körper, obwohl das Badewasser noch ganz warm war.
«Sie war für ein halbes Jahr weg», flüsterte er. «Für Ärzte ohne Grenzen in Nigeria. Und sie sollte erst morgen wiederkommen.»
«Das ist nicht wirklich eine Erklärung», erwiderte ich, und mein Magen klumpte sich noch mehr zusammen.
«Psst», zischte Bendix und legte seinen Zeigefinger an die Lippen, doch es war zu spät. Aus dem Flur hörten wir eine melodiöse Stimme rufen: «Bendix, bist du das?»
«Ja, Marissa!», rief er zurück.
«Ich glaube», fand ich, «es wird Zeit zu gehen.» Ich stützte mich auf dem Rand der Riesenwanne ab, um mich hochzuhieven.
«Nein, Nellie», zischte Bendix hastig. «Geh nicht.»
«Nicht?», hielt ich in halber Höhe inne. Wollte er, dass seine Verlobte mich sah? Wollte er ihr gestehen, dass er jemanden kennengelernt hat? Und dann mit ihr Schluss machen? War also alles gar nicht so schlimm?
«Du darfst jetzt nicht gehen, Nellie», wiederholte er und drückte mich mit den Armen wieder sanft in die Wanne zurück. Mein Gott, er wollte wirklich, dass seine Verlobte mich sah. Er wollte sie für mich verlassen!
«Tauch unter, Nellie.»
«Ähem … wie bitte, was?»
«Tauch unter», wiederholte er und deutete in das vom Badeschaum bedeckte Wasser. So viel also zu der Illusion, dass er sich für mich entscheiden würde. Bendix wollte seine Verlobte nicht verlieren. Ich sollte so lange unter dem Badeschaum verschwinden, bis er sie aus dem Badezimmer herauskomplimentiert hatte. Sie sollte nichts von mir mitkriegen. Und ich war ihm anscheinend völlig egal. Das tat weh.
Eigentlich hätte ich Bendix den Waschlappen ins Gesicht hauen und unter Protest Wanne und Wohnung verlassen sollen. Doch wäre das richtig gewesen? Anständig? Seine Verlobte würde mich sehen, und das würde ihr das Herz brechen. Und seines gleich mit, das erkannte ich jetzt an seinem flehenden Blick. Wenn ich untertauchte, könnte ich die Frau vor einer Verletzung bewahren und Bendix die Chance geben, seine Beziehung zu kitten. Dann gäbe es nicht drei Opfer, sondern nur eins. Mich. Und wenn mich all meine geliebten Comics, Serien und Fantasy-Bücher von Star Wars über Tribute von Panem zu Harry Potter eins gelehrt hatten, dann war es, dass es das Richtige ist, andere vor Schaden und Schmerz zu bewahren, auch wenn man selbst darunter leidet. Es war also moralisch richtig unterzutauchen!
Abgesehen davon hatte ich tierische Angst davor, mich von seiner Verlobten nackt in der Badewanne erwischen zu lassen.
So holte ich tief Luft und tauchte unter. Dabei musste ich an Harry Potter und der Feuerkelch denken, als Harry unter Wasser überleben musste. Wie gerne hätte ich mit ihm getauscht. Nicht nur, dass er Kiemenkraut dabeihatte, mit dem er unter Wasser atmen konnte, Harry musste auch nicht zwischen behaarten Männerbeinen liegen. Zugegeben, der junge Zauberer musste sich unter Wasser mit Grindelohs rumschlagen, aber ich hätte jetzt auch lieber gegen fiese kleine Wasserdämonen gekämpft.
«Ich dachte, du kommst erst morgen, Marissa», hörte ich Bendix sagen. Seine Stimme klang unter Wasser ganz gedämpft.
«Ich wollte dich überraschen», lachte sie.
Das war ihr durchaus gelungen.
«Super», lachte Bendix, und selbst unter Wasser konnte man hören, dass er nicht sonderlich überzeugend klang.
«Ist was?», fragte Marissa, die das natürlich bemerkte.
«Wieso?»
«Du wirkst so merkwürdig.»
«Nein, nein … ich bin nur wirklich überwältigt, dass du schon da bist. Komm lass uns einen Kaffee trinken gehen», schlug Bendix vor. Unterdessen stellte ich mir die Frage, wie lang ein Mensch überhaupt unter Wasser überleben konnte. Sechzig Sekunden? Neunzig? Und wie viele davon waren schon vergangen? Fünfundzwanzig? Dreißig? Jedenfalls deutlich mehr, als mir lieb war!
«Ich hab eine bessere Idee», sagte Marissa, und obwohl auch ihre Stimme dumpf verzerrt klang, war ich mir sicher, dass ihr Tonfall verführerisch war.
«Und welche?», fragte Bendix, bemüht, sich nichts anmerken zu lassen.
«Ich komm zu dir in die Wanne.»
Ach du Scheiße, dachte ich. Und noch nie in meinem Leben zuvor war Ach du Scheiße ein so passender Gedanke für eine Situation gewesen.
«Aber … aber», stammelte Bendix, «ich bin … ganz verschrumpelt.»
«Hach, ich entschrumpele dich schon wieder.»
Ich wartete auf Bendix’ genialen Einfall. Und wartete. Und wartete. Langsam, aber sicher ging mir die Luft aus. Offenbar fiel Bendix noch nicht mal etwas Blödes ein. Es fiel ihm gar nichts ein. Und so kam es, dass plötzlich ein nackter Frauenfuß durch den Schaum stieß und direkt über meinem Gesicht die Temperatur des Wassers testete. Vor lauter Schreck öffnete ich den Mund. Luftblasen stiegen zur Oberfläche.
«Was ist denn das?», staunte Marissa, während sie mit ihrem Fuß etwa eineinhalb Zentimeter über meiner Nase innehielt.
«Ich … ich hab gepupst», stammelte Bendix.
«Gepupst?», fragte Marissa skeptisch, während ich sehnsüchtig meinen Luftblasen nachsah.
«Ich war heute indisch essen», schwindelte Bendix.
«Indisch?»
«Da hab ich was mit Linsen gegessen.»
Marissa war nicht überzeugt. Und meine Lunge war schier am Zerplatzen. Viel länger würde ich es nicht mehr aushalten.
«Erbsen gab es da auch», legte Bendix hektisch nach.
«Aha.»
«Es war ein All-you-can-eat-Buffet!»
«Ich glaub dir kein Wort», sagte Marissa und ließ ihren Fuß tiefer ins Wasser sinken. Direkt auf mein Gesicht.
So etwas passierte Harry Potter nie.
«Ah, ich bin da in etwas getreten», schrie Marissa und nahm den Fuß schnell wieder aus der Wanne.
«Meine Wade …», versuchte sich Bendix rauszureden.
Ich konnte nicht mehr. Gleich müsste ich auftauchen. Mit geradezu übermenschlicher Anstrengung versuchte ich, diesen Moment noch ein paar Sekunden herauszuzögern. Doch da griff Marissa schon in die Wanne, packte meine Haare und zog mich rüde aus dem Wasser.
«Lag die etwa auch auf dem All-you-can-eat-Buffet?», fragte sie bissig.
Vielleicht wäre ich von dem schlagfertigen Spruch sogar beeindruckt gewesen, wenn sie nicht so brutal an meinen Haaren gezogen hätte, dass ich aufschreien musste. Ich verschluckte mich fürchterlich. Außerdem brannte der Badeschaum in meinen Augen, ich rieb sie trocken, aber sie brannten nur noch mehr, also tastete ich blind und hustend nach dem Handtuch. Bendix war wie gelähmt. Dafür klatschte mir Marissa ein Handtuch ins Gesicht. Ich schrie wieder auf, musste noch mehr husten und brauchte so eine Weile, bis ich mir mit dem Handtuch mein Gesicht abtrocknen und wieder klar sehen konnte. Vor mir stand eine zierliche Schönheit mit langen braunen Haaren und dunklen Augen. Ein bisschen wie die junge Angelina Jolie. Eigentlich hätte ich mich dieser wunderschönen Frau entsetzlich unterlegen fühlen müssen. Nicht nur, weil sie so anmutig war, sondern weil sie etwas in ihrem Leben erreicht hatte. Sie arbeitete als Ärztin in der Entwicklungshilfe, stieg mutig in klapprige Flugzeuge und rettete im nigerianischen Busch Menschenleben. Das größte Abenteuer meines bisherigen Lebens war ein Ryanair-Flug an den bulgarischen Goldstrand, wo ich mir einen Magen-Darm-Infekt geholt hatte. Diese Frau war eine Heldin im echten Leben, ich hingegen dachte mir nur Heldinnen in Comics aus. Und dennoch hatte ich in diesem Augenblick Mitgefühl für sie. Wie hart musste das für sie sein? Ihr Verlobter ging fremd. Und dann auch noch mit einer Frau, die ihr in keiner Hinsicht das Wasser reichen konnte.
Marissa sah das Mitleid in meinen Augen. Das machte sie jedoch nur noch zorniger. Mit einem Blick, der geschmolzenen Hochofenstahl hätte gefrieren lassen können, sagte sie: «Raus!»
Ich widersprach nicht. Tropfend und mit Badeschaum am ganzen Körper stieg ich aus der Wanne.
«Und jetzt verschwinde, du Schlampe!»
«Wie hast du mich genannt?» Mein Mitgefühl für sie schwand schlagartig.
«Ich hab dich Schlampe genannt!», wiederholte sie.
Ich wollte kontern, aber nicht einfach plump mit einem anderen Schimpfwort. Ich wollte etwas total Cleveres erwidern. Etwas, das sie bis ins Mark traf. «Wenn ich eine Schlampe bin, bist du … dann bist du … eine … eine … Schlimpe.»
«Eine was?»
Mein Gott, warum fiel mir nie etwas Schlagfertiges ein?
«Hau endlich ab!», befahl sie mir.
«Darf ich noch meine Sachen nehmen?», fragte ich kleinlaut, um einen Funken Restwürde bemüht.
«Nein.»
«Nein?»
«Nein!»
«Ich verstehe immer nur nein», sagte ich irritiert.
«Das liegt daran, dass ich das auch gesagt habe.»
Blitzschnell hob sie meine Klamotten vom Boden und drückte sie an ihre perfekt geformten Brüste. «Das ist die Strafe dafür, dass du einer Frau den Mann ausspannen willst.»
«Du kannst mich doch nicht ohne Klamotten rauswerfen», protestierte ich.
«Und ob ich das kann!»
Hilflos sah ich zu Bendix, der sich bis dahin erfolgreich aus dem Gespräch herausgehalten hatte, in der sicherlich nicht ganz unberechtigten Annahme, dass im Falle seiner Einmischung beiden Frauen aufgehen könnte, wer hier eigentlich der Schuldige war. Er überlegte kurz, was er antworten sollte, öffnete einmal sogar den Mund, ließ es aber lieber bleiben und tauchte unter.
«Verschwinde endlich!», zischte die Ärztin ohne Grenzen. Ich fühlte mich jetzt ein wenig wie in einem Superheldenkampf: Single-Woman gegen Die Verlobte des Grauens. Und eins war klar, Single-Woman würde sich von so einer Schurkin nicht unterkriegen lassen.
«Ich will aber meine Sachen», beharrte ich.
«Ich habe mich in Nigeria mit Ebola, Soldaten und Warlords rumgeschlagen. Da werde ich mit dir locker fertig!», erklärte Marissa recht überzeugend.
Mit wem war ich im Leben schon so fertig geworden? Das letzte Mal hatte ich eine körperliche Auseinandersetzung in der dritten Klasse gehabt. Damals hatte ich mich mit dem dicken Paul geprügelt und sogar gewonnen. Allerdings war Paul einen Kopf kleiner und ging noch in den Kindergarten. Die Verlobte des Grauens würde mich zum Frühstück verputzen, obwohl bereits Nachmittag war.
Während ich zögerte, tauchte Bendix kurz auf, checkte die Lage, holte tief Luft und verschwand erneut im Wasser.
Mir schossen die Tränen in die Augen. Ich wollte der Irren jedoch nicht die Genugtuung geben, vor ihren Augen einen Heulkrampf zu bekommen. Ich schnappte mir das Handtuch, wickelte es um meinen Körper und verließ die Wohnung. Trotzig. Tropfend. Traurig. Und kein bisschen heldenhaft.
Ich Idiotin hätte es besser wissen müssen: Kaum lässt man Gefühle zu, kommt sie auch schon und schlägt einen zu Boden: die blöde Realität.
2
Es gibt angenehmere Dinge, als lediglich mit einem Handtuch bekleidet durch Berlin-Mitte zu gehen. Zum Beispiel Magen-Darm-Verstimmungen, die Beulenpest oder ein Konzert der Kastelruther Spatzen. Das lag weniger an den Berlinern, die gab es in Mitte so gut wie gar nicht mehr, es lag an den Touristen. Ich wurde von Japanern fotografiert, die fast beleidigt reagierten, wenn ich ihnen zurief: «Please take the handy away», «No, I won’t take a selfie with you!» und «Hey, take the selfie stäng away!» (Dabei war ich mir ziemlich sicher, dass die englische Übersetzung für Selfie-Stange nicht selfie stäng war.) Da ich barfuß unterwegs war, fiel mir das erste Mal auf, wie schmutzig die Berliner Gehwege sind. Ich musste oft Slalom gehen und manchmal sogar hüpfen wie beim Gummitwist. Hätte Pretty Woman in Berlin gespielt, wäre Richard Gere in seiner Barfuß-Szene, wo er die Erde wieder spürte und so seine Menschlichkeit fand, in Kaugummi getreten. Oder in Scherben. Oder in Hundekacke. Flugs hätte er seine Schuhe wieder angezogen, wäre böser Unternehmer geblieben, und Julia Roberts müsste immer noch anschaffen gehen.
Das einzig Gute an meinem Martyrium war, dass es mich von Bendix und meinen Tränen ablenkte. Ich musste mich auf die Frage konzentrieren, wie ich mich aus dieser unangenehmen Lage befreien konnte, bevor irgendein Blödmann ein Video von mir auf Youtube hochlud. Ich wollte meinen Comicladen-Kollegen Lenny anrufen, damit er mich mit seinem VW-Käfer abholen würde. Doch um ihn anzurufen, fehlte mir eine Kleinigkeit: mein Handy. Das lag noch zusammen mit meinen Klamotten in Bendix’ Wohnung. Ich fragte Passanten, ob sie mir kurz ihr Handy für einen Anruf leihen könnten, doch die gingen einfach weiter mit dem typischen Was-interessiert-mich-dein-Schicksal-Großstädterblick. Da entdeckte ich einen punkigen Teenager mit blauen Haaren, der auf seinem Handy daddelte. Ich ging zu ihm und spähte ihm über die Schulter. In dem Spiel ging es darum, niedliche kleine Fische möglichst weit aus dem Wasser an Land zu katapultieren.
Ein freakiger Typ wie dieser Punker, so hoffte ich, würde mehr Mitgefühl zeigen, Außenseiter mussten doch zusammenhalten!
«’tschuldige», sprach ich ihn an, «kannst du mir einen Gefallen tun?»
«Und welchen?», fragte der Punk eher lustlos, ohne mich anzuschauen.
«Kann ich mit deinem Handy mal einen Anruf machen?»
Er sah auf, bemerkte, dass ich nur mit einem Handtuch bekleidet war, und lächelte breit: «Na klar!»
«Danke», sagte ich erleichtert.
«Ich hätte aber gerne etwas im Gegenzug», sagte er und starrte dabei auf meine nur von dem Handtuch bedeckten Brüste.
«Und was?», fragte ich vorsichtig.
«Dein Handtuch», grinste er anzüglich.
Genervt wandte ich mich ab und fand einzig und allein Trost in der Tatsache, dass ich keine Lehrerin geworden war und mich deshalb nicht Tag für Tag mit solchen pubertierenden Amateurkomikern herumschlagen musste.
Da es offenbar unmöglich war, als Mensch in Not in Berlin Hilfe zu bekommen, wog ich meine Optionen ab. Meine Ein-Zimmer-Bude war sechs S-Bahn-Stationen entfernt, der Comicladen, in dem ich jobbte, nur zwei. Dort hatte ich zwar keine Anziehsachen herumliegen, aber es gab da jede Menge Fan-Klamotten im Angebot, die ich mir ausleihen konnte.
Ich eilte zur nächsten S-Bahn-Haltestelle, zog mangels Geld keine Fahrkarte am Automaten und war erleichtert, dass ich nicht am Bahnsteig rumstehen und mich anstarren lassen musste, da die Bahn sofort einfuhr. Hastig hüpfte ich hinein und suchte mir einen Platz. Die Menschen um mich herum rückten ein wenig von mir ab und starrten auf ihre Smartphones – der ganz natürliche Umgang mit vermeintlichen Spinnern im öffentlichen Nahverkehr. Während die Bahn vor sich hin ruckelte, fiel mein Blick auf die Ankündigung einer Ausstellung des New Yorker Künstlers Damien Moore namens Heaven and hell are other people. Unter anderen Umständen hätte ich mir das Poster genauer angesehen, weil ich die Werke dieses Mannes großartig fand. Aber ich musste immerzu an Bendix denken. Erneut zog sich mein Magen zu einem kleinen harten Klumpen zusammen. Und das Magenweh war ja nur die erste von den sieben Stufen des Liebeskummers, die ich leider allzu genau kannte:
Magenweh
Heulen
Weltrekordversuch im Selbstmitleid
Über Wochen
Und Monate
Stundenlanges Hören von Michael Jacksons Klassiker Man in the Mirror, um Selbstbewusstsein aufzubauen
Verarbeiten des Erlebten in einem Comic
«Fahrscheine, bitte!», hörte ich von etwas weiter her eine Stimme. Panisch blickte ich auf, weiter hinten im Wagen verrichteten Kontrolleure ihre Arbeit. Ich stand auf und wollte unauffällig ans andere Ende des Wagens gehen, in der Hoffnung, aussteigen zu können, bevor ich erwischt wurde. Aber leider ist es nicht ganz so einfach, unauffällig zu sein, wenn man lediglich mit einem Handtuch bekleidet ist. Kaum war ich ein paar Schritte gegangen, stellte sich mir ein dritter Kontrolleur in den Weg: «Irgendetwas sagt mir, dass Sie keine Fahrkarte dabeihaben.»
Bei dem Mann handelte es sich um einen Mittvierziger mit Migrationsvordergrund. Vielleicht kam er aus Syrien, Marokko oder Afghanistan, jedenfalls definitiv nicht aus Norwegen. Dennoch sprach er besseres Deutsch als viele Zuwanderer. Und sicherlich sehr viel besser als die meisten Deutschen Dari sprechen würden, wenn sie durch die Umstände gezwungen wären, in Kabul zu leben.
«Wie kommen Sie denn darauf, dass ich keine Karte habe?», fragte ich und rang mir ein Lächeln ab, das angesichts meines Kummers und meiner augenblicklichen Situation eher gequält ausfiel.
«Nun», lächelte der Mann freundlich, «Ihr Handtuch hat vermutlich keine Tasche.»
«Nein», musste ich gestehen.
«Dann müsste ich Sie jetzt wegen Schwarzfahren anzeigen», erklärte der Kontrolleur, während die S-Bahn vor sich hin ratterte und nicht mehr weit von meinem Ziel entfernt war. «Und da Sie gewiss auch keinen Ausweis dabeihaben, muss ich auch die Polizei rufen, die Sie dann mitnimmt.»
«Ich hatte heute echt einen schlechten Tag», appellierte ich an sein Mitgefühl.
«Schlechte Tage kenne ich», seufzte der Mann. «Zum Beispiel, als wir mit unserem Flüchtlingsschiff in Seenot gerieten …»
Plötzlich schien mir mein Liebeskummer ein wenig lächerlich.
«Oder als es im Flüchtlingslager ein Erdbeben gab.»
Okay, arg lächerlich.
«Ich weiß gar nicht», sinnierte der Kontrolleur weiter, «soll ich aufhören, an Gott zu glauben, weil er so viel Leid zulässt? Oder ihm dankbar sein, weil ich alles überlebt habe und jetzt zwölf Stunden am Tag in Sicherheit Fahrkarten kontrollieren darf?»
Was sollte man darauf antworten?
«Und wie schlecht war Ihr Tag genau?», wollte er nun von mir wissen.
Ich mochte ihm nicht erzählen, dass mich die Verlobte eines Mannes, in den ich mich verknallt hatte, in der Badewanne erwischt und hinausgeworfen hatte. Das wirkte im Vergleich zu seinem Schicksal lächerlich. Daher entschloss ich mich für eine simple Lüge: «Man hat mich im Freibad ausgeraubt.»
«Sie riechen aber kein bisschen nach Chlor», entgegnete er, und ich fluchte innerlich, dass ich offensichtlich an den einzigen Kontrolleur in Berlin geraten war, der es mit Sherlock Holmes aufnehmen konnte.
«Haben Sie keine bessere Geschichte für mich, die es mir erlaubt, Sie nicht der Polizei zu übergeben?»
Sollte ich dem Mann doch erklären, was passiert war? Oder ihm, wie gewünscht, mit einer Geschichte kommen? Ich entschied mich für die Geschichte: «Ich bin eine Prinzessin, die von einer Hexe in einen Frosch verzaubert wurde. Vorhin hat mich ein Mann geküsst und damit wieder zurückverwandelt. Und jetzt bin ich nackt. Und das Einzige, was ich zum Bedecken meines Körpers gefunden habe, ist dieses Handtuch.»
«Und was ist mit dem Mann, der Sie geküsst hat?», fragte der Kontrolleur.
«Der ist vor lauter Schreck weggelaufen.»
Da musste der Mann laut loslachen. Die S-Bahn stoppte an der Station, an der ich aussteigen wollte. Hinter mir gingen die Türen auf, und er bedeutete mir mit dem Kopf, zu verschwinden. Zum Abschied rief er mir nach: «Und sehen Sie zu, dass Sie sich von Hexen fernhalten.»
Ich stieg aus, atmete tief durch und dachte: 1:0 für die Phantasie.
3
Meine Euphorie, den Tag nicht halbnackt auf einem Berliner Polizeirevier zu verbringen, währte gerade mal zweihundert Meter Fußweg. Kaum trat ich durch die Tür des Ladens Käpt’n Comic und sah den schmuddeligen Teppichboden, dessen ursprüngliche Farbe wohl nur Experten rekonstruieren konnten, da hatte mich der Liebeskummer auch schon wieder eingeholt.
Käpt’n Comic war nicht so sauber und elegant wie die Comicläden, die man aus amerikanischen Filmen und Serien kannte. Im vorderen Bereich sah er noch halbwegs ordentlich aus mit einem lebensgroßen Superman aus Kunststoff, einem Donald-Duck-Aufsteller aus Pappe, gut gefüllten Comicregalen, einem Kleiderständer und einem wirklich gemütlichen Ledersessel. Der hintere Teil des Ladens und der Lagerraum waren hingegen so unordentlich, als wäre eine Horde Walking Dead durch sie gestapft. Überall lagen Haufen mit Heften und Groschenromanen herum, die kein Mensch jemals kaufen würde. Unser stets missgelaunter Chef, der eigentlich Lothar hieß, den wir aber nur Griesgram Grauswitz nannten, wollte sie auf gar keinen Fall wegwerfen. Er war davon überzeugt, jederzeit könnte jemand kommen, um die alten Dinger zu kaufen. Meine Vermutung war, dass Lothar sich einfach nicht von Heften wie Sommerspaß mit Bussi-Bär trennen wollte.
Der Griesgram glaubte genauso wenig an freundliche Kundenbehandlung wie an die pünktliche Bezahlung seiner Mitarbeiter. Und dennoch war er ein Chef, auf den jeder Angestellte, der in einem Konzern arbeiten musste, neidisch gewesen wäre, denn er glänzte die meiste Zeit durch Abwesenheit. Er ließ mich und meinen Kollegen einfach machen.
Hinter dem Tresen saß der dünne, blasse Lenny und las einen Batman-Comic. Dabei hatte er einen Lolli im Mund und seine Star Wars-Cap mit der Aufschrift Han shot first auf dem Kopf. Ich glaube, ich habe Lenny noch nie ohne dieses Cap gesehen. Vermutlich war er damit schon auf die Welt gekommen. Lenny sah gar nicht auf, sondern plapperte direkt los: «Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist?»
«Nein», antwortete ich matt und schlurfte zum Kleiderständer.
«Batman hat ganz schön Glück gehabt, dass ihm genau in dem Moment, als er beschloss, Superheld zu werden, Fledermäuse begegnet sind. Wegen denen hat er sich ja Batman genannt.»
«Und warum hat er da Glück gehabt?», fragte ich ohne echtes Interesse.
«Stell dir mal vor, es wären Meerschweinchen gewesen», redete er weiter, noch immer ohne aufzusehen, «dann wäre er jetzt Meerschweinchen-Man. Oder Stinktiere …»
Ich drehte den Kleiderständer und suchte nach passenden Klamotten, ohne wirklich zuzuhören.
«Oder ihm wäre Adam Sandler begegnet …»
Ich nahm mir einen Overall, der dem von Sigourney Weaver in Alien nachempfunden war.
«Oder ein Fahrstuhl …»
Da ich gar nicht reagierte, sah Lenny doch mal auf und erkannte, dass ich nur mit einem Handtuch bekleidet war. Da fiel ihm beinahe der Lolli aus dem Mund, und er vergaß glatt, mir zu erklären, welche Superkräfte ein Fahrstuhl-Man besitzen würde (bestimmt war das ein Held, der sich sehr gut mit dem Auf und Ab im Leben auskannte). Lenny wollte gerade zum Sprechen ansetzen, da bat ich: «Frag nicht.»
«Was ist denn mit dir passiert, Nellie?»
«Was hast du an Frag nicht nicht verstanden, das Frag oder das nicht?»
«Warum ich nicht fragen soll.»
«Weil die Antwort so weh tut», erwiderte ich mit einem Pathos, zu dem nur unglücklich Verliebte fähig sind.
«Bendix», begriff Lenny.
«Genau, Bendix», bestätigte ich traurig.
«Hipster – hasse sie oder hasse sie.»
Obwohl es sicherlich für meinen emotionalen Haushalt gesund gewesen wäre, konnte ich Bendix nicht hassen. Das konnte ich keinen der Männer, die mir das Herz gebrochen hatten. Zum Hassen fehlt mir anscheinend jegliches Talent.
«Kannst du dich bitte umdrehen?», bat ich Lenny.
«Warum das denn, Nellie?»
«Weil ich mich umziehen will?»
«Ich hab schon viele nackte Frauen gesehen», sagte Lenny.
«Auch im echten Leben?»
Für einen kurzen Moment sah ich Schmerz in Lennys Augen. Und ich verfluchte mich, nicht die Klappe gehalten zu haben. Ich kannte Lenny schon sieben Jahre, und in der Zeit hatte er noch nicht mal ansatzweise ein Date gehabt. Er war also noch einsamer als ich. Und das hatte ich ihm jetzt unter die Nase gerieben. Bevor ich mich entschuldigen konnte, hatte Lenny sich schon wieder im Griff und lächelte: «Ich hab meinen Comic noch nicht zu Ende gelesen, ich muss doch wissen, ob Batman und Catwoman in der Kiste landen und dabei ihre Masken auflassen.»
Lenny wandte sich wieder seinem Heftchen zu, und ich ließ das Handtuch zu Boden fallen. Er war bestimmt nicht der Typ, der glotzte. Er war zwar schräg, aber im Herzen anständig. Ich nahm mir Minnie Mouse-Unterwäsche, schlüpfte in den Overall und zog mir noch rot-goldene Iron Man-Sneakers an. Anschließend ging ich zu einer Glasvitrine und betrachtete mein Spiegelbild. Der Overall schlabberte ein wenig, aber alles war besser, als nur mit einem Handtuch herumzulaufen. Ich beugte mich vor und sah mir mein Gesicht genauer an. Unter beiden Augen hatte ich jeweils vier kleine Trauerfalten. Eine für jeden Mann, der mir bisher das Herz gebrochen hatte. In chronologischer Reihenfolge waren das:
Jasper: Als ich dreizehn Jahre alt war, war er fünfzehn, deutlich weiterentwickelt als ich, und ich hatte mich unsterblich in ihn verliebt. Leider erklärte Jasper mir bei einer Schulparty, dass er grundsätzlich keine Mädchen mit Zahnspange küsst. Noch viele Jahre später hatte ich ein gestörtes Verhältnis zu Kieferorthopäden.
Lukas: Mit ihm hatte ich den ersten Zungenkuss. Den ersten Sex. Und den ersten Trennungsschmerz. Der Reihe nach: Wir lernten uns in den Sommerferien kennen, den ersten, die so heiß waren, dass auch mein konservativer Vater langsam daran glaubte, es könnte so etwas wie den Klimawandel geben. In einer Eisdiele bestellte ich mir einen Schoko-Crispie-Becher. Lukas stand hinter mir in der Reihe und bestellte auch einen Schoko-Crispie-Becher. Da sah ich ihn zum ersten Mal. Er lächelte mich so nett an und hatte so schöne braune Haare. Ich dachte sofort, wir wären seelenverwandt, weil hey … wir mochten beide Schoko-Crispie-Becher! Wir verliebten uns so schnell, wie es nur zwei Teenagern bei 38 Grad im Schatten möglich war. Ein ganzes Jahr lang hatten wir nur Augen füreinander, liebten es, gemeinsam im Bett zu liegen, dabei Serien anzuschauen und Schoko-Crispie-Eis zu essen. Wir stellten fest, dass Sex etwas Wunderbares sein konnte, selbst wenn man sich manchmal dabei dämlich anstellte, und dass er sehr viel mehr Freude bereitete, als für das Abi zu pauken. Ohne Lukas wäre mein Abischnitt bestimmt 0,7 besser gewesen. Als er sich nach der Abifeier zum sozialen Jahr nach Peru verabschiedete, heulten wir uns am Flughafen die Augen aus und schworen uns ewige Liebe für den Rest des Lebens. Der Rest des Lebens dauerte gerade mal drei Wochen. Da begann Lukas den täglichen Skype-Anruf mit den schrecklichsten Worten, die es in der deutschen Sprache gibt: «Du … ich muss dir was sagen …» Dann erzählte er mir von einem Lama, das sich auf der Farm, auf der er arbeitete, den Fuß an einem Felsvorsprung böse verletzt hatte und wie er das Lama verarztet hatte. Zusammen mit Conchita.
«Conchita?», fragte ich nervös und hoffte, sie wäre vielleicht eine alte Frau, die gute Seele der Farm. Aber der Lukas auf meinem Laptopbildschirm sah so schuldbewusst zur Seite, dass mir sofort klar war, dass Conchita keine alte Frau war und er mit ihr noch ganz andere Dinge gemacht hatte, als nur Lama-Füße zu verarzten. Schweren Herzens sagte er zu mir: «Ich habe mich in Conchita verliebt.»
Und ich klappte meinen Laptop zu.
Raffael: Er war so ganz anders als die meisten Männer, die ich auf den Studentenpartys kennengelernt hatte. Raffael konnte gut zuhören, war einfühlsam und sehr, sehr behutsam. Es dauerte ein halbes Jahr, bis wir das erste Mal miteinander schliefen. Ein weiteres halbes Jahr später eröffnete er mir, dass er jemand anderen liebte. Verletzt und getroffen sagte ich: «Sag jetzt bitte nicht, sie heißt Conchita.» Und er antwortete: «Nein, er heißt Jörg.» Dieses Geständnis war nicht gerade förderlich für mein weibliches Selbstbewusstsein.
Jasper noch mal: Jasper und ich begegneten uns wieder, als wir zufällig in einem Aldi-Markt mit den Einkaufswagen ineinanderfuhren. Er stellte fest, dass ich keine Zahnspange mehr trug, und küsste mich noch am gleichen Tag. Drei Jahre blieben wir zusammen, mein persönlicher Langstreckenbeziehungsrekord. Jasper studierte inzwischen Nanotechnologie, und ich verstand kaum, worum es bei seinem Studium ging. In der Regel konnte ich seinen Ausführungen kaum länger als dreißig Sekunden folgen. Umgekehrt hatte er Probleme, meine Zeichenträumereien ernst zu nehmen. Erlobte mich zwar für mein Talent, aber es klang immer ein wenig so, als würde ein gnädiger Vater das gemalte Bild seiner fünfjährigen Tochter preisen («Da hast du aber einen schönen Gorilla gemalt», «Papa, das soll doch Mama sein!»).
Jaspers Freunde waren allesamt erfolgsorientierte Ingenieurstypen und hatten ebenso zielstrebige Freundinnen. Das führte dazu, dass ich mich bei unseren wöchentlichen – für die anderen heiteren – Spieleabenden immer mehr fühlte wie bei «Eins von den Dingen ist nicht wie die anderen». Als sich Jaspers Studium dem Ende näherte und ich meins geschmissen hatte, erkannte Jasper, dass die Pharmaziedoktorandin Jessica eher zu seinen Spieleabenden passte, und ließ mich ein zweites Mal mit gebrochenem Herzen zurück.
Zu den vier Tränenfalten unter jedem Auge würde sich nun eine weitere für Bendix gesellen.
Lenny, der seinen Comic ausgelesen hatte, trat zu mir und fragte: «Du wirst doch jetzt nicht etwa weinen?»
«Nein, nein», sagte ich. «Werde ich nicht.»
«Und warum füllen sich deine Augen mit Tränen?»
«Hausstauballergie», log ich wenig überzeugend.
«Hattest du noch nie.»
«Allergien können sich im Erwachsenenalter spontan entwickeln», erklärte ich, während sich die erste Träne ihren Weg bahnte.
«Ich hab eine Idee, was dich aufmuntern könnte», sagte Lenny, der – wie jeder Mann – mit den Tränen einer Frau nicht umgehen konnte.
«Und was?»
«Wir werfen uns die hier ein!» Er holte aus seiner Hosentasche zwei grüne Pillen. «Die machen happy. Mit denen hab ich vor zwei Wochen Titanic gesehen und dreieinhalb Stunden durchgelacht.»
Lenny hielt mir eine Pille hin, aber ich schüttelte den Kopf. Ich nahm keine Drogen. Ich hatte auch lernen müssen, dass es keine gute Idee ist, sich bei Liebeskummer zu betrinken. So etwas konnte – wie ich nach der Trennung von Jasper leidvoll feststellen musste – zu Führerscheinentzug führen.
«Wir können auch eine schöne Zombie-Filmnacht machen», ließ Lenny nicht locker. «Da gibt es eine neue Zombieliebeskomödie, die heißt Komm, gib mir deine Hand.»
«Keine Liebeskomödien!», winkte ich ab, während sich die zweite Träne startbereit machte. «Mit Zombies oder ohne.»
«Oder wir gehen zur Ausstellungseröffnung von Damien Moore.»
Damien Moore. Seine Bilder waren so intensiv, dass man sich ihnen nicht entziehen konnte. Seine wichtigsten Themen waren Himmel und Hölle. Und während seine Höllenbilder qualvoll und unheimlich waren, konnte man seine Himmelsgemälde nur als unbeschreiblich schön bezeichnen. Allein wenn ich im Internet Fotos davon sah, erfüllten sie mich mit unerhörter Leichtigkeit und Freude. Wie musste es dann erst sein, die Gemälde in echt zu sehen? Seine Bilder würden mich – ganz ohne Drogen – in eine andere, schönere Welt transportieren.
«Hast du denn Karten?», fragte ich Lenny erstaunt, und meine Tränendrüsen stellten vorläufig die Produktion ein.
«Natürlich nicht», antwortete Lenny. «Bin ich Millionär, der sich seine Bilder leisten kann? Oder gehöre ich zur Berliner Kunstszene?»
«Und wie sollen wir dann da reinkommen?»
«Der Security-Chef und ich haben den gleichen Dealer», grinste Lenny.
4
Ich wäre gerne vorher noch in meine Wohnung gegangen und hätte mir dort für die Ausstellungseröffnung etwas Schickeres als den Alien-Overall angezogen, aber leider befand sich mein Schlüsselbund in meiner abgewetzten Umhängetasche, und die wiederum lag im Flur von Bendix’ Wohnung. Ich überlegte kurz, Bendix anzurufen und ihn zu bitten, mir meine Umhängetasche und meine Klamotten in den Comicladen zu bringen. Ich malte mir aus, wie er käme und mir mit verheulten Augen beichtete, dass er nur mich liebt. Aber könnte ich ihn in so einem Fall überhaupt wieder in die Arme schließen? Immerhin hatte er mir verschwiegen, dass er eine Verlobte hatte. Und das über Wochen hinweg. Könnte ich ihm diesen Vertrauensbruch je verzeihen?
Natürlich könnte ich das!
Das ist nun mal das Allerblödeste am Liebeskummer: Man besitzt keinerlei Stolz.
In meiner Phantasie küssten Bendix und ich uns mit Tränen des Glücks in den Augen, während seine Ärztin Richtung Nigeria flog, um dort einen Buscharzt zu heiraten. Meine Phantasie sah immer ein Happy End für jeden vor, sogar für die Verlobte des Grauens und einen mir bis dato völlig unbekannten nigerianischen Buscharzt. Doch dann fiel mir wieder ein, dass ich mein Handy ebenfalls nicht bei mir hatte, es lag in der Umhängetasche in Bendix’ Wohnung. Ohne Handy könnte ich ihn nicht anrufen, da ich seine Nummer nicht auswendig wusste – die moderne Technik ging nun mal zu Lasten der menschlichen Fähigkeit, sich Dinge zu merken. Egal, wie ich es drehte und wendete, ich musste im Alien-Overall zur Vernissage, die im Pergamonmuseum stattfand. Wir fuhren in Lennys quietschbunt bespraytem Käfer, den er nur das Lenny-Mobil nannte, durch das abendliche Berlin, bis wir das altehrwürdige Museum erreichten.
Als wir die Stufen hochgingen, fühlte ich mich ein wenig wie in einer amerikanischen Komödie, in der die Heldin sich mit ihrem albernen Outfit zwischen all den Reichen und Schönen in Smoking und Abendkleid nach allen Regeln der Kunst blamierte. Aber nachdem der Security-Chef uns am Eingang durchgewunken hatte, stellte ich erleichtert fest, dass meine Sorge unbegründet war. Zwar war ein großer Teil der Anwesenden in dem imposanten Museumssaal tatsächlich in Abendgarderobe erschienen, aber es gab auch viele, die demonstrieren wollten, wie kreativ und unangepasst sie waren. Von einer Frau mit zwei Augenklappen über einem Mann im Federkostüm bis hin zu einem uralten, asiatisch aussehenden Mann im roten Mönchsgewand waren viele bunte Vögel unterwegs. Ich fiel in der Menge also nicht sonderlich auf.
An den Wänden hingen einige von Moores Bildern, die so beeindruckend waren, dass es mir die Sprache und zwischenzeitlich sogar den Kummer verschlug. Zur Linken hingen die Gemälde des Himmels, rechts die Höllenbilder. Einige davon waren auf schwarzhumorige Art komisch – zum Beispiel wurden spanische Inquisitoren von Dämonen in einem Kessel gekocht. Andere Bilder wiederum waren so düster, dass sie mir Angst machten, wie zum Beispiel eins, auf dem Berlin von Blut überschwemmt wurde. Daher wandte ich mich lieber den Himmelsbildern zu. Auf einem war einzig und allein ein geradezu überirdisches Blau zu sehen, von dem man glauben konnte, Gott höchstpersönlich hätte ein Foto von seiner Umgebung geknipst. Das Blau war so magisch, dass ich mich einfach nicht von ihm losreißen konnte, bis Lenny mir zuraunte: «Der Meister tritt jetzt auf!»
Lenny führte mich von dem Bild weg in Richtung eines leeren Podiums, vor dem schon viele Gäste mit Champagnergläsern in freudiger Erwartung standen. Der Saal wurde langsam dunkel. Technomusik ertönte, eine Lasershow startete, und Blitze in verschiedenen Farben schossen so schnell umher, dass mir ein wenig schummerig wurde. Lenny hingegen betrachtete fasziniert das Spektakel und seufzte: «Hach, mit LSD wäre das noch viel besser.»