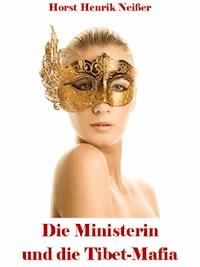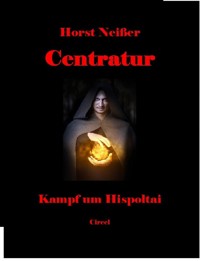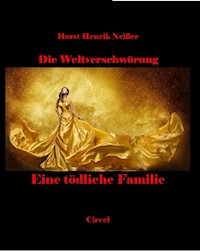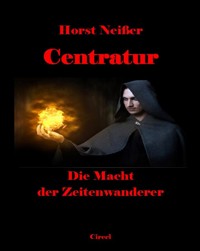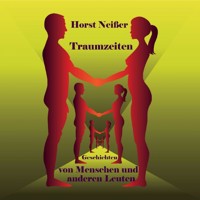
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Da sitzt ein Mann im ausverkauften Konzertsaal vor einem mächtigen Steinway-Flügel auf dem Podium, um ein Klavierkonzert von Mozart zu spielen. Während er beim Vorspiel des Orchesters auf seinen Einsatz wartet, wird ihm bewusst, dass er außer "Hänschen klein" gar nichts spielen kann. Da schwebt eine Frau zusammen mit ihrem Mann auf dem schmalen Sitz einer Drahtseilbahn über einem Abgrund. Der Strom ist ausgefallen. Und nun gesteht sie ihm, dass sie ihn mit einem jungen Mann betrogen hat. Wird sie es überleben? Da befiehlt der König seinem hungernden Volk, jeden Tag ein Huhn zu essen – und beschwört damit eine Revolution herauf. Da wandert ein Mann mit schönen Frauen auf eine einsame Insel aus. Dort ist er der Hahn im Korb seines Harems. Doch dieser männliche Wunschtraum endet in einem Albtraum. Außerdem wird eine sogenannte Wissenschaftlichkeit satirisch hinterfragt, und Märchen werden gegen den Strich gebürstet. Ein Buch zum Gruseln und Schmunzeln. Trotz der absurden Themen beschleicht den Leser das Gefühl, die Geschichten und Märchen könnten durchaus wahr sein. Auf jeden Fall zeigen sie zeigen eine andere Seite des Autors, der mit Thrillern und Fantasy-Romanen bekannt wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Neißer
Traumzeiten
Geschichten von Menschen und anderen Leuten
Böse Geschichten, Märchen und Satiren – wie aus dem richtigen Leben
Da sitzt ein Mann vor einem mächtigen Steinway-Flügel auf dem Konzertpodium, um ein Klavierkonzert von Mozart zu spielen. Während er beim Vorspiel des Orchesters auf seinen Einsatz wartet, wird ihm bewusst, dass er außer „Hänschen klein“ gar nichts spielen kann.
Da schwebt eine Frau zusammen mit ihrem Mann auf dem schmalen Sitz einer Drahtseilbahn über einem Abgrund. Der Strom ist ausgefallen. Und nun gesteht sie ihm, dass sie ihn mit einem jungen Mann betrogen hat. Wird sie es überleben?
Da befiehlt der König seinem hungernden Volk, jeden Tag ein Huhn zu essen – und beschwört damit eine Revolution herauf.
Ein Buch zum Gruseln und Schmunzeln. Trotz der absurden Themen beschleicht den Leser das Gefühl, so etwas Ähnliches selbst schon erlebt zu haben.
Horst Henrik Neißer
Traumzeiten
Geschichten von Menschen
und anderen Leuten
Imprint
Horst Neißer
Traumzeiten
Geschichten von Menschen und anderen Leuten
Published at epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
Copyright © 2017 beim Autor
Circel Verlag 2017
Einige dieser Geschichten sind bereits erschienen in:
Traumzeiten, Geschichten vom Untergang, Verlag der Handzeichen, 1984
Der Gott der Ameise, Geschichten von Menschen und anderen Leuten, Logos Verlag 1993
Centratur Bd. 1, Kampf um Hispoltai, List-Verlag 1996
Wortlaut 21 und 22, Literaturzeitschrift für Franken, 2015 und 2016
Alle Texte wurden vollständig überarbeitet, neu zusammengestellt, und kommentiert.
Internet: www.centratur.de
Alle Rechte der Vervielfältigung und Verbreitung vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Autors wiedergegeben werden.
What thou lovest well remains,
the rest is dross
What thou lov'st well shall not be reft from thee
What thou lov'st well is thy true heritage
Whose world, or mine or theirs
or is it of none?
The ant's a centaur in his dragon world.
Pull down thy vanity, it is not man
Made courage order, or made grace.
Pull down thy vanity, I say pull down.
Master thyself, then others shall thee beare'
Pull down thy vanity
But to have done instead of not doing
this is not vanity
Here error is all in the not done,
all in the diffidence that faltered.
Ezra Pound
(Bruchstücke aus Canto LXXXI – Pisaner Gesänge)
Vorwort:
Diese Erzählungen sind im Lauf von 35 Jahren entstanden. Etliche sind schon veröffentlicht worden und haben ein vielfältiges Echo hervorgerufen.
Die Originalausgaben werden noch immer antiquarisch gehandelt, obgleich die damaligen Verlage längst verschwunden sind. Einigen Jahren konnte man die Storys auch im Internet unter www.centratur.de lesen, und ich war überrascht, wie viele Besucher diese Seite hatte, und wie oft die Geschichten heruntergeladen wurden.
Ist es also Nostalgie, wenn ich sie im Jahr 2017 noch einmal einem breiten Publikum vorstelle?
Mit dem Abstand von Jahrzehnten habe ich die Texte wieder gelesen und versucht, sie so nüchtern wie möglich zu betrachten. Wichtig war mir dabei die Frage, ob sie uns heute noch etwas zu sagen haben, ob sie Menschen und Situationen beschreiben, die auch im 21. Jahrhundert real sein könnten?
Der Kalte Krieg, der in einigen der Geschichten eine Rolle spielt, ist doch beendet. Man müsste sich eigentlich heute keinen Bunker mehr im Vorgarten bauen und sich auch auf keinen Einschlag von Interkontinental-Raketen innerhalb der nächsten Stunden vorbereiten. Aber die Welt wird von Jahr zu Jahr unsicherer und diverse Kreise und Mächte scheinen ganz zielstrebig so wie damals auf eine weltumspannende Auseinandersetzung zuzusteuern.
Sicher hat sich auch der Musikgeschmack der jungen Leute gewandelt. Hört der jugendliche Held, der seine Burg im Mittelalter mit Maschinengewehren verteidigen will, noch die Beatles, so würde er sich heute sicher Rap über seinen iPod reinziehen. Aber Pop-Musik als Mittel des Eskapismus, also um der Welt zu entfliehen, ist geblieben. Wenn man heute in der U-Bahn fährt, so ist unübersehbar, wie sich die Menschen mit den kleinen Knöpfen im Ohr hinter einem Klangwall verstecken. Und Allmacht-Phantasien („Wenn ich jetzt eine Knarre hätte, würde ich es dem schon zeigen“), dürften noch immer unter Heranwachsenden weit verbreitet sein.
Sicher, zeitgebundene Faktoren kann man korrigieren und modernisieren – und das habe ich auch getan. Dennoch stellt sich weiterhin die Frage: Was soll das Aufwärmen alter Texte? Nimmt man diese Frage aber ernst, so muss man sie auch bei den Schullektüren, zum Beispiel dem „Werther“ oder dem „Stiller“, stellen. Und doch lesen wir Goethe, Frisch oder Böll auch heute noch mit Gewinn - ganz zu schweigen von den Klassikern der Weltliteratur von Homer bis Dante, die nun wirklich jeden Aktualitätsbezug vermissen lassen.
Worum geht es denn bei guter Literatur? Zumindest ist sie zeitlos. Das bedeutet, die beschriebenen Menschen könnten zu jeder Zeit leben, der Verlauf ihres Schicksals ist allgemeingültig und trifft für jedes Zeitalter zu.
Für mich als Autor ist und war beim Schreiben das Wichtigste, dass die Texte „wahr“ sind. Aber was ist „wahr“? Meine Personen sollen leben. Jeder Leser sollte „so jemanden“ schon einmal selbst getroffen haben.
Sogar Märchen müssen realistisch sein! Deshalb habe ich eine Abneigung gegen ideologische Literatur, gegen Belehrung, gegen Helden, die nur gut oder böse sind. Solche Menschen gibt es nämlich nicht! Die Personen in Büchern dürfen nicht zu Demonstrationsobjekten von Ideologien verkommen.
Dieses Buch gliedert sich in vier Teile:
Die erste Abteilung sind Satiren - sozusagen zum Aufwärmen.
In der zweiten Abteilung werden Märchen erzählt.
Die dritte Abteilung stellt die Frage: “Was wäre wenn?“
Die vierte Abteilung behandelt ein schwieriges Thema: Was ist Wirklichkeit? „Der Traum ein Leben, das Leben ein Traum“, heißt ein Theaterstück von Calderon. Dieses Motto könnte auch hier Pate gestanden haben.
Und nun, viel Spaß beim Lesen!
Januar 2017
Horst Neißer
Satiren
Ach, was sind wir Angehörige der intellektuellen Mittelschicht doch alle so gesittet und diszipliniert! Anstand und Moral haben wir bereits mit der Muttermilch eingesogen, und unsere humanistische Bildung hat ein Übriges getan. Nein, Konkurrenzdenken oder gar Handgreiflichkeiten sind uns doch absolut fremd.
Wenn es da nicht Situationen gäbe, in denen etwas aus uns herausbricht, von dem wir gar nicht wussten, dass es in uns steckt. Da kann uns selbst der kategorische Imperativ zum Schläger machen. Seien Sie ehrlich: Diese Art Schwätzer wie in dieser einleitenden Geschichte kennen Sie doch auch?
Nichts als Worte
Der Ort: ein Szenen-Kneipe in Berlin wie die „Bar Mama“, die „Kim Bar“ oder das „Sankt Oberholz“
Die Zeit: Früher Abend
Die Akteure: Sven, Studienrat, und Björn, Senatsangestellter.
Das Lokal ist überfüllt. Es bestätigt sich wieder das alte Gesetz: Volle Lokale werden noch voller, leere bleiben leer. Ist es der Herdentrieb oder die Meinung „Millionen Fliegen können nicht irren, hier lasst uns picknicken“? Nichts dergleichen! Sondern man geht in eine Kneipe, um jemanden zu treffen, sich zu unterhalten, in Gesellschaft zu sein. All dies ist in leeren Gaststätten eben nicht möglich.
In dieser Szenenkneipe stehen die Gäste dicht gedrängt im schummrigen Zwielicht an der Theke oder sitzen an winzigen Tischchen auf unbequemen Stühlen. Der Mann hinter der Theke schwitzt und zapft Bier auf zehn Gläsern gleichzeitig. Lebhafte Unterhaltung. Seit dem allgemeinen Rauchverbot kann man auch in diesem Lokal wieder atmen. Dafür stehen nun vor dem Eingang Menschen in Trauben mit Zigaretten, Zigarillos und einigen sogar mit Pfeifen in der Hand.
Der hohe Geräuschpegel drinnen und draußen zeigt, wie gut sich die Gäste unterhalten und auf ihre Kosten kommen.
Sven und Björn kennen sich nicht. Sie stehen durch Zufall neben einander. Sven hat ein Pils in der Hand und Björn einen Latte macchiato vor sich auf dem Tresen stehen. Sie langweilen sich und kommen ins Gespräch.
Das Übliche! Sie schwärmen von anderen Kneipen in der Stadt. Sven berichtet von der Trattoria, in der er in Rom so köstlich gespeist hat, und Björn erklärt, dass die Antipasti doch das Beste in der italienischen Küche sind. Schließlich verkündet Sven stolz, dass er noch eine Karte für das nächste Rolling Stones Konzert ergattert habe – wer weiß, wie lange die noch auftreten.
Man versteht sich. Sendet auf der gleichen Wellenlänge. Es wird Zeit, sich ernsteren Themen zuzuwenden: dem Klimawandel, der Flüchtlingskrise, dem Rechtsruck bei der letzten Wahl. Man ist sich bei der Beurteilung der Lage völlig einig.
Weil Harmonie so angenehm ist, wagen sich Sven und Björn nun an die Ismen. Sven zählt sie mit Abscheu in der Stimme auf: „Imperialismus, Kolonialismus, Faschismus, Patriotismus, Revanchismus, Nationalismus.“ Da fällt ihm Björn ins Wort: „Bellizismus, Kommunismus, Liberalismus, Kapitalismus, Anti-Amerikanismus“
Da man sich ideologisch einig ist, geht Sven, obgleich überrumpelt und düpiert, über die Wichtigtuerei des Anderen hinweg. Von irgendwelchen Ismen lassen sich Sven und Björn nicht auseinanderdividieren. Sie sind Individualisten, selbstständig denkende Menschen. Ein Rattenfänger hätte bei ihnen keine Chance.
So fragen sie sich, wieso es überhaupt Menschen gibt, die diese Ismen vertreten. „Wie kann jemand nur so dumm, borniert und inhuman sein?“ Sven frönt seiner Lust an Aufzählungen. Und wieder hat Björn das letzte Wort indem er fortfährt: „Uninformiert, abgebrüht, ignorant, gefühlskalt.“
Sven ist auch über diesen Einwurf nicht glücklich, aber er nimmt ihn hin. Warum auch eine Auseinandersetzung wegen einer solchen Kleinigkeit?
Björn hat seinen Latte macchiato längst ausgetrunken und sich inzwischen Rotwein bestellt. Gerade ordert er das dritte Glas, und Sven signalisiert dem Barkeeper das fünfte Pils.
Die Gesprächsthemen werden nun schneller gewechselt, Meinungen ungeschützter vorgetragen. Sven und Björn outen sich als Menschen, die unter den verkrusteten gesellschaftlichen Formen leiden. Sie fühlen sich der Diktatur der DSDS-Gucker ausgeliefert. Björn gesteht sogar, dass er einige Folgen des Dschungel-Camps gesehen hat und nun weiß, dass eine der Ursachen für den politischen Rechtsruck in dieser Form der geistigen Verblödung zu suchen ist.
Um sich von dem gesellschaftlichen Abschaum zu distanzieren, betont Sven, dass Mitmenschlichkeit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Friedfertigkeit unabdingbare Voraussetzungen für eine bessere Welt seien. Björn stimmt ihm zu und ergänzt Svens Aufzählung mit Sorge um die Natur, freie Entfaltung der sexuellen Persönlichkeit und Frauen endlich in Führungspositionen.
Er hätte gern noch weitere Problemfelder aufgezeigt, wenn ihn Sven nicht mit einer unwirschen Handbewegung zum Schweigen gebracht hätte. Ein wenig oberlehrerhaft erklärt er: „Wer die Gesellschaft verändern und retten will, muss bei sich selbst beginnen. Man muss lernen, sich zurückzunehmen.“
„Eben“, fügt Björn hinzu, „man darf die eigene überlegene Position nicht ausspielen, muss Irrtümer im täglichen Leben ohne Hemmungen eingestehen und Affekte kontrollieren. Unterlegenheit ist schließlich keine Schande. Nur wer zu ihr steht, ist der wahre Sieger.“
Sven nickt eifrig. Ein neues Menschenbild gelte es zu verwirklichen. Nicht länger sollten Stärke und Gewalt dominieren. Verstehen, Helfen und sogar Mitleiden sei angesagt. Björn erinnert nun an das Prinzip Hoffnung. Die Gesellschaft müsse endlich Alternativen finden, ein Plan-B sei nötig. Es sei eine Minute vor Zwölf! Die befreiende Wirkung der Vernunft wird betont, christliche Ethik beschworen, wobei Sven sofort betont, dass er auch die muslimische Ethik sehr schätze.
Schließlich fasst Björn zusammen: „Im Prinzip ist alles ganz einfach! Alle Menschen sollten sich an den Spruch halten, den schon meine alte Großmutter zu uns Kindern sagte: Was du nicht willst, das man dir tut, das füg' auch keinem andern zu!"
Sven nickt andächtig und bekräftigt dann: „Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein."
Wenigstens bei Spruchweisheiten soll dieser Björn nicht das letzte Wort haben.
Doch der hat inzwischen erneut ausgeholt und stellt nun in den Raum: „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück."
Da kann Sven nur ein wenig kläglich kontern mit: „Wie du mir, so ich dir!"
Damit ist es aber nicht ausgestanden, denn Björn setzt noch eins obendrauf: „Wer Wind sät, wird Sturm ernten."
„Wer Bomben baut, darf sich nicht wundern, wenn sie explodieren“, fällt Sven im letzten Moment ein.
Schlag auf Schlag, wie Geschosse, donnern sie sich die Sprichworte an den Kopf.
Nun ist Björn wieder an der Reihe: „Wer sich in Gefahr begibt, wird in der Gefahr umkommen.“
Aber Sven hat inzwischen sein Pulver verschossen. Er überlegt verzweifelt. Die folgende Pause ist drückend. Das breite Grinsen von Björn verrät seinen Triumph. Sven trommelt nervös auf den Tresen. Augenblicke ziehen sich zur Ewigkeit. Endlich entspannen sich Svens Züge und aufatmend sagt er: „Wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen."
Nun fällt ein Schatten auf das Gesicht von Björn, dem bisherigen Sieger. Zu früh hat er sich gefreut. Es gilt jetzt mehr denn je, eine Entgegnung zu finden, die den vorlauten Wichtigtuer in Grund und Boden stampft. Seine Ehre steht auf dem Spiel. Wieder einmal schleicht die Zeit unerbittlich dahin. Das Schweigen wird unerträglich.
Da endlich stammelt Björn: „Wenn dich einer auf die eine Backe schlägt, so halte ihm auch die andere hin."
Natürlich ist er sich im Klaren, dass das Bibelzitat nicht passt. „Aber was soll's“, denkt er sich, „es verhilft zum letzten Wort. Wichtig ist allein der Sieg. Es ist gleichgültig, womit eine Schlacht gewonnen wird.“
Aber seine Freude währt nicht lang, und das ekelhafte Grinsen im Gesicht des Gegners verschwindet nur für kurze Zeit. Dieser hat die Bedenkzeit genutzt und sich eine letzte, eine tödliche Waffe zurechtgelegt. Sie wird seinen Feind in die Knie zwingen, seine bedingungslose Kapitulation unvermeidlich machen.
Ganz ruhig, jedes Wort betonend, sagt Björn: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde."
Noch bevor ihm Kants Worte auf der Zunge zergangen sind, trifft ihn ein Faustschlag mitten ins Gesicht.
Der Worte sind genug gewechselt!
***
Wissenschaftliche Vorträge bestehen allzu häufig nur aus Wortgeklingel. Geben Sie es zu, auch Sie haben schon oft derartigen wohlklingenden Unsinn gehört – nur wird er leider in der Regel als seriöse Wissenschaft verkauft und eben nicht wie hier als Satire deklariert.
Die Lyoner als solche schlechthin
(Ein Bericht für eine Akademie)
Vorbemerkung: Im Saarland heißt die gewöhnliche Fleischwurst „Lyoner“ und ist dort so etwas wie ein Nationalgericht. In einem Sammelband, genannt das Lyonerbuch, sollten von mir die psychologischen Seiten der Fleischwurst beleuchtet werden. Der folgende Bericht für eine Akademie (Kafka lässt grüßen) ist das Ergebnis.
Eure Magnifizenz, Spektabilitäten, hohe Damen und Herren von der Akademie!
Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über meine Lyonererfahrungen einzureichen. Dazu muss ich etwas ausholen und leider Ihre Geduld auf eine, wenn auch, wie ich hoffe, erträgliche Probe stellen.
Der Genuss von Fleisch ist ein animalischer Akt. Er führt phylogenetisch beinahe bis zur Entstehung des Lebens zurück, kennzeichnet aber ontogenetisch eine relativ späte Stufe der Entwicklung.
Vor Millionen Jahren herrschte nur nackte Barbarei auf der Erde. Eine Amöbe fraß die andere mit Haut und Haaren. (Diese Aussage ist unter biologischen Gesichtspunkten natürlich nur sentenzenhaft zu verstehen.) Aber wie auch immer, schon der Gedanke daran ist unappetitlich. Relikte dieser abscheulichen Sitte finden sich in der menschlichen Gesellschaft noch bei der Spezies der Gourmets. Jene Menschen, die Schnecken, Muscheln, ja sogar kleine Fische, wie zum Beispiel Sardinen, ohne anatomische Differenzierung und der Ausscheidung der Gedärme und was sich sonst noch alles Ekelerregendes in einem Lebewesen befindet, verzehren.
Selbst die Natur missbilligt derartige unästhetische Fressgewohnheiten. Deshalb entwickelte sie bei den höher stehenden Lebewesen ein gesitteteres Vorgehen, nämlich die Teilung der Beute und deren partiellen Verzehr. Der Löwe frisst das geschlagene Tier nicht mehr im Ganzen, sondern reißt einzelne Fleischbrocken heraus. Er trifft dadurch eine Auswahl und erhöht selbstverständlich den Genuss. Nicht das blindwütige Verschlingen, die totale Einverleibung des anderen Lebens dominiert, sondern die dezente, taktvolle Ernährung. (Eine Ausnahme von dieser Höherentwicklung findet sich lediglich bei der Schlange, die deshalb auch zwangsläufig in einem recht schlechten Ansehen steht.)
Meine Damen und Herren, wieder einmal stehen wir staunend vor einer höchst sinnreichen Entwicklung der Natur, die so ganz unserem eigenen hochstehenden Denken und Fühlen entspricht. Doch lassen Sie mich fortfahren.
Die Zubereitung der Mahlzeit durch Kochen, Braten, Würzen ist von allen Lebewesen allein dem homo sapiens vorbehalten. Er sucht sich die schmackhaftesten Stücke aus seinen Jagd- oder Haustieren aus, und unterzieht sie einer Sonderbehandlung Dies ist nicht nur augenfälliges Zeichen für die Beherrschung und Sublimierung seines tierischen Erbes, dem Fresstrieb, sondern drückt gleichzeitig seine Reverenz vor dem ihm zur Nahrung dienenden Geschöpf aus.
Die Umwandlung des Fleisches, eine Transmutation, lässt den Menschen dessen tierische Herkunft, das Blut und den Schmerz, vergessen. Beim Verzehr eines Kalbsschnitzels denkt wohl niemand mehr an die traurigen Augen des jungen Rindes, sondern man lobt den Koch, der diesen göttlichen Bissen cum grano salis erschaffen hat.
Oh, bedenken Sie, welch' große kulturelle Entwicklung von der Barbarei der Amöbe bis zum Nierenrollbraten nötig war. Doch mit dem Drehen des Bratspießes gab sich der menschliche Geist nicht zufrieden. Er strebt stets nach Totalität, ruht nicht, bevor nicht das Vollkommene erreicht ist. Deshalb machte sich der Homo sapiens daran, die fleischliche Nahrung auch äußerlich umzuformen.
Kurz: Auf den Schinken folgte die Wurst.
Gemessen an evolutionären Zeitaltern ist diese Entwicklung sehr jung. Aber sie ist ein überaus augenfälliges Beispiel für die überlegene Beherrschung der Natur. Die Anweisung, "Macht euch die Erde untertan", wurde mit der Wurst ernst genommen und akribisch befolgt. Der Mensch formte das ihm vorgegebene Leben nach seinem Willen. Die Wurst ist deshalb ein zivilisatorischer Akt.
Der Inbegriff der Wurst aber ist die Lyoner. Sie ist gleichsam die Wurst an sich. In der Lyoner transzendiert sich die Wurst. Man kann deshalb zu dem legitimen Schluss kommen: Die Existenz der Lyoner ist der augenfällige Ausdruck für die kulturelle Entwicklung des Menschen.
Natürlich gebietet die wissenschaftliche Redlichkeit, dass ich vor Ihnen, erlauchte Damen und Herren, die Sie sich alle auf Ihren Forschungsgebieten als Koryphäen ausgezeichnet haben, den Wahrheitsbeweis für diese These antrete. Dazu muss ich meinen Streifzug durch die Evolution verlassen, und mich der Basis allen Lebens, der Materie selbst, zuwenden.
Während die Griechen das Chaos als das absolute Nichts interpretierten, das aus sich selbst Gaia, die Erde, gebar, sahen die Römer im Chaos das Ungeordnete. Alle Elemente sind bereits vorhanden, aber noch nicht zu Strukturen und Funktionseinheiten vereinigt. Dies geschieht erst im Schöpfungsakt. Besser als durch dieses mythologische Bild ist wohl die "Ursuppe, die von den Biologen als Ausgangsbasis für das Leben auf der Erde angenommen wird, nicht zu kennzeichnen.
Wer je eine Fleischwurst-Fabrik besichtigen durfte, der weiß, dass diese Beschreibung auch auf den Urzustand der Lyoner zutrifft. Der Sud aus geschleudertem Knochenbrei, aus Fett, Sehnen und Fleischmatsch, der sich schließlich in zarten, fleischfarbenen Därmen zu der von uns allen geschätzten Wurst materialisiert, ist der Inbegriff des lateinischen Chaos. In dem von mir entwickelten Sinn steht er aber nicht mehr allein für Materie und Leben, sondern reicht weit darüber hinaus. Aus dieser fleischwurstlichen Ursuppe entsteht nämlich, nach einer faszinierenden Metamorphose, Kommunikation und damit menschliche Gesellschaft. Diese wiederum ist Grundlage für den Geist, ja für den Sinn überhaupt,
Ja, wer auch nur einmal in seinem Leben bei einem Vereinsfest mit Bier und Lyoner dabei war, der weiß, wovon ich spreche. Bei diesem gemeinsamen Mahl wird die Wurst in der Hand gehalten, mit Senf verfeinert und schließlich ohne zivilisatorische Hilfsmittel wie Messer und Gabel zum Mund geführt. Dieser Akt hat nicht nur etwas die ganze Menschheitsgeschichte umschließendes Ursprüngliches an sich, sondern auch etwas ungemein menschlich Verbindendes. Das gemeinsame Bemühen von der im Durchmesser für den Mund zu großen Wurst ein Stück abzubeißen, ohne das künstliche Fell, die Kleidung zu beschmutzen, schafft Nähe, mindert die Distanz, die die heutige komplexe Gesellschaft zwischen ihren Mitgliedern aufgebaut hat.
Das vertrauenerweckende, beinahe auf Symbiose zielende "Du" geht leichter von den Lippen, ein echter, unverstellter Gedankenaustausch wird in den Gesprächen nicht nur möglich, sondern geradezu initiiert. Schließlich vereinigen sich dann alle Individuen zu einem großen, übergreifenden Ganzen. Sie haken in einer Art dialektischem Prozess ihre Arme ineinander, bewegen die Oberkörper in gemeinsamem Rhythmus und vereinigen ihre Stimmen zu einem gewaltigen Unisono, das die Gefühle der Beteiligten im Gleichklang bis in die Grundfesten erbeben lässt. Landschaften, Getränke und Flüsse werden besungen und der Wunsch beschworen, dass solch' ein Tag, der diese Unio-mystica stattfinden ließ, nie vergehen möge.
Kolleginnen und Kollegen, wir sehen in diesem Beispiel, welche katalysatorische Wirkung die Lyoner hat. Aus der Verbindung von Archaischem und höchst Artifiziellem entsteht das Utopische. Hier wird der Übermensch sichtbar, der nicht mehr singulär vor sich hinlebt, sondern sich mit Seinesgleichen zu einem höheren Wesen vereinigt. Hier endlich wird mithilfe der Lyoner der Gedanke Wirklichkeit, den John Donne so trefflich und bewegend in seinem Sonett ausgedrückt hat:
No man is an Iland intire of it selfe;
every man is a piece of the Continent,
a part of the maine.
Im Vorherigen wurde gesagt, dass die Lyoner ein artifizielles Produkt ist, das eine sehr späte Stufe der Menschheitsentwicklung kennzeichnet. Dies ist unstreitig schon allein wegen der Tatsache, dass nicht einmal die Art des Tieres, das zu ihrer Erzeugung herangezogen wird, noch erkennbar ist.
Wir alle wissen jedoch, dass das kluge Schwein für die Lyoner in die Pflicht genommen wird. Sein Metabolismus ist dem unseren nicht nur so ähnlich, dass das Schwein in der medizinischen Forschung einen bedeutenden Platz beanspruchen darf, darüber hinaus wirken die Heilmittel, die man ihm vor der Vollendung seines Lebens gibt, über die Vermittlungsinstanzen Kotelette, Eisbein und natürlich Lyoner infektionsabwehrend, beruhigend und damit segensreich auf den Menschen.
Die Fleischwurst schafft also nicht nur enge, ins Metaphysische gehende Beziehungen zwischen den Menschen, sondern ist auch sinnfälliger Ausdruck für die Symbiose zwischen Mensch und Haustier. Und doch verletzt ihr Genuss nicht das tiefe Gefühl der Liebe, das wir für Bruder Tier empfinden, und dem Franz von Assisi so wortreich Ausdruck verliehen hat. Wir wissen zwar, dass wir Schwein essen, aber die konkrete Vorstellung von der Sau ist gleichzeitig weit von uns entfernt.
Lassen Sie mich damit zum Ende des ersten Teils meiner Ausführungen kommen. Meine ursprüngliche These ist hinreichend belegt, und ich will diesen philosophischen Bereich verlassen, um noch einen kurzen psychoanalytischen Exkurs anzuschließen.
Nicht nur C.G. Jung weist auf die Bedeutung von Mythos und Symbol im Leben des Menschen hin. Auch Freud sah in Symbolen, speziell aus dem Bereich der Sexualsphäre, die Vergegenständlichung einzelner Triebkomponenten.
Wenn ich diese Aspekte und archetypischen Konstellationen im Folgenden untersuche, muss ich Sie, hoch verehrte Damen, und auch Sie, natürlich nicht minder verehrte Herren, um ihre Toleranz, Nachsicht und wissenschaftliche Distanz bitten. Selbstverständlich werde ich mich auf diesem heiklen Gebiet mit Andeutungen begnügen und Ihr Schamgefühl nur soweit strapazieren, als es für meine wissenschaftlichen Darlegungen unabdingbar ist. Dabei hoffe ich auf Ihr Vorstellungsvermögen, das mir nähere Ausführungen ersparen soll.
Die äußere Form der Lyoner ist nicht langweilig gerade, sondern zu einem Oval gebogen. Die Lyoner schließt sich damit andeutungsweise zu dem Vollkommensten, was wir denken können, dem Kreis. Gerade der zum Oval gestreckte Kreis ist tiefenpsychologisch gesehen ein Symbol für die Vulva.
Durch einen raschen Schnitt mit dem scharfen Messer wird diese geschlossene Form jedoch zerstört, wandelt sich der Fleischwurstring in Wurststücke, entwickelt sich aus dem Symbol des Weiblichen das Männliche, der Penis. (Diese Assoziationen verstärken sich, wenn beim Erhitzen der Lyoner-Stücke der Wurstinhalt an den Enden über die Haut hinaus quillt.)
Wie bei allem Lebendigen begegnen wir bei der Lyoner demnach zuerst dem Femininum, das aus sich selbst das Maskulinum entstehen lässt. Diese Grundtatsache ist nicht nur ein Wunschdenken der feministischen Bewegung, sondern biologisch nachgewiesen. (Es ist schmerzlich, dies darf ich hier in Parenthese anmerken, dass die Genesis, diese sonst bis ins Detail zutreffende Allegorie, in diesem Punkt leider irrt.)
Doch ohne auf den Prioritätenstreit von Henne und Ei näher einzugehen, die Fleischwurst enthält eine männliche und eine weibliche Komponente. Sie vereinen sich hier auffallend zu einem Ganzen. Wir finden diese Konstellation auch genetisch beim Mann mit all den positiven und negativen Auswirkungen, die sich daraus ergeben.
Tiefenpsychologisch bedeutet dies neue Einsichten in die Triebstruktur des Menschen. Seine unbewussten Wünsche und Regungen werden beim Umgang mit dem Lyoner nicht nur angesprochen, sondern auch freigesetzt. Sie lässt die tiefsten und geheimsten Saiten im Menschen erklingen. Ein bedeutender Teil ihrer Beliebtheit ist darauf zurückzuführen. Doch muss ich wahrscheinlich konkreter werden, wenngleich auch jetzt Andeutungen genügen mögen.
Der Genuss der Lyoner löst im Unterbewusstsein, "Ubw", wie es Freud in seinen späteren Schriften abkürzt, Assoziationen aus wie Fellatio aber auch Kastration. Ein scheinbarer Antagonismus, der seine Erklärung im Penisneid der Frau findet.
Dieser Penisneid ist inzwischen von der psychoanalytischen Schule so oft behauptet worden, dass wir ihn als gegebene Tatsache hinnehmen können.
Andererseits wiederum bedeutet die Wandlung des Lyoner-Ringes in Wurststücke, dieser Schnitt, der das Feminine in ein Maskulines wandelt, eine Verstümmlung des Weiblichen, ja sogar seine Auflösung. Er ist ebenso ein hoch aggressiver Akt.
In Kastration übergehende Fellatio beim Beißen und Essen hier, Nihilation des Wesens, Deformation beim Schneiden des Ringes dort. Im Fleischwurstessen kommen die Schatten des homo sapiens, wie sie C.G. Jung definiert, zum Ausdruck. Seine latente Aggression und damit natürlich auch deren Januskopf, der Masochismus, nehmen Gestalt an, brechen sich mit Gewalt Bahn durch die Fesseln von Erziehung und Zivilisation.
Schon Aristoteles führt in seiner Poetik aus, dass das intensive geistige Erlebnis zur Katharsis führt, zur Abreaktion also und damit zur inneren Reinigung des Menschen. Dies wirft die Frage auf, Kolleginnen und Kollegen, was geht in uns allen vor, wenn wir Lyoner essen? Welche tiefen Schichten unseres Wesens brechen hier auf? Was aus unserem Unterbewussten wird mit jedem Bissen Fleischwurst verarbeitet?
Auch Sigmund Freud leugnet nicht die niederen Instinkte des Menschen. Gerade er hat dafür gekämpft, dass sie zugelassen und damit kontrolliert werden. Erst wenn wir zu ihnen stehen, wird Thanatos, der Todestrieb, entmachtet. Triebe, die im Menschen ständig verleugnet und verdrängt werden, brechen plötzlich und unkontrollierbar mit ungeheurer Gewalt hervor. Kriege, Mord und Totschlag, Vergewaltigungen sind dafür sinnfällige Zeichen.
Nicht die Unterdrückung und Leugnung negativer Gefühle ist demnach die Aufgabe, die es zu leisten gilt, sondern deren Sublimierung. So ist die Kompensation von Aggression eine der vorzüglichsten Aufgaben der Kultur. Da, wo dies nicht gelingt, kann nicht von Kultur gesprochen werden.
Wie wir gesehen haben, findet beim Verzehr der Lyoner eine Aggressionsabfuhr statt. Das tiefe Auskosten des Schneidens und Beißens führt zur Katharsis und baut dadurch aggressive Triebe ab. So bestätigt sich wiederum meine eingangs vorgetragene These, dass die Fleischwurst einen wichtigen Platz in der Endstufe der kulturellen Entwicklung der Menschheit einnimmt, ja die Kultur eo ipso repräsentiert.
Die Sublimierung der Triebsphäre ist nach Freud die Aufgabe der Kultur. Die Menschheit hat sich bisher aber als unfähig erwiesen, im Großen und Ganzen mit der Aggression ihrer Individuen ja, ihrer Völker umzugehen. Kriege werden noch immer als unvermeidlich angesehen. Feindbilder gepflegt, Überrüstung als Friedensdienst gefeiert. Das Lyoner-Essen ist da zumindest der Weg zu einem kleinen bisschen Frieden.
Lassen Sie mich nun, hoch verehrtes Auditorium, zum Ende kommen. Gar vieles bliebe noch zu berichten. Ich konnte in dem mir vorgegebenen begrenzten Rahmen nur einzelne Schlaglichter auf die Gesamtthematik werfen. Doch je mehr man sich mit der Lyoner auseinandersetzt, desto umfangreicher und unergründlicher präsentiert sie sich. Mit etwas kreativem Problembewusstsein lassen sich aus der Lyoner noch für Jahre Dissertations-, wenn nicht gar Habilitationsthemen gewinnen.
Denken Sie, liebe Kollegen, allein an die politischen Aspekte, die es noch auszuloten gilt. Die Lyoner ist schließlich eine demokratische Wurst, so wie die Kartoffel eine demokratische Frucht ist. Ihr Verzehr hat sich erst lange nach der französischen Revolution durchgesetzt. In der Rezeptionsgeschichte der Fleischwurst lässt sich nachweisen, dass sie nie das alleinige Privileg einer Gesellschaftsschicht war. Stets haben sich die unterdrückte arbeitende Klasse, aber auch die herrschenden Schichten an ihr gütlich getan. Wo sonst ist die Forderung nach égalité und fraternité so verwirklicht wie bei der Lyoner? Jeder hat in diesem unserem Staat das Recht, an allen Orten und zu jeder Zeit Lyoner zu essen, wenn er sie bezahlen kann.
Aber die Wirkung der Fleischwurst reicht bis in die Keimzelle unseres Staates, die Familie, hinein. Ihr Anwärmen im Wasserbad erfordert zwar Aufmerksamkeit und nicht zu unterschätzende Fähigkeiten, aber es kann auch vom Mann, dem Pater familia, wie es seit den Römern bekannt ist, übernommen werden. Damit wiederum ist eine Entlastung im Alltag der geplagten Hausfrau möglich. Sie kann sich nun stärker ihrer Emanzipation widmen.
Doch trotz dieser Fakten kann keine gesellschaftliche Gruppe, auch nicht die Feministinnen die Lyoner für sich okkupieren. Die Fleischwurst bleibt neutral! Sie liefert auch der Gegenseite Argumente. So kann der Chauvi unter den Männern sie heiß machen, und sich dann seiner Kochkünste brüsten.
Last but not least sei noch an die Jugend erinnert, die nicht vergessen werden darf und immer an erster Stelle kommen muss. Sie, dem inzwischen so gründlich an amerikanischen Fastfood gewöhnt wurde, findet in der Lyoner eine echte deutsche Alternative. Es wäre zu wünschen, dass sich daraus bei ihr eine stärkere Autarkie gegenüber dem american way of life und der Hamburger-Kultur unserer Freunde aus dem Westen entwickelte.
Mit diesen Ausblicken auf künftige Forschungsaufgaben will ich nun schließen. Sie haben mir sehr lange Ihre Aufmerksamkeit für eine schwierige Thematik geschenkt. Dafür danke ich Ihnen. Ziel meines Vortrags war es, Ihnen paradigmatisch aufzuzeigen, wie die Wissenschaft interdisziplinär an einem Sujet Problembewusstsein entwickelt und dabei neue Relevanzen entdeckt und ausschöpft. Letztlich werden auf diesem Weg die Freiheit von Wissenschaft und Forschung und deren hohe staatliche Subvention gerechtfertigt. Unser aller Präferenz für die Lyoner war dafür zwar eine angenehme Basis. Der Primat der Wissenschaft muss aber letztlich den Vorrang haben.
Mit der Tradition und den Bräuchen ist dies so eine Sache. Da gibt es in Schwaben „das Aufsagen“, wobei missliebige Mitbürger in aller Öffentlichkeit bloßgestellt werden, andere verkleiden sich als Hexen und treiben den Winter aus oder wir stellen uns einen Christbaum ins Wohnzimmer. Es gibt eben mannigfache Bräuchen in deutschen Landen. Fragt man nach dem Ursprung und dem Sinn, so bekommt man als Antwort, diese Bräuche seien uralt und reichten noch in germanische Zeiten zurück. In der Regel hätten sie zur Abwehr böser Geister gedient. Aber Volkskundler wissen, dass sie meist erst vor einem halben Jahrhundert von einem Oberlehrer erfunden worden waren.
Das tut dem Spaß beim Ausüben der Bräuche aber keinen Abbruch und für den Tourismus sind sie auch unverzichtbar. Die folgende Geschichte beschäftigt sich mit dem Entstehen eines Brauches und den Marotten eines sehr reichen Mannes.
Erinnerungen für die Ewigkeit
Das Essen war einfach aber ausgezeichnet gewesen. Es hatte Käsenockerln gegeben und dazu ein kräftiges Bier. Zufrieden lehnte sich William zurück und rülpste leise in die hohle Hand. Dann legte er seinen Arm um Hilda, zog sie an sich und hatte den Wunsch, die Zeit möge stehen bleiben.
Nach dem Aufstieg über steile, steinige Gebirgspfade waren beide rechtschaffen müde gewesen. Doch die imposanten Berge mit ihren weißen Spitzen, die sich gebieterisch über ihnen erhoben und die prächtige Fernsicht hatten sie für alle Mühen entlohnt.
Die Sonne hatte sie auf der ganzen Wanderung nicht im Stich gelassen. Der Gesang der Vögel und tanzende Schmetterlinge waren ihre Begleiter gewesen. Durch das Fernglas konnten sie sogar eine Herde Gämsen beobachten. Sie hatten sich wie in einem dieser alten, kitschigen Heimatfilme gefühlt.
Dann war hinter einem Berghang die Hütte aufgetaucht. Beim Eintreten hatten sie sogar den Kopf einziehen müssen, so nieder waren die Tür und auch die Zimmerdecke. Der kleine Gastraum mit den drei Tischen und Bänken war leer. Außer ihnen hatte heute niemand hier heraufgefunden. Die Wirtin war dann auch gleich nach nebenan gegangen, um das Essen zuzubereiten, und ihr Mann hatte zwei Flaschen Bier und Krüge auf den Tisch gestellt.
Nun nach der guten Mahlzeit fühlten sich beide wieder erholt. Ein kleines Mittagsschläfchen würde aber das Glück vollkommen machen, sagte sich William und fragte den Herbergswirt nach Übernachtungsmöglichkeiten. Es gab ein kleines Zimmer unter dem Dach. Nicht besonders komfortabel, mit schrägen Wänden und natürlich ohne Toilette und Bad. Das war genau richtig, und William mietete es sogleich.
Dorthin zog er sich mit Hilda zurück. Sie kamen aber doch nicht zum Ausruhen, denn als Hilda ihr fesches Dirndl auszog, das sie am vergangenen Tag unten im Tal in der teuren Modeboutique gekauft hatte, wurde die schlummernde Lust in Williams Lenden zu einem übermächtigen Feuer. Die nächste Stunde wurde das alte Bett dann sehr strapaziert. Doch es hielt stand. William und Hilda kannten sich schon einige Monate, und noch immer rief die Frau in William Stürme des Verlangens und der Lust hervor.
Es war schon spät, als sie sich auf den Rückweg ins Tal machten. Sie würden den letzten Teil der Strecke im Schein der Taschenlampen bewältigen müssen.
Die Wirtsleute waren großzügig entlohnt worden und standen winkend in der Tür der Hütte.
‚Hierher möchte ich wieder zurückkehren‘, dachte sich William, ‚und dann soll es ebenso schön sein wie heute.‘
Er winkte seinen Privatsekretär herbei und gab entsprechende Anweisungen. Während William und Hilda frohgemut und singend zusammen mit den acht Bodyguards und den beiden Bergführern weiterwanderten, kehrte der zur Hütte zurück. Er wusste, was er zu tun hatte, schließlich hatte er einen derartigen Auftrag nicht zum ersten Mal erhalten.
Er würde nun die Hütte und die umliegenden Grundstücke kaufen und die Herbergsleute als Bedienstete seines Chefs engagieren. Diese würden recht erfreut sein, denn William zahlte gut.
Anschließend galt es alles zu fotografieren, damit der Originalzustand dokumentiert war und für immer erhalten werden konnte.
Später, wenn alles erledigt war, begann für die Menschen hier oben die Wartezeit. Wann würde sich William an die schöne Zeit, die er hier verbracht hatte, erinnern und wiederkehren? Noch in diesem Sommer? Im nächsten Jahr? In zehn Jahren? Vielleicht nie?
Es stand außer Frage, dass in der Zwischenzeit keine Gäste mehr aufgenommen werden durften. Schließlich hatte William den Gastraum leer in Erinnerung, ohne fremde Wanderer. Sollte er unverhofft aufkreuzen, wären missliebige Fremde eine Katastrophe. Und natürlich würden die Wirtsleute jeden Tag die Kleider tragen, die sie an diesem einem, diesem entscheidenden Tag angehabt hatten. Im Tal würde man dazu einen Schrank voll identischer Kleider und Hosen anfertigen lassen.
Die Frau mit den schweren Brüsten und der Mann mit dem eindrucksvollen Bart erzählten in den kommenden Jahren wieder und immer wieder von den seltsamen Gästen, die ihr Leben so radikal verändert hatten. Dabei dampften in der Küche Tag für Tag frische Käsenockerln und warteten auf Gäste, die vielleicht niemals kamen. Und das alles wurde überwacht von einem Beauftragten Williams, der sich aber leider mit dem Paar in der Hütte nicht besonders gut verstand. Es kam häufig zu Streit.
Irgendwann verfluchten die Herbergsleute die damaligen Gäste, die ihnen dies alles beschert hatten. Aber es half nichts. Verträge sind Verträge und müssen eingehalten werden, und ihre Einhaltung wurde streng überwacht.
Nur einem Faktum konnte nicht Einhalt geboten werden: der Zeit. Zwar konnte man die Hütte und ihre Einrichtung immer wieder getreu restaurieren, und im Lauf der Jahre wurde praktisch alles erneuert. Aber die beiden Menschen ließen sich nicht konservieren. Sie wurden eben älter. Sicher die Haare und den eindrucksvollen Bart konnte man färben. Aber die Gesichter bekamen mehr und mehr Falten. Der Mann ging nun gebückt, und die Frau hütete immer häufiger das Bett. Dann dampften in der Küche keine Käsenockerln.
Deshalb kamen die Beauftragten von William nicht umhin, das verbrauchte Herbergspaar gegen ein frisches auszutauschen. Man richtete sich nach den alten Bildern und hatte auch bald Ersatz gefunden. Wer wollte nicht gern ein sorgenfreies Leben hoch oben in den Bergen ohne Arbeit aber bei guter Bezahlung führen!
So ging die Zeit ins Land und auch dieses Paar wurde in Rente geschickt und durch ein neues ersetzt. Und keiner der Erben von William wurde je auf die Hütte in den Bergen aufmerksam, in der man noch immer ein strenges Ritual einhielt. Den Erben war auch das Lokal an dem idyllischen Bergsee gleichgültig, in dem William mit Angie wunderschöne Stunden verbracht hatte. Sie wussten nicht einmal etwas von der kleinen Dorfkirche, in der neun alte Frauen den Rosenkranz lautet gebetet hatten, was William damals zu Tränen rührte. Dort beteten neun Frauen noch immer und lösten sich schichtweise ab.
Nein, diese und viele andere Erinnerungen hatte der Verblichene mit ins Grab genommen. Wahrscheinlich hatte er zuletzt nicht einmal mehr selbst gewusst, dass er diese Erinnerungen überhaupt besaß.
Und wieder gingen Jahre und Jahrzehnte ins Land, und irgendwann wurden auch die Zahlungen aus dem Vermögen Williams, das seine Erben inzwischen recht dezimiert hatten, sang- und klanglos eingestellt. Doch die Hütte in den Bergen, das Lokal am See, das Rosenkranzbeten und alle die anderen Erinnerungen Williams waren inzwischen zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Niemand kannte mehr ihren Ursprung, denn der Name William war längst vergessen. Aber die Erinnerungen existierten eben, und dies schon solange, wie man denken konnte. Deshalb machte man einfach weiter.
Zwar wurden die Akteure nicht mehr dafür bezahlt, aber sie taten es nun für die Gemeinschaft und wurden dafür hoch geehrt.
Endlich entdeckten auch die Ethnologen von irgendwelchen Universitäten die seltsamen Bräuche. Sie begannen, Bücher darüber zu schreiben und ihren Ursprung in das frühe Mittelalter zu verlegen. Ursprünglich sollten ihrer Meinung nach böse Geister gebannt werden, auch von Fruchtbarkeitszauber war die Rede.
Langsam entdeckte auch der Tourismus die Orte. Von überall her kamen Busse mit Menschen, die sich für die seltsamen Bräuche interessierten. Zu der Berghütte wurde irgendwann sogar eine Straße gebaut und Würstchen- und Andenkenbuden in ihrem Umkreis aufgestellt.
Williams hatte sein Ziel erreicht. Seine Erinnerungen entwickelten sich zu einem Wirtschaftszweig und wurden unsterblich.
Märchen
Nun folgen ein paar Märchen. Den Anfang macht die Geschichte vom gütigen Herrscher, der für sein Volk nur das Beste will. Die zentrale Idee habe ich dabei von Heinrich IV. geklaut, dem wohl beliebtesten König der Franzosen. „Wenn mir Gott zu leben erlaubt, werde ich dafür sorgen, dass es in meinem Land keinen Bauern gibt, der sonntags nicht sein Huhn im Topf hat!" ("Si Dieu me prête vie, je ferai qu’il n’y aura point de laboureur en mon royaume qui n’ait les moyens d’avoir le dimanche une poule dans son pot!")
Er wird von den Historikern durchaus als Reformer und weitsichtiger Herrscher gerühmt. Vielleicht, weil ihm der Plan mit dem Huhn nicht so ganz gelungen ist?
Der König in dieser Geschichte übertreibt es aber auch: Er verordnet seinem Volk täglich (!) das berühmte Huhn im Topf. Aber vielleicht braucht man einen derart konsequenten Herrscher damit die Verführbarkeit der Völker und die Entstehung des Kapitalismus aus der Gunst der Stunde ein wenig deutlich werden.
Das Märchen vom Volk, dem König und dem Huhn im Topf
Es war einmal ein Volk, dem ging es zu Zeiten besser und zu anderen Zeiten schlechter. An vielen Tagen im Jahr hatte es nur Grütze zu essen, aber manchmal gab es auch ein fettes Huhn, oder es stand, wenn die Jäger erfolgreich waren und man bei Hofe nicht alles Fleisch brauchte, ein schmackhafter Wildbraten, gespickt mit weißem Speck auf dem Tisch.
Da waren aber auch Zeiten, in denen Schmalhans als Küchenmeister regierte. Dann ging man in den Wald, um Beeren zu suchen und freute sich über eine große fette Kohlrübe, die noch irgendwo verlassen und vergessen auf einem Feld stand. Sie wurde mit Sorgfalt gekocht und auf mehrere Tage verteilt.
Doch die Zeiten des Darbens gingen auch wieder vorüber, und die Menschen hatten darüber ihre Fröhlichkeit nicht verloren. Weil man den Hunger kannte, wusste man einen gedeckten Tisch umso mehr zu schätzen.
Im Feiern waren alle ganz groß. Wenn die Musik zum Tanz aufspielte, drehten sich die Mädchen, dass die Röcke flogen, und die Burschen hüpften, dass es eine Freude war. Alt und Jung schmauste, und schon allein das Zusehen war eine Lust.
Die Frauen galten landauf und landab als besonders gute Köchinnen. Sie wälzten die Täubchen in Honig und spickten die Hühner vor dem Braten mit süßen Mandeln. Für die Forellen gab es einen wohlschmeckenden und gut riechenden Sud aus Kräutern, bei dem sich besonders die Pfefferminze hervortat. Getrunken wurde Holunder- und Erdbeerwein, Limonade und gegorene Ziegenmilch.
Das Volk hatte auch einen König. Der lebte in seinem Schloss, umgeben von seinen Hofleuten.
Mit seinem Volk hatte der König nur wenig zu tun. Er wusste, dass es da war, und das genügte ihm. Zwar war er sehr stolz auf sein Volk, aber den Umgang mit ihm überließ er lieber seinen Hofleuten, den Beamten und Ministern. Die sagten ihm, was das Volk dachte, wollte und brauchte.
Der König fuhr auch manchmal zu seinem Volk. Er saß dann in der goldenen Staatskarosse, die von acht Pferden gezogen wurde, und winkte seinen Untertanen huldvoll zu. Die standen am Straßenrand, verbeugten sich und jubilierten. Wenn er von einer solchen Ausfahrt zurückkam, fragte sich der König im Stillen oft, ob es wohl noch einen anderen Herrscher gab, der sich so treu wie er um sein Volk bemühte, und der dafür so heiß geliebt wurde?
Eines Tages saß der König an der Mittagstafel. Er hatte bereits die gerösteten Taubenaugen und den Salat aus Nachtigallenzungen hinter sich und freute sich auf die dritte Vorspeise, kandierten Auerhahn.
Plötzlich erhob sich wütendes Gezeter auf dem Hof.
„Du Lump", scholl es durch das offene Fenster und „du Diebin" und „du Verbrecherin".
Gewöhnlich hörte der König nicht auf solch gewöhnliche Worte. Gewöhnliches brachte in der Regel Verdruss. Nichts hasste der König jedoch mehr, als Probleme zur Essenszeit. Deshalb versuchte er anfangs, das Geschrei zu überhören. Doch der nächste Gang ließ auf sich warten, und der erste Hunger war bereits gestillt, und auch das beste Essen verträgt hin und wieder eine kleine Abwechslung. Deshalb lehnte er sich zurück, rülpste ein wenig und spitzte die Ohren. Und was musste er da hören?
„Erbarmen, Erbarmen, so habt doch Erbarmen!" schrie eine zarte Mädchenstimme.
Sie klang so flehentlich, dass es dem König richtig warm ums Herz wurde.
Sein Haushofmeister aber antwortete barsch: „Mit frechen Dieben machen wir kurzen Prozess. An den Galgen mit dir!"
Der König war ganz und gar nicht gegen das Hängen eingestellt. Moral muss sein, sagte er sich, und das Aufhängen von Missetätern hat der Moral noch nie geschadet. Ganz im Gegenteil, es führt andere, die im Herzen Untaten begehen wollen, auf den rechten Weg. Aufhängen war also zum Besten aller. So gesehen war der Galgen sogar eine moralische Institution.
Aber im Augenblick befand sich der König in einer gar zu milden Stimmung und drakonische Strafen belasteten sein gutmütiges Herz. Nein, Aufhängen passte einfach nicht zu einem guten Essen. Das war degoutant. Vielleicht verstieß es sogar gegen die Etikette, auf die der Gourmet so viel Wert legte?
Ärgerlich winkte er einem Pagen und befahl ihm, sich um den Lärm zu kümmern, der inzwischen an Lautstärke noch beträchtlich zugenommen hatte. Der Page kam voller Eifer zurück und berichtete, man habe ein junges Mädchen beim Stehlen erwischt. In seiner Schürze wären ein paar von den festen runden Knollen versteckt gewesen, die Forschungsreisende aus Amerika mitgebracht hätten.
Diese hässlichen Früchte seien zwar zu nichts gut und dienten lediglich als Schweinefutter, aber der Haushofmeister vertrete die Auffassung, gestohlen sei gestohlen. Am Hofe des hohen Herrn könne man keine Diebe dulden. Deshalb werde das junge Ding eingesperrt und am nächsten Tag in aller Früh zum Galgen geführt.
Der König war mit der Auskunft zufrieden und wollte sich dem Auerhahn zuwenden, den die Diener gerade hereinbrachten.
Doch welche Ungehörigkeit!
Das Mädchen schrie schon wieder „Erbarmen!", und diesmal klang es noch flehentlicher, aber gleichzeitig auch süßer als zuvor.
Neugierde erfüllte das Herz des Königs. Er wollte das Geschöpf, das zu dieser Stimme gehörte, sehen. Deshalb ließ er alle Beteiligten der Schandtat zu sich rufen, bevor er den Auerhahn mit einem Ruck seiner gepflegten Hände auseinanderbrach.
Das Mädchen, das bald darauf in den prächtigen Speisesaal gezerrt wurde, war barfuß und in Lumpen gekleidet. Es schluchzte jämmerlich und warf sich vor dem reich gedeckten Tisch auf den Boden.
Der Haushofmeister hatte das helle, lange Haar seiner Gefangenen wie einen Strick um seine Hand geschlungen und zog, während er sprach, wie um seine Worte zu unterstreichen, kräftig daran. Dann flog jedes Mal der Kopf des Mädchens zurück, und der Kleinen traten die Augen aus den Höhlen.
Kartoffeln habe das unverschämte Ding gestohlen, erklärte der Bediente auf einen Wink seines Herrn. Zwar seien diese hässlichen Knollen nichts wert und so gut wie ungenießbar, nur die Säue hätten ihre Freude an ihnen. Aber auch die Kartoffeln gehörten schließlich dem durchlauchtigsten und erhabensten Herrscher, deshalb dürfe sich keine Bauerngöre an ihnen vergreifen.
Der Haushofmeister hatte recht und der König nickte bekräftigend.
Das Mädchen wurde nun barsch gefragt, was es zu seiner Verteidigung vorzubringen habe. Anfangs konnte es nicht antworten, sondern schluchzte still vor sich hin.
„Warum hast du gestohlen?" wurde drohend wiederholt.
Die Gefangene wimmerte.
„Wenn du nicht reden willst, so müssen wir dich peinlich befragen."
Bei der Androhung der Folter warf sich die Kleine wieder auf den Boden, rang die Hände und rief kläglich: „So habt doch Mitleid mit meiner armen Seele!"
Doch sie bekam barsch zu hören: „Dann rede!"
Daraufhin stammelte das Mädchen: „Aber wir haben doch Hunger."
Dieser Unsinn konnte natürlich nur eine Lüge sein, das wusste der König. In seinem Land hungerte kein Mensch. Schließlich hungerte er selbst auch nicht. Lügen langweilten den Herrscher. Er befahl deshalb mit einem Fingerzeig, die Gefangene abzuführen. Er war wirklich ein gutmütiger Mensch, doch es grenzte schon an Majestätsbeleidigung, ihn mit haarsträubenden Unwahrheiten beim Essen zu stören.
Als das junge Ding merkte, dass alles verloren war, schrie es voller Verzweiflung auf. Der raue Haushofmeister riss wütend an dem zarten Haar, der kleine Kopf flog zurück, und in diesem Moment blitzten in dem verschmierten Gesicht zwei strahlend blaue Augen auf.
Der König sah nicht mehr die zerlumpten Kleider, die nackten, schmutzigen Füße. Er beachtete nicht mehr den vor Zorn schnaubenden Haushofmeister, ihn interessierten nicht einmal mehr der herrliche Auerhahn und die köstlichen Soßen. Er blickte nur noch in die hellen Augen und die Gestalt vor ihm verwandelte sich wie durch Zauberkraft.
Das gelbe, strähnige Haar, das um die Hand seines Büttels gewickelt war, verwandelte sich in goldenes Geflecht. Die schmutzige Haut wurde zart und milchig-weiß und hätte einer Königin wohl angestanden. Eine entzückende Stupsnase ragte aus dem hilflosen Gesichtchen und wurde umrahmt von Sommersprossen, die wie Sterne blitzten.
Erregt rief der König, man möge dieses wunderbare Geschöpf sofort loslassen und klatschte in die Hände, um den Schinder, der dieses zarte Wesen quälte, zu verjagen. Dieser starrte seinen wild gestikulierenden Herrn verwirrt an und lief dann ängstlich aus dem Zimmer. Der König winkte nun seinem Gast. Das Mädchen rutschte zögernd und schüchtern auf den Knien näher. Das genügte dem Mann aber nicht. Er winkte und winkte und schließlich hatte die Kleine den Tisch erreicht und schielte furchtsam über die Kante.
„Wie heißt du denn?" flüsterte der gütige König.
„Ich bin die Froni, Majestät", war die Antwort.
„Und warum hast du wirklich gestohlen?"
„Weil ich Hunger habe, und weil die Meuder Hunger hat, und der Knan hungert, und der kleine Simpl auch."
„Aber, wenn ihr alle Hunger habt", fragte der König erstaunt und ungläubig, „warum esst ihr dann nicht?"
„Wir haben doch nichts zum Essen!"
In diesem Augenblick erinnerte sich der König seines edlen Vogels, der allmählich kalt zu werden drohte.
Er riss mit seinen kühlen, gepflegten Händen einen zweiten Schenkel ab und fuhr auf beiden Backen kauend fort: „Ihr müsst ja nicht gleich so etwas Edles wie einen Goldfasan essen. Ein Hühnchen werdet ihr doch haben. Wenn euch ein Hühnchen aber nicht gut genug ist, dann dürft ihr euch nicht bei mir beschweren."
Leise kam darauf die Antwort: „Wir haben kein Huhn, wir haben kein Brot. Wir finden nicht einmal mehr Bucheckern im Wald, die wir essen könnten."
Dem König blieb der Bissen im Hals stecken. Er spuckte ihn quer durch den prächtigen Speisesaal, wo er auf dem leuchtenden Seidenteppich, der mit echten Goldfäden durchwirkt war, liegen blieb.
Dann schrie er auf: „In meinem Reich hungert niemand! Derartige Lügen dulde ich nicht in meinem Palast! Henker! Wo ist der Henker? Schafft die Göre fort! Hängt die dreiste Lügnerin auf! Wachen! Henker!"
Die Froni kauerte sich noch ängstlicher zusammen und Tränen schossen ihr wieder in die Augen. Sie konnte sich nicht bewegen, sondern starrte nur den fürchterlichen König an. Ganz leise wimmerte sie in sich hinein und ergab sich ihrem Schicksal.
Der Mann aber, der ihr Schicksal war, hatte wieder ihre Augen gesehen und den Henker sofort aus dem Zimmer gescheucht. Das strahlende Blau hatte ihn gnädig gemacht. Nun glaubte er beinahe seinem jungen Gast.
In seiner Stimme war Mitleid, als er fragte: „Warum habt ihr denn nichts zu essen?"
„Die Ernten der letzten Jahre waren schlecht, und die Steuereintreiber sind unerbittlich. Mein Knan sagt immer, wenn sie von uns nichts mehr holen können, dann werden sie uns selber nehmen."
„Sage doch nicht solch einen Unsinn!" sagte der König mild und fuhr fort: „Sonst seid ihr doch immer fröhlich und guter Dinge. Ihr tanzt und singt, dass es eine Freude ist. Warum habt ihr euch so geändert und macht mir Kummer?"
„Wir wollen ja auch lustig sein, wie es sich für ein braves Volk gehört. Aber der Hunger hält uns davon ab."
„Das muss anders werden", rief da der gute Herrscher. „Ihr sollt nicht mehr hungern, sondern tanzen und singen."
Voller Triumph schwenkte er seinen Fasan durch die Luft.
„Ich befehle, dass in jedem Haus meines Volkes jeden Tag ein Huhn auf dem Tisch steht."
Schreiber und Minister wurden alsbald gerufen und in Kürze war der königliche Wille aktenkundig. Ins ganze Land wurden Boten gesandt und verkündigten die frohe Botschaft, die allem Volke widerfahren sollte.
Jubel erhob sich von Haus zu Haus, von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt. Hastig wurden Feste vorbereitet und der verständnisvolle und gütige Herrscher gepriesen.
Dankgottesdienste fanden statt, Dichter schrieben Gedichte auf den großen König und Steinmetzen machten sich ans Werk, seine edle Gestalt noch einmal in Marmor zu verewigen.
Der Gepriesene kümmerte sich aber nicht weiter um die Beifallsstürme. Er winkte den ihn umbrausenden Dank bescheiden mit seinen zarten Händen ab. Dann ließ er die süße Froni baden, mit duftendem Öl salben und zog sich mit ihr in seine Gemächer zurück.
Monate waren seit diesem denkwürdigen Tag ins Land gegangen, und wirklich stand, getreu dem königlichen Willen, in jedem Haus jeden Tag ein Huhn auf dem Tisch.
Um die vielen Hühner, die dazu nötig waren, zu züchten, hatte man die ganze Landwirtschaft umstellen müssen. Riesige Hühnerfarmen waren aus dem Boden gestampft worden. Alle wirtschaftlichen Kräfte wurden auf die große Aufgabe konzentriert.
Die Schweine- und Rinderzucht war verboten worden, denn in dieser historischen Situation von entscheidender Tragweite konnte man keine Verzettelung der volkswirtschaftlichen Kräfte zulassen.
Im ganzen Land, wo man stand und ging, hörte man das Gegacker von Hühnern und das Krähen stolzer Hähne. Das Königreich war über Nacht ein Hühnerreich geworden.
Die Hühner hatten aber nicht nur den Hunger im Land gestillt, sondern auch Glück gebracht. Im ganzen Jahr hatte es kein Unwetter gegeben, und der Herbst brachte eine gute Ernte. Auf den Äckern standen der Weizen und die Gerste in Fülle. Aber kein Korn wurde gemahlen und kein Brot gebacken. Man brauchte alles Getreide, um die ungeheure Menge Hühner zu füttern. Für Müller und Bäcker brachen schwere Zeiten an. Es gab für sie keine Arbeit und ohne das tägliche Gratishuhn hätten sie verhungern müssen.
Einen ungeheuren Aufschwung nahm die Zunft der Hühnerschlachter. Sie stellten jeden Tag neue Leute ein, bauten immer größere Hallen und schlachteten immer mehr Hühner und verdienten immer mehr Geld. Dieses Geld wollten sie natürlich auch ausgeben.
Zuerst kauften alle Hühnerschlachter Kutschen, die mit Silber beschlagen waren, dann welche mit Gold und schließlich fuhren sie alle mit Diamanten besetzten Wagen durch die Gegend. Ihre Häuser waren bald prachtvolle Paläste und ihre Frauen trugen den Pelz seltener Tiere aus fernen Ländern. Störend empfanden sie nur das tägliche Huhn auf dem Tisch. Sie, die sich alle Leckerbissen dieser Erde hätten leisten können, bekamen täglich ihre eigenen Hühner serviert und mussten sie auch noch essen. Aber sie nahmen es hin. Der Befehl des Königs war schließlich die Quelle ihres Wohlstands.
Wenn aber alle Bürger ihr Huhn täglich umsonst bekamen, wer bezahlte dann den Reichtum der Hühnerschlachter? Wer bezahlte all die Hühner, die gegessen wurden? Wer bezahlte das Korn, das die Hühner fraßen? Wer bezahlte die Fuhrleute, die die Hühner durch das Land fuhren? Von wem bekamen die Hühnerärzte ihr Geld? Wer gab den Hühnerhändler, die für die Verteilung des Gratisessens sorgten, ihren Lohn?
Die Steuern, von denen man das alles hätte bezahlen können, wurden täglich weniger. Durch die Hühner verloren viele Menschen ihre Arbeit, und andere wollten wegen der kostenlosen Ernährung nicht mehr arbeiten. Die Lage wurde immer ernster.
Man darf auch den König nicht vergessen. Der wollte natürlich weiterhin seine Fasane, Rebhühner und Tauben, seine Hirsche und Rehe und nicht zuletzt sein Rinderfilet essen. Man muss nämlich wissen, dass für Könige die eigenen Gesetze nicht gelten. Sie gehören schließlich nicht zum Volk, für das die herrschaftlichen Verordnungen gemacht werden.
Die Jäger, die das Wildbret für die königliche Tafel in den königlichen Wäldern erlegten, wollten ihren Lohn. Das Gleiche forderten die Hirten für ihre Arbeit auf den königlichen Weiden und die königlichen Händler, die durch alle Lande streiften, immer auf der Suche nach neuen Leckerbissen.
Dann wollte Ihre Majestät noch einen neuen Pavillon im königlichen Park für seine Froni bauen.
Wer sollte die Kosten tragen? Die Schatzkammern hatten sich durch die Hühnerzucht im Lande rasch geleert.
Zum Glück war einer im Reich, der sich über diese wichtigen Dinge Gedanken machte und an das Allgemeinwohl dachte: der königliche Schatzmeister.
Der war zwar nicht glücklich über den Hühnerbefehl seines Herrn, aber nach drei schlaflosen Nächten hatte er die Lösung gefunden.
Er rief vertrauenswürdige Landeskinder zu sich. Leute, für die eine Stellung bei Hofe das höchste Ziel war. Sie unterwies der kluge Schatzmeister im Geldprägen. Er sagte sich nämlich, wenn Geld gebraucht wird, so muss man es eben erzeugen. Natürlich verwendeten sie für die neuen Münzen nur Eisen und Blei und sparten das Gold und das Silber für andere königliche Zwecke.
Bei Tag und bei Nacht wurde nun in der königlichen Münze gearbeitet. Die Männer schlugen und schlugen, und ein Strom neuen Geldes übergoss das Land. Das Volk wurde aufgerufen, die alte Gold- und Silberwährung gegen das neue Zahlungsmittel umzutauschen. Und weil diese Aufforderung nur sehr zögernd befolgt wurde, währte es nicht lange und ein neues Dekret verbot den Besitz von Edelmetall und stellte ihn unter Strafe.
Die Bevölkerung musste das gute alte Geld abgeben, und die Schatzkammern füllten sich wieder. Das neue Geld aber war wenig wert und keiner wollte etwas Ordentliches dafür geben. Im Ausland konnte man schon gar nicht damit einkaufen. Reisende, die dort mit dem neuen Geld zahlen wollten, wurden nur ausgelacht.
Und doch war das Problem des fehlenden Geldes gelöst, und man war wieder zufrieden, nur die Hühnerschlachter nicht. Ihr Schatz an wertlosem Blei und Eisen wurde zwar von Tag zu Tag größer, aber neue Kutschen konnten sie dafür keine kaufen, und ihre Frauen bestellten im Ausland vergeblich Geschmeide und Pelze. Die Hühnerschlachter fühlten sich deshalb um den gerechten Lohn ihrer Arbeit betrogen.
Die erfolgreiche Sanierung der Staatsfinanzen währte leider nicht lange. Der König dachte nämlich nicht ans Einschränken. Immer neue Delikatessen wurden im Ausland gekauft und einen Lustpavillon und einen Seerosenteich und einen Wintergarten nach dem anderen ließ er für Froni bauen. Außerdem kaufte er ihr noch viele Kleider und eine große goldene Kutsche, mit der sie gemeinsam weite Reisen in ferne Länder unternahm.
Die Schatzkammern waren deshalb bald wieder leer, und der Schatzmeister hatte wieder drei schlaflose Nächte. Am Morgen des dritten Tages fand er die Lösung. Er schickte Boten zu den umliegenden Königen, mit dem Auftrag zu verhandeln. Gehandelt wurde um Landeskinder und schließlich, nach langem Feilschen, erreichten sie einen guten Preis. Für hundert Köpfe erhielt der König jeweils 50 Dukaten.
Der König lobte seinen weisen Schatzmeister und verlieh ihm einen Orden.
Dieser hatte mit seinen Verhandlungen sogar zwei Ziele erreicht: Geld floss wieder in die Schatzkammern des Königs, und die hungrigen Mäuler im Land wurden weniger.
Ein königlicher Wunsch ist ein Befehl, ja sogar eine Art Naturgesetz, und ein König muss darauf achten, dass diese seine Befehle auch befolgt werden. Er darf keine Nachlässigkeiten einreißen lassen, denn stets wäre dies der Anfang vom Ende. Unser König machte deshalb von Zeit zu Zeit Inspektionsfahrten durch sein Königreich und prüfte nach, ob auch in jedem Haus ein Huhn auf dem Tisch stand. Wurden ihm dabei von der dankbaren Bevölkerung die Hände geküsst, so war er es zufrieden und schenkte Froni noch ein goldenes Armband.
Im eigenen Land war er also geehrt und geliebt, aber in den anderen Ländern neidete man ihm die Zuneigung seines Volkes. An den angrenzenden Königshöfen riss man Witze über ihn und nannte ihn den Hühnerkönig.
Unser König wusste zum Glück nichts von so viel Bosheit, denn sein Hofgesinde hielt derartige abscheuliche Nachrichten von ihm fern.
Jahre gingen ins Land, und jeden Tag gab es in jedem Haus ein Huhn auf dem Tisch. Der König war inzwischen auf einer langen Reise durch die Welt und kaufte Froni in jeder Stadt, durch die sie kamen, ein Kleid. Die Sache mit den Hühnern hatte er längst vergessen. Wer denkt schon an Hühner, wenn er die Pyramiden und die chinesische Mauer sieht!
Seine Untertanen aber konnten inzwischen keine Hühner mehr sehen. Schon der Geruch von gekochtem oder gebratenem Federvieh verbreitete im ganzen Land Übelkeit. Dennoch achteten die Beamten des Hofes sorgsam darauf, dass täglich Hühner serviert wurden und man nicht gegen das Gebot des Königs verstieß. Sie hatten die Anzahl der Polizisten verdoppelt und ließen jeden Tag die Mahlzeiten kontrollieren. Wehe, wenn ein Büttel jemanden erwischte, der keine Hühner essen wollte! Dies war eine Subordination, eine Missachtung der Gnade des allergnädigsten Königs.
In ihrer Not erprobten die Leute allerlei Hühnerkochrezepte. Die Hühner wurden gespickt und mariniert, sie wurden kandiert und paniert, und einige Mutige aßen sie sogar mit süßer Schlagsahne. Aber Huhn bleibt eben Huhn, und auch die beste Speise hängt einem, wenn man sie täglich essen muss, zum Halse heraus. Andere Lebensmittel wiederum konnte keiner kaufen, so war die Lage aussichtslos.
Die Leute sammelten heimlich Bucheckern in den Wäldern und vergruben dafür die gebratenen Hühner bei dunkler Nacht im Garten, obwohl dies ein Staatsverbrechen war und mit dem Tode bestraft wurde.
Das Wort „Huhn“ geriet allmählich zum Schimpfwort und hat sich als solches bis auf den heutigen Tag erhalten.
Das Volk, das einst so fröhlich und zufrieden war, das stets lachte und tanzte und sogar Hungerzeiten ergeben hinnahm, dieses Volk ächzte unter der Last der Hühner. Die Empörung wurde immer größer, eine Revolte bahnte sich an. Mochte der König doch machen, was er wollte, mochte er sie alle verkaufen oder aufhängen lassen, wenn er nur den Hühnerfluch von ihnen nahm! Aber genau dies konnte er nicht, schon allein deshalb, weil er gar nicht da war.
Die Polizei musste immer schärfer durchgreifen und blieb doch erfolglos. In den Nächten wurden Hühnerschlachtereien angezündet. Das Federvieh wurde getreten, wo man es traf. Dies war natürlich ungerecht, denn was konnten die armen Hühner dafür, dass sie keiner mehr essen wollte? Am meisten aber hasste man die Hühnerschlachter. Keiner von denen wagte sich noch ohne eine starke Leibwache vor die Haustür. So konnte es nicht weitergehen!
Da kam eines Tages ein junger Königssohn aus einem weit entfernten Land. Ursprünglich nur auf der Durchreise hatte er seinen Aufenthalt verlängert, weil er so gerne Hähnchen aß.
Unser Prinz freute sich über die kostenlosen Hühner und schlug sich Tag für Tag den Magen voll. Er war so mit Essen beschäftigt, dass er lange Zeit nicht merkte, welcher ein Groll in den Menschen um ihn war.
Eines Tages aber, er ging ruhigen Schrittes irgendeine Straße entlang, hörte er durch das offene Fenster irgendeines Hauses eine Frauenstimme.
Schrill und hart klang es auf die Gasse: „Wenn du nicht folgst. dann musst du heute dein Hähnchen essen!"
Da schall ein markerschütterndes und steinerweichendes Geheul aus dem Haus. Die fürchterliche Drohung hatte bei dem Kind ihre Wirkung nicht verfehlt.
Dies war für den Studiosus ein Schlüsselerlebnis. Er achtete von nun an mehr auf seine Umgebung. Dabei musste er entsetzt feststellen, dass alle Menschen um ihn herum einen schrecklichen Ekel vor Hühnern hatten. Das Paradies, in dem er zu leben glaubte, war doch nicht so fleckenlos. Sein Interesse war erwacht. Er fragte nach und erfuhr die ganze tragische Geschichte.
Da er ein gutmütiger Königssohn war, dauerten ihn die Leute in diesem Königreich und er beschloss, ihnen zu helfen.
Der Studiosus grübelte und grübelte. Bei all dem Grübeln verging ihm sogar der Appetit auf Hähnchen. Er dachte daran, die überschüssigen Hühner ins Ausland zu exportieren und an ihrer Stelle Runkelrüben einzuführen. Aber diesem Plan stand das Verdikt des Königs entgegen.
Er zog Radikallösungen ins Kalkül, wie zum Beispiel alle Hühner mit Hühnerpest zu infizieren, und verwarf sie wieder.
Je mehr er nachdachte, desto mehr wurde ihm bewusst, dass die Wirtschaft des ganzen Landes völlig auf die Hühner abgestellt war, und der Ausfall dieses einzigen Produktionszweiges ein unermessliches wirtschaftliches Chaos heraufbeschworen hätte.
Der Königssohn sah deshalb nur zwei Alternativen: entweder man aß weiter Hühner, obwohl sie allen zum Hals heraushingen, oder man nahm den Untergang von Gesellschaft und Staat in Kauf.