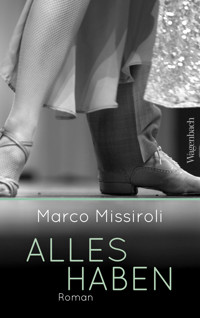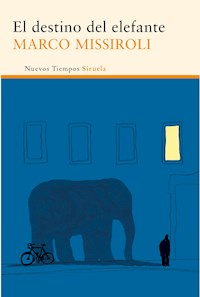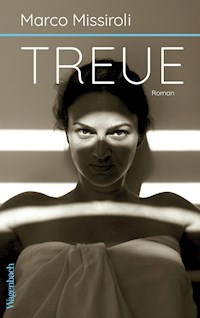
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alles nur ein Missverständnis? Carlo, Dozent für literarisches Schreiben, wurde mit der Studentin Sofia auf der Universitätstoilette gesehen. Ihr sei übel gewesen, er habe ihr nur geholfen, erklärt Carlo dem Rektor, seinen Kollegen und seiner Ehefrau Margherita – und die Studentin bestätigt es. Margherita, Immobilienmaklerin mit eigener Agentur, und Carlo würden sich glücklich nennen, doch das »Missverständnis« dringt wie schleichendes Gift in die Ehe des Mailänder Paars ein: Für Carlo wird der vermeintliche Seitensprung zur Obsession, zum Inbegriff seines Versagens; für Margherita hingegen zum besten Alibi, ihren eigenen erotischen Phantasien nachzugeben … Mit großem Gespür für die feinen Unterschiede, für Blicke, Gesten und Berührungen erkundet Marco Missiroli das Leben seiner Protagonisten: ihre unterdrückten Sehnsüchte, ihre kleinen Fluchten, ihre uneingestandenen Ängste, ihre Versuche, den anderen treu zu bleiben – und sich selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus dem Italienischen von Esther Hansen
Die italienische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Fedeltà bei Einaudi in Turin.
Die Übersetzung dieses Buches ist dank einer Förderung des italienischen Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und Internationale Kooperation entstanden.
Questo libro è stato tradotto grazie ad un contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.
E-Book-Ausgabe 2021
© 2019 Giulio Einaudi editore s. p. a., Torino. This edition published in agreement with the Proprietor through MalaTesta Literary Agency, Milan.
© 2021 für die deutsche Ausgabe:
Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Covergestaltung: Julie August unter Verwendung einer Fotografie © Zissou / Gallery Stock.
Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 978-3-8031-4305-1
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978-3-8031-3330-4
www.wagenbach.de
Alle Bezüge zu realen Ereignissen und Personen sind rein zufällig.
Leichte Veränderungen der geografischen und historischen Gegebenheiten beruhen auf erzählerischen Erfordernissen.
Wieder für Maddalena
Für Silvia Missiroli
Daran merken wir,
dass wir am Leben sind:
wir irren uns.
Philip Roth
»Deine Frau ist mir gefolgt.«
»Meine Frau.«
»Bis hierher.« Sofia sah ihn an: »Professore?«
Er warf einen Blick auf die Tür des Seminarraums.
»Sie ist im Hof, glaube ich.«
Carlo Pentecoste trat ans Fenster und erkannte Margheritas amarantroten Mantel, den sie seit dem zweiten warmen Frühlingstag trug. Sie saß auf einem Mäuerchen und las in einem Buch, immer noch Némirovksy, mit übereinandergeschlagenen Beinen, die freie Hand wachte über den Rucksack. Es war Ende März, und durch Mailand zog ein unerwarteter Nebel.
Carlo drehte sich wieder zu seinen Studenten um. Sofia hatte sich in die zweite Reihe gesetzt, ihren Block und die Mandeln ausgepackt. Sie wirkte jünger als zweiundzwanzig, mit ihrem zierlichen Gesicht und den grazilen Bewegungen, weswegen ihre Hüften umso mehr verwunderten. Sie sah ihn mit der gleichen Besorgnis an wie zwei Monate zuvor, als beide beim Rektor einbestellt waren, weil eine Studentin aus dem ersten Semester sie in der Toilette im Erdgeschoss überrascht hatte: er über ihr, seine Hände zärtlich an ihrem Hals oder so ähnlich, die Studentin hatte erst die eine Version erzählt, dann eine andere, dann unzählige, die am Ende alle das Gerücht erhärteten, dass es zwischen Professor Pentecoste und einer seiner Studentinnen zu einer uneindeutigen Annäherung gekommen war.
Statt mit dem Seminar zu beginnen, warf er sich die Jacke über und verließ den Raum, lief die Treppe hinunter, wurde in der Halle langsamer und sah zu den Toiletten hinüber. Damals war er mit einem Kollegen an den Ort des Geschehens zurückgekehrt, um die Sache zu klären, und später noch einmal mit dem Rektor. Für beide hatte er eine Re-Inszenierung dessen aufgeführt, was er »das Missverständnis« nannte: wie er die Herrentoilette betrat, pinkelte, in den gemeinsamen Vorraum ging, sich Hände und Gesicht wusch und abtrocknete, wie er dann einen dumpfen Laut aus der Damentoilette hörte, merkte, dass eine Tür nur angelehnt war und dahinter halb ohnmächtig – was genau meinte er mit »halb«? – seine Studentin Sofia Casadei fand. Wie er sich über sie beugte, sie mehrmals mit Namen ansprach, ihr half, sich aufzurichten und aufzustehen – dem Rektor hatte er vorgemacht, wie –, bis sie von ihm gestützt etwas wackelig in der Kabinenecke lehnte. Das Ganze hatte kaum ein paar Minuten gedauert, dann hatte sich die junge Frau erholt und sich – von ihm begleitet – das Gesicht mit kaltem Wasser gewaschen: Die andere Studentin war ihm gar nicht aufgefallen.
Er blieb kurz stehen und sah auf sein Telefon: Margherita hatte sich nicht angekündigt. Dann trat er in den Hof hinaus, wo seine Frau auf dem Mäuerchen saß und las.
»Dein Mantel ist einfach unverkennbar«, sagte er und wies auf das Fenster des Seminarraums.
»Ich lasse die Sehne ein bisschen ausruhen. Ich wollte gleich hochkommen.« Sie klappte das Buch zu und stand auf. »Das hast du vergessen«, sie reichte ihm ein Sprühfläschchen.
»Du bist wegen eines Asthmasprays hier.«
»Dein Anfall letzte Woche hat mir gereicht.«
»Du sollst doch das Bein schonen.«
»Ich bin mit der U-Bahn gekommen.« Sie richtete ihm den Mantelkragen. »Ich an deiner Stelle würde das Seminar heute draußen abhalten, der Nebel hat seinen ganz eigenen Reiz.«
»Das würde sie nur ablenken.« Er legte ihr die Hand auf den Rücken wie an dem Abend, als sie sich bei einer Essenseinladung seiner Schwester kennengelernt hatten. Die Mulde in Höhe der Lendenwirbel hatte ihn schon damals den trainierten Körper erahnen lassen. »Kommst du mit hoch? Ich muss anfangen.«
Margherita liebte seine Hände, die nicht die eines Lehrers waren. Sie ließ sich mit dem Rucksack helfen und begleitete ihn zum Eingang.
»Du bist wirklich nur gekommen, um.«
»Ich bin gekommen, weil ich gekommen bin.« Sie deutete auf die Uhr, er musste sich beeilen, mit einem Lächeln wandte er sich ab.
Als er über die Treppe verschwunden war, ließ Margherita sich an die Glastür sinken und sah zu Boden. Warum hatte sie nicht den Mut gehabt, mit ihm in den Kurs zu gehen? Warum hatte sie nicht den Schneid, wie ihre Mutter immer sagte, über die Schwelle der Uni zu treten und genau die Toilette anzusteuern? Und warum zitterte sie jetzt? Langsam entfernte sie sich, sie wollte stehenbleiben, zwang sich aber zum Weitergehen, durchquerte das Tor und knöpfte auf der Straße den Mantel zu. Sie verharrte und schloss die Augen, suchte innerlich nach Halt gegen die aufsteigende Traurigkeit: Sie dachte an die kommenden fünfzig Minuten, die aus ihr eine andere machen würden. Eine andere, verführbare Margherita. Der Eintrag in ihrem Terminkalender lautete Physiotherapie, und das hieß auch Abenteuer. Sie spürte das und wappnete sich mit diesem Gefühl gegen die Unsicherheit, während sie das Universitätsgebäude hinter sich ließ und zum Taxistand ging. Ihr Bein schmerzte schon seit dem Morgen. Der Schmerz ging vom Schambein aus und strahlte bis ins Knie, zum ersten Mal war er drei Monate zuvor nach einer Übung auf dem Laufband im Fitnessstudio aufgetreten. Seitdem kreisten ihre Gedanken immer wieder um Kleinigkeiten, die sie traurig machten: die hohen Schuhe, die sie durch Sneaker ersetzt hatte, der Verzicht auf Wohnungsbesichtigungen in Gebäuden ohne Aufzug oder die Unfähigkeit, einem Kind hinterherlaufen zu können.
Sie zog das Telefon hervor und sah eine Nachricht der Eigentümerin der Wohnung am Corso Concordia: Liebe Margherita, ich habe unterschrieben. Jetzt sind Sie dran, und eine zweite von ihrem Mitarbeiter: Die Wohnungsschlüssel lagen in der Agentur bereit, um die Immobilie zum Verkauf anzubieten. Außerdem ein entgangener Anruf von ihrer Mutter. Sie ignorierte ihn und hielt das Telefon in der Hand, widerstand dem Impuls, auf Facebook zu gehen. Immer wenn sie sich Sofia Casadeis Profil ansah, kam sie auf komische Ideen, das Café, wo sie jobbte, die Bar, in der sie morgens frühstückte, ihr Wohnviertel, überlegte, sich irgendwie ihrem Umfeld anzunähern. Sie erreichte den Taxistand, nannte die Adresse des FisioLab, Via Cappuccini 6, ließ sich in den Sitz sinken und schloss die Augen. Der Taxifahrer fragte, ob er einen Umweg fahren solle wegen der Bauarbeiten auf dem inneren Ring, sie willigte ein und dachte an nichts mehr. Vor dem Fenster trieb Mailand vorbei, das Hin und Her der Passanten auf den Bürgersteigen und die Portiers vor den herrschaftlichen Häusern. Ihre Mutter fiel ihr wieder ein, und sie wählte die Nummer. Beim ersten Klingeln wurde abgehoben: »Mama.«
»Ich wollte gerade den Klempner anrufen.«
»Was ist denn passiert?«
»Das«, sie holte tief Luft, »die Scheißtherme.«
»Na, jetzt aber!«
»Ich habe immer gerne so geredet, nur dein Vater war der Ansicht, dass der Mund einer Frau schön rein bleiben muss.« Sie verstummte. »Jedenfalls wollte ich dich fragen, wie es mit der Wohnung am Corso Concordia steht.«
»Sie haben mir im Moment zugesagt.«
»Und wie gefällt sie dir?«
»Sie hat keinen Aufzug, ist aber trotzdem interessant. Ich werde Carlo vorbeischicken, bevor ich sie in der Agentur anbiete.«
»Und dein Bein?«
»Was würdest du tun, wenn du einen Verdacht hast?«
»Du hast Schmerzen, ich wusste es.«
»Was würdest du tun?«
»Verdacht welcher Art?«
»Einen Verdacht eben.«
»Ein Verdacht ist ein Beweis.«
»Mama, das ist keine Gerichtsshow hier.«
»So ist das Leben, mein Schatz.« Sie zögerte: »Willst du mir nicht sagen, worauf du hinauswillst?«
»Ich bin da, ich muss Schluss machen.«
»Meine liebe Tochter«, sie räusperte sich, »bei deinem Termin morgen kannst du dir Klarheit über jedweden Verdacht verschaffen.«
»Oh Gott!«
Die Mutter seufzte. »Du willst seit Monaten dahin, und es war eine Heidenarbeit für mich, den Termin zu bekommen: halb elf, Via Vigevano 18, Klingel F.«
»Sag mir bitte noch mal, warum genau ich zugestimmt habe.«
»Weil Dino Buzzati immer dorthin gegangen ist. Schreib es dir auf die Hand.«
»Und du denk an den Geburtstag meiner Schwiegermutter.«
»Ich geh da nicht hin.«
»Und ob du das tust.«
»Sicher nicht. Schau du lieber hin und wieder bei deiner Mutter vorbei, aber natürlich nur, wenn du Lust hast.«
Nachdem Margheritas Mutter ihren Mann beerdigt hatte, war sie drei Tage und Nächte lang wachgeblieben und nicht einen Moment von dem Sessel aufgestanden, in dem er sonntagmorgens immer die Zeitung gelesen hatte. Schließlich hatte sie gesagt: Für wen soll ich denn jetzt kochen?, und wollte eine Weile nicht mehr über den Mann reden, der sie an Alltagsrituale, Flohmärkte und Tex-Willer-Comics gewöhnt und ihnen beigebracht hatte, wie man Haltung bewahrte. Er war ein schweigsamer Mann gewesen, und um den Schmerz des Abschieds nicht so zu spüren, hatten sie und ihre Mutter ein Hintergrundrauschen installiert. Sie telefonierten, zankten, echauffierten sich.
Vor dem FisioLab zahlte sie und stieg aus. Ihr war ganz warm, aus Vorfreude, wie sie wusste. Sie schaute in ihrem Rucksack nach, ob sie Badeanzug, Duschgel, Handtuch und Kamm dabeihatte. Dann meldete sie sich beim Empfangstresen, ging in die Umkleidekabine, zog unter die Shorts den Badeanzug – den sie sich extra gekauft hatte, nachdem sie begriffen hatte, um welche Art von Therapie es sich handelte –, band die Haare zusammen, ergriff Telefon und Kopfhörer und verließ die Umkleide mit der Befürchtung, die Kosmetikerin könnte nicht sauber gearbeitet haben. Sie nahm die Wasserflasche, die das Sportcenter allen Kunden schenkte, und betrat den Behandlungsraum. Andrea war auch an diesem Tag pünktlich. Er gab ihr die Hand und erkundigte sich, ob das Bein schmerze, sie erwiderte wie stets »Das wechselt«, zufrieden hörte sie, wie die Verbindungstür mit einem trockenen Klacken ins Schloss fiel, und gewöhnte sich wieder an die Aussicht, den engen Raum mit diesem ernsten Sechsundzwanzigjährigen zu teilen, der versuchte, ihre fast schon chronische Entzündung zu lindern. Er forderte sie auf, sich auf der Liege auszustrecken, sie tastete mit fragendem Blick nach dem Bund ihrer Shorts und zog sie aus, als er nickte. Der junge Mann nahm das Elektrotherapiegerät und hielt es an die Innenseite ihres Oberschenkels, wanderte bis zur Leiste, verweilte mit sanftem Druck auf dem Schambein. Margherita konzentrierte sich auf einen bestimmten Punkt im Raum und versuchte, ruhig zu atmen. Das Aufwärmen – wie er es nannte – dauerte zehn Minuten, die sie brauchte, um ihre Verlegenheit zu überwinden. Dann entspannte sie sich. Andreas Entschlossenheit überzeugte sie, seine sicheren Handgriffe, sein gesenkter Blick. Auch sie sah woanders hin, bis er schließlich – wie jetzt – das Gerät weglegte und den Badeanzug behutsam ein Stück beiseiteschob: In diesem Moment glaubte Margherita bei ihm jenseits der Pflichterfüllung einen Anflug von Erregung zu erkennen. Sie spürte dem Druck seiner Finger nach, ob sie nicht doch ein klein wenig Unsicherheit verrieten, während sie auf der Suche nach der Sehne das Schambein abtasteten. Er setzte den Daumen, den Mittelfinger und manchmal auch den Zeigefinger ein, bohrte in ihr Fleisch, als grabe er nach etwas. In der ersten Sitzung hatte er ihr den Ablauf der Behandlung erklärt: die entzündungshemmende Wirkung der Geräte, die abschwellende Wirkung der Massage, die Übungen, die sie anschließend im Fitnessraum machen sollte. Fünfundzwanzig Sitzungen plus Nachuntersuchungen und Ultraschall zu einem Gesamtbetrag von zweitausendachthundertzwanzig Euro. Das konnte sie sich nicht leisten, zumindest nicht komplett, deshalb hatte sie zunächst beim Gesundheitsdienst nachgefragt, um sich dann nach endlosen Wartezeiten entnervt für den einfachen Weg zu entscheiden, wie ihr Vater gesagt hätte. Es war einfach, aus eigener Tasche knapp dreitausend Euro für einen Physiotherapeuten zu bezahlen, es war einfach, sich nach der Schule ein Interrail-Ticket schenken zu lassen, obwohl man nicht zu den Jahrgangsbesten gehörte, es war einfach, sich mit einem Job als Immobilienmaklerin zu begnügen, obwohl man das Zeug zur Architektin hatte. Und wahrscheinlich war es auch einfach, eine Massagetherapie mit Unzucht zu verwechseln.
Und während sie sich nun von ihrem Physiotherapeuten mit angemessener Intensität in einem Grenzgebiet berühren ließ und darauf wartete, ihm zu sagen, an welcher Stelle der Schmerz genau saß, kehrte Margherita innerlich zurück: zu ihrem Mann, der Tür zu den Toilettenräumen, Gebäude 5 der Universität, Erdgeschoss, die Damentoilette. Dies war die genaue Stelle, wo seit zwei Monaten der Schmerz saß. Sie schob den Gedanken beiseite, wie immer in den letzten Wochen, und versuchte die Dinge umzukehren: War sie eine aufmerksame und hilfsbereite Tochter? Sie konnte auch anders. War sie eine Immobilienmaklerin, die ihre Zeit zwischen zwei Besichtigungsterminen nicht für andere Dinge nutzte? Sie konnte sie auch anders nutzen. War sie eine Patientin, die sich niemals von drei geschickten Fingern verführen lassen würde? Auch das konnte sie, wenn sie wollte. Immer wenn sie an die Tür zu den Toilettenräumen denken musste, konnte sie aus ihrer Haut schlüpfen und sich vom Verdacht ablenken.
Andrea fragte, ob der Schmerz genau an der Stelle sitze, die er gerade massierte. Sie hätte nur »Weiter rechts« sagen müssen, um ihren Phantasien nachzugeben. Andrea hätte weiter rechts massiert, und sie hätte nichts weiter getan, als es zu genießen, Himmel noch mal.
Stattdessen sagte sie: »Weiter links.«
Er rutschte mit den Fingern an eine andere Stelle. »Nimmt der Schmerz abends zu?«
»Je nach Tagesform.«
»Machst du deine Übungen?«
»Je nach Tagesform.« Sie rückte ihren Körper auf der Liege zurecht. »Eigentlich bin ich eine sehr pflichtbewusste Frau.«
»Das sagen alle.«
»Alle?«
»Und dann kneifen sie.«
»Inwiefern?«
»Sie stellen sich nicht wirklich dem Problem.« Er drückte ganz leicht: »An der Stelle ist sie etwas verdickt, spürst du das?«
Sie schwieg. Sie war also alle Frauen, die hier ein und aus gingen, mit neuer Unterwäsche, mit Perlenohrringen, mit einer Wohnung in der Innenstadt und einem Ehemann von zweifelhaften Verhaltensweisen, mit ihrer Fügsamkeit.
»Man merkt, dass du deine Arbeit liebst, Andrea.«
Der Druck seiner Finger ließ etwas nach.
»Ich meine, du bist gut. Hörst du das manchmal, dass du gut bist?«
»Ist schon vorgekommen.« Er ließ von ihr ab und ging um die Liege herum, setzte am unteren Teil des Beines neu an und massierte langsam nach oben.
Margherita spürte, wie er sich allmählich ihrer Leiste näherte, die Sehne Zentimeter für Zentimeter traktierte. Sie gab sich kurz der Überlegung hin, wie er wohl im Bett war. Vielleicht grob, wahrscheinlich unerfahren. Einen Moment lang kamen ihr die zwei leerstehenden Wohnungen in den Sinn, in die sie mit ihm gehen konnte: Viale Sabotino 3, die Immobilie, die sie nicht loswurde wegen der unverhältnismäßig hohen Betriebskosten, und Via Bazzini 18, die Dreizimmerwohnung mit dem kleinen Jacuzzi.
»Weiter rechts«, hörte sie sich plötzlich zu ihrem eigenen Erstaunen murmeln.
Er hielt inne: »Weiter rechts?«
»Ein bisschen.«
Er wusste, dass weiter rechts nicht stimmen konnte. Die schmerzende Stelle an der Sehne lag genau unter seinen Fingern, und er bearbeitete sie schon, so gut es ging. Weiter rechts bedeutete Gefahr, schon bei der kleinsten Bewegung: Es genügte, den kleinen Finger sinken zu lassen, um die Wärme zu ertasten, die Feuchtigkeit, die andere Beschaffenheit der Haut, ihn dann wieder anzuheben, ohne die Massage auch nur eine Sekunde zu unterbrechen. Er hatte es nie ausprobiert, doch seine Kollegen hatten ihm gezeigt, wie man es machte und dabei ganz professionell dreinschaute. Immer wenn eine Patientin zur Behandlung einer Adduktoren-Tendopathie hereinkam und interessant war, fuhren sie alle die Ellbogen aus, um sie zu übernehmen. Margherita war wegen ihrer vordergründigen Unscheinbarkeit bei ihm gelandet. Eine hübsche Frau, aber ein bisschen blass. Ihr Körper jedoch hatte Erstaunliches offenbart: nicht wegen ihrer harmonischen Muskulatur oder ihrer wohlgeformten, kräftigen Beine oder der runden Hüften, es war die Art, wie sie sich in diese fünfzig Minuten heilsamer Anspannung hineingab, ihre Sehnen, ihre Glieder, sich selbst. Er mochte die Schweigsamkeit dieser Frau, die ihn konzentriert arbeiten ließ, Margherita wirkte manchmal, als denke sie überhaupt nichts und sei plötzlich doch voller Ideen. Er versuchte sie daher nicht anzusehen, als schrecke ihn die Vorstellung, sie bei diesen Gedankenblitzen zu überraschen. Ihren Geruch nahm er dafür umso stärker wahr, einen Duft, den er so noch nie gerochen hatte – beinah wie Milch – und der bis unter die Dusche an ihm haften blieb.
Er sah auf die Uhr, noch fünf Minuten. Er half ihr, das Bein anzuwinkeln, fragte, wo die Beugung den Schmerz verstärkte, und schloss aus ihrer Antwort, dass noch eine kleinere Verspannung der ischiocruralen Muskulatur zu lösen war. Er legte sich den Fußknöchel auf die Schulter und bearbeitete mit leichtem Zupfen den Muskelstrang auf der Rückseite des Beins, fand die Blockade und drückte zu. Er hörte sie aufstöhnen wie in den ersten Sitzungen, eher ein Winseln als ein Schrei. Noch ein letztes Mal, kündigte er an und drückte zu, er wollte noch einmal das Stöhnen hören, das nach etwas anderem klang. War er also doch wie seine Kollegen? Schneller und weniger fest massierte er weiter, bis sein Arm schmerzte. Er legte das Bein auf die Liege zurück. »Jetzt gehst du eine Runde auf den Crosstrainer, dann macht Alice die Übungen mit dir.«
»Alice?«
»Ich muss heute früher weg. Aber du solltest morgen wiederkommen. Die Entzündung gefällt mir nicht.«
»Morgen schon?«
»Wenn du Zeit hast, ja.«
Sie dachte nach. »Neun Uhr schaffe ich.« Sie setzte sich auf und ließ die Beine baumeln. »Was hast du denn Schönes vor heute Nachmittag?«
Er öffnete die Tür des Séparées.
»Entschuldige, das geht mich natürlich nichts an.« Sie schlüpfte in ihre Shorts. »Aber ein freier Nachmittag ist in Mailand nun mal was Besonderes.«
»So frei nun auch wieder nicht.«
»Ach ja?« Margherita machte eine verlegene Miene. »Sorry, ich kann einfach nicht anders.« Sie schob sich an ihm vorbei und ging zum Crosstrainer in den Geräteraum.
Andrea sah ihr nach. Dann ging er in die Umkleidekabine, zog sich schnell um, und als er das FisioLab verließ, dachte er schon nicht mehr an sie oder die anderen Patienten. Früher hatte er ihre Körper mit nach Hause genommen: auf welche Art und in welchem Zeitraum er sie therapieren, wie er die Sitzungen optimieren könnte. Dann hatte er gelernt, sie zu vergessen, indem er durch die vornehmen Mailänder Straßen rund um die Via Cappuccini lief, durch das plötzliche Gewimmel auf dem Corso Buenos Aires, den aggressiven Verkehr des inneren Rings, durch Mailand in all seiner Kompliziertheit. Kompliziert, dieses Adjektiv hatten ihm die Lehrerinnen als Kind immer angehängt. Kompliziert: Der Junge redet so wenig. Kompliziert: Er hört nicht zu. Kompliziert: Er hat einen Mitschüler verprügelt. Kompliziert: Er hat von heute auf morgen seinen Hund ausgesetzt. Kompliziert: Er hatte nie eine Freundin, dann immer nur die falschen. Kompliziert: Andrea Manfredi. Und als seine Mutter einmal gesagt hatte, ihr Sohn sei so kompliziert wie Mailand – schwierig nämlich nur auf den ersten Blick –, hatte er begriffen, was es hieß, verstanden zu werden.
Jetzt brauchte er dieses Gefühl der Zugehörigkeit; er kam an der Villa Invernizzi vorbei, dem kleinen Park mit seinen absurden Flamingos im Brunnen, an den prächtigen, von Abgasen geschwärzten Jugendstilfassaden, tauchte in die Straßen ein, die auf die Porta Venezia zuliefen, mit ihrem Dicht-an-Dicht von Schwulen, Afrikanern und Kleinbürgern, entlang der mit frischem Gras bewachsenen Straßenbahngleise des Viale Piave. Er folgte der Straße rund einen Kilometer lang – er hatte eine fast elegante Art zu gehen, die Hände in den Taschen vergraben, die Schultern etwas gebeugt –, erreichte die Piazza Tricolore, stieg in die 9 und fuhr bis Porta Romana, das sich von der Mailänder Borgata zum In-Viertel gewandelt hatte. Hier war er aufgewachsen, seine Eltern führten seit dreiundzwanzig Jahren den Zeitschriftenkiosk gegenüber der Kirche Sant’Andrea. In dem Kiosk hatte er sich seine Ausbildung zum Physiotherapeuten verdient, hatte sechs Sommer in Folge die Frühschicht übernommen und zwei ganze Winter durchgearbeitet. Er hatte Routine mit den Rücksendungen der Tageszeitungen und verfolgte bei der Präsentation der Auslage seine eigene Philosophie. Zwischen den Zeitschriften platzierte er immer einen »Eindringling«, einen Marvel-Comic, eine Illustrierte über Tiere oder die Panini-Alben. Der Vater ließ ihn gewähren und sortierte anschließend alles wieder um. Sein Vater war ununterbrochen am Sortieren, auch an diesem Tag kniete er über einem Karton und ordnete die gebrauchten Urania-Ausgaben für je zwei Euro zu handlichen Stapeln. »Ich komme nicht mit«, sagte er, als er Andrea kommen sah.
»Er ist so ein Sturkopf.« Die Mutter trat vor den Zeitungsstand und machte ihm ein Zeichen. Andrea nahm seinen Vater am Arm, er hatte ganz wässrige Augen, half ihm hoch und ließ sich von der Mutter die Mappe mit den Arztbefunden geben.
»Sagt Bescheid, wenn ihr etwas wisst.«
Sie überquerten die Straße und gingen aneinandergedrängt an der Kirche vorbei, als sei ihnen kalt, dann wiederholte der alte Mann: »Ich gehe da nicht hin.«
»Der Termin steht seit zwei Monaten fest.«
»Du redest wie deine Mutter.«
»Es ist doch nur eine Kontrolle.«
»Hör auf.«
»Mach, was du willst.«
Das machte er schon, seit die Jungs von der Bar Rock ihn auf dem Boden vor seinem Kiosk gefunden hatten, wo er sich den linken Arm hielt und über Schmerzen in der Brust klagte; wenig später war er mit drei Bypässen aus dem Krankenhaus entlassen worden und hatte erklärt, den Herzkasper hätten ihm der Vatikan – nicht der Papst persönlich, sondern die Kardinäle – und Inter Mailand – nicht Vereinspräsident Moratti, sondern die Spieler – beschert. Dann sagte er: Der Kiosk war’s. Und die Ärzte hatten ihm recht gegeben, dass ein Leben mit nur vier Stunden Schlaf seinem Herzmuskel schadete. Seitdem schlief er nachts eine Stunde länger, schimpfte nicht mehr so viel, wenn er Domenica Sportiva schaute, regte sich insgesamt weniger auf und gewöhnte sich ab, ein paar Züge von der Marlboro seiner Frau mitzurauchen. Er hörte auf, sich um Notlagen zu sorgen, die es noch gar nicht gab. Andrea kam allein zurecht. Maria kam allein zurecht. Seine einzige Aufgabe lautete nun: auf sich selbst zu achten.
»Lass dich einfach untersuchen und fertig.«
»Leg dir wieder einen Hund zu und lass mich in Ruhe.«
Andrea folgte ihm mit einem halben Meter Abstand bis zu einer Parkbank bei einem Spielplatz. Sie setzten sich, die Sonne schien schwach durch den diesigen Himmel, und der Vater knöpfte sich das Polohemd zu. Er versank fast in seiner Jeans mit den schlackernden Hosenbeinen. »Hol dir einen Schäferhund, dann geht’s dir besser.«
Auf der Bank gegenüber saß eine junge Frau mit einem Lederrucksack auf dem Schoß, aus dem sie etwas hervorzog und zu essen begann. Andrea betrachtete sie, sie sah melancholisch aus.
»Oder einen Maremma-Hund.« Der Vater richtete sich auf und fasste sich an die Schulter.
»Hol dir doch selbst einen.«
»Dann lässt du mich wenigstens in Ruhe.« Er hielt sich weiter die Schulter.
»Was hast du?«
»Verspannungen vom Hocker.«
Andrea starrte auf seine Hände. Sie waren groß und glatt, der Ringfinger länger als der Zeigefinger. Er rieb sie ineinander wie immer, wenn er unentschlossen war, und beobachtete aus den Augenwinkeln, wie sein Vater sich an die Schulter fasste. Dann wanderte sein Blick wieder zu der melancholischen Frau, und er bemerkte, dass auch sie ihn beobachtete, während ein paar südamerikanische Kindermädchen sich an der Schaukel unterhielten. Er legte sich die Hände vors Gesicht. Sie rochen immer noch nach Margherita. Er ließ sie sinken. »Wo sitzt die Verspannung?«
»Signora Venturi kauft den Corriere della Sera nicht mehr, sie sagt, ihr Mann liest ihn jetzt am Computer.«
»In der Schulter?«
»Du musst den Stand sofort verkaufen, wenn ich nicht mehr da bin.«
»Nur in der Schulter?«
»Ein bisschen im Nacken.«
»Lehn dich aufrecht zurück und lass die Arme seitlich runterhängen.«
»Du musst sofort verkaufen, hast du gehört?«
»Tu, was ich dir sage.«
Der Vater rührte sich nicht, und Andrea ging um die Bank herum, half ihm, sich anzulehnen; bei den ersten Massagegriffen spürte er, wie zerbrechlich sein Vater war, und bekam Angst, ihm wehzutun. Sie hatten die gleiche Nase, doch es war eher der verschlossene Gesichtsausdruck, der sie zu Vater und Sohn machte. Sofia wandte den Blick ab, steckte die letzte Mandel in den Mund und setzte den Rucksack auf. Sie hatte Pentecostes Kurs mitten in der Stunde verlassen und war in den 91er gestiegen. Als sie durch das Fenster des Oberleitungsbusses den Parco Ravizza sah, stieg sie aus. Seit sie Rimini verlassen hatte, verspürte sie eine ständige Sehnsucht nach offenen, weiten Räumen. Vor sechs Monaten war sie am Mailänder Hauptbahnhof angekommen, voller Vorfreude und in der Gewissheit, dass sich ihr Leben nun verändern würde. Stattdessen stand sie jetzt wieder ganz am Anfang: eine Zweiundzwanzigjährige vom Land, die der Provinz nachhing und Dinge tat, die sie später bereute.
Sie lief über den Rasen zur Straße, sah sich noch einmal nach dem alten Mann und dem Jungen um, der ihn massierte, bis sie im Nebel verschwammen. Langsam ging sie weiter, Porta Romana mit seinen niedrigen Dächern und den kleinen Läden war ein Viertel, das ihr Sicherheit gab. Als sie an der Kirche vorbeikam, blieb sie stehen und gestand sich ein, dass sie sich bei Pentecoste entschuldigen wollte. Dass sie ihn vor dem versammelten Kurs vorne am Pult angesprochen hatte, musste ihn neuen Spekulationen aussetzen. Sie würde ihm sagen, dass seine Frau ihr nicht gefolgt war, sondern sie nur zufällig denselben Weg wie sie genommen hatte. Aber was sollte sie antworten, wenn er sie fragte, warum sie gelogen hatte? Sie wusste es doch selbst nicht. Als sie Pentecostes Frau in der U-Bahn entdeckte, hatte sie sie zuerst heimlich beobachtet und war ihr dann mit Sicherheitsabstand bis zur Uni gefolgt. Sie hatte gesehen, wie sich die Frau in den Hof setzte, war dann in den Seminarraum gegangen und hatte dem Professore ihre kleine Lüge aufgetischt. Und währenddessen hatte sie sich insgeheim im Recht gefühlt: Nach dem Missverständnis auf der Toilette war er auf Distanz zu ihr gegangen, hatte ihr keine Gelegenheit zu einem Gespräch gegeben, nicht einmal über die Kurzgeschichte, die sie vor fast zwei Monaten eingereicht hatte, und hatte sie alleingelassen mit seiner Kritik der ersten Erzählung, die er als »gehaltlos« abgeurteilt hatte.
»Gehaltlos?«
»Gehaltlos.«
Darum hatte sie ihm die zweite Kurzgeschichte gegeben, sieben handgeschriebene Seiten, auf denen sie erzählte, was damals im Fiat Punto mit ihrer Mutter geschehen war. Sie hatte sie Wie die Dinge liegen genannt. Als sie sie an einem Mittwochmorgen abgeben wollte, hatte der Professore gesagt, er akzeptiere keine unverlangt eingereichten Arbeiten. Mit den Blättern in der Hand stand sie vor ihm, legte sie dann einfach auf das Dozentenpult und ließ sie den Kurs über nicht aus den Augen. Nach Unterrichtsende hatte er sie zusammen mit den Büchern und dem Laptop in die Tasche gepackt, ohne aufzuschauen, genau wie damals beim Rektor, als er sie auch keines komplizenhaften Blickes gewürdigt hatte, obwohl er doch wusste, dass für ihn alles von ihrer Aussage abhing. Sie hatte sich brav ans Drehbuch gehalten: die Unpässlichkeit auf der Toilette, er kommt ihr zu Hilfe, stützt sie, damit sie aufstehen kann. Der Rektor hatte ihnen versichert, dass er von weiteren Schritten absehen würde, und hätte nicht weiter nachgefragt, hätte nicht Pentecoste selbst auf Klärung bestanden. Um sich auf eine gemeinsame Version zu verständigen, hatten sie sich zwei Tage zuvor in einer Bar in Chinatown getroffen. Sie hatten eine minutiöse Chronologie entworfen mit glaubwürdigem Handlungsablauf und Timing. Mehrmals hatten sie alles durchgespielt und in der übrigen Zeit über Gott und die Welt geplaudert. Nach dem Treffen – er hatte gezahlt –, hatte sie auf der Straße Richtung des Cimitero Monumentale ihr Telefon hervorgeholt und die Aufnahme gestoppt, hatte die Kopfhörer aufgesetzt und die Datei einmal, ein zweites Mal und ein drittes Mal angehört. Dass sie beschlossen hatte, alles aufzuzeichnen, konnte nur eins bedeuten: Der Apfel fiel nicht weit vom Stamm. Sich absichern, sich wappnen, sich gegen eine Wirklichkeit verteidigen, die unendliche Qualen bereithielt – das war die Obsession ihrer Familie. Von Zahlen kannst du leben, von Büchern nicht: ein dreijähriges Studium in Tourismusmanagement. Mach mit dem Ballett weiter, vielleicht kommst du ja bei einem namhaften Ensemble unter. Lass die Finger von Männern, die älter sind als du. In Mailand vergeudest du nur deine Zeit. Dass sie die einundfünfzig Minuten und siebenunddreißig Sekunden aufgenommen hatte, war der Beweis, dass auch sie genau das war. Eine Kleinigkeit allerdings führte sie wieder zu sich zurück: das Timbre in Pentecostes Stimme. Die weiche Aussprache, die klingenden Vokale, vor allem das »U«, das erst scheue, dann vergnügte Lachen erregten sie. Vielleicht war sie stattdessen ja genau das, jemand, der Gefallen daran fand, in seinem Monolog in Minute einundzwanzig zu schwelgen:
»Bringen Sie uns bitte noch einen halben Liter stilles Wasser. Möchtest du sonst noch was, Sofia? Gut, dann nur das Wasser, danke. Also, wo war ich, ach ja, meine Eltern, die hatten mir damals dieses Küken geschenkt als Belohnung für die überstandene Mandeloperation, ich muss vier Jahre alt gewesen sein, ein Küken, ich nannte es Alfredo, und es wohnte bei meinen Großeltern, eine Etage unter uns, in einem Pappkarton. Es war ganz brav und piepste nur wenig, und wenn ich allein war, ließ ich es immer in der Küche herumlaufen und beobachtete seine kleinen Tapser und Sprünge, und am faszinierendsten für mich war, es wieder in den Karton zu setzen und gleich darauf aufs Neue freizulassen. Jetzt, dreißig Jahre später, habe ich verstanden, was genau der Reiz daran war: Der Übergang vom Karton zum Küchenboden, dieser Moment, wenn die Füßchen diesen schüchternen und zugleich unbändigen Antrieb spüren, was aber nicht heißt, dass ich es nicht auch gerne in den Karton eingesperrt sah. Es war die Verwandlung, die mich faszinierte. Mich interessiert die Veränderung, die jemand durchmacht, wenn er die Möglichkeit dazu bekommt, verstehst du, was ich meine?«
Sie lauschte seinem Monolog und drückte auf Stop, als er unbändig sagte, ging zurück und lauschte erneut. Das lange U und das weiche B. Unbändig, das Küken, Mailand, ihr Master, der Café-Job, zu dem sie auf dem Weg war und in die schmale Gasse zwischen den Giardini Cederna und der Basilica di San Nazaro einbog. Im Café verband sie, was sie im Seminar über Erzähltechniken gelernt hatte, mit ihrem Sinn fürs Praktische und notierte manchmal schnell ein paar Ideen auf dem Bestellblock. Das Café war gemütlich eingerichtet, gebeizter Parkettboden und ein paar vegane Gerichte auf der Speisekarte – Couscous lief besonders gut –, sie bekam neun Euro die Stunde. Die Anzeige hatte am Schwarzen Brett der Uni gehangen, nach zwei Probetagen war sie eingestellt, allerdings mit dem nachdrücklichen Hinweis, sie müsse ihre Herzen und sonstigen Cappuccino-Schaummotive perfektionieren. Sie arbeitete sechsmal die Woche halbtags mit wenig Überstunden, nach Abzug der Miete konnte sie so wenigstens einen Teil der siebentausend Euro zurückzahlen, die ihr Vater ihr für den Master vorgestreckt hatte. Auch an diesem Tag würde sie fünfundvierzig Euro einstecken, die Sesamriegel an der Kasse ordnen und ein bisschen mit Khalil über sein geliebtes Jordanien plaudern, würde mit bunter Kreide einen hübschen Rahmen auf die Tafel mit den Tagesgerichten zeichnen und versuchen, möglichst freundlich zu den Kunden zu sein: und das alles, um sich nicht ausmalen zu müssen, an einem solchen Ort den Rest ihres Lebens zu verbringen.
Als sie eintrat, saßen fünf Leute an den Tischen, eilig verzehrte sie einen Lachs-Avocado-Toast, zog sich in der Vorratskammer um, band die Schürze um, sodass sie nicht an den Hüften drückte, legte die Armbanduhr ab und füllte sich etwas grobes Salz in die Tasche – laut ihrer Tante genügten schon wenige Körnchen, um negative Energien fernzuhalten. Sie ging zu Khalil und krempelte ihm die Hemdsärmel ordentlich hoch. »Ich vermisse Rimini noch immer«, sagte sie und strich ihm über die Schulter.
»So lange bist du ja auch noch nicht hier.«
»Sechs Monate sind doch ziemlich lange.«
»Für Mailand?«
»Kann ich heute die Kasse machen?«
Sie standen Seite an Seite, sie an der Kasse und er an der Kaffeemaschine. Wenn niemand zu bedienen war, schwiegen sie normalerweise, oder Khalil bat sie, zusammen eine To-do-Liste zu erstellen. So auch an diesem Tag, sie nahm ein Post-it und notierte: Fenster putzen, er sagte: Müll ausleeren, sie: Frühstücksbestellungen vorbereiten, er: Dienstplan durchgehen, sie: Obst schneiden, er: fünfmal beten.
»Warst du neulich nicht noch ein jordanischer Christ?«
»Wer in einem zu vierundneunzig Prozent muslimischen Umfeld aufwächst, macht irgendwann automatisch mit.«
Sie lachte.
»Jetzt schreib noch was von dir auf, Mädchen aus Rimini, dann ist die Liste fertig.«
»Ich habe doch schon was von mir aufgeschrieben.«
»Obst schneiden? Herzlichen Glückwunsch zu so viel Tiefgang.«
Die Tür schwang auf, sie hob den Kopf und sah Pentecostes Frau hereinkommen. Mit der Hand auf der Klinke zog sie gerade die Tür hinter sich zu. Sofia trat zur Kaffeemaschine und bat Khalil, die Kasse zu übernehmen, und begann mit dem Rücken zum Raum die Ablagefläche zu schrubben. Die Frau kam näher und schaute auf die Getränkekarte an der Wand, dann bestellte sie einen grünen Smoothie.
Khalil fragte, ob sie ihn klein, mittel oder groß wolle.
»Klein reicht mir völlig, danke.«
»Wir bringen ihn an den Tisch.«
Sofia legte den Schwamm beiseite und schob das Küchenbrett in die Mitte. Aus den Kühlfächern nahm sie einen Apfel, eine Fenchelknolle, Basilikum, Limette und Ingwer und begann alles in Scheiben zu schneiden, setzte plötzlich das Messer ab und drehte sich um, die Frau ließ sich gerade auf einen Hocker am Fenster nieder. Nach und nach füllte sie die Schnitze in den Entsafter und drückte siebenmal auf den Kolben. Sie goss den Saft in das Glas, verschloss ihn mit einem Deckel und steckte einen Strohhalm hinein, reichte ihn Khalil und verschwand in der Vorratskammer. An die Wand gelehnt verschränkte sie die Hände, legte sie auf die Augen. So verharrte sie, bis sie meinte, wieder hineingehen zu müssen. Khalil suchte gerade einen neuen Radiosender: »Geht’s dir gut, Sofia?«
Sie starrte wortlos die Frau an, die an ihrem Smoothie sog und in einer Zeitschrift blätterte. Den amarantfarbenen Mantel hatte sie abgelegt und hielt gedankenversunken den Strohhalm zwischen den Lippen.
Khalil machte ihr ein Zeichen: »Alles klar?«
Sie nickte und warf die ausgepressten Fruchtreste weg. Nun sah sie Pentecostes Frau schon zum zweiten Mal an diesem Tag, insgesamt zum dritten Mal, wenn man die Eröffnungsfeier des Masterstudiengangs mitzählte. Damals hatte sie sie attraktiv gefunden, sie erinnerte sich noch gut an die Hemdbluse, die sie trug, und ihren behutsamen Gang auf den Pumps. Auch jetzt erinnerte ihre Ausstrahlung sie an die Schauspielerin Virna Lisi, der braune Schopf fiel ihr halb ins Gesicht, und die übereinandergeschlagenen Beine wirkten, als ruhten sie gemeinsam aus. Sie liebte die alten Filme mit Virna Lisi, die sie immer mit ihrer Mutter geschaut hatte. Sie riss sich von dem Anblick los und griff nach dem Bestellbuch, vervollständigte die Liste der Rückläufe, die Khalil nach der Frühstückszeit begonnen hatte. Sie überschlug die Vorräte an Magermilch – sie konnten pro Woche ruhig einen Karton weniger davon bestellen – und hörte einen Hocker über das Parkett schrappen. Sie hob den Kopf und sah die Frau auf sich zukommen. »Kann ich dich einen Moment sprechen?«
Sofia legte den Stift weg. »Mich?«
Die Frau nickte.
Khalil sah von einer zu anderen. »Geh nur.«
Sofia hielt sich an ihrer Schürze fest, ging an der Kasse vorbei Richtung Tür. Die Frau bedankte sich bei Khalil und folgte ihr, sie standen nun auf dem kleinen, mit Kies bestreuten Vorplatz, hundert Meter von ihnen entfernt die Mauern der Universität.
»Du bist doch Sofia und besuchst das Seminar bei Professor Pentecoste.«
Sie nickte.
»Ich wollte dich kennenlernen.« Die Frau stellte ihre Handtasche und den Rucksack auf den Boden und strich sich die Haare aus dem Gesicht. Sofia stellte fest, dass die Ähnlichkeit mit Lisi in ihrem Blick lag, sie lachte auch dann, wenn sie ernst war. »Ich wollte dich nach deiner Version fragen.«
Zwei junge Frauen schoben sich an ihnen vorbei ins Café. »Meine Version von was.«
»Ich bitte dich.«
»Ach so«, murmelte sie und strich sich eine Kante der Schürze glatt. »Der Professore hat ja schon gesagt, dass.«
»Du«, unterbrach seine Frau sie. »Was sagst du?«
»Mir war nicht gut, und er hat mir geholfen.«
»Wirklich.«
»Wirklich.«
»Und vorher, was ist vorher passiert?«
Der Nebel hatte sich gelichtet, konnte aber jeden Moment zurückkehren. »Wann vorher?«
»Vor der Sache in der Toilette.«
»Nichts Besonderes.«
»Was heißt nichts Besonderes?«
»Der Kurs, manchmal sind wir rausgegangen, um an den Erzählungen zu arbeiten.« Ein Border Collie und sein Herrchen gingen vorbei. »Das ist seine Lehrmethode.«
»Die Pentecoste-Methode.«
Sofia betrachtete den Border Collie, er beschnüffelte zwei Hunde hinter den Blumenrabatten. »Er geht mit uns an einen Ort, der eine Bedeutung hat, und.«
»Hält dort ein kleines Seminar.«
»Ja.«
»Wohin ist er mit dir gegangen?«
»In eine Bar.«
»Zu Bianciardi in Brera.«
Sofia nickte.
»Und wohin noch?«
»Einmal waren wir in Chinatown«, sie zog die Hände aus der Schürzentasche und ließ sie herabhängen. »Ich komme mir vor wie bei einem Verhör.«
»Bitte«, Pentecostes Frau lächelte angestrengt. »Warum ist er mit dir dorthin gegangen?«
Rimini. Ihr Vater und der blaue Arbeitskittel. Der Sockel des gelben Leuchtturms ganz im Osten des Hafens, zurückkehren. »Wir waren eine Handvoll Studenten, und der Professore wollte«, sie räusperte sich. »Er wollte, dass wir eine Erzählung dort spielen lassen.«
»Also waren noch andere dabei?«
»Ja.« Wenn sie log, musste sie immer den Blick senken.
»Du hast recht, das klingt nach einem Verhör.«
»Ist schon in Ordnung.«
»Übrigens, ich heiße Margherita, freut mich«, sie beugte sich leicht vor und reichte ihr die Hand.
Sofia nahm sie, ihre Hände waren weich.
»Ich musste mit dir sprechen, ich glaube, du kannst das verstehen. Verstehst du das?«
Sie nickte, und es war wirklich so. Auf eine merkwürdige Art fühlte sie sich ihr nahe, weil sie sich nicht hatte zurückhalten können, und auch wegen ihrer Hüften, die im Widerspruch zu ihren langgliedrigen Zügen standen.
»Dann, also, auf Wiedersehen.« Sofia wandte sich zum Gehen.
»He.« Die Frau hatte sich die Tasche umgehängt.
Sofia sah sie an.
»Entschuldige den Überfall.«
Margherita entfernte sich. Wie kam sie nur darauf, sich zu entschuldigen, fragte sie sich drei Schritte lang, dann überschlugen sich ihre Gedanken. Die letzte Bemerkung hätte sie sich sparen können. Aber was hieß das schon. Wichtig war doch nur, dass sie nicht als das arme Würstchen dastand, als eine dieser schockstarren, schicksalsergebenen Ehefrauen, das sagte sie sich immer wieder, bis sie schließlich vor einem indischen Imbiss langsamer wurde, warum nur hatte sie das getan? Vielleicht, weil sie selbst vor zehn Jahren wie Sofia gewesen war und jetzt nur noch wie alle Frauen, wie ihr Physiotherapeut gesagt hatte. Sie blieb stehen, plötzlich war sie überzeugt, dass sie in der gleichen Situation genauso gehandelt hätte, wie Sofia Casadei wahrscheinlich gehandelt hatte, dass sie die Grenzen eines Mannes ausgetestet hätte, der das zuließ. Sie betrachtete ihre rechte Hand. War ihr Händedruck entschieden genug gewesen? Die Hand war feucht, sie steckte sie in die Manteltasche und ging weiter mit dem Gefühl, etwas abgeschlossen zu haben. Vielleicht würde sie jetzt ja aufhören, sich immer wieder die Szene in der Toilette auszumalen, er über dem Mädchen, seine drängende Zunge in ihrem Mund, oder sie auf den Knien vor Carlo mit aufgeknöpfter Hose. Sie hatte es vermieden, ihrem Mann all das unter die Nase zu reiben, nur eines hatte sie ihm vorgeworfen, dass er selbst unnötig Staub aufwirbelte, weil er unbedingt wollte, dass der Rektor seine Wahrheit hörte, dass sie seine Wahrheit hörte, dass die ganze Welt seine Scheißwahrheit hörte. Carlo hatte sie alle unter seinem Wortschwall begraben, das machte sie fuchsteufelswild. Sie ging schneller und spürte die Stiche in der Sehne, als sie die Piazza Duomo erreichte, war sie völlig erschöpft.
Sie schickte eine Nachricht ins Büro, dass sie an diesem Tag nicht mehr reinkommen würde, dachte im Schutz der Galleria Vittorio Emanuele kurz nach und ging dann die Treppe zur U-Bahn hinunter, um an den einzigen Ort zu fahren, an dem sie gerade sein wollte. Am Ticketautomaten kaufte sie einen Fahrschein und setzte sich auf den Bahnsteig der Linie Richtung Norden. Sie zog das Buch von Irène Némirovsky hervor und legte es sich auf den Schoß. Suite française pulsierte vor Leben. Und dennoch schwang zwischen den Zeilen eine dunkle Ahnung mit, ein letzter Gesang auf das Leben, bevor Auschwitz sämtliche Träume der Autorin vernichtete. Sie stieg in die Bahn und dachte an das Telegramm, das Irène Némirovskys Mann ihrem Verleger geschickt hatte, als seine Frau von der Gendarmerie abgeholt worden war: »Irène heute plötzlich abgefahren nach Pithiviers (Loiret) – hoffe, Sie können sofort eingreifen – versuche vergeblich zu telefonieren«.
Sie hielt das Buch in den Händen, bis sie an der Station Pasteur ausstieg, wieder an die Oberfläche trat und die Straßen entlangging, in denen sie aufgewachsen war. Früher war es ein Viertel der alteingesessenen Mailänder gewesen, heute lebten hier siebenundzwanzig verschiedene Ethnien, viele Studenten, ein buntes Treiben, das sie in gute Laune versetzte. Sie schlenderte um die Ecke der Via delle Leghe mit den China-Restaurants und marokkanischen Lebensmittelläden. Hier war sie noch sie selbst gewesen, als sie vor den großen Gefühlen noch mit wenig zufrieden gewesen war. An der nächsten Ecke stand das Haus ihrer Kindheit, aus dem Milch- und Käseladen im Erdgeschoss war mittlerweile eine Bar geworden, geführt von einer tunesischen Familie, mit Illy-Caffè und schnellem Internet. Sie zog den Haustürschlüssel hervor, klingelte dann doch zweimal und rief in die krächzende Gegensprechanlage: »Ich bin’s.«
»Ich?«
»Deine Tochter.«
Sie drückte die Haustür auf und stieg die Treppe hinauf, auf dem ersten Absatz wartete schon ihre Mutter: »Was ist passiert.«
»War der Typ mit der Therme da?«
»Lenk nicht ab.«
»Kann ich denn nicht einfach meine Mutter besuchen? Was ist jetzt mit der Therme?«
Ihre Mutter zog eine Grimasse: »Eine De-kom-pres-sion«, sie betonte jede Silbe. »Das Ausdehnungsgefäß war leer.«
Sie küsste sie auf die Wange, ihre Mutter gehörte zu den Frauen, die nach Oil of Olaz dufteten. Sie war sehr klein und schaute die Leute immer von unten her an. »Hast du Hunger?«
Margherita ging ins Wohnzimmer. Der Sessel ihres Vaters war vom Bücherregal weggeschoben, auf dem Fernseher lief stumm Rai Uno.
»Dann mal raus mit der Sprache, mein Schatz.«
»Ich wollte mir nur eine kurze Auszeit bei dir nehmen.«
»Wie Churchill, der sich mitten im Zweiten Weltkrieg einen Tag Urlaub nimmt.« Sie setzte sich neben sie. Und verstummte, sobald sie begriff, dass ihre Tochter unter Herzschmerz litt. Als Kind hatte sie Margherita in schwierigen Momenten manchmal auf den Kopf geküsst, doch seit diese verheiratet war, bemühte sie sich um eine bewusstere Nähe, blieb bei ihr sitzen, richtete ihr den Kragen, fuhr ihr mit dem Handrücken über den Mantel.
Sie nahm ihr die Némirovsky aus der Hand. »Weißt du, mein Schatz, dir kann ich es ja sagen: Ich lese nicht mehr so viel wie früher.« Sie wies auf das Bücherregal. »Ich habe festgestellt, dass die Ehe der Grund war, weswegen ich gelesen habe.«
»Hast du dich mit Papa so gelangweilt?«
»Im Gegenteil, das Lesen war für mich eine Art Resonanzraum.« Sie schob ihr die Haare aus der Stirn. »Wenn du mir nicht verraten willst, was du hast, werde ich dir sagen, was los ist.«
»Nichts ist los, das hab ich doch schon gesagt.«
»Wenn ich von Pannella träume, muss etwas passiert sein.«
»Mama!« Margherita musste unwillkürlich schmunzeln. »Was hast du nur immer mit der Politik?«
»Ich habe mit einem Berlusconi-Wähler zusammengelebt. Weißt du, was er geantwortet hat, als ich ihn nach seinen Gründen gefragt habe?«
»Was denn?«
»Ich wähle Silvio wegen Drive In.«
»Wegen der Fernsehshow? Wegen Titten und Ärschen?«
»Wegen der Leichtigkeit, mein Schatz«, sie lehnte sich im Sofa zurück, »und du musst zugeben, Titten und Ärsche können wirklich ein netter Zeitvertreib sein.«
»Lassen wir das.«