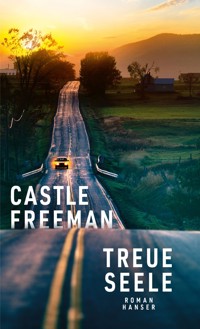
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Das Wunderbare an Castle Freemans Geschichten vom Lande ist die Lakonik, mit der sie erzählt werden.“ (Deutschlandfunk) – Ein neuer Roman mit Sheriff Wing Connie Bennett macht sich nicht viel aus dem zugezogenen Eigenbrötler Port Conway. Dass ihr Mann Cliff ausgerechnet mit ihm befreundet sein muss – sei’s drum. Doch als ihre verboten schöne Halbschwester Lucy zu ihr und Cliff zieht und dem ganzen County – einschließlich Port – den Kopf verdreht, gerät so einiges aus den Fugen. Denn Lucy lässt sich nicht reinreden, schon gar nicht bei den Männern. Mit gewohnter Lakonie und einer großen Portion Ironie erzählt Castle Freeman von einer Hochzeit mit Hindernissen im hinterwäldlerischen Vermont. Bis zum Altar ist es weit und Sheriff Wing muss mehr als einmal die Ordnung wiederherstellen – auf seine Art natürlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
"Das Wunderbare an Castle Freemans Geschichten vom Lande ist die Lakonik, mit der sie erzählt werden.« (Deutschlandfunk) — Ein neuer Roman mit Sheriff WingConnie Bennett macht sich nicht viel aus dem zugezogenen Eigenbrötler Port Conway. Dass ihr Mann Cliff ausgerechnet mit ihm befreundet sein muss — sei’s drum. Doch als ihre verboten schöne Halbschwester Lucy zu ihr und Cliff zieht und dem ganzen County — einschließlich Port — den Kopf verdreht, gerät so einiges aus den Fugen. Denn Lucy lässt sich nicht reinreden, schon gar nicht bei den Männern. Mit gewohnter Lakonie und einer großen Portion Ironie erzählt Castle Freeman von einer Hochzeit mit Hindernissen im hinterwäldlerischen Vermont. Bis zum Altar ist es weit und Sheriff Wing muss mehr als einmal die Ordnung wiederherstellen — auf seine Art natürlich.
Castle Freeman
Treue Seele
Roman
Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren
Hanser
Lass mich von keinen Hindernissen wissen,
Die treuer Seelen Ehebund bedräun!
Lieb’ ist nicht Liebe, wenn sie Störer stören,
Wenn sie Zerstreuung irrend kann zerstreun.
O nein! Sie ist ein ewig sichres Ziel,
Thront unerschüttert über Sturmeswogen;
Ein Angelstern für jeden irren Kiel;
Kein Höhenmaß hat seinen Wert erwogen.
Lieb’ ist kein Narr der Zeit, ob Rosenwangen
Auch ihrer Sichel krumme Schneid’ umspannt:
In enger Stunden Lauf uneingefangen
Beharrt sie bis an Weltgerichtes Rand.
Wenn dies als Wahn, als Lüge sich ergibt,
So schrieb ich nie, so hat kein Mensch geliebt.
William Shakespeare: Sonett 116
»Aber ich will doch nicht unter Verrückte gehen!«, widersprach Alice.
»Ach, dagegen lässt sich nichts machen«, sagte die Katze; »hier sind alle verrückt. Ich bin verrückt. Du bist verrückt.«
»Woher weißt du denn, dass ich verrückt bin?«, fragte Alice.
»Musst du ja sein«, sagte die Katze, »sonst wärst du doch gar nicht hier.«
Lewis Carroll: Alice im Wunderland
Prolog
Es kamen noch immer welche. Oder versuchten es jedenfalls. Harlan und Millie Burnside hatten an der Tür ein paar Freunde getroffen und protzten mit ihrem geschniegelten New Yorker Sohn. Die nächsten mussten warten, bis sie die Tür freimachten, was sie dann auch taten. In der ersten Reihe hatte Connie sich umgedreht, um die Eintreffenden in Augenschein zu nehmen. Ebenfalls in der ersten Reihe, aber jenseits des Mittelgangs, saßen unser doppelläufiger Gast Miss Cheever-Conway, ihr Bruder (wenn es denn ihr Bruder war) und die beiden Omars. Miss Cheever-Conway musterte alles mit einem taxierenden Blick, dem nicht viel entging, und war von dem, was sie sah, keineswegs sonderlich beeindruckt.
Ich öffnete die Tür der Sakristei einen Spaltbreit und spähte hinaus. Hinter mir sprach Port mit dem Pfarrer, dem jungen Mr. Hescock, der mit seiner Familie gerade durch den Westen gereist war und Port nun vom Hoover-Damm erzählte. »In diesem Damm sind fast drei Millionen Kubikmeter Beton verbaut«, sagte er. »Das würde für eine zweispurige Straße von New York nach San Francisco reichen.« Port nickte. Er nickte und sah den jungen Pfarrer an, als dürfte er keines seiner Worte verpassen, als würde er, Port, darüber nachdenken, wie er Lucy in den Wagen werfen und sofort und auf dem schnellsten Weg mit ihr von hier verschwinden könnte.
Der Pfarrer erzählte vom Hoover-Damm in der Hoffnung, Port von der bevorstehenden Zeremonie abzulenken und ihn zu beruhigen. Port war nervös. Wenn man in dem Alter, in dem Port ist — um die sechzig —, zum ersten Mal heiratet, sollte man schon ein bisschen nervös sein. Ich selbst war auch ein bisschen nervös. Ich spähte durch den Türspalt auf die Bänke und die Gemeinde, die sich in der kleinen Kirche versammelt hatte.
Connie sah wieder nach vorn, bemerkte mich und nickte. Man war so weit. Alle hatten Platz genommen, es war still geworden, und es kamen auch keine Nachzügler mehr. Links von der Kanzel saß Evelyn, die Organistin, und ging ihre Noten durch. Ich sah zur Tür. Draußen, im Sonnenlicht, kam Lucy in ihrem weißen Kleid über den grünen Rasen und schob ihren Vater im Rollstuhl vor sich her. Der Alte trug einen blauen Anzug mit einer weißen Blume im Knopfloch. Wo in aller Welt hatte Connie diesen Anzug aufgetrieben? Arthur sah wie ein Bestattungsunternehmer und zugleich wie sein Kunde aus.
Evelyn nahm die Brille ab, putzte sie mit einem Zipfel ihres Kleids, setzte sie wieder auf und begann zu spielen. Und los. Die Kirche war zu zwei Dritteln gefüllt, etwa fünfundsiebzig Leute. Ich schloss die Tür und drehte mich zu Port und Pfarrer Hescock um.
»Ich glaube, man ist so weit«, sagte ich.
»Na dann«, sagte der Pfarrer. »Ich gehe vor. Sie warten ein bisschen und kommen dann nach.«
»Wie lange soll ich warten?«, fragte Port.
»Zählen Sie bis zehn.«
TEIL EINS
1990
1. Die Zählung des Volkes
(Auf jeden Fall blau)
März. Die Sonne gewinnt an Höhe. Sie erreicht die Tagundnachtgleiche, steigt höher, wird stärker. Die Winde werden sanfter. Das Land wird sanfter. Es seufzt. Es belebt sich. Überall das Geräusch von rinnendem Wasser. Überall das Rutschen, Platschen, Mahlen großer Räder, die sich aufs Neue im herrlichen, allgegenwärtigen Matsch drehen.
Mit diesem Jahr beginnt ein neues Jahrzehnt. Zehn Jahre. Männer und Frauen, Veteranen und blutige Anfänger, schwärmen aus, um das Volk und seine Stämme zu zählen. Sie sind Volkszähler. Leichte Arbeit, sollte man meinen. Ja, manchmal ist sie leicht. Manchmal aber auch nicht.
Porter Conway ist kein blutiger Anfänger. Er hat schon einiges auf dem Tacho. Nicht so viel, dass man ihn hinter dem Schuppen auf Hohlblocksteinen aufbocken oder zum Hühnerstall umfunktionieren würde, aber eben doch so einiges. Ein Mann mit Erfahrung. (Na ja, in manchen Dingen.) Er hat schon in anderen, weit entfernten Bundesstaaten gezählt, wo es viele Menschen gibt. Dieses Jahr arbeitet er in dem kleinen Bundesstaat Vermont, wo er sein Alter verbringen will. Es ist ein landwirtschaftlich geprägter Staat, wo es fast gar keine Menschen gibt. Das müsste das Zählen umso leichter machen, doch das tut es nicht. Im Gegenteil, findet Conway. Je kleiner die Zahl, desto schwieriger ist das Zählen. Warum?
Er fuhr mit seinem alten Pickup auf dem zerfurchten Feldweg und hielt schlingernd neben einem noch älteren Pickup vor einem ungestrichenen Haus von der Farbe schmutzigen alten Schnees. Links vom Haus stand ein langer dunkler Wellblechschuppen, in dem man eine Bandsäge erkennen konnte, rechts war ein Maschendrahtzaun.
Conway blinzelte. Ein Maschendrahtzaun konnte nur eines bedeuten. Als er den Motor abstellte, hörte er den Hund. Er öffnete die Fahrertür und stieg in den Matsch.
Jetzt konnte er den Hund sehen. Er war hinter dem Zaun, lief laut bellend auf und ab, fixierte ihn mit wütenden, blutunterlaufenen Augen und sah aus, als würde er etwa so viel wiegen wie Conway — ein Killerhund, tödlich für Postboten und Paketausträger. Aber besonders tödlich für Volkszähler. Postboten und Heizöllieferanten kamen so oft, dass sogar ein hirnloses Vieh wie dieses Monster sich irgendwann daran gewöhnte und sie durchließ. Der Volkszähler kam alle zehn Jahre und wurde nie durchgelassen. Andererseits: In zehn Jahren war diese Bestie wahrscheinlich tot. Man durfte die Hoffnung nicht aufgeben.
Conway beugte sich wieder ins Fahrerhaus, griff nach der Erkennungsmarke mit dem langen Band und hängte sie sich um den Hals. Er nahm den Aktenordner, das Klemmbrett, die Lesebrille und zuletzt eine große Dose Desinfektionsspray, die er in die Jackentasche steckte. Nein, Conway war kein Anfänger, er wusste, worauf es ankam, und hatte, was er brauchte.
Er wandte sich zum Haus. Trotz des bellenden Hundes zeigte sich niemand. Conway ging die drei Holzstufen zur Vorderveranda hinauf und klopfte. Er wartete. Kurz darauf wurde die Tür von einem Mädchen geöffnet, vierzehn, fünfzehn Jahre alt, blond, hübsch, noch nicht ganz ohne Babyspeck, aber mit einem ernsten, unverwandten Blick, der nicht zu ihrem Alter passte.
»Ja?«, fragte sie.
»Ich bin Port Conway. Ich komme wegen der Volkszählung. Wohnst du hier?«
Das Mädchen nickte.
»Ist deine Mutter oder dein Vater zu Hause?«
»Mein Vater.«
»Kann ich ihn sprechen?«, fragte Conway. »Ich hab ein paar Fragen. Es ist wegen der Volkszählung. Für das Statistikamt. Du weißt schon, die Bundesbehörde? Es wird nur zehn Minuten dauern.«
»Nein, wird es nicht«, sagte das Mädchen.
»Wird es nicht?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Warten Sie hier.«
Sie ging hinein. Conway stand auf der Veranda und wartete. Eine Schönheit. Eine kleine Hinterwaldschönheit. Blaue Augen? Was machte sie hier? Der Hund war endlich still. Conway hoffte, dass er noch immer hinter dem Zaun war. Wenn so einer aufhörte zu bellen, kam er vielleicht gerade von hinten. Blaue Augen? Grün? Braun?
Das Mädchen kam wieder an die Tür, gefolgt von einem großen Mann, ein paar Jahre älter als Conway. Er hatte graue Bartstoppeln und einen dicken, harten Bauch. Conway kannte ihn; jedenfalls hatte er ihn schon mal gesehen. Seinen Namen kannte er nicht. Der Mann schob das Mädchen beiseite und baute sich einen halben Meter vor Conway auf.
»Was?«, sagte er.
»Ich bin Porter Conway«, begann Conway, aber —
»Ich weiß, wer Sie sind«, sagte der Mann. Seine Tochter stand hinter ihm im Haus.
»Ich komme wegen der Volkszählung«, fuhr Conway fort.
»Keine Volkszählung«, sagte der Mann.
»Wie bitte?«
»Ich sagte: keine Volkszählung. Keine Schnüffler. Keine Regierungsspitzel.«
»Ich bin kein Schnüffler, Mr. …«, sagte Conway. »Sie sind Mr. ..?«
Der Mann zeigte auf ein Schild, das am Dach des Schuppens hing. Conway las:
A. S. BENNETT & CO.
HOLZ
»Ich bin kein Schnüffler, Mr. Bennett«, sagte Conway. »Ich muss Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Sechs Fragen. Es dauert nur ein paar Minuten.«
»Mir ist egal, was Sie müssen«, sagte Bennett. »Ich will, dass Sie verschwinden. Wissen Sie was: Treiben Sie doch eine schwarze Familie auf. Die können Sie dann zählen. Drüben in Grafton wohnen ein paar. Fahren Sie hin. Treiben Sie ein paar Nigger auf. Oder Mexikaner. Oder Chinesen. Oder irgendwelche Kanaken. Kameltreiber. Araber. Treiben Sie ein paar Araber auf und zählen Sie die. Zählen Sie sie drei-, viermal, na los. Wir beide wissen doch, dass es das ist, was Sie hier tun — also tun Sie’s.«
»Was ist denn das, von dem wir beide wissen, dass ich es hier tue?«
»Sie wollen beweisen, dass es mehr von denen gibt als von uns«, sagte Bennett. »Und das stimmt wahrscheinlich sogar, aber nicht hier. Noch nicht. Bei Gott, noch nicht.«
»Ich will gar nichts beweisen, Mr. Bennett«, sagte Conway. »Sie sollten sich nicht so aufregen, sonst platzt Ihnen noch eine Ader. Ich will hier nur was erledigen. Es ist ziemlich einfach und dauert nicht lange. Aber es muss nicht jetzt gleich sein — ich kann auch ein andermal kommen, wenn es Ihnen besser passt. Was wäre eine gute Zeit?«
»Für Sie gibt’s keine gute Zeit«, sagte Bennett. »Sie drehen sich jetzt um, steigen in Ihren Wagen und schaffen Ihren Schnüfflerarsch von meinem Grundstück. Ich muss Ihnen keine Fragen beantworten.« Sein großes Gesicht hatte sich gerötet.
»Genau genommen schon«, sagte Conway. Er schwenkte die Erkennungsmarke, die an dem Band um seinen Hals hing. »Handelsministerium der Vereinigten Staaten«, sagte er. »Abteilung für Volkszählung. Ich bin ein Volkszähler im Auftrag des Handelsministeriums, das wiederum zur Bundesregierung gehört. Sie haben sicher mal davon gehört. Von der Bundesregierung, meine ich.«
»Hab ich«, sagte Bennett.
»Und Bundesregierung heißt: das Gesetz, Mr. Bennett, verstehen Sie?«, fuhr Conway fort. »Das allgemeine, für alle geltende Gesetz. Ich habe sechs Fragen. Ich komme nicht darum herum, sie zu stellen. Sie kommen nicht darum herum, sie zu beantworten.«
»Quatsch«, sagte Bennett. »Ich kann bei Gott tun, was ich will. Ich kann zum Beispiel das Tor da aufmachen und den Hund auf Sie loslassen. Das kann ich.«
»Aber das wollen Sie nicht«, sagte Conway.
»Ach, nein? Und warum nicht?«
Conway zog das Desinfektionsspray aus der Tasche, zeigte es Bennett und schüttelte es. »Wenn Sie das tun«, sagte er, »haben Sie einen blinden Hund. Den blinden Hund kriegen Sie sofort. Der Sheriff und seine Deputies sind noch vor dem Abendessen hier. Und bis zum Wochenende müsste dann auch die Klage zugestellt sein.«
»Scheiß drauf«, sagte Bennett. Sein Gesicht war jetzt dunkelrot. Seine rechte Augenbraue zuckte. Conway sah von ihm zu seiner Tochter. War in diesen jungen Augen eine ganz kurze, ganz zarte Andeutung eines Lächelns? Sie verschwand im Haus. Blau. Auf jeden Fall blau.
»Glauben Sie, Sie können mir Angst machen?«, sagte Bennett. »Sie machen mir keine Angst. Ich weiß, was Sie sind. Ich kenne euch Regierungsschnüffler, ich weiß, wie ihr tickt. Ihr seid allesamt schwul, allesamt Schwuchteln. Ihr macht mir keine Angst. Ich scheiße auf euch und eure Volkszählung! Verpiss dich!« Und damit trat er ins Haus und knallte die Tür zu.
Conway schüttelte den Kopf. Noch ein Philosoph. Er steckte die Spraydose ein, ging die Treppe hinunter und stieg in seinen Pickup. Dann ließ er den Motor an, wendete und fuhr den Feldweg zurück zur Straße. Hinter einer Biegung erwartete ihn das Mädchen. Conway hielt an und kurbelte das Fenster hinunter.
»Miss Bennett«, sagte er.
Sie stand neben dem Fenster. »Wie bitte?«, sagte sie.
»Mach dir deswegen keine Sorgen«, sagte er. »So was passiert. Es ist nicht deine Schuld. Du solltest dir keine Gedanken machen.«
»Ich mache mir keine Gedanken«, sagte sie. »Ich hab Ihnen ja gesagt, dass es keine zehn Minuten dauern wird.«
Conway lächelte. »Stimmt«, sagte er.
»Sie sind ein Freund von Cliff«, sagte sie.
Conway sah sie an. »Ja«, sagte er. »Woher kennst du ihn?«
»Er ist mein Onkel. Irgendwie.« Sie sah ins Fahrerhaus des Pickups und wies mit dem Kinn auf die Spraydose, die er auf die Sitzbank gelegt hatte.
»Hätten Sie Spike wirklich damit eingesprüht?«, fragte sie.
»Wenn ich gemusst hätte.«
»Und kommen Sie wirklich mit den Deputies?«
»Ich hoffe nicht«, sagte Conway.
»Das würde ihn sauer machen.«
»Vielleicht komme ich in zehn Jahren noch mal«, sagte Conway. »Wie wäre das?«
»In zehn Jahren?«
»Alle zehn Jahre ist es so weit, dann zählen wir.«
»Das weiß ich«, sagte sie. »Und die Deputies?«
»Deputies?«
»Sie haben gesagt, die Deputies würden kommen.«
»Ich hab nur geblufft«, sagte er. »Es werden keine kommen. Hier.« Er klappte einen Block auf und riss ein Formular heraus. »Da stehen mein Name und meine Telefonnummer. Nimm das und gib es deinem Vater. Sag ihm, er soll mich anrufen, wenn es ihm wieder bessergeht, dann schaue ich noch mal vorbei.«
»Wie bitte?«, sagte sie. »Wieder bessergeht?«
»Oder warte«, sagte Conway. »Ich kann ja auch dich befragen. Du kannst mir alles sagen, was ich wissen muss. Dann brauche ich nicht noch mal zu kommen. Würdest du das tun?«
»Wie meinen Sie das: wenn es ihm wieder bessergeht?«
»Deinem Vater«, sagte er. »Ich dachte, er kriegt einen Anfall.«
»Was für einen Anfall?«
»Einen Schlaganfall.«
»Ach so«, sagte sie. »Na und? Pop hat eben einen klaren Standpunkt.«
»Das ist offensichtlich.«
»Er weiß eine Menge.«
»Das ist nicht so offensichtlich.«
»Er hat jedenfalls ein Recht auf seine Meinung.«
»Absolut«, sagte Conway. »Ein gottgegebenes Recht. Er hat auch das Recht, ein unsympathischer, ungehobelter Volltrottel zu sein. Jedes Recht der Welt.«
»Er ist kein Volltrottel«, sagte sie.
»Nein?«
»Nein«, sagte sie. »Und was Sie angeht, hat er recht. Ich glaube Ihnen nicht. Sie kommen hierher mit Ihrem Zeug und Ihrem blöden Abzeichen. Abteilung für irgendwas. Sie denken, Sie sind was Wichtiges. Aber Pop hat recht — Sie sind … Sie sind …«
»Ja, Miss Bennett?«
Sie gab keine Antwort, sondern warf das Formular, das er ihr gegeben hatte, durch das Fenster. Es flatterte gegen seine Brust und landete auf seinem Schoß. Sie trat vom Wagen zurück und ging zurück zum Haus, blieb aber stehen, drehte sich um und hob die rechte Hand mit dem gestreckten Mittelfinger. Dann drehte sie sich wieder um und stapfte den Feldweg entlang.
Charmant, dachte Conway. Wirklich charmant. Prima Nachwuchs. Er setzte den Wagen in Bewegung und fuhr weiter. Wer ist sie? Ihren Vater hatte er erkannt, aber sie war ihm neu. Auf Jugendliche achtete er nicht besonders. Warum auch? Aber die hier war neu. Cliff hatte nie irgendwas von einer Nichte gesagt. Aber wer immer sie war — sie hatte ihn beeindruckt. Wie alt war sie wohl? Dreizehn? Vierzehn? Das wäre dann also die achte Klasse. Wahrscheinlich brachte sie schon die nicht mehr so kleinen Jungs um den Verstand. In ein paar Jahren würde es wehtun, sie anzusehen. Aber sie saß hier fest, in diesem Loch. In dieser Hinterwaldbruchbude. Eine Blume — ein Krokus, eine Lilie im Schlamm.
Conway fuhr dahin, schüttelte den Kopf und führte Selbstgespräche. Siehe: ein törichtes, einsames, ungeübtes Herz.
2. Lucy
»Onkel?«, fragte ich Port.
»Das hat sie gesagt.«
»Ich bin nicht ihr Onkel«, sagte ich. »Ich bin ihr Schwager, ob du es glaubst oder nicht. Willst du einen Kaffee? Ein Bier?«
»Bier«, sagte Port. »Lass uns das gemästete Kalb schlachten.«
»Zwei Bier«, sagte ich, ging in die Küche und nahm sie aus dem Kühlschrank. Als ich auf die Veranda zurückkehrte, hatte Port sich gesetzt und die Füße auf das Geländer gelegt. Ich stellte eine Flasche auf die Armlehne seines Stuhls und setzte mich auf den Stuhl links von ihm.
Wir tranken. Man spürte die Frühlingssonne und ihre Wärme, auch wenn vor dem Haus noch ein Streifen schmutziger Schnee lag, der vom Dach gerutscht war.
»Sie ist Constances Schwester?«, fragte Port.
»Halbschwester.«
»Jünger«, sagte Port.
»Viel jünger.«
Eine große Hornisse wollte auch ein bisschen die Sonne genießen. Sie landete auf der Armlehne von Ports Stuhl und krabbelte herum. Port schnippte sie mit dem Finger weg, und sie flog davon.
»Das war eine Hornisse«, sagte ich. »Warum hast du sie nicht erschlagen? Die stechen.«
»Mich hat sie nicht gestochen.«
»Ich hoffe, sie tut’s noch«, sagte ich. »Ich hoffe, sie kommt zurück und sticht dich in den Hintern. Das würde dir recht geschehen. Das nächste Mal erschlägst du sie.«
»So viel Gewalt«, sagte Port.
»Du hast leicht reden«, sagte ich. »Du wohnst ja nicht hier. Du gehst nach Hause, aber die Hornisse bleibt hier, und jetzt ist sie sauer. Wen wird sie wohl stechen? Dich nicht. Du bist schon längst weg. Ich finde das unverantwortlich.«
»Dann ist der Alte also dein Schwiegervater«, sagte Port.
»Wer?«
»Der nette ältere Herr mit der Bandsäge. Der Vater des Mädchens.«
»Arthur«, sagte ich. »Pop.«
»Sieht so aus, als wäre er dein Schwiegervater.«
»Sieht so aus, ja.«
»Gratuliere.«
»Danke.«
»War er schon immer so?«
»Im Großen und Ganzen ja.«
»Und dieses Mädchen und Constance sind Halbschwestern«, fuhr Port fort. »Man fragt sich, wie er zwei verschiedene Frauen dazu gekriegt hat, ihn zu heiraten.«
»Hat er nicht«, sagte ich. »Er hat Connies Mom geheiratet. Sie ist gestorben, als Connie noch klein war. Arthur hat Connie größtenteils bei ihren Tanten aufwachsen lassen. Die andere, spätere, hat er nicht geheiratet. Das Blumenkind, die Hippiebraut. ›Miss Moonbeam‹ hat Connie sie genannt. Sie hat ihn verlassen und ist nach Westen gegangen.«
»Warum nur?«, sagte Port.
»Damit waren Arthur und die Kleine auf sich gestellt.«
»Was war mit Constances Tanten? Warum haben die sie nicht genommen?«
»Sie gehörte nicht zu ihrer Familie«, sagte ich. »Außerdem waren sie zu diesem Zeitpunkt schon alt. Jedenfalls geht’s dem Mädchen gut. Arthur tut sein Bestes.«
»Wenn du das sagst.«
»Wie es aussieht, habt ihr euch nicht auf Anhieb verstanden«, sagte ich. »Er hat sich richtig in dich verbissen, was?«
»Redest du von seinem Hund?«
»Was für ein Hund? Du meinst Spike? Der alte Spike ist immer noch da?«
»Ein Mastiff? Nicht übermäßig freundlich? Ungefähr so groß wie ein Kalb?«
»Das ist Spike«, sagte ich. »Er muss jetzt an die zwanzig Jahre alt sein. Der würde dich nicht beißen. Wahrscheinlich hat er gar keine Zähne mehr. Nein, ich meine Arthur.«
»Er war unkooperativ.«
»Was du nicht sagst.«
»Das ist nicht so ungewöhnlich«, sagte Port. »Volkszähler haben irgendwas an sich, was die Leute auf die Palme bringt. Leute, die denken, dass sie denken. Leute mit Überzeugungen. Mit Prinzipen. Politischen Prinzipien. Ich hasse Leute mit politischen Prinzipien. Denen kann man nicht trauen. Die sind nicht glücklich. Nie. Die regen sich auf. Bei der letzten Volkszählung haben sie mich in Texas eingesetzt. Ich hab an eine Tür geklopft, und der Typ hat mir eine Schrotflinte unter die Nase gehalten.«
»Und was hast du gemacht?«
»Ich hab vernünftig mit ihm geredet«, sagte Port. »Er hat’s schließlich eingesehen. Aber der war mir lieber als Arthur Bennett.«
»Du machst Witze.«
»Ganz und gar nicht.«
»Arthur ist harmlos«, sagte ich.
»Nein, ist er nicht«, sagte Port. »Verstehst du nicht? Einer, der dir eine Flinte unter die Nase hält, will nur angeben.«
»Das hofft man jedenfalls«, sagte ich.
»Das ist so«, sagte Port. »In neunundneunzig von hundert Fällen will er dir bloß zeigen, was für tolle Prinzipien er hat. Es ist wie ein Spiel. Er wird dich nicht erschießen. Und wenn doch — tja, Tod durch Schrotflinte? Das geht immerhin schnell. Aber Leute wie dein Schwiegervater mit seiner Politik, seinen Ideen, seinen Prinzipien können einen leicht zu Tode langweilen. Und Tod durch Langeweile ist langsam und qualvoll.«
»Ach, komm«, sagte ich. »Du würdest lieber erschossen als gelangweilt werden?«
»Viel lieber.«
»Du bist ein richtiger Teufelskerl, was?«
»Wie wir wissen«, sagte Port.
»Willst du noch eins?«
»Nein«, sagte Port. »Nein, danke. Ich fahre nach Hause.«
»Warum?«
»Constance kommt gleich, und sie will mich nicht sehen. Und außerdem will ich die Nachrichten nicht verpassen.«
»Die kannst du auch hier sehen.«
»Würdest du dir die Nachrichten ansehen, wenn ich nicht da wäre?«, fragte Port.
»Nein.«
»Oder Constance?«
»Nein.«
»Das heißt, ich fahre.« Port stellte die leere Bierflasche auf die Armlehne seines Stuhls. »Sie hat mir da draußen ganz schön die Meinung gesagt.«
»Wer?«, fragte ich.
»Deine kleine Schwägerin.«
»Kann ich mir vorstellen«, sagte ich. »Die ist nicht auf den Mund gefallen.«
»Kann man wohl sagen. Und bildhübsch, oder? Oder bald jedenfalls. Nicht mehr lange, und man muss eine Schutzbrille aufsetzen, wenn man sie ansieht. Wie alt ist sie?«
»Wie alt? Nicht alt genug.« Ich sah Port an. »Pass bloß auf, mein Lieber, pass bloß auf. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du das? Du sitzt ganz allein in diesem heruntergekommenen alten Kasten und denkst dir irgendwelches Zeug aus. Falsches Zeug. Zum Beispiel über die kleine Lucy. Pass auf. In diesem Land verschwinden Tausende Typen, die genauso schlau sind wie du, für Jahre im Knast, weil sie sich mit einer Person in Lucys Alter eingelassen haben.«
»Du machst dir zu viele Sorgen«, sagte Port. »Sie bedeutet mir nichts. Wofür hältst du mich? Für einen depravierten Pädophilen? Ich bin gekränkt.«
»Einen was?«
»Einen Kinderschänder«, sagte Port.
»Und was ist der?«
»Depraviert«, sagte Port.
»Depraviert?«
»Schmutzig, verkommen, minderwertig«, sagte Port.
»Nein«, sagte ich. »Ich weiß, dass du nicht minderwertig bist. Ich wollte es nur gesagt haben.«
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Port und stand auf.
»Gut, mache ich nicht«, sagte ich. »Wir sehen uns.«
»Genau«, sagte Port. Er ging die Treppe hinunter. Ich saß da und trank mein Bier aus. Port ging zu seinem Pickup, blieb stehen und drehte sich noch mal um.
»Lucy, hast du gesagt? Sie heißt Lucy?«
»Lucy«, sagte ich.
3. Unter dem Bett
Lucy. Eigentlich Lucinda. Nach ihrer Mutter benannt, aber warum? Die Welt brauchte nicht zwei von dieser Sorte. Unser Vater? Was kümmerte es ihn, welchen Namen sie hatte? Er hatte für Namen keine Verwendung. Hör auf damit. Komm her. Mach den Abwasch. Mehr brauchte er nicht. Pop. Bei Pop musste man immer arbeiten. Für mich war es wahrscheinlich leichter wegen meiner Mutter, jedenfalls als sie noch lebte. Gegenüber mir war er nachsichtiger, wahrscheinlich wegen ihr. Und später, weil ich so viel älter war. Für Lucy galt das nicht. Bei Pop leben? In der Sägemühle? Da muss man hellwach sein. Man muss besondere Kräfte haben. Man muss wissen, wann man unsichtbar zu sein hat. Man ist wie ein Kind in einem Märchen, das in der Höhle eines Riesen lebt: Man verbringt einen großen Teil der Zeit unter dem Bett. Gott weiß, wie viel Zeit ich dort verbracht habe, und Lucy ebenso. Aber sie wahrscheinlich mehr als ich.
Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir sprechen nicht über Pop. Wir sprechen überhaupt nicht viel über irgendwas. Wir sind uns nicht nah. Oder doch, irgendwie. Wir sind in der Nähe, aber wir sind uns nicht nah. Cliff steht ihr näher. Er kann mit ihr reden, manchmal jedenfalls. Wenn irgendeiner mit ihr reden kann, dann er. Ich nicht. Ich bin so viel älter. Ich könnte ihre Mutter sein. (Wahrscheinlich bin ich so was wie ihre Mutter. Wenn ja, ist sie die Einzige, deren Mutter ich bin, so viel ist sicher.) Aber sie will keine Mutter. Sie hat einen Elternteil, und wenn es sich bei diesem Elternteil um Pop handelt, dann ist einer genug.
Manchmal tut sie mir leid, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Sie wird ihren Weg gehen. Das kann man jetzt schon erkennen, obwohl sie noch so jung ist. Cliff sagt, Lucy hat einen Willen wie zwei Meter Armierungsstahl. Kein Wunder. Wenn man unter dem Bett lebt, hat man Zeit nachzudenken. Man hat Zeit, zu Ansichten und Urteilen zu kommen. Zu unverrückbaren Urteilen. Lucys Leben und ihr Zuhause waren nie einfach. Ein ständiger Widerstand, und sie hat gelernt, ihn zu überwinden. Das musste sie. Und das ist nicht schlecht. Das ist genau das, was auch andere junge Leute hier lernen sollten, nicht nur hier, nicht nur junge Leute.
Ich finde es seltsam, dass in diesem Land, den guten alten USA, wo man den Menschen immer sagt, dass sie sein können, was immer sie wollen, so viele eigentlich gar nichts wollen. Cliff zum Beispiel. Ich habe Glück gehabt mit ihm. Das weiß ich. Cliff ist ein lieber, anständiger Mann, der gut für mich sorgt. Er ist auch intelligent, mindestens so intelligent wie sein Freund Port Conway mit seinen Geschichten und seiner Bildung, der schon überall gewesen ist und Gott weiß wo gelebt hat, und so weiter, und so weiter. Cliff treibt sich nicht herum, er geht nicht fremd, er trinkt nicht, er ist nicht gemein.
Aber genau das ist der Punkt: So viel von dem, was er ist, kommt von dem, was er nicht ist. Zum Beispiel ehrgeizig. Um es kurz zu machen: Er hat keinen Ehrgeiz. Er hat noch nie gewollt, was man wollen soll. Er hat nie mehr gewollt. Nicht dass er faul wäre. Cliff ist alles andere als faul. Er ist ein guter Arbeiter. Als er jung war, hat er im Wald gearbeitet, und später dann für Leon, als Dachdecker, Anstreicher, Betongießer. Er kann alles bauen und alles reparieren. Man muss sich sein Brot da, wo man ist, mit dem verdienen, was man kann. Das tut Cliff, und zwar ziemlich gut. Aber ich habe ihn gefragt: Was, wenn die Arbeit erledigt ist? Er arbeitet ja nicht die ganze Zeit, das tut niemand. Und man kann noch so viel anderes tun, und damit meine ich nicht fernsehen oder an irgendwas herumschnitzen. Man kann sich für wichtige Sachen engagieren, bei denen freiwillige Helfer gebraucht werden: in der Gemeinde, in der Kirche, bei den Pfadfindern, im Bauausschuss, beim Zivilschutz, bei der Feuerwehr. Könnte man doch mal probieren. Aber nein — nicht Cliff. Keine Chance. Er will nicht nur nichts damit zu tun haben, sondern hat auch nicht viel für die übrig, die da mitmachen. Es ist nicht so, dass er Autoritäten nicht respektiert. Nein, er missbilligt sie. Er misstraut ihnen. Für Cliff ist ein Stadtrat ein machtbesessener Diktator.
Nein, stimmt nicht: Cliff tut was in seiner Freizeit. Er hängt mit Port herum. Nicht viele wären auf den Gedanken gekommen, die beiden könnten gut zusammenpassen. Port ist eine Art Einsiedler. Nein, er ist wie ein Bär: Man weiß, dass er irgendwo da oben im Wald ist. Er ist immer in der Gegend, aber man trifft ihn nur selten. Er bleibt für sich. Man sieht ihn vielleicht alle paar Jahre mal.
Was Cliff und Port zu bereden haben, weiß ich nicht, aber sie reden. Und sie lachen. Sie sind wie Enten auf einem Teich: quak-quak-quak, den ganzen Tag. Wie können Männer, die sonst nicht viel sagen, so viel reden? Port redet wahrscheinlich mehr als Cliff, da möchte ich wetten. Er ist voller Geschichten (und die meisten davon sind nichts weiter als Geschichten, wenn Sie mich fragen), Geschichten, denen man entnehmen kann, wie weit er herumgekommen ist, wie viel er gesehen hat und wie viel er weiß — wie viel mehr als man selbst zum Beispiel. Port schwingt Reden. Und die Sache ist: Bei jedem anderen würde Cliff sich daran stören. Jeden anderen würde Cliff verachten, aber nicht Port. Er hört sich diese Geschichten gern an. Er saugt sie praktisch auf. Ich weiß nicht, warum.
Cliff sagt, ich mag Port nicht, aber das stimmt eigentlich nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn nicht mag, aber auch nicht, dass ich ihn mag. Ich glaube, ich kenne ihn gar nicht wirklich. Sein Name zum Beispiel: Port Conway. Das klingt wie der Name eines Kaffs am Mississippi. Was ist Port? Was macht er? Er arbeitet nicht, jedenfalls nicht dass ich oder irgendjemand sonst wüsste. (Mit Ausnahme seines Jobs als Volkszähler — aber das zählt nicht.) Er hat sich zur Ruhe gesetzt? Aber was hat er vorher gemacht? Er sieht nicht aus, als wäre er reich. Im Gegenteil: Ich würde sagen, er sieht ziemlich abgerissen aus. Aber hungern wird er wohl nie. Ich wette, er hat sich nach einem langen, mühevollen Leben voll Nichtstun zur Ruhe gesetzt. Und ich nehme an, »Port« ist eine Abkürzung für Portfolio. Das nehme ich an. Nicht dass es mich was angeht.
Und Pop darf man schon gar nicht mit Port kommen. Lucy hat gesagt, Pop hat Port rausgeschmissen, als der wegen der Volkszählung da war, und sich aufgeführt, als wäre Port ein Spion. Nein, Pop hält gar nichts von Port. Er denkt sogar, Port ist schwul, weil er unverheiratet ist und anscheinend keine Freundin hat und sich so gut mit Cliff versteht. Ehrlich gesagt hat Pop auch noch nie viel von Cliff gehalten. Aber Port hasst er. Andererseits: Pop hasst so ziemlich jeden, der nicht 1949 für die Red Sox gespielt hat.





























