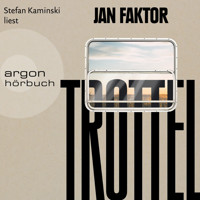12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Prager Vorhölle, einer schicksalhaften Ohnmacht, einem Sprung und dem seltsamen Trost von Chicorée. Mit »Trottel« ist Jan Faktor ein wunderbar verspielter, funkelnder, immer wieder auch düsterer, anarchischer Schelmenroman gelungen. Im Mittelpunkt: ein eigensinniger Erzähler, Schriftsteller, gebürtiger Tscheche und begnadeter Trottel, und die Erinnerung an ein Leben, in dem immer alles anders kam, als gedacht. Und so durchzieht diesen Rückblick von Beginn an auch eine dunkle Spur: die des »engelhaften« Sohnes, der mit dreiunddreißig Jahren den Suizid wählen und dessen früher Tod alles aus den Angeln heben wird. Ihren Anfang nimmt die Geschichte des Trottels dabei in Prag, nach dem sowjetischen Einmarsch. Auf den Rat einer Tante hin studiert der Jungtrottel Informatik, hält aber nicht lange durch. Dafür macht er erste groteske Erfahrungen mit der Liebe, langweilt sich in einem Büro für Lügenstatistiken und fährt schließlich Armeebrötchen aus. Nach einer denkwürdigen Begegnung mit der »Teutonenhorde«, zu der auch seine spätere Frau gehört, »emigriert« er nach Ostberlin, taucht ein in die schräge, politische Undergroundszene vom Prenzlauer Berg, gründet eine Familie, stattet seine besetzte Wohnung gegen alle Regeln der Kunst mit einer Badewanne aus, wundert sich über die »ideologisch morphinisierte« DDR, die Wende und entdeckt schließlich seine Leidenschaft für Rammstein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jan Faktor
Trottel
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jan Faktor
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jan Faktor
Jan Faktor, 1951 in Prag geboren, 1978 Übersiedlung nach Ostberlin. Arbeit als Kindergärtner und Schlosser. Entdeckt in den 80er-Jahren das »Rückläufige Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache« für die experimentelle Dichtung. Bis 1989 fast ausschließlich in der inoffiziellen Literaturszene engagiert. 1989/90 Mitbegründer der Zeitung des Neuen Forums.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Von der Prager Vorhölle, einer schicksalhaften Ohnmacht, einem Sprung und dem seltsamen Trost von Chicorée. Mit »Trottel« ist Jan Faktor ein wunderbar verspielter, funkelnder, immer wieder auch düsterer, anarchischer Schelmenroman gelungen.
Im Mittelpunkt: ein eigensinniger Erzähler, Schriftsteller, gebürtiger Tscheche und begnadeter Trottel, und die Erinnerung an ein Leben, in dem immer alles anders kam, als gedacht. Und so durchzieht diesen Rückblick von Beginn an auch eine dunkle Spur: die des »engelhaften« Sohnes, der mit dreiunddreißig Jahren den Suizid wählen und dessen früher Tod alles aus den Angeln heben wird.
Ihren Anfang nimmt die Geschichte des Trottels dabei in Prag, nach dem sowjetischen Einmarsch. Auf den Rat einer Tante hin studiert der Jungtrottel Informatik, hält aber nicht lange durch. Dafür macht er erste groteske Erfahrungen mit der Liebe, langweilt sich in einem Büro für Lügenstatistiken und fährt schließlich Armeebrötchen aus. Nach einer denkwürdigen Begegnung mit der »Teutonenhorde«, zu der auch seine spätere Frau gehört, »emigriert« er nach Ostberlin, taucht ein in die schräge, politische Undergroundszene vom Prenzlauer Berg, gründet eine Familie, stattet seine besetzte Wohnung gegen alle Regeln der Kunst mit einer Badewanne aus, wundert sich über die »ideologisch morphinisierte« DDR, die Wende und entdeckt schließlich seine Leidenschaft für Rammstein.
Inhaltsverzeichnis
Hinweise vom Autor
Widmung
Motto
Kapitel 1b [1]
Mein Gaskrieg, der Anfang [2]
Patschulischock im Anmarsch [3]
Gipsklumpen im Magen [4]
Ein gut lesbares, zugegebenermaßen hart erarbeitetes Kapitel [5]
Tektonik [6] [dieses Kapitel enthält dummerweise einige konzeptionswidrige Dialoge]
Kapitel »Œ« wie Œuvre [7]Anders: Mischkapitel Hauptwerk (HW), Beiwerk (BW) und Nebenmist (NM)
Überschrift wurschtegal, sie wird in Kürze sowieso wieder vergessen [8]
Kapitel 1a [9]
Kapitel 6++ (Alternative Lesart: »SexDoublePlus«) [10]
Siebzehnmal darfst du raten [11]
Unter wehenden FDJ-Fahnen geboren [12]
Heiße Venen [13]
Kapitel ~ 14 (etwa vierzehn) [14]
Das Fanfarenkapitel Prenzlauer B-Republik [15]
Dieses Sohn-Kapitel werde ich niemandem ersparen können, mir auch nicht [16]
Kapitel #2, das Frau-Kapitel, das diese auf gar keinen Fall lesen sollte [17]
Born to hate Alex – ungerecht sei der Mensch, liederlich und liedlos [18]
Vorsicht – hier spricht nochmal der lyrische Schweinehund des Autors [19]
Kapitel 19fff. (strukturell nicht ganz unwichtig) [20]
Die Freude, mit Freude angesehen zu werden [21]
Wie man seinen Mandanten in die Grube hinterherruft [22]
Kapitel Karpfen- und Forellenteich – Ein Ödem auf Schmetterlingsratten, Darmhornissen, Ameisenhornochsen, Augapfelwürmer und Zungenbrecher [23]
Kapitel: unweigerlich das nächste [24]
Wenn das Eisen vom Himmel regnet [25]
Folgendes hätte vielleicht auch woanders deplatziert werden können [26]
Dieses Kapitel wurde in voller Länge lediglich in einer limitierten und mit Originalgrafiken ausgestatteten Vorzugsausgabe abgedruckt [27]
Lieber ungdldger Leser: Das eigentliche Schlüsselkapitel kommt erst in Kürze [28]
Prügel für den Regelbrecher [29]
Im achtzehnten Kapitel werden in einem fiktiven Dialog fortlaufend Verse aus den Gedichten des Dichters Bert Papenfuß zitiert. Da die jeweiligen Textstellen der direkten Rede angepasst werden mussten, wurden sie zum Teil leicht paraphrasiert, manchmal auch frei fortgeführt. Um dabei die Dialogform nicht zu stören, wurden etliche dieser Zitate/Zitatfragmente nicht kursiv gesetzt. Das bedeutet, dass nicht alles, was in diesem Kapitelabschnitt von Bert Papenfuß stammt, im Text auch als Zitat erkennbar ist. Der Autor bedankt sich an dieser Stelle für die ihm in diesem Sinne erteilte Erlaubnis und vor allem für das ihm vorab entgegengebrachte Vertrauen. Auf Quellennachweise wurde in diesem Kapitelabschnitt vollständig verzichtet. Diese hätten die Lektüre des so schon etwas wirren Gesprächs nur noch zusätzlich erschwert.
Im gesamten Text werden etliche Songtitel der Band Rammstein genannt, die es gar nicht gibt – oder die etwas bzw. vollkommen anders heißen. Ähnlich unkonventionell verfährt der Text gelegentlich mit Zitaten aus den Texten der Band. Alle diese Nennungen und Zitate – ob spielerisch umgewandelt, korrekt oder angezerrt wiedergegeben – sind keine ironischen Missgriffe, es handelt sich lediglich um Anspielungen bzw. harmlose Rätsel für kundige Rammstein-Kenner.
Es handelt sich bei diesem Buch um ein fiktionales Werk. Namen, Figuren, Orte und Vorkommnisse sind entweder Erfindungen des Autors oder werden fiktiv verwandt. Alle Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Ereignissen, Örtlichkeiten, lebenden oder toten Personen wären gänzlich zufällig.
Mit Dank an Sebastian Guggolz und an meine Frau, die dieses Buch lieber nicht lesen sollte.
Was ist der Grund für meine gute Laune?
Einfach alles.
Kapitel 1b [1]
Die stille Frage meiner Jugend lautete, ob ein Trottel im Leben glücklich werden kann. Und im Grunde war es keine Frage. Um mich herum gab es viele Menschen, die versuchten, mir dies und jenes einzureden – wortlos, versteht sich, einfach durch den Membranendruck ihrer Zuneigung. Sie kannten mich aber nicht, sahen nur meine gesunde Oberfläche. Für mich war meine zukünftige Glücklosigkeit dagegen leicht vorauszusehen. Ich bin als ein Trottel auf die Welt gekommen, bin wie ein Trottel aufgewachsen und musste folgerichtig einer bleiben – zu retten oder gutzureden war da nichts. Gequält bis in die Tiefen meiner auf Dauer erigierten Riechzentralen dachte ich eine ganze Ewigkeit, dass ich die Scham über meine allumfassenden Unzulänglichkeiten nicht überleben werde. Überraschenderweise kam alles anders. Ich habe inzwischen konstant gute Laune, wobei ich mich mitunter unsympathisch finde, wenn ich mich unerwartet in einer Spiegelfläche erwische. Und flüchte gelegentlich vor schlecht gelaunten Individuen, die mein etwas motivloses Innenstrahlen missverstehen könnten. Leider begeben sich viele Menschen Tag für Tag in die Öffentlichkeit, egal wie viele Sorgen um die Gegenwart oder Zukunft[1] sie sich gerade machen. Ich für meinen Teil bin auf den Bürgersteigen unserer Städte eher auf der Suche nach noch mehr Freude, nach dampfendem Optimismus oder einfach spendablem Wohlwollen. Seitdem ich so blendende Laune habe, altere ich nicht. Neulich habe ich beispielsweise wieder mal sechzehn Klimmzüge geschafft. Und ich weiß nicht, wohin das alles noch führen soll. Auch meine Rennradstrecken werden immer länger; was allerdings eher damit zusammenhängt, dass ich mich unterwegs ein bisschen schlauer ernähre. Die Leute essen viel zu viel Käse, fällt mir gerade ein, viel zu fetten Käse und viel zu viel davon – zum Ausklang ihrer sowieso vollsättigenden Mahlzeiten. Manche Erkenntnisse habe ich in meinem Leben spontan im Terrain gewonnen, ohne sie später mühsam aus einem Prostata- oder Nasensekret extrahieren zu müssen. Die gerade angesprochene, seinerzeit ganz und gar ungeplant vorgenommene Feldforschung[2] hängt mit einem Kasein[3]-starken Erlebnis zusammen. Inzwischen habe ich hier in Deutschland schon mehrere solcher Sättigungsorgien erlebt – mit klarem Kopf und immer noch zystenfreier Leber. Mein ganzes Leben war eine einzige trottelige Feldforschung, habe ich den Eindruck; ein ewig währender Sonderlehrgang. Zum Glück blieb ich naiv genug, um mich immer wieder unter die Menschen zu trauen – wenigstens in einem begrenzten Auslaufradius. Da aß eine intellektuelle Runde viel zu viel von viel zu fettem französischen Käse, fraß sich nach und nach durch alle Sorten – nach einem gehaltvollen Abendbrot, versteht sich – und sinnierte darüber, wie irgendeine humanitäre Katastrophe hätte verhindert werden können und was die Politik dabei wieder falsch gemacht hatte. Wobei die Leute nur das wiederholten, was sie am Vortag in einer einzigen Fernsehsendung gesehen hatten. Und wie benimmt sich ein Trottel bei einem solchen Käseparcours? Der Trottel schweigt natürlich, weil man zu so etwas Hochnotpeinlichem nur schweigen kann. Außerdem ging es den Leuten noch – das war meiner Erinnerung nach der Ausgangspunkt – um irgendwelche Thesen von Walter Benjamin. Leider habe ich bei vergleichbaren Gelegenheiten immer wieder viel zu viel Körperhitze entwickelt, statt mich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Und weil ich in meinem Leben viel Peinliches erlebt habe – und an den meisten dieser Peinheiten war ich selbstverständlich auch schwer mitschuldig –, habe ich dauernd übertrieben viel Energie verheizt, unzählige molekulare Schwingungen freigesetzt, einfach unwiederbringlich an diverse Feinstaubpartikel um mich herum abgegeben und nebenbei großporig feucht verpuffen lassen.[4] Mit anderen Worten einem effizienteren Nutzkreislauf entzogen, statt Pyramidenbau und Ähnliches zu betreiben – wie mein Freund Peter, der Mann der sieben Handwerkssparten und -künste. Ich habe das alles glücklicherweise überlebt. Mein Sohn wurde genauso wie ich als Trottel geboren, er kämpfte dagegen ehrenhaft und lange genug unter stark widrigen Vorzeichen – und er hat sich schließlich aus Scham über sein in eine Sackgasse geratenes Trotteltum umgebracht.
Dazu fällt mir dieser pausenlos zufrieden lächelnde Antonius ein – vielleicht hieß er aber auch Albrecht oder Andreas –, und ich weiß noch, wie grundsätzlich mich dieser Mensch jedes Mal aufbrachte, wenn er mich mit seinem vollkommenen Lächeln anfiel. Ehrlich gesagt: Es war der blanke Hass, und ich war jung. Und dieser Antonius, Atominus, Ato+, der Name ist jetzt unwichtig, studierte damals erst irgendetwas, hatte für ein großes, gut sortiertes Siegeslächeln noch nichts weiter vorzuweisen, stand also wie wir alle auf keinem trigonometrisch ausgerichteten Betonblock, um solch gewaltige Überschüsse an Zufriedenheit abstrahlen zu dürfen. Und ich war damals erst ein verwirrter Anfängertrottel, konnte seine vielleicht doch vorhandenen Gründe für Kraft und Freude gar nicht erkennen. Diese Sonntagskreatur Antonius war, denke ich jetzt, einfach vorschüssig zufrieden und eins mit seinem zukünftigen Selbst. Und er lächelte pausenlos drauf zu, weil er offensichtlich keinen Grund hatte, nicht zu lächeln. Er lächelte freundlichst und anscheinend sogar personenbezogen, hatte man den Eindruck, trotzdem unterschiedslos jeden an. Eine einmalige Erscheinung – in meinem damaligen Umfeld auf alle Fälle. Und in meinen Augen eine Ungerechtigkeit ohnegleichen: Ich persönlich hatte nur eine Art vakuumverschweißte Angst in mir, Furcht vor irgendwelchen mikrorissigen Einschüssen, vor meinem erwartbaren Gewebeverfall oder vor dem langsamen Einsickern der Scham in mein gesamtes Inneres. Allerdings wusste ich auch nicht, ob eine Art Schonbehandlung für mich überhaupt gut gewesen wäre. Zum Glück war ich lange ein fast unbespucktes Blatt – und heute bin ich reichlich besabbert und dabei trotzdem glücklich. Die Dinge funktionieren eben anders als ballistisch sauber fliegende Spucke. Ein echter Rockmusiker sollte auf der Bühne niemals lächeln – das weiß heute allerdings jedes Kind. Und siehe da: Aus Atomikus ist im Leben ein angenehmer Prachtkerl geworden.
Antonius – Arsch zu Geige, Geige zu Asche, Asche zu Rammsand[5] – war eine Art Messlatte für mich, sein Lächeln unübertroffen. Und es war sowieso sein gutes Recht, prachtgemessen fröhlich zu sein. Helge, mein Verleger, sagte mir neulich in Hamburg: Mach einfach so weiter … So läuft es doch prächtig. Jetzt könnte ich auch lächeln oder sogar dauerlächeln. Ich hatte aber nie die Möglichkeit, das reine Fröhlichsein lange genug zu üben. Und schon aus Angst vor nur halbwegs gelungenem Grinsen ziehe ich es vor, grinssparend zu leben. Und mein aktuelles internes Lächeln hat mit dem von Antonius garantiert wenig gemein.
Die Schwierigkeiten meines Sohnes zu beschreiben, wird für mich als Obertrottel und selbst ernannten Supervisor eine kipplige Angelegenheit sein. Meine Frau oder Schwiegermutter werden mir dabei nicht helfen können. Und andere mir nahestehende Menschen auch nicht, weil ich auch über sie einiges werde preisgeben müssen. Das Gros der im Folgenden zu verklappenden Ladung betrifft aber sowieso nur mich persönlich, erst an zweiter Stelle meinen Sohn. Man kann sich das über Jahre Aufgetürmte auch so vorstellen: Wenn zwei Trottel aufeinandertreffen, blicken da Dritte in der Regel bald nicht mehr durch. Mein Sohn würde diesen Text aber sicherlich ohne Weiteres absegnen. Viele Schwierigkeiten kommen und gehen, manche vermehren sich, kumulieren hemmungslos, werden riesig, rissig und bleiben im besten Fall irgendwo an einem Reisighintern haften. Mir ging es jahrelang so beschissen, dass mein Gedächtnis und die Fähigkeit, meine durchweichten Erinnerungen zu sortieren, stark gelitten haben. Kein Vergleich zu Vonneguts Problem, also wie sich seine Dresdner Feuerhölle auf eine konsumierbare Art und Weise für Außenstehende überhaupt darstellen ließe. Bei mir hat es allerdings auch Jahre gedauert, bis ich mir einige einfache Sätze, die meinen Sohn betrafen, auf einen Zettel notieren konnte.
Was ich mir zugutehalten kann, ist, dass ich mir mehrmals im Leben vornahm, kein Trottel mehr zu sein. Während meiner Jugend in Prag sogar recht oft. Jeden Tag die volle Härte der Nacht! Und trotzdem bin ich immer wieder aufgestanden. Einmal bin ich in die zentrale Prager Stadtbibliothek gegangen, um der Reihe nach möglichst alle Bücher, die in den Regalen des Lesesaals standen, zu verschlingen. Mir war klar, dass ich nur von einem Bruchteil des Weltwissens eine Ahnung hatte – und auch noch eine ziemlich diffuse. Manche Bücher blätterte ich gleich im Lesesaal durch, manche nahm ich mit, ein einziges steckte ich unter die Jacke und ließ es ohne Vermerk im Leserausweis mitgehen. Draußen herrschte gerade ein wunderschönes Fußballwetter, trotzdem saß ich unweit meiner Wohnung in einem wenig einladenden Parkzipfel auf einer Bank und las. Die kleine Parkfläche lag zwischen einer Nebenstraße und den Schienen einer stark befahrenen Straßenbahnstrecke und war ausgesprochen unbeliebt. Auch der nahe gelegene kleine Platz war menschenleer, es parkten dort außerdem kaum Autos. Die Katzenkopfpflasterung strahlte die aufgenommene Hitze ab bis unter die Kastanienbäume, unter denen ich saß. Und ich glühte sowieso – in erster Linie vor Bedrückung. Und irgendwann konnte ich nichts mehr aufnehmen. Ich weiß zwar bis heute, welches Buch ich damals las und nie zu Ende lesen konnte, der Titel spielt jetzt aber keine Rolle. Und meine depressionsinduzierte Erkenntnis dieses Tages möchte ich auch nicht preisgeben.
Meine Vertrottelung gedieh in Prag am besten auf den Straßen und einigen damals kaum befahrenen Plätzen[6], inmitten – sagen wir – diverser Zusammenballungen intellektueller Unschärfe. Dort bemerkte meine Art mitzustolpern einfach niemand, und sie löste sich beim Rasen auf dem Fahrrad oder eben beim Fußballspielen sowieso leicht auf. Ich war die meiste Zeit einfach ein aufgeschäumter anderer, und von dem geklauten Buch wusste niemand. Aber nicht nur auf dem Fahrrad und beim Fußballspielen war ich ein verdeckter Entwicklungsfall. Und in meiner Clique, die aus einigen üblen, aber gut gelaunten Typen aus der Umgebung bestand, konnte ich sowieso leicht vergessen, wer ich war.
Das Leben lag vor uns, einiges, auch wenn nicht alles, schien mit leiser oder lauter Leichtigkeit machbar. Die Vorstellung, dass ich einen Sohn in der Deutschen Demokratischen Republik zeugen würde, hätte damals jeder für absurd gehalten. In uns allen steckte die Gewissheit, dass alle Länder dieser Welt etwas Besonderes zu bieten hatten. Ausgenommen die DDR. Genau dort ging es dann für mich aber hin – und sogar rein aus Gier nach guten Gerüchen. Sicher ein Wagnis. Oder besser gesagt: Bescheuerter ging es nicht.
Kuchen kann man bei guter, schlechter, aber auch bei ganz mieser Laune backen, in der Regel wird es der gleiche Kuchen. Ein Vollwerttrottel hat zum Glück kaum Angst vor Kritik. Er kennt seine Grenzen, die schlimmsten Patzer hat er in seinem Leben schon hinter sich. Und ein eingeschränkter Horizont ist leichter überschaubar. Das etwas niedertourige Nachdenken beschäftigt sein Bewusstsein außerdem so fieberhaft, dass sich die dort eventuell aufkeimenden Zweifel meistens schnell verflüssigen. Gegenwärtig ist es für mich, ehrlich gesagt, ausgesprochen überraschend, wie leicht es mir fällt, über mich zu berichten. Das würde ich jedem anderen Menschen auch gern wünschen. Da ich nebenbei zahlreiche meiner schreibenden Kollegen im Blick habe, bekomme ich manchmal mit, wie unterschiedlich sie ihre Tätigkeit betreiben. Manche ackern sich leider jahrelang nur freudlos bis qualvoll ab. Folgerichtig übernehmen, überschlagen sie sich dabei oft oder verletzen sich sogar an ganz empfindlichen Stellen – und manche handeln sich am Ende auch noch einen Leistenbruch ein. Dann lieber zehn Jahre lang die Klappe halten, würde ich sagen – schon aus Rücksicht auf den lieben Leser, der sich gern einfach nur unterhalten lassen möchte … und sei es nur bei leichtfüßigen Berichten über irgendwelche technischen Neuigkeiten. Meine Frau ist für Vorträge aus dem Reich der Technik leider so wenig empfänglich, dass ich es inzwischen aufgegeben habe, sie zum Beispiel für die Berechnung der Ritzelgrößen bei Fahrradschaltungen oder fürs Untersuchen der Tribolumineszenz beim Abreißen von aneinanderhaftenden Klebeflächen zu begeistern. Trotzdem ist sie der liebste und gerechteste Mensch, den ich hier auf Erden kenne. Deswegen tut es mir immer wieder leid, wenn ich beim Autofahren ausgerechnet in dem Moment Gas gebe, in dem sie dabei ist, aus einer breithalsigen Flasche zu trinken. Zumal sie sich auch ohne jegliche Fremdeinwirkung oft genug bekleckert oder begießt.
Mein Gaskrieg, der Anfang [2]
Natürlich würde ich meine Geschichte gern etwas übersichtlicher erzählen als so, wie es mich meine aktuellen Notate vorfürchten lassen. Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen ich ganz pingelige Regeln für die Aufbewahrung aller meiner, wie man heute sagt, personenbezogenen -lassenschaften hatte; das heißt aller meiner Dokumente, amtlicher und technischer Unterlagen und so weiter. Ich hielt also in allen Schächtelchen mit den unterschiedlichsten Zetteln, Karteikarten und Schnipseln, also praktisch in allem, was mir wichtig war, eine strenge zeit- wie auch raumsystematische Ordnung. Ich versuchte einfach, meiner Begrenztheit, so gut es ging, entgegenzusteuern. Inzwischen herrscht um mich herum relativ viel Chaos, und meine Geschichte lässt sich sowieso – wenn überhaupt – nur auf eine abanale Weise achronal erzählen. Anders ausgedrückt: Mehr zappelig als in Grenzen wohl.[7]
Wenn einer meint, Lebensläufe würden dank einer Verkettung von mehr oder weniger frei gefällten und begründbaren Entschlüssen zusammengehalten, weiß ich nicht, wo er lebt. Oft gönnt man sich irgendwo nur einen Tick mehr Zeit und verpasst eine Von-bis-Spanne, in der man eine Weiche noch hätte umstellen und dauerhaft verkeilen können. Man rennt los, geradeaus oder schräg zur Seite, gern auch gegen etwas Gemauertes. Ich habe in Prag angefangen, etwas zu studieren, es nach dem Abitur also kurzzeitig geschafft, auf dem Bildungsweg einen Schritt voranzukommen. Mitten im Sozialismus und in Schussweite russischer Granatwerfer, Luftabwehrkanonen und propagandistischer Nebelgranaten. Das muss man sich erst einmal vorstellen, auch wenn dies – unter uns – nicht alles stimmt. Mir wird schlecht, wenn ich heute an meine mir damals theoretisch offenstehenden sozialistischen Perspektiven denke. Die Luftabwehrkanonen standen nach dem Einmarsch von 1968 noch eine ganze Weile auf dem Altstädter Ring, gleichmäßig in einem Kreis angeordnet, und ich sehe sie dort manchmal noch heute – trotz der vielen Touristen, Souvenirbuden und kotabwerfenden Kutschenpferde. Da mir von einer meiner Tanten rechtzeitig eingeredet worden war, die Zukunft würde auch in unserem besetzten Land den Computern gehören, wählte ich ein Studium, das vor allem mit Mathematik und kopflosen Maschinen zu tun haben würde. Wie recht meine Tante hatte und wie grandios sie sich gleichzeitig in mir geirrt hatte! Ich studierte diese tatsächlich früchtetragende und sich dauerhaft selbst besamende Digitalwissenschaft aber nicht elitär bei den intelligenten Mathematikern, sondern dummerweise bei den perspektivisch zum totalen Scheitern verurteilten Ökonomen, was mein studentisches Leben noch grauenhafter machte, als es in der damaligen Situation hätte sein müssen. Ich war also dabei, nicht einfach nur ein Programmierer, sondern außerdem ein sozialistischer Ökonom zu werden – das heißt ein philosophoider Marxist, doppelbödiger Buchführungsspezi und Lügenstatistiker. Geschichte der geschickten Arbeiterbewegung, hieß eine der wichtigsten Vorlesungsreihen. Ein anderer Themenkomplex hieß: Erstarrt menschenbenebelnde Preismissbildung im Sozialismus. Der nächste: Die Partei und ihre akzeptanzsteigernden Maßnahmen für die primäre Disziplinakkumulation des Zappelproletariats[8]und für den gemütlichen familienzentrierten Balkongemüseanbau, oder: Die führende Rolle der KPdSU bei der Berechnung des Toilettenpapierbedarfs der befreundeten Bruderstaaten im alltäglichen Katastrophenmodus … So reichhaltig und abwechslungsreich waren die Themen, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Da mir das Studium und außerdem die anderen Bekloppten, die sich der vorgezeichneten ökonomischen Rettungsonanie verschrieben hatten, zuwider waren, wurde ich gleich zu Beginn meiner studentischen Karriere beinah zum Alkoholiker. Die Innenstadt von Prag ist klein, und ich war nach den drei oder vier Doppelstunden im vollgepferchten Unigebäude nicht in der Lage, in eine Straßenbahn zu steigen, wo die nächsten Verklumpungen von Menschen bereit waren, sich auf den zickzackig liegenden Schienen schütteln und in den Kurven die Körperneigerichtung diktieren zu lassen. So ging ich einfach zu Fuß nach Hause, quer durch die ganze Innenstadt. Und ausgerechnet damals wurden dort kleine Weinschenken eröffnet, was sicher kein Zufall war. Die unzähligen Bierkneipen reichten zur Ruhigstellung der Bevölkerung inzwischen nicht mehr aus. »Wir stellen dem Volk Opiate in ausreichenden Mengen und in ausgezeichneter Qualität zur Verfügung!«, stand auf großen Plakaten, wenn ich mich nicht irre. Warum erzähle ich jetzt aber nicht lieber von einigen meiner warmherzigen Verwandten oder anderen Mitmenschen von damals? Oder konkret zum Beispiel von der Unantastbarkeit ihrer mit ihnen verstorbenen Gefühle? Gerade dank dieser mir nahen, herrlichen und trotz aller Widrigkeiten optimistischen Menschen bin ich doch der geworden, der ich bin. Einfach nur liebenswürdig und zartfühlend bin ich aber natürlich nicht. Neulich stand ich in Triest vor einer leider aufgegebenen Filiale des Café Hausbrandt und dachte gleich als Erstes: Café Hausbrand, Berghotel Erdrutsch, Eigenheim Kellervollscheiße. Zum Glück ist meine Frau ein ausgesprochen reizendes, tolerantes und hilfsbereites Wesen und gleicht immer wieder einiges aus – oder wischt dies und jenes mit einem nassen Lappen weg. Und ruft bei Bedarf notfalls in die Menge: So blöd ist er gar nicht! Und ich hatte im Leben sowieso auch noch andere tatkräftige Kurskorrektoren und Mahner an meiner Seite, die mich – wie ich wusste – schon vor dem Schlimmsten bewahren würden.
Die Prager Weinschenken zum Standsaufen waren schlicht, aber rustikal eingerichtet, hatten in der Regel nur einen Raum, und die stillen Saftlutscher, die sich dort tagsüber einfanden, verbrachten beim Nippen an ihren Weingläsern nicht übermäßig viel Zeit. Hinter dem Tresen lagerten gut sichtbar einige mittelgroße Weinfässer, und aus den in sie eingerammten Zapfhähnen tropfte es pausenlos. Dementsprechend entsetzlich roch es dort immer. Aber nicht einfach nur säuerlich nach Wein, sondern nach Breitbandzersetzung durch freie Weinradikale und durch die wahrscheinlich eher nachtaktive Spaltkeilsäure. Und haben diesen Geruch vielleicht dann noch irgendwelche Tannine in eine instabile Seitenlage gebracht? Natürlich wurde die Geruchsblume dieser Stuben auch dank schlichter Holzfäulnis, vielleicht auch dank der wenig schlichten Kotabwürfe besoffener Ratten und ihrer mitsaufenden Milben und Flöhe anfermentiert, abgerundet, nachgegart und rundverekelt. Man trank also nur schnell sein Gläschen und musste sich dort nicht wie in den Bierkneipen länger aufhalten, um das geschluckte Kohlendioxid abzurülpsen. Mein Nachhauseweg war tröstlich, auch die politische Situation fühlte sich bald etwas erträglicher an; und in der nächsten Schenke kostete ich einen anderen nachokkupatorischen, möglicherweise aber sogar noch vorokkupatorischen Jahrgang.
Ich mag bis heute keine verklemmten Menschen, verklemmte Menschen machen mich sofort verklemmter, als ich es inzwischen sein dürfte. Sie erinnern mich an viele meiner Zustände von früher, und ich bekomme im Beisein solcher Atemgenossen sogar eine piepsige Stimme. Und dann diese Schwere in der Brust! Aber eigentlich verlagerte sich mein Schweregefühl damals nach und nach eher in meine Magengegend. Mich beherrschte regelrecht die Vorstellung, dass das ganze Essen, das ich in mich in einem vier- bis fünfstündigen Rhythmus reinstopfte, sich in mir regelrecht stauen würde – und war davon überzeugt, immer mehr Ballast durch die Gegend zu schleppen. In mir steckten sehr viel Wut und Widerwillen, zum Glück aber auch die hinterwäldlerische Hoffnung, auf dem heimatlichen Fleckchen Erde später doch einen Ort für mich zu finden; und ich nahm dabei an, irgendwann im Leben – egal wie langsam – die in mir stecken gebliebenen Ballastladungen wieder loszuwerden. Mittlerweile weiß ich medizinisch über dies und jenes etwas besser Bescheid. Ich weiß zum Beispiel, dass die Legionen der bakteriellen Darmbewohner ein Trockendrittel der Ausscheidungsmasse ausmachen – gemeint sind hier die reinen Zellenbodys der Bakterien, ihrer ganzen Stämme und Familien, ob lebendig oder längst tot. Und nach getaner Arbeit sowieso bereits im Zerfall begriffen. Das zweite Trockendrittel der braunen Masse besteht aus nicht verdaulichen Ballaststoffen. Und der allerletzte Rest setzt sich einfach aus Materialien zusammen, die der Körper absolut nicht mehr gebrauchen konnte – dazu gehören zum Beispiel auch alle abgestorbenen, nun also abzustoßenden Zellen aus dem gesamten Körpergebiet. Also alles, was nicht ausgespuckt, ausgerotzt, ausgekotzt, ausgeweint, ausgepisst, ausgeblutet oder als Eiter ausgedrückt – also nicht anders entkloakisiert – werden konnte. Zur Beruhigung sollte man sich aber Folgendes klarmachen: Drei Viertel der Gesamtmasse ist einfach reines Wasser. Irgendwann im vorigen Jahrhundert sagte Bert Papenfuß zu mir: Die Natur hat uns einen gewaltigen Verdauungsauftrag übergebraten, ans Werk! Das Folgende weiß inzwischen fast jeder: Zwischen Böhmen und Mähren gibt es keine Mauer, die Grenze definiert eher die Dominanz des Bier- beziehungsweise Weinkonsums. Verlassen wir uns, hinterlassen wir Dreck, taufrisch – verkündete mein Freund Bert Mitte der Achtzigerjahre dann auch noch.
Trotz des täglichen Weinkonsums war es ziemlich unwahrscheinlich, dass ich damals ein studentischer Junioralkoholiker geworden wäre. Wegen der erwähnten und nicht wegzuabstrahierenden Gerüche der Weinstuben habe ich meine Trinkpraxis bald wieder aufgeben müssen. Außerdem passten mir die dort herumhängenden Wachsfiguren menschlich ganz und gar nicht – und ich passte nicht zu ihnen. Wobei ich damals noch nicht wissen konnte, dass Bierkneipen – jedenfalls in den Morgenstunden – noch viel schlimmer, also noch kotzfördernder muffen können als die harmlosen kleinen Weinlokale. Mein abwechslungsreiches Berufsleben zwang mich zum Glück, über das und jenes wenigstens behelfsmäßig nachzudenken. Als es einige Jahre später zu meinem Beruf gehörte, täglich Bierkneipen lange vor ihrer Öffnung zu betreten, war ich schockiert. Der dortige Gestank attackierte einen gnadenlos, war absolut widerlich und obendrein ganz anders als vermutet. Und nur durch die Rückstände des nicht mehr sichtbaren Zigarettenrauchs oder durch die Ausdünstungen des bläschenlosen Biersafts, die aus allen Tischen und aus den fußbödigen Schichten aufstiegen, war die Qualität dieser Melange nicht zu erklären. Dass ich mich im Alltag mit den unterschiedlichsten Lebens-, Zerfalls- oder Sterbegerüchen anfreunden und ihnen einiges abgewinnen konnte, war ein göttliches Geschenk, eine Quelle voller überraschender Erkenntnisse. Ich begriff in diesem Fall zum Beispiel, was die körpereigene Wärme, der individuell gefärbte Schweiß und die sonstigen Ausdünstungen der menschlichen Organismen, die die Kneipen in den Vormittagsstunden im Griff haben würden, für so ein Innenklima im Allgemeinen bedeuten. Nicht nur dass der frische Zigarettenrauch dann einiges überduftet; der Punkt ist, glaube ich, dass der sich in den Räumlichkeiten über Nacht festbeißende Standgeruch dank der Masse der tagsüber Anwesenden einem oberflächenaffinen Katalysationsprozess unterzogen wird. Dergestalt, dass die in den Räumlichkeiten ansässigen, in moribunden Warteschleifen herumwirbelnden Tröpfchen, Fett- und Harzkoagulate sich nach und nach vollständig auflösen; außerdem werden sie aufgespalten, danach durch chemische, lokal sich sicher leicht unterscheidende Pufferstoffe aufgewertet und durch biologisch frischaktive Infektionströpfchen aus den dampfenden Mündern und Nasenöffnungen der Gäste angereichert. Und das so lange, bis die lebensnahe Mischung wieder stimmt und die kneipentypischen Lockrufe sich bis nach draußen über die Bürgersteige ergießen können.
Ich bin jetzt allerdings wieder von meinem momentanen Hauptthema abgekommen – eigentlich ging es mir um die nach dem Russenüberfall[9] neu eröffneten Weinstuben und nicht um meine wesentlich späteren Geruchserfahrungen aus der Zeit als Brötchenausfahrer. Denn in den Kneipen galt: keine Bockwurst, keine würzig-zwiebelig-essigkonzentriert ersoffene Speckwurst und keine gepfefferte Eisbeinsülze ohne ein Brötchen! Aber ich drifte schon wieder ab, statt die traurigen Weinschenken trockenzulegen und endlich von meinem Schreibtisch verschwinden zu lassen. Diesen Räumen fehlte einfach jegliche Vorab-Suggestion von Gemütlichkeit – und die hätte bei etwas gutem Willen beispielsweise von an den Wänden hängenden künstlichen Trauben ausgehen können und/oder ähnlichen Schmuckelementen. Aber natürlich vor allem von egal wie hässlichen Tischen – vorausgesetzt, dass an ihnen freundlich aufblickende Weinschlucker gesessen hätten. In diesen Stuben war die Mehrzahl der Gäste aber leider nur auf sich selbst gestellt. Die Männer standen an den seitlich angebrachten Pulten oder saßen höchstens halbarschig auf Barhockern – und so war in diesen Weinstuben schon bald nach deren fröhlicher Eröffnung nur noch Trostlosigkeit angesagt. Und wenn dort der eine oder andere Gast kurzzeitig doch mal beglückt worden sein sollte, drückte der nur phasenverschobene Frust trotzdem dauerhaft auf die Stimmung. Die meisten Trinkenden starrten nur gegen die Wand oder schauten unfokussiert durch die Fensterscheiben nach draußen. Im Grunde betrat man diese Stuben schon mit der Vorahnung, dass man dort keine Geselligkeit finden würde. Mit Fixerstuben oder Peepshows samt Einmannkabinen lassen sich diese Etablissements allerdings schwer vergleichen, fürchte ich. Peepshows gab es zu diesem Zeitpunkt vorerst nur in Amerika, und wie es in Fixerstuben zugeht, wollte ich nie genau wissen. Wie ich inzwischen aber mitbekommen habe, lässt sich über das und jenes wunderbar reden, auch wenn man diesbezüglich relativ ahnungslos ist. Was weiß ich schon aus Erfahrung über richtige Bierkneipen? Aber offenbar hatte es mir doch gereicht, ein- oder zwei- oder höchstens dreimal im Monat eine Bierkneipe mit wachem Blick zu betreten, um etwas von ihrem Wesen zu erfassen. Dieses ist mit dem einer Weinschenke tatsächlich nicht vergleichbar. Das Fluidum einer Kneipe wird erstmal mit viel größeren Flüssigkeitsmengen – und viel mehr Lärm – befüllt und von diesen beiden Strömen auch dauerhaft durchflutet. Und das von jedem Gast zu bewältigende Biervolumen erfüllt nebenbei noch eine andere wichtige Funktion: Es braucht etwas Zeit, bis man einen halben Liter Flüssigkeit getrunken hat – und diese reicht meistens aus, um in irgendwelche Gespräche hineingezogen zu werden. Wobei sich die Bestellzyklen der einzelnen Gäste sowieso permanent überschneiden und die Biertrinker schon aus diesem Grund voneinander schwer loskommen. Und diejenigen, die schon längst gehen wollten, bekommen plötzlich doch noch ein Bierchen auf ihren Pappdeckel geknallt … Das Biertrinken hat aber noch einen weiteren Vorteil: Man ist nach vier, fünf oder mehr Halblitergläsern (ich spreche hier über richtige Männer – nicht über mich) immer noch in der Lage aufzustehen, einigermaßen gerade zu laufen und verständlich zu artikulieren.
Über mein furchtbares Studium werde ich hier nichts weiter erzählen. Nur Folgendes: Ich war in dieser Lebensphase kurzzeitig in eine verstockte mährische Mitstudentin verliebt – und das müsste hier erzähltechnisch reichen. Der mährische Wein spielte in unserer Beziehung zum Glück keine Rolle, und wie gesagt: Von den Gerüchen der holzverätzenden Tropfweine hatte ich irgendwann sowieso die Schnauze voll. Leider hatten meine schöne Mährin und ich uns mehrere Monate lang nichts, tatsächlich überhaupt nichts zu sagen. Vielleicht schwächelte das wie erstarrt wirkende Mährenzimmer im Geiste aber nur anders als ich, und ich war als Komplementärtrottel nicht der Richtige für sie. Und vielleicht war meine schöne Mährin von der großen Stadt Prag einfach geschockt. Im Gegensatz dazu rührte meine Sprachlosigkeit höchstwahrscheinlich daher, dass ich die auf meine Fenster gerichteten Raketenwerfer noch vor Augen hatte. In Prag war für die langhaarige Mährin alles vollkommen neu und einfach riesengroß – auf jeden Fall alles andere als dörflich. Hätte ich vor diesem reinen Wesen etwa meine prag-spezifischen Ekelgefühle ausbreiten sollen? Wenn wir zusammen waren, war es einfach langweilig, und mir war nicht klar, wohin diese Reduzierung auf einige wenige Inhaltsschnipsel und das eingehakte stumme Miteinandergehen noch führen sollte. Diese Frau war allerdings großflächig und gleichmäßig schön und sprach auch im Alltag, also wenn sie überhaupt sprach, reines mährisches Tschechisch – das heißt grammatikalisch hemmungslos richtiges Tschechisch. Als ob ihre Sätze so an der Tafel einer Grundschule stünden – oder sie vor einem behördlichen Schalter eine Meldung zu tätigen hätte. Bei ihr, da sie eine echte mährische Tschechin war, klang das alles aber ganz natürlich, nicht wie aus einem Lautsprecher im Sprachlabor. Für sie war es eben selbstverständlich, im Alltag so und nicht anders zu reden. Dagegen könnn wir – also die nicht-mährischen Tschechen aus der Hauptstadt – ynfach nüxt unverhünzelt lassn.[10] Meine Mährin redete also wie alle Mähren dauerhaft korrekt: Die Wortendungen blieben bei ihr wie frisch gestanzt, und sie ließ auch die inneren Stammvokale unberührt – vielleicht liebte ich diese Frau rein sprachwissenschaftlich, also wegen dieser dörflichen Reinheit, die so überhaupt nicht peinlich klang. Ansonsten war bei ihr vieles ziemlich peinlich, und politisch war sie ein zartes Produkt außerstädtischer Ahnungslosigkeit. Dabei war ihre ältere Schwester, die auch in Prag studierte, wesentlich quirliger. Dieses mährische, sprachlich nicht ganz so reine Wesen studierte außerdem etwas viel Handfesteres, ich glaube die schon damals halbwegs technisierte Land-, Forst- und Viehwirtschaftswissenschaft. Sie muss viel über Traktoren, Humusböden, Gülle oder Reifeprozesse der unterschiedlich muffenden Silagemischungen gewusst haben, das konnte mir aber egal sein. Was nicht egal war: Sie besaß – und möglicherweise war es kein Zufall – ein Parfüm von einer unwahrscheinlichen Kraft und Qualität.
Worauf ich hinauswill, wird sich bald klären. Da ich und meine Mährin kaum miteinander sprachen und uns abends in der Dunkelheit überall ewig nur küssten, wurde es für uns beide irgendwann unerträglich. Und uns mit ineinander verschränkten Extremitäten und mit Schenkelreiben zwischen den Beinen zu beglücken, fanden wir mit der Zeit außerdem zu monoton. Ihr war sicher klar, dass in Prag sexuelle Handlungen irgendwann nicht zu umgehen sein würden. Ob sie darüber aber so explizit nachdachte oder die Dinge einfach geschehen lassen und selbst eigentlich gar nichts wollte, wusste ich nicht. Wie verstockt sie beim Sprechen war, so verengt war sie auch vulval. Sie fühlte sich trocken an, überhaupt nicht elastisch. Ich konnte das alles aber nicht empirisch feststellen, weil ich mich damals noch nicht traute, nach unten in den Einstiegsbereich zu fassen. Sie lag unter mir, die Beine einigermaßen geöffnet – wenn auch nicht ganz –, und ich kam und kam in sie nicht hinein. Ich schob sie mit meinem kondomierten Pimmel immer weiter zum Kopfende des Bettes, bis sie dann schon halb heraushing … das will ich alles aber nicht unbedingt schildern. Ich bin einfach an ihrer körperlichen Verstocktheit gescheitert, und irgendwann war ich auch mechanisch nicht in der Lage weiterzumachen. Das eigentlich Wichtige war, dass meine Mährin an dem Tag das Parfüm ihrer Schwester aufgelegt hatte. Ob mit deren Erlaubnis oder nicht, blieb unklar. Es war auf alle Fälle aber die allerintelligenteste ihrer Leistungen aus dieser Zeit. Sie hatte auf ihrer Haut einfach ein für mich vollkommen neuartiges Duftdestillat mitgebracht, von dessen Auswirkungen ich nie wieder freikommen sollte. Dummerweise schleppte dieser Duft, also wenn er mich irgendwo später anfiel, immer auch eine Menge der ebenfalls unauslöschlichen mährischen Hautwärme mit sich. Und auf eine solche Weise angereichert, alarmiert mich dieses sensorische Pelemele völlig inadäquat, also auch wenn es nur mäßig[11] konzentriert ist oder dem damaligen nur ganz entfernt ähnelt. So gesehen war es natürlich besser, dass wir nicht ineinanderkamen. Es hätte nur unnötige und sicher eher langweilige Befriedigungsnöte oder sogar -pflichten und dann langwierige Trennungsprozeduren mit sich gebracht. So war das Haupterlebnis ein anderes und um vieles gewaltiger als ein kurzer Beischlaf. Die vom männlichen Zwischenhirn und Rückenmark koordinierten Ejakulationsereignisse sind wiederholbar, diese Geruchsattacke war es nicht. Das, was mir meine Nasenschleimhäute damals ins Gehirn schossen, war reines Nervengift. Und für mein an sich schon etwas eng fokussiertes, teilweise sogar reduziertes Dasein war es nur der Anfang … aber der Anfang von was? Jetzt muss ich mich stark konzentrieren – und drücke mich sicher etwas unlocker aus: der Anfang eines Stellungskriegs in den tiefen Gräben des damaligen Ostblocks.
Meine Ehefrau ist ehrlich gesagt auch nicht ganz so helle. Aber egal – ich werde sie später noch ausreichend würdigen. Das »nicht ganz helle« war jetzt sowieso ganz und gar positiv gemeint. Man muss im Leben einfach auch ein bisschen Glück haben. In diesem Kapitel ging es nicht, wie es die Überschrift suggeriert hat, um irgendeinen Gaskrieg, merke ich gerade. Ich entschuldige mich dafür – auch für einige in diesem Kapitel hinterlassene historische Unwahrheiten.[12]
Patschulischock im Anmarsch [3]
Auch alte Menschen stehen auf schrägen Ebenen erstaunlicherweise streng senkrecht, wenn sie nicht völlig krummgealtert sind. Wenn ich an mein Leben zurückdenke, wird mir ganz schwindlig. Und nach vorn zu denken, hat mir auch früher nie irgendwas gebracht. Was ich in meinem Leben alles zu sortieren, zu bedenken, zu bewegen und dabei auszutarieren hatte! Bloß nicht umfallen, nicht zu Boden gehen, sage ich mir fast täglich. Für mich bedeutete und bedeutet jeder Verlust von Gleichgewicht eine grauenhafte Erniedrigung – an sich ist beim Kippen der Moment bitter genug, an dem man merkt, dass sich der Körper hinter dem letzten Kehrpunkt befindet. Meine Großmutter meinte, man hätte es im Leben generell einfacher, wenn man unterschätzt würde. Und das bestätigte sich mir in meinem Leben in der Tat mehrfach. Ich wurde in meinem Leben oft überrumpelt, überhobelt und überhebelt; trotzdem verhielten sich meine vielen Weggefährten zu mir immer korrekt, waren wohlwollend, freundlich, reizend bis liebenswürdig. Und auch wenn ich dabei oft gnadenlos vollgelabert wurde, bin ich deswegen niemandem böse – ich habe es den anderen in der Regel zu leicht gemacht. Ob ich es im Leben einfacher gehabt hätte, wenn ich als Gleicher unter Gleichen aufgewachsen wäre, ist allerdings fraglich. Prägend für mich war lange Jahre nicht nur die Beziehung zu dem dauerlächelnden Antonesko, sondern außerdem zu meinem Schulfreund Peter, der prinzipiell nie unterschätzt wurde. Alles, was Peter im Leben anpackte, konnte er dann bald auch perfekt. Er preschte wiederholt mit Aktivitäten vor, über die in der Klasse bis dahin noch niemand etwas gehört hatte. Dafür bewegte er sich später leider meistens am Rande der Erschöpfung; trotzdem war er ständig dabei, schon seine nächsten Erschöpfungszustände zu planen. Und ich würde auch noch aus anderen Gründen mit Menschen wie Peter niemals tauschen wollen. Auch ein leicht Eingeschränkter bekommt im Leben viel Bestätigung – viel mehr als allgemein angenommen. Und ich persönlich kannte sowieso auch die andere Seite, also das genaue Gegenteil des Unterschätztwerdens: die auf einen einprasselnde Bewunderung. Meine Großmutter hielt mich beispielsweise für ein Genie und einen zukünftigen Schriftsteller.
Mein lieber Peter beschloss eines Tages – so fing es an –, dass er sich alles, was er an Kleidung anziehen sollte, ganz und gar alleine schneidern würde. Er brachte sich das Schneidern im Eiltempo selbst bei, und schon nach einer Woche tauchte er in der Schule mit einer selbst genähten Hose auf. An den Hosenbeinen hatte er sogar seitlich praktische und in Prag damals noch kaum bekannte Außentaschen angebracht. Als ich ihn fragte, wie man an fertige Hosenbeine – maschinell, wohlgemerkt – von außen überhaupt noch etwas annähen könne, antwortete er, so etwas sei ganz einfach. Wie einfach, verriet er mir aber nicht. An sich war es trotzdem schön, einen Freund zu haben, der von allen Seiten bewundert wurde. Und ich musste keineswegs alles selbst können – dazu hätten meine Energiepuffer sowieso nicht gereicht. Für Peters Qualitäten sprach aber noch einiges mehr: Er war nicht nur handwerklich begabt, er hatte außerdem Sinn für Ästhetik. Seine neue Hose sah ausgesprochen fortschrittlich aus und passte wie maßgeschneidert – war sie ja auch. Und sich selbst abzumessen, war ganz bestimmt ein Riesenproblem gewesen. Manche Körperstrecken dehnen oder weiten sich doch beim Bücken, andere schrumpfen unnatürlich. Eine nackte Frau demonstriert einem solche Dinge immer wieder, natürlich unwissentlich … In Peters Manufaktur ging es dann bald mit der Herstellung von Schuhen los, was verständlicherweise noch viel aufwendiger war, weil Peter sich erst einmal zähe Lederstücke untertan machen musste. Er musste außerdem noch einigermaßen perfekte Leisten herstellen lernen und sich mit dem Nähen, Kleben, Pressen, Punzieren vertraut machen – also mit einer ganzen Kette der Schuhentstehungsarbeiten. Das erforderte viel Zeit und Geduld, und ich verlor ihn in dieser seiner Beschäftigungsperiode fast aus den Augen. Er schwänzte einmal sogar drei Tage lang die Schule. Aber ich nerve jetzt schon wieder mit irgendwelchen Details und kleinlichen Vorgängen wie dem Punzieren. Ich werde mich diesem meinem Erzähldriftdrang aber trotzdem nicht immer widersetzen können, fürchte ich. In einem Punkt hatte Peter natürlich pures Glück: In Prag gab es damals ganze Mengen an Spezialläden[13], in denen es alle nötigen Materialien für Bastler gab. Diese fand man dort immer gut sortiert vor, getrennt nach den einzelnen Bastelsparten. Und was es im sozialistischen Alltag tatsächlich alles zu verbessern oder zu erbasteln gab! – die Anzahl der Utensilien, Werkstoffe, Kleinstteile, Verbundstoffe, Lösungs- oder Farbstoffe ging in die Tausende. Ich würde hier gern noch einige völlig überflüssige Aufzählungen unterbringen, um den jungen Menschen den sozialistischen Alltag näherzubringen, lasse es aber lieber sein. Meine Frau überspringt beim Lesen zum Beispiel grundsätzlich alle Landschaftsbeschreibungen – und das hat mir, was das Schreibhandwerk angeht, schon recht früh zu denken gegeben. Dieser Roman enthält verständlicherweise keine einzige Beschreibung von irgendwelchen Außen- oder Innenräumen, was allerdings nur mittelbar mit meiner Frau zu tun hat. Was viele ihrer anderen Eigenarten angeht, werde ich sie möglichst nur sparsam preisgeben.
Der Sinn des – damals aus kommunistischer Sicht sicher weisen – Entschlusses, die Bastelleidenschaft des Volkes zu befeuern, war klar: Die Menschen sollten sich in Eigeninitiative üben und sich in Notfällen selbst auszuhelfen wissen. Viele Dinge gab es im Einzelhandel oft einfach nicht. Und wenn irgendwelche Gerätschaften kaputtgingen, fehlten wieder die passenden Ersatzteile. Dank der entsprechenden Aktivitätskanalisierung war die Bevölkerung außerdem ausreichend ausgelastet und für störendes Aufmucken irgendwann zu müde. Wobei diese auf zusätzliche Selbstversorgung zielende Strategie natürlich ihre Schattenseiten hatte. Alle bastelbezüglichen Besorgungen, also zeitraubenden Gänge durch die Stadt wurden von den Bürgern – und das war auch in den höchsten Lenkungsebenen bekannt – grundsätzlich in der Arbeitszeit erledigt.
Mit Peter erlebte ich allerdings auch ganz andere Zeiten, in denen er alles vorläufig Angestrebte hinter sich gebracht hatte und sich die Zeit nahm, mich stundenlang weiterzubilden – ohne mich dabei sonderlich wahrzunehmen. Ich bin ihm dafür trotzdem dankbar, und vieles, was ich heute weiß, weiß ich dank seiner endlosen Vorträge. Schämst du dich nicht, den Leuten dauernd solche Dinge über dich zu verraten?, blaffte mich neulich wieder mal meine Frau an. Nichts Neues in unserer Beziehung … und dass sie gelegentlich in meinen Papieren herumwühlt, gehört auch dazu. Meine Frau begann mich mit ihren scharfen Sprüchen (»Was Hänschen nicht lernt …«) schon recht früh zu traktieren. In Zeiten nämlich, als ich ein derartig herbes weibisches Verhalten aus meiner Heimat gar nicht kannte. Zum Glück irrt sich meine Frau aber relativ oft, wobei natürlich einiges, was sie sagt, sich später als korrekt bis pädagogisch sinnvoll erweist. Was sie gegen meine angebliche Schamlosigkeit hat, weiß ich nicht genau. Mir fällt es bis heute überhaupt nicht leicht, jedenfalls nicht immer, irgendwelche Peinlichkeiten über mich preiszugeben. Wenn bloß der Harmoniewille vom Himmel fiele! Er muss es aber nicht, sage ich mir, wenn sich der Mensch auch ohne diesen ganzen Kram gut amüsiert. Und ich rufe lieber Folgendes zum Himmel hinan: Du mein großer Lilliputtivater[14]in deinem Wolkenschloss, was habe ich in meinem Leben an Glück ertragen müssen – säckeweise sogar! Und warum hast Du mich, Du luftiger Hillbilly, erst mit fünfunddreißig zum brutalen Karatetraining geschickt und mich nicht viel früher mit wurffähigen Kieselsteinen[15]versorgt? Wie gern würde ich meiner lieben Großmutter mit Zähren in den Augen über alle Schicksalstreffer berichten, die mir schließlich zu meinem so rundkantigen Glücksgefühl verholfen haben!
Mein Leben in Prag hätte furchtbar schäbig geraten können. Um mich herum war sowieso schon alles schäbig genug, und ich war auf dem besten Weg, die allgemeine Schäbigkeit hyperbolisch[16] zu vermehren. In Prag blätterte von den Mauern und Wänden schwerkraftbedingt alles ab, was kohäsionsgemindert war: nicht nur der Putz, auch ganze Simse oder Balkone. Und wenn dabei ein oder mehrere Fußgänger erschlagen wurden, wurde dies sogar in den zensierten Zeitungen öffentlich diskutiert. Auch unser späterer Präsident Havel hat sich als junger Mann an einem solchen Gedankenaustausch – als er es in den Sechzigerjahren noch durfte – beteiligt; und hat die Absurdität der ganzen Diskussion gnadenlos auseinandergenommen. Das tschechische Volk war aber trotz der staatlichen Lethargie nie faul und nie verzagt. Und wenn sich irgendwo – auch im Sozialismus – ein Unheil ankündigte und sogar bemerkt wurde, rückte eine tapfere Arbeitsbrigade mit Gerüsten und Stützbalken an und rettete oft erst im letzten Moment ein kleines Stück historischer Substanz vor der Zerbröselung. Wenn aber irgendein Fundament plötzlich überraschend absackte, dann hatten auch die Denkmalschützer nichts zu melden. Mehr als dieses oder jenes Gebäude abzureißen, war der tapferen Misswirtschaft dann gar nicht zuzumuten. Da ich damals noch furchtbar unselbständig und die Wohnungsnot in Prag so dramatisch war, meldete mich meine Mutter eines Tages bei einer Wohnungsbaugenossenschaft an, ohne mich groß zu konsultieren. Mein großer Himmelslilli![17] Mir wird wieder schlecht! Das Leben war vorgeplant – vorgeplant schäbig; mein Leben sollte offenbar unbedingt so und nicht anders werden. Und ich war nicht nur grundschäbig und angeschabt, ich war schon damals im Grunde so gut wie verhackepetert. Ich steckte in tausend eng abgezirkelten Alltagszwängen und hatte das Gefühl, die Palette der Ausweichrouten wäre für Menschen wie mich längst zusammengefaltet worden. Ich hätte versuchen können, mich entweder mit läppischen Trippelschritten in Bewegung zu setzen, mich ins Wildwasser von irgendwelchen Dreckstromrinnen zu stürzen oder mir zur Abwechslung erfrischend gallige Einläufe verabreichen zu lassen. Und wenn das zu nichts geführt hätte, hätte ich mich mit Schnittwunden zieren, mir mittelschwere Knochenbrüche organisieren oder Morbus Bechterew simulieren können. Ich hätte aber trotzdem keine Chance gehabt. War mein damaliges Leben wirklich so, wie ich es mir hier gerade krampfhaft abpressen tue? Wahrscheinlich nicht, obwohl später tatsächlich verdächtige Schnittwunden an meinen Armen zum Vorschein kamen; und so möchte ich aus verständlichen Gründen darum bitten, die soeben gelesenen Sätze lieber nicht noch einmal zu lesen. Wahr ist jedenfalls, dass ich über lange Strecken etwas reduziert und dabei gleichzeitig eingenebelt lebte – also in einer Art Schutzmodus vegetierte, würde man heute sagen. Dabei kamen mir schon die einfachsten praktischen Dinge, die um mich herum im Gange waren, so verwirrend vor, dass ich sie sicher niemals eigenständig bewältigt hätte. Und das betraf nicht nur die kümmerliche Oberfläche des Alltags, sondern auch das damals relativ einfach strukturierte gesellschaftliche Innenleben. Eventuell hätte ich, was meine Mitgliedschaft in der Wohnboxen-Genossenschaft betrifft, nach zwanzig Jahren theoretisch eine kleine Chance bekommen, in meine eigene hässliche Neubauwohnung zu ziehen. Oder auch nicht. In Prag wohnten auch vollständig verfeindete Ehepartner jahrzehntelang weiter zusammen, weil sie einfach nicht auseinanderziehen konnten. Im Bekanntenkreis unserer Familie war dies fast die Regel.
Ich und eine Genossenschaftswohnung in einem zeitgemäß modernen, also hässlichen Haus – stelle sich das einer nur plastisch und ausreichend schäbig vor! Das wäre das folgerichtige, vollrichtige Ende meines planmäßig auf bieraufgedunsene Schäbigkeit zusteuernden Daseins gewesen. In einer solchen Wohnung[18] hätte ich dann sicher auch keine Urteilskraft mehr gebraucht. Da meine Mutter in die Genossenschaftskasse kaum Geld einzahlen konnte, war meine Anmeldung an sich relativ witzlos – und ich hätte später sowieso nie genug verdient, um mich in eine solche Bauleistungshölle einzukaufen. Manche andere Trottel besaßen natürlich außer der nötigen Zahlungspotenz auch noch extrem dickhäutige Hände und kräftige Rücken, und sie hätten perspektivisch viel an Eigenleistungen[19] einbringen können. Sie hätten dies und jenes einmörteln, zubuttern, verschmirgeln, unterfuttern, untermischen, überwinkeln, gleichmäßig befliesen und und können … Und ich war einfach eher einer, der nur durch Zufälle nebenbei mitbekam, wie Türen in die Waagerechte gebracht wurden, um nicht dauernd selbständig aufzugehen. Eine Tante von mir, die seit dreißig Jahren mit ihrem Ehemann in einer Plattenbauwohnung lebte und den Mann abgrundtief hasste, meinte, dass einen am Partner irgendwann faktisch alles stört: jedes Wort.
Ich und meine mährische Schönheit mit ihrem grammatikalisch korrekten Tschechisch in dieser Brutkastenwohnung! Und ihre frisch geschiedene, längst Prager Slang sprechende Schwester vielleicht noch mit dabei? Eventuell wäre noch deren Parfüm mitgekommen und vielleicht noch ein Hund oder drei Katzen. Und wir alle in einer vielleicht noch Ziegel auf Ziegel erbauten Wohnung voller Rohre und selbst verlegter elektrischer Leitungen! Wir in einem Haus voller anderer, gegen ihre Lebenswut ankämpfenden, frittierten Fettfraß kauenden und aus den Achselhöhlen stinkenden Genossenschaftlerfamilien. Grausame Visionen, denen zu frönen ich damals zum Glück noch gar nicht den Mut hatte. Ich trug einfach alles Mögliche nur dumpf in mir herum – das heißt, dass ich das alles auch schnell wieder wegsacken, runterschlucken oder verdampfen lassen konnte. Zur damaligen Zeit war es in Prag sowieso nicht üblich, explizit über psychische Schieflagen nachzudenken – das hätte noch gefehlt! Von meinen ungesunden Absack- und Schluckpraktiken rührten dann schließlich, fürchte ich, meine ungewohnt frühen Magenverkrampfungen. Meinem Magen werde ich später vielleicht noch ein ganzes Kapitel widmen – oder auch nicht. Das könnte jemand anders übernehmen, litten doch damals mindestens neunzig Prozent der Prager an Magengeschwüren. Ehrlich gesagt, finde ich es nicht ganz gerecht, wieso gerade ich gegenwärtig so gut wie jeden Tag mit einer Prachtlaune aufwache. Anna Seghers meinte, wie mir mal überbracht worden war: »Unter jedem Dach ein Ach.« Dazu fällt mir idiotischerweise und viel zu ruckhaft etwas völlig anderes ein: Unser Sohn hat sich bei seinem Sprung vom Dach, also bei seiner Selbsttötung, auf den Rücken fallen lassen. Darüber werde ich irgendwann noch anders und genauer berichten. Auch darüber, dass dadurch sein Gesicht unverletzt blieb.
Das Parfüm meiner Mährin kam natürlich aus dem Westen, aus den Tiefen eines Tuzex-Ladens, wie ich annahm. Unsinnigerweise sollte das zusammengesetzte Kunstwort Tuz+ex der Bevölkerung suggerieren, dass dort »inländischer Export« betrieben wurde, obwohl es sich bei dem devisenschweren Treiben eindeutig um den gegenläufigen Verkauf von importiertem Warengemisch handelte.[20] Ich wusste damals natürlich nicht, womit und wie mir aus der Prager Hölle zu helfen gewesen wäre. Das Aussprechen von Dingen, die man über sich selbst dachte, brachte in mein Leben, wie man sich denken kann, erst viel später meine Frau. Etwas in mir[21] wollte aus Prag unbedingt verschwinden, wollte raus aus dieser fauligen, verfilzten, porenverstopften Knödelgeschwulst – und zwar bei der allerersten Gelegenheit. Ich hätte mich irgendwann also in Bewegung setzen müssen, und am besten in Richtung Westen. Nüchtern betrachtet, lag die DDR für diesen meinen Wunsch fast richtig. Wenn ich heute das Wort Karriereplanung höre, weiß ich, dass es in meinem Wortschatz damals nicht existierte. Und der ostdeutsche Geigerrocker André Greiner-Pol sang für Menschen wie mich später in den Achtzigern: Wenn … dann hab ich alles, alles, alles, alles falsch gemacht … André war ein liebenswürdiger Radikallebender und machte so gut wie alles richtig, wenn er mit seiner eingepluggten Geige und seinem zerzausten Geigenbogen auf der Bühne stand. Was die Schäbigkeit meines Lebens betraf, hätte ich auch auf Goethe zurückgreifen können: Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch!, du bist so schäbig! Oder: Verweile doch, ich will mich an meiner eigenen Schäbigkeit laben … Aber warum hätte ich so etwas Frevelhaftes tun sollen?[22] Ich sage gerne frei heraus, dass in meinem Leben alles anders kam als gedacht: Und die DDR zeigte sich mir dann gleich von der besten, also allerschäbigsten Seite. Die DDR war einfach ein Musterland, sie war glänzend verrottet, tiefst im Stunk eingeräuchert und baggerte sich außerdem den Braunkohl- und Wirsingboden unter den Füßen weg. Und so gesehen habe ich meinen Fuß irgendwann in das für mich am besten präparierte, allerliebst geeignete und sowieso recht nah gelegene[23] Drecksloch des gesamten Ostblocks gesetzt – und blieb dort wie alle anderen im Brikettstaub stecken. Ganz folgerichtig oder sogar logisch hören sich meine Ausführungen zum Thema Schäbigkeit, Dreck, Flucht und Verpuffung vielleicht nicht an, aber egal. Wahrscheinlich war ich an Dreck auch einfach gewöhnt, mit den unterschiedlichen Fluchtarten familienbedingt vertraut und schäbigkeitsallergisch vielleicht nur auf ganz bestimmte Prager Beimischungen. Die DDR war für mich tatsächlich wie geschaffen. Die Schäbigkeit des Landes wurde mein Forschungsthema, und ich fühlte mich in Ostberlin sofort wie zu Hause, obwohl ich dort lange Zeit überhaupt kein Zuhause hatte. Verstehe das alles, wer will. Immerhin lag der Westen im Prenzlauer Berg nur einen Mauerseglersprung weit entfernt.
Gipsklumpen im Magen [4]
Wenn ich nur wüsste, was sich aus dem porösen Haufen meiner Vergangenheit überhaupt lohnt zu erzählen. Einiges ließe sich vielleicht auch mathematisch interpolieren, mit feinmaschigen Membranen herausfiltern oder zum Glück relativ einfach – wem sage ich das – mithilfe hochsaurer Pufferstoffe ausflocken. Ich war sowieso schon seit der Schulzeit ein Freund der Osmose, der kapillaren Elevation – des befreienden Dampfens sowieso. Die meisten Erwachsenen, die ich in meiner Wachstumsphase kannte, waren unglücklich – die lasse ich hier als Kollektiv lieber in Ruhe. Dieses Buch muss doch keine sechshundertvierzig Seiten haben! Und die Frage, wieso ausgerechnet ich jetzt Romane schreibe, obwohl es um mich herum durchgängig viel begabtere Menschen gab, lasse ich auch lieber beiseite. Der Grund dafür, dass mein Frustlevel sich irgendwann so tief unten eingependelt hat, war einfach der, denke ich, dass ich mir nicht allzu viel vorgenommen hatte, meine Lattenroste generell lose hängen ließ und meinen Ehrgeiz … und so weiter. Ich werde mich mit diesem Thema sicherlich nochmal beschäftigen. Weiterzustudieren kam für mich irgendwann nicht mehr infrage. Aus Feigheit vor dem Feind entschloss ich mich allerdings, den Abgang gesundheitlich zu begründen. Theoretisch hätte ich später, wenn sich mein Magen wieder beruhigt hätte, weitermachen können. Für den tapferen Leser, der sich beim Entziffern dieser meiner Wortpermutation[24] – dieses Romananfangs also – schon so weit vorgearbeitet hat, werde ich die Beschreibungen meiner diesbezüglichen Krankengeschichte stark zusammenraffen. Ich bin doch kein dysfunktionaler Schwätzer, Co-Hysteriker oder Komplementärnarzisst! Im Krankenhaus musste ich erst mal eine gipsartige Röntgenkontrastmasse schlucken und anschließend schmerzhaft wieder ausscheiden. Wie unwichtig! Nebenbei – aber umso intensiver, weil zum ersten Mal – erlebte ich im überbelegten Krankenzimmer das lange nächtliche Sterben eines Menschen. Mit der Beschreibung der entsprechenden schleimreichen Sterbeszene möchte ich aber niemanden quälen. Jeder literaturinteressierte InnenReader ist im Winter oft genug selbst reichlich verschleimt. Warum sollte ich hier also schildern, wie ein alter Mann seinen Rachenschleim nicht mehr schlucken, im Liegen nicht auswerfen und auch anders nicht mehr entsorgen kann? Ich verließ das Krankenhaus mit stark verschatteten Röntgenbildern meines Magens. Und ich verließ dann auch endlich meine Universität und war frei. Diese Freiheit hätte für jeden anderen jungen Mann damals allerdings eine Katastrophe bedeutet. Er wäre bald eingezogen worden. Nur ich, der Glückliche, musste nichts befürchten, weil ich mehr oder weniger irrtümlich ausgemustert worden war.
Nach der Unterbrechung des Studiums musste ich so schnell wie möglich arbeiten gehen. Streng genommen waren zwar alle Bewohner meines Landes mehr oder weniger Parasiten des kollektivistischen Gesellschaftskonstrukts, die Gesetzeslage war aber eindeutig. Man galt damals schon nach vier oder sechs Wochen des egal wie betriebsamen Herumgammelns, also des unbeschwerten Lebens ohne nachweisbare Einkünfte, als kriminell – sodass man nach dem gefürchteten Paragrafen 203 eingesperrt werden konnte. Und tatsächlich gehörte damals mehr als die Hälfte der Gefängnisinsassen zu dieser Art von Sozialdelinquenten.[25] Dank der katastrophal suboptimalen Arbeitsproduktivität gab es Beschäftigungsangebote zum Glück überall, man stolperte in der Stadt regelrecht über sie – und man konnte sich dann irgendeine nicht allzu abstoßende, zu einem eben passende Arbeitsstelle aussuchen. Dabei ging es in erster Linie aber nicht darum, überdurchschnittliche Schäbigkeit oder besonders ärgerliche Missstände zu meiden, man floh also nicht vor stinkenden Toiletten oder kaputten Klinken, die man beim Zuziehen der Tür auch noch nach Wochen gedankenlos abzog und dann lose in der Hand hielt. In der Regel waren sowieso nicht nur düstere Werkstätten oder Umkleidekabinen von Stadtreinigern verwohnt und schmutzig, sondern auch recht solide Büroräume von irgendwelchen Instituten. Als Arbeitswilliger sah man lieber nicht allzu genau hin und suchte in erster Linie nach warmer menschlicher Umgebung, nach freundlich rauchenden Damen in der Buchhaltung und nach einigermaßen – stundenweise wenigstens – sinnvoller Beschäftigung. Der Rest würde dann sowieso mit kollegialen Gesprächen ausgefüllt werden, mit unauffälliger Lektüre unter der Tischplatte, mit straßenläufigen Besorgungen oder mit schreibtischnaher Simulation von irgendetwas. Meine Tante, die mich zu einem Topprogrammierer ausbilden lassen wollte, verschaffte mir dank irgendwelcher Beziehungen eine vollkommen untergeordnete Arbeit in einem ökonomischen Forschungsinstitut. Meine Intelligenz dürfe auf keinen Fall verkümmern, meinte sie. Seit dieser Zeit weiß ich allerdings: Man darf nie eine vollkommen untergeordnete Arbeit annehmen, sich nie mit Statistik beschäftigen und nie in die Lage geraten, kurz vor dem Feierabend vor Langeweile zu implodieren. Alle diesem Institut zur Verfügung stehenden Zahlen waren gelogen, geschönt, frei erfunden … oder auch nicht, man wusste es nicht genau. Und so wichtig waren die vielen zu verarbeitenden Zahlenkolonnen und -haufen sowieso nicht. Nach Möglichkeit sollte die Realität eher nicht allzu genau abgebildet werden – jedenfalls nicht von Personen erfasst werden, die keiner Geheimhaltungspflicht unterlagen. Für die meisten Angestellten des Instituts bedeutete die ewige Rechnerei die reinste Handarbeit. An Großcomputer konnte man Normalsterbliche damals sowieso nicht ranlassen. Ich persönlich musste irgendwelche Zahlen in lange Tabellen eintragen, und wenn ich mich verguckt oder verschrieben oder wenn ich einfach nicht darauf geachtet hatte, was ich schrieb, musste ich einen neuen Tabellenvordruck nehmen und wieder von vorn anfangen. Der Tag war lang und die Woche endlos. Und bis heute jagt mir der Anblick eines beliebigen Blatts Millimeterpapier Angst ein – und zwar wegen der grauenhaften Verlaufsdiagramme, die ich anhand einer bestimmten Auswahl meiner Zahlen auf die kotzblass-pastellfarbenen Papierbogen zeichnen musste. Ich war grausam ungenau, meine farbigen Stifte waren nicht spitz genug oder brachen in entscheidenden Momenten ab, und die Anschlüsse der Linien schlossen in der Regel nicht an. Vielmehr schossen sie oft über das Ziel hinaus oder bekamen widersinnige Buckel, weil irgendwo mittendrin eine meiner Fingerkuppen dazwischengekommen war. Und farbige Linien auf Millimeterpapier radieren zu wollen, ist fast unmöglich – davon kann ich jedem nur abraten. Zum Glück musste ich meine langen Zahlenreihen regelmäßig auch mal addieren oder anderweitig verarbeiten, wozu ich dann eine mechanische Rechenmaschine benutzen durfte – und diese mechanische, gar mechamaschinistische Beschäftigung gefiel mir einigermaßen. Der bewegliche obere Teil des Maschinchens ließ sich mit einem Drehknauf jeweils um eine Dezimalstelle nach links oder rechts versetzen. Addiert oder multipliziert wurde mit einer Kurbel an der Seite – im Uhrzeigersinn. Subtrahiert oder dividiert wurde anders herum. Kam die Maschine vielleicht sogar aus der DDR? Oder aus Russland? Im Sozialismus war alles möglich. Während des Kurbelns konnte man beobachten, wie sich die Ziffernrädchen in ihren länglichen Öffnungen brav und fast synchron drehten, um schließlich etwas asynchron, also leicht drehphasenversetzt das jeweilige, leider oft verwackelte Ergebnis anzuzeigen. Ich vertraute der Maschine nicht wirklich, da die vielen Zahnrädchen im Inneren sicher schon stark abgenutzt waren. Beim Kurbeln konnte man ab und an so etwas wie einen Übersprung spüren, jedenfalls einen ruckartigen, aus dem Inneren der Maschine kommenden Hüpfer. Ich rechnete lieber alles zweimal durch. Dummerweise fabrizierte das Ding gar keinen Ausdruck, sodass man nachträglich nichts nachprüfen konnte. Am sichersten war es einfach, alle Operationen mindestens dreimal durchzuführen. Und jeder kann sich vorstellen, was es für einen bedeutete, wenn die Endergebnisse gegen Ende der Arbeitszeit zum fünften Mal nicht übereinstimmten.
Im Grunde bedrückten mich die herrschenden politischen Verhältnisse aber wesentlich mehr als die ärgerlichen Zahlenkolonnen. In der Tschechoslowakei waren damals schnell alternde Opportunisten, Schleimer und Dummköpfe an der Macht, die bei der nachokkupatorischen Säuberungswelle aus der zweiten oder dritten Reihe nach oben gespült worden waren. Und nebenbei wuchs noch – also parallel dazu – eine neue, moral- und ethikneutrale Generation von jungen Opportunisten, Schleimern und Dummköpfen heran, die zu meinem Ärger sogar auch noch gut gelaunt war. Dass ich die idiotische Beschäftigung als Zahlenkurbelheini überhaupt angenommen hatte, war zwar bescheuert, aber nicht weiter schädlich. Ich hatte dort niemanden ins Abseits gestoßen, tat trotz meiner Wut niemandem weh und bereitete meiner Tante eine Zeitlang wenigstens etwas Freude. Sie selbst war aus ihrem Institut als revisionistisches Element rausgeworfen worden und machte ihre untergeordnete, neu-sinnlose Arbeit dann einfach woanders. Bis Frühjahr 1969 war sie sogar Abteilungsleiterin gewesen, und ihr damaliges Spezialgebiet war MARKETING IM SOZIALISMUS. Diesen Begriff, also diesen Unsinn, sollte man sich als ein Mensch von heute auf der Zunge zergehen lassen: Man hatte sich, also bevor die russischen Panzerdivisionen kamen, tatsächlich mit dem Gedanken getragen, in unserem eingekesselten Land probeweise kapitalistische Marktmechanismen einzuführen. Als meine Tante bei ihrer Pflichtüberprüfung gefragt wurde – das war die Standardfrage –, ob der Einmarsch der verbündeten Armeen in unser Land eine brüderliche Hilfe gewesen war, sagte sie schlicht und einfach Nein. Weitere fachliche Befragung hatte sich damit erledigt. Absurderweise glaubte meine Tante trotz ihres Scheiterns später immer noch an die Richtigkeit ihrer frühen Ansätze, die sie mit ihren Mitstreitern wie dem Großträumer Ota Šik hatte erarbeiten wollen. Aber immerhin: Lange Jahre ihres Lebens, die meine Tante mit ihrer doch verantwortungsvollen Beschäftigung zugebracht hatte, hatte sie exzellentes Gehirntraining betrieben und konnte ihre Fähigkeiten in den Dissidentenkreisen später immer wieder effektiv einsetzen.
Dass die DDR Menschen wie mir auch weiße Ostsee-Strände, riesige Seenlandschaften und viele nackt herumlaufende Bürgerexemplare zu bieten hatte, wusste ich damals nicht. Ich wusste auch nicht, dass es zugleich ein Dihydrogensulfid-Land war, wo jedes zweite Kleinkind an Pseudokrupp litt und sich ab der Grundschule auf das Rentenalter freute, um in den Westen reisen zu dürfen. Was das Dihydrogensulfid betrifft, irre ich mich garantiert, da es sich um eine andere, nicht aus Fäulnis-, sondern aus Verbrennungsprozessen stammende Sulfur-Verbindung gehandelt haben muss: Schwefeldioxyd. Wen kümmert es aber heute in unserem Land des Katalysierens, Feinstaubfilterns oder Bluetec-Ejakulierens von Mercedes? Die meisten mit dem Verbrennen zusammenhängenden chemischen Vorgänge sind mir sowieso bis heute fremd, weil ihre tiefere Molekularoidität sich nicht beobachten lässt. Als ein tschechischer Hinterwäldler wusste ich damals auch nichts über Albert Schweitzer, nichts über die Schule in Summerhill oder den vaginalen G-Punkt.