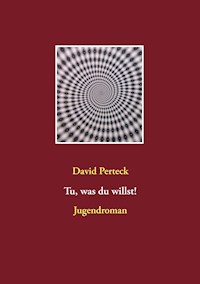
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Felix ist ein vierzehnjähriger Junge aus reichem hamburger Hause, der als hochbegabt gilt und unter den verfehlten Ansprüchen seiner Eltern und der Schule leidet. Eines Tages begegnet er Malina, der bildhübschen Tochter armer afrikanischer Einwanderer, die gerade mit ihrer Familie nach Hamburg gezogen ist. Sie verlieben sich auf den ersten Blick ineinander. Malina und Felix lernen erstaunt die fremde Welt des Anderen kennen und erleben spannende Abenteuer in Hamburg. Die erste große Liebe, die sozialen Konflikte zwischen Arm und Reich und die Fragen nach Identität, Glück und Sinn, bis hin zu Erfahrungen des Todes, verändern das Leben der jungen Liebenden für immer. Im Roman erzählen sie selbst in abwechselnden Kapiteln von ihren Gedanken, Gefühlen und Erlebnissen. Beste Unterhaltung und erstaunliche Einsichten für alle Leser! www.science-fantasy.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Felix
Die Sommerferien hatte ich in England verbracht, bei meinen Großeltern in einem kleinen Dorf nahe London. Dort konnte ich in der Sonne stundenlang allein über die Felder und durch die Wälder wandern. In der Nachbarschaft wohnten aber auch ein paar Kinder, mit denen ich gerne Fußball spielte und gemeinsam die Umgebung erkundete. Außerdem konnte man mit dem Auto oder dem Bus in einer halben Stunde leicht in die Hauptstadt fahren, um sich zu vergnügen und alles mögliche zu erleben. Meine Großeltern, die Eltern meines Vaters, waren kürzlich pensionierte Professoren für Philosophie und Geschichte, die vor vielen Jahren wegen ihrer Arbeit nach England gezogen waren. Sie nahmen mich sehr oft mit nach London, um mir die vielen Sehenswürdigkeiten zu zeigen, in den riesigen Einkaufszentren und auf den großen Märkten einzukaufen oder einfach durch die belebten Straßen und weiten Parkanlagen zu spazieren und bei Gelegenheit in einem Restaurant zu Mittag oder draußen vor einem Café oder an einem Stand ein leckeres großes Eis zu essen. Bereits nach wenigen Tagen fühlte ich mich dort zu Hause und glücklicher als jemals in Deutschland. Nebenbei hatte ich ganz wie von selbst meine Fähigkeiten im Englischen unglaublich verbessert und begeistert mehrere Bücher im englischen Original gelesen. So hätte ich ewig weiterleben können, aber die sechs Wochen vergingen leider wie im Flug!
Die unvermeidliche Rückkehr nach Hamburg wurde insbesondere von zwei gewaltigen dunklen Wolken überschattet: Vom Alltag zu Hause mit meinen widerlichen Eltern und vom Anfang des neuen Schuljahres in der achten Klasse auf dem abgrundtief verhassten Gymnasium! Meine Eltern lebten schon solange ich zurückdenken konnte nur noch für den öffentlichen Schein zusammen, weil eine offene Trennung oder Scheidung sicherlich ihren beruflichen Karrieren massiven Schaden zugefügt hätte. Mein Vater war Richter am Landgericht Hamburg und meine Mutter Chefsekretärin des Hamburger Bürgermeisters. Entsprechend arbeiteten sie sehr viel und waren selten zu Hause. Wenn sie aber mal da waren, schrien oder schwiegen sie sich entweder gegenseitig feindselig an oder kümmerten sich übertrieben und scheinheilig um mich, ihren einzigen und angeblich hochbegabten Sohn. Sie sorgten sich verzweifelt um jedes Zeugnis, jede Klassenarbeit und jede Schulnote, die womöglich von der erwarteten Höchstleistung abweichen und folglich mein künftiges Einserabitur, mein ausgezeichnetes Jurastudium und meine steile berufliche Karriere in der Justiz- oder Wirtschaftselite gefährden könnte. Sie bemühten sich um alle möglichen unliebsamen außerschulischen Aktivitäten für mich, wie etwa intensiven privaten Nachhilfeunterricht, sobald ich einmal keine Eins in einem Fach hatte. Sie zwangen mich, regelmäßig in einem Schachverein und einem Golfklub aktiv zu sein, sowie Klavier und Violine zu spielen. Es grenzte eigentlich an ein Wunder, dass ich die Sommerferien nicht zur Hälfte in einer privaten Sprachschule mit täglichem intensivem Englisch-, Französisch- und Lateinunterricht und zur Hälfte in einem Segel- oder Polocamp für adeligen Nachwuchs hatte verbringen müssen. Aber da mein letztes Zeugnis in Ordnung war und meine Eltern diesmal aufgrund ihrer Arbeit vielleicht auch einfach nicht die Zeit für entsprechende Vorbereitungen und Anmeldungen gefunden hatten, war mir die angenehme Auszeit in England vergönnt gewesen. Meine Großeltern hatten sich wohl für mich eingesetzt, um nach ihrer Emeritierung auch mal etwas vom ihrem Enkelkind zu haben. Von meinen Eltern hatte ich hingegen niemals wirkliche Liebe oder Wärme erfahren.
Ein ähnlicher Horror wie zu Hause erwartete mich auch in der Schule. Meine Eltern wollten mich nach der Grundschule ab der fünften Klasse zunächst auf ein teures Eliteinternat nach Süddeutschland schicken, nämlich auf die berühmt-berüchtigte Kaderschmiede des Geldadels nach Schloss Salem. Ich hatte es damals für einen reinen Segen gehalten, dass sie dann doch noch von einem staatlich-öffentlichen Gymnasium in Hamburg überzeugt wurden und ich nicht urplötzlich aus meiner bisherigen Heimat und meinem bisherigen Freundeskreis herausgerissen und in einer solchen Lehranstalt des Grauens eingesperrt wurde, wie ich sie mir nach schwärmerischen Erzählungen von Verwandten und abschreckenden Filmdokumentationen über Schloss Salem ausmalte.
Die Freude war aber sehr schnell bitterer Ernüchterung gewichen, als ich dann in die sogenannte Gelehrtenschule, in das traditionsreiche Johanneum in Hamburg gesteckt wurde. Hier waren ebenfalls fast nur andere Kinder von steinreichen und stockkonservativen Eltern und die Lehrkräfte schienen entsprechend aus einer preußischen Lehranstalt des 19. Jahrhunderts entsprungen und auf wundersame Weise in die 2010er Jahre versetzt worden zu sein. Ich versuchte, das Beste aus meiner betrüblichen Lage zu machen, und achtete genau darauf, immer höchstens zweit- oder drittbester Schüler in meiner Klasse und bei unzähligen unsinnigen Schulwettbewerben zu werden, um nicht auch noch besondere repräsentative Aufgaben und öffentliche Auftritte für meine Schule absolvieren und an entsprechenden landesweiten Wettbewerben teilnehmen zu müssen. Über die Jahre konnte ich mich also anpassen und meine Eltern sowie die Lehrer einigermaßen zufrieden stellen. Ich wusste längst, dass Leben meistens Leiden war und fügte mich in mein aussichtsloses Schicksal.
In diesem trüben Bewusstsein kam ich auch am Morgen des ersten Schultags der achten Klasse mit gewohnten Magenkrämpfen pünktlich zum Unterricht. Die gedämpfte Aufregung und das allgemeine Unwohlsein der Schülerschaft waren am ersten Schultag nach den Sommerferien vielleicht etwas größer als an einem ganz gewöhnlichen Tag, aber alles in allem lief auch an diesem Schultag alles wie eh und je an der Gelehrtenschule mit Tradition und Zukunft, wie es in der Werbung des Johanneums so schön hieß. Ich dachte einmal mehr, dass man auch leicht die schlechtesten Aspekte von Tradition und Moderne verbinden konnte und dass dies an meinem Gymnasium vielfach geschah. Der Werbeslogan „Zukunft braucht Herkunft“ zeigte dabei deutlich, dass an der Gelehrtenschule des Johanneums ausschließlich Kinder reicher Eltern erwünscht und willkommen waren. Aber wenigsten konnte ich meine Freunde in der Schule wiedertreffen. Wir gingen nach einigen kurzen Begrüßungen auf dem Schulhof oder in der Halle eine Treppe hinauf in unsere Klasse im ersten Stock, die bereits von Herrn Schütz, dem alten Hausmeister, aufgeschlossen worden war. Dort begaben wir uns hier und da verschlafend murmelnd an unsere angestammten Plätze, wo wir unsere Arbeitsmaterialien aus den Schultaschen hervor holten und vor uns auf den Tischen bereit legten.
„Guten Morgen“, sagte unser Klassenlehrer Dr. Zander schneidig, nachdem er pünktlich mit dem Klingeln zur ersten Stunde mit gestrengem Blick den Klassenraum betreten und seinen Aktenkoffer zackig neben dem Lehrerpult abgestellt hatte.
„Guten Morgen, Herr Dr. Zander!“, rief die ganze Klasse im Chor. Wir standen alle ehrfürchtig und stramm hinter unseren Tischen und schauten unseren Lehrer unterwürfig und erwartungsvoll an.
„Setzen“, sagte Dr. Zander, ein Deutsch- und Lateinlehrer, der etwa fünfzig Jahre alt war, kurze graue Haare hatte und immer in dunkelgrauem oder dunkelblauem Anzug mit Krawatte in der Schule erschien. Alle Schüler setzten sich wie ein Mann, völlig lautlos.
„Aufsatz“, sagte der Reserveoffizier in maßvollem Kommandoton. „Thema: Was ich in den Sommerferien für meine Bildung getan habe. Bearbeitungszeit: 45 Minuten. Wird benotet.“
Wir schlugen alle gleichzeitig zügig, aber nicht zu hektisch, unsere Deutschhefte auf und griffen zu den ordnungsgemäß vor uns bereitliegenden Füllern, um dem Arbeitsauftrag eifrig nachzukommen. Dr. Zander blickte eine Zeit lang wachsam in der Klasse umher, um sicherzustellen, dass alle frisch und konzentriert am Werk waren. Dann griff er zu dem auf dem Lehrerpult bereitliegenden großen grünen Klassenbuch und machte mit ernster Mine seine Eintragungen, bis er es zackig wieder zuklappte und beiseite legte. So schrieben wir alle strebsam mit gesenkten Köpfen unsere Aufsätze unter den strengen Blicken von Dr. Zander und unter den hoheitlichen Blicken von Bundespräsident Jürgen Gurke, der von einem schwarz eingerahmten Foto an der Wand auf uns herab blickte. Zu beiden Seiten des multifunktionalen digitalen Whiteboards an der Stirnseite des Klassenzimmers standen große weiße Steinbüsten von Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller, die uns düster und erhaben bei der Arbeit betrachteten.
Es ging also wieder alles seinen gewohnten und trostlosen Gang. Ich konnte nicht ahnen, dass sich in diesem Jahr doch etwas für mich verändern sollte.
Malina
„Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben!“, rief Frau Binder in singendem Tonfall, als sie sich am ersten Schultag nach den Sommerferien durch die wartenden Kinder zur Tür drängelte, um das Klassenzimmer aufzuschließen. Als sie die Tür unter dem albernen Kichern und den dummen Sprüchen der Schüler schließlich mit einiger Mühe erreicht hatte, brauchte sie noch über eine Minute, um den richtigen Schlüssel zu finden und endlich aufzuschließen. Dann stürmten alle in den Klassenraum und pfefferten ihre Rucksäcke neben die Stühle und auf die Tische. Viele Kinder unterhielten sich und liefen weiter im Raum herum. Einige holten ihre Smartphones oder irgendwelche kleinen Videospiele heraus und beschäftigten sich damit, ohne auf die Lehrerin zu achten.
Frau Binder war meine neue Klassenlehrerin in der achten Klasse meiner neuen Schule, auf der Albert-Schweitzer-Stadtteilschule in Hamburg. Sie war eine freundliche und etwas tolpatschige junge Frau, mit langen dunkelblonden Haaren, ungefähr dreißig. Um kurz nach acht Uhr hatte sie mich vor dem Lehrerzimmer abgeholt und dann gleich mit über den Schulhof genommen, zum Klassenraum in einem anderen kleinen Gebäude mit vier Klassenzimmern. Von diesen kleinen Gebäuden gab es hier mehrere, die über das ganze Schulgelände verteilt waren. Jeweils vier Klassen der gleichen Klassenstufe waren da meistens in so einem Gebäude, wie ich morgens, als ich noch vor dem Schulbüro warten musste, auf einer Karte gesehen hatte.
Fünf Minuten beschäftigte sich Frau Binder, deren Unterrichtsfächer Deutsch und Kunst waren, erstmal mit irgendwelchen Heften und Mappen am Lehrerpult und sortierte irgendetwas in die Schubladen ein.
„Wo ist das Klassenbuch!?“, rief sie zwischendurch mehrmals in die laute Klasse, bis sie irgendwann eine Markierung in einer Namensliste gefunden hatte.
„Aysche?“, sprach sie ein kleines dickes Mädchen mit Kopftuch an, das gerade in sein Smartphone vertieft war und dort irgendwas eintippte. „Jetzt seh´ ich, du bist ja nach der Liste dran als neue Klassenbuchführerin, ne?“
„Was?“, fragte das Mädchen. „Keine Ahnung, scheiße, hab vergessen.“
„Wärst du dann vielleicht so freundlich“, fragte Frau Binder, „es jetzt aus dem Schulbüro zu holen, Aysche?“
„Kein Problem, man“, sagte das türkische Mädchen mit starkem Akzent. „Hol ich gleich her, Frau Binder.“
Daraufhin tippte Aysche noch ein paar mal auf das Display ihres Smartphones und schlurfte dann langsam aus der Klasse. Frau Binder schaute ihr mit schief gelegtem Kopf und nachsichtigem Lächeln hinterher, bis sie draußen war und die Tür des Klassenzimmers offen stehen ließ. Die Lehrerin klatschte mehrmals laut in die Hände und versuchte vergeblich, für etwas Ruhe in der Klasse zu sorgen.
„Bis das Klassenbuch da ist“, rief sie und schaffte es kaum, den Geräuschpegel im Raum zu übertönen. „Bis Aysche mit dem Klassenbuch wieder da ist, möchte ich euch eine neue Schülerin vorstellen!“
Einige Kinder hatten mich schon etwas misstrauisch oder amüsiert angeguckt, aber noch niemand hatte mich bisher angesprochen.
„Ähm, wie heißt du nochmal, entschuldigung“, sagte die Lehrerin und schaute nochmal auf eine Namensliste. „Ach ja, Malina“, fuhr sie fort, „komm doch bitte mal mach vorne.“
Ich hatte bisher im hinteren Bereich der Klasse gestanden, wo ich nach dem Aufschließen des Raumes einfach stehen geblieben war. Ich hatte keine Ahnung, was ich sonst machen sollte, und kam mit total blöd vor, wie ich mich schüchtern in der Klasse umgeschaut habe und sich niemand um mich gekümmert hat. Jetzt ging ich nach vorne zu Frau Binder neben das Lehrerpult vor der grünen Schiefertafel.
„Ruhe, bitte!“, rief Frau Binder. „Ruhe jetzt, ich will euch eure neue Mitschülerin vorstellen! Also, das ist Malina. Willst du nicht ein bisschen über dich erzählen, damit wir dich besser kennen lernen?“
Es wurde ein bisschen ruhiger in der Klasse, sodass man mich einigermaßen verstehen konnte.
„Hallo, ich bin Malina“, sagte ich leise. „Ich bin vierzehn Jahre alt und gerade mit meiner Familie von Berlin nach Hamburg gezogen.“
„Hahaha!“, lachte plötzlich ein dünner Junge in einem T-Shirt von Counterstrike mit ziemlich langen fettigen braunen Haaren, verpickeltem Gesicht und hässlichen großen schiefen Zähnen. „Ich dachte schon, du kommst aus dem Urwald, hehehe! Du bist so schwarz wie Teer, hoho! Bist du etwa die Tochter von King Kong?! Uuh, uuh, uuuhh!!!“
Er sprang auf, trommelte sich auf die vorgestreckte Brust und machte kreischende Affengeräusche nach. Die meisten anderen fingen dämlich und gehässig an zu gackern und der Junge freute sich über seinen gelungenen Auftritt und grinste schwachsinnig in die Runde.
„Iwan!“, rief Frau Binder ihm zu. „Das ist aber gar nicht nett! Reiß dich bitte etwas zusammen!“
„Halt´s Maul!“, rief ich wütend. „Meine Eltern kommen aus Ghana, du dummer Penner!“
Ich wollte mich am liebsten gleich auf diesen bescheuerten Iwan stürzen und ihm seine hässliche Fresse polieren! Aber ich wollte nicht gleich einen so schlechten Eindruck machen und konnte mich gerade noch zurückhalten, als Iwan sich wieder hinsetzte und nichts mehr sagte und die ganze Klasse wieder etwas ruhiger wurde.
„Setz´ dich doch am besten da vorne hin, Malina“, sagte Frau Binder, fasste mich sanft an der Schulter und zeigte auf einen Platz rechts vor dem Lehrerpult. „Ich glaub, da is´ noch frei, oder?“
Ich setzte mich auf den freien Platz und legte meinen Rucksack auf den Tisch. Inzwischen war Aysche mit dem großen grünen Klassenbuch wieder dar, schlurfte durch den Raum nach vorne und schob es auf das Lehrerpult.
„Danke, Aysche“, sagte Frau Binder. „Sooo, die Klassenliste, ich geh die eben durch. Ach, ich seh´ schon, sieben Leute fehlen heute. Aktion kleine Klasse! Die haben sich wohl im Urlaub verlaufen, was!?“
„Witz komm raus, hehehe!“, rief ein dicker arabischer Junge, der ganz hinten links in der Klasse saß. Währenddessen begannen ein paar andere Schüler, mit Papierkügelchen durch den Klassenraum zu werfen. Einige landeten vorne auf meinem Tisch, auf dem Lehrerpult und an der Tafel dahinter.
„Hey, Leute!“, rief Frau Binder und sprang hektisch von ihrem Stuhl auf. „Das kann doch nicht so weiter gehen wie letztes Schuljahr! Wir haben das doch schon tausendmal besprochen!“
„Eine Frau kann keine Lehrerin sein!“, rief der arabische Junge bestimmend mit irgendeinem Akzent. „Allah und Mohammed sagen, nur Männer dürfen Lehrer sein! Eine Frau hat mir gar nichts zu sagen!!!“
„Hamid!“, rief Frau Binder. „Reiß dich mal zusammen! So ist das vielleicht bei euch in Afghanistan, aber hier in Deutschland sind Männer und Frauen gleichberechtigt und es müssen sich alle an unsere Regeln anpassen.“
„Was soll das?!“, rief Hamid wütend. „Bis du etwa ausländerfeindlich, oder was?! Ich beschwer´ mich beim Schulleiter! Ich will einen Mann als Lehrer!“
„Ich auch!“, rief Iwan und kicherte albern. „Aber auch keine Schwuchtel, keine schwule Sau, hehehehe!“
„Neee, Digga, bestimmt keine Schwuchtel, Digga!“, rief Hamid. „Ein Lehrer der an Allah und Mohammed glaubt, Digga! Sonst sagt mir keiner was!“ Dann schlug er wütend auf den Tisch und brüllte die Lehrerin an: „Und du musst ein Kopftuch tragen, wie Allah es verlangt, der dich geschaffen hat!!!“
„Schluss jetzt!“, rief Frau Binder. „Wir haben diese Themen schon tausendmal diskutiert, aber von euren Eltern kommt ja fast nie jemand zum Elternabend, sonst könnte man das vielleicht mal besser klären. Die Lehrer und Klassen werden von der Schulleitung eingeteilt und da wird nicht darauf geachtet, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich bin eure Klassenlehrerin und das muss jeder akzeptieren! Wer die Regeln verletzt, die hier ganz deutlich an der Wand stehen, den melde ich der Schulleitung und es gibt wieder Briefe an die Eltern und Verwarnungen!“
Dabei zeigte sie auf ein großes weißes Plakat, das hinter ihr neben der Tafel an der Wand hing und auf dem mehrere Klassenregeln in dicker schwarzer Schrift standen.
„Mein Vater spricht nich´ mit ´ner Frau, die mir sowas erzählen will!“, meinte Hamid. „Und schon gar nich´ mit ´ner Ungläubigen! Der zerreißt die Briefe! Passiert ja doch nichts bei den scheiß Verwarnungen!“
„Was soll eigentlich Malina denken, bei so einen Empfang?“, fragte Frau Binder und ich fühlte mich ganz schlecht, weil die Aufmerksamkeit in diesem Streit plötzlich auf mich gelenkt wurde. Sie blickte hinter sich auf die große runde schwarz-weiße Uhr, die über der Schiefertafel hing. Die erste Schulstunde war schon fast vorbei.
„Wir müssen jetzt auch wirklich mal mit dem Unterricht anfangen“, sagte die Lehrerin. „Also, liebe Leute, jetzt waren ja die Sommerferien und ich möchte, dass ihr alle aufschreibt, was ihr so in den Ferien gemacht habt, ja?“
„Dürfen wir auch in Gruppen arbeiten?“, fragte ein kleines zierliches Mädchen mit Kopftuch, dass zwei Plätze neben mir direkt vor dem Lehrerpult saß.
„Äh, ja okay, Aylin“, sagte Frau Binder. „Wenn ihr euch gegenseitig dabei mal erzählt, was ihr in den Ferien gemacht habt, wo ihr vielleicht im Urlaub wart oder so. Aber dann muss auch jeder was dazu in sein Deutschheft schreiben. Und es wäre besonders schön, wenn ihr auch ein Bild dazu malt, das etwas mit euren Sommerferien zu tun hat, dafür könnt ihr euch auch buntes Papier holen. Später sollt ihr das in der Klasse vorlesen und die schönsten Bilder könnt ihr dann an die Wände hängen, wenn ihr wollt. Frohes Schaffen!“
Daraufhin standen einige Kinder auf und gingen durch die Klasse. Sie setzten sich zueinander an die Tische. Die Zweiertische waren jeweils zu dritt zusammen gestellt, sodass bei dieser Sitzordnung normalerweise sechs Kinder daran sitzen konnten. Da heute nur sechzehn Schüler da waren und die übrigen sieben aus der Klasse fehlten, blieb aber viel mehr Platz, und es bildeten sich einige kleine Gruppen. Die Schüler redeten miteinander und einige fingen irgendwann an, etwas in ihre Hefte zu schreiben. Einige holten sich aus einem Regal große farbige Papierbögen und begannen, darauf etwas zu malen. Ein paar Jungen um Hamid und Iwan bildeten eine kleine Gruppe, die sich mit ihren gezückten Smartphones in eine hintere Ecke des Raums verzog und dort irgendetwas machte, das bestimmt nicht sehr viel mit dem Arbeitsauftrag von Frau Binder zu tun hatte. Aylin und Aysche hatten sich mit noch einem türkischen Mädchen zusammengesetzt und schauten manchmal heimlich zu mir herüber. Ich traute mich aber nicht, jemanden anzusprechen, und wusste nicht, ob sie etwas mit mir zu tun haben wollten. Also holte ich mein neues Schreibheft aus dem Rucksack und schrieb etwas über meine Sommerferien auf. Ich war ja ein paar Wochen bei unseren Verwandten in Ghana gewesen und darüber konnte ich ein bisschen schreiben. Aber einiges war mir etwas zu peinlich, wie diese wilden Stammestänze und dass man bei den Festen das Blut von Kühen trankt und so etwas. Wenn ich das vorlesen müsste, würde dieser bescheuerte Iwan bestimmt gar nicht mehr aufhören, mich aus zu lachen und mich weiter zu mobben. Also achtete ich vorsichtshalber darauf, nur einigermaßen normale Erlebnisse aus Afrika zu berichten.
„Macht das dann bitte als Hausaufgabe fertig“, sagte Frau Binder später, als es zum Ende der Doppelstunde klingelte und während die meisten Schüler schon tobend herum liefen oder in die Pause hinausgingen.
„Aylin!“ rief Frau Binder plötzlich und winkte mich ebenfalls zu sich heran. „Könntest du dich vielleicht etwas um Malina kümmern? Ihr den Schulhof und die Pausenhalle zeigen und so. Und ihr zeigen, wo die Fachräume sind und die Sporthalle und so weiter, ne? Das wäre wirklich lieb von dir.“
„Ja, Frau Binder“, sagte Aylin schüchtern unter ihrem Kopftuch.
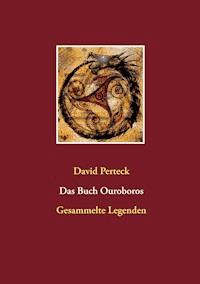
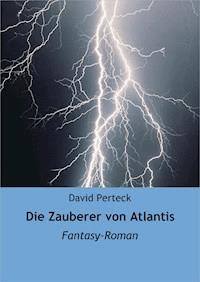













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













