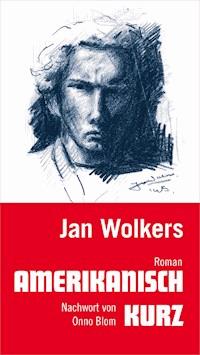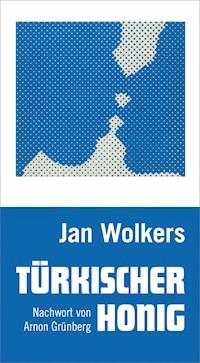
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alexander
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leidenschaftlich lieben sich der namenlose Ich-Erzähler, ein Bildhauer, und die junge Olga. Wie im Rausch leben sie in seinem Atelier in Amsterdam und genießen - zum Entsetzen vonOlgas kleinbürgerlicher Familie - ihre Liebe in vollen Zügen. Überraschend wird der Erzähler von Olga verlassen und bleibt verzweifelt und voller Unverständnis zurück. Nach Jahrenkommt es zu einem Wiedersehen. Als er glaubt, sie zurückgewonnen zu haben, verliert er sie für immer. Mit 'Turks Fruit' gelingt Jan Wolkers 1969 der internationale Durchbruch als Schriftsteller. Der autobiographisch geprägte Roman wurde bis heute in vierzehn Sprachen übersetzt und 1973 von Paul Verhoeven verfilmt. Er zählt in den Niederlanden für jede neue Generationvon Lesern und Schriftstellern zu den prägenden Leseerlebnissen - wie etwa Fausers 'Rohstoff' im deutschsprachigen Raum. Die Kritik betont die stilistische Nähe zur amerikanischenBeat-Literatur: Wolkers schreibt offen und freizügig über Einsamkeit, Leidenschaft,Haß, Verfall, Tod und Sexualität, bedient sich einer klaren, bildhaften Sprache und schöpftdabei zumeist aus dem wahren (eigenen) Leben. 'Türkischer Honig' gehört zu den Romanen der niederländischenLiteratur des vergangenen Jahrhunderts,die großes Aufsehenerregten, und gilt als Ikone einer Generation. Mit 'Türkischer Honig' entfesselte Jan Wolkers einenSturm von Emotionen - sowohl Bewunderung als auch Wut. Er brach eine Lanze für sexuelle, religiöse und künstlerische Freiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
JAN WOLKERS
TÜRKISCHER HONIG
Roman
Aus dem Niederländischen von Rosemarie Still
Mit einem Essay von Onno Blom und einem Nachwort von Arnon Grünberg
ALEXANDER VERLAG BERLIN | KÖLN Bdc
Die Übersetzung wurde vom Nederlands letterenfonds gefördert.
»Türkischer Honig« ist eine im Deutschen oft benutzte Bezeichnung für Lokum, eine orientalische weiche Süßigkeit auf Sirupbasis, die im Niederländischen »Turks fruit« genannt wird.
Eine Publikation des Bureau de Cologne im © Alexander Verlag Berlin | Köln 2012 Alexander Wewerka, Fredericiastr. 8, D-14050 Berlin info@alexander-verlag.com | www.alexander-verlag.comAlle Rechte vorbehalten. Umschlaggestaltung Antje Wewerka, Abbildung: Relief Print for an exhibition of Man Ray, 1945 von Marcel Duchamp. © Succession Marcel Duchamp/VG Bild-Kunst, Bonn 2012. Die Originalausgabe erschien 1969 unter dem Titel Turks fruit. © 1969 Jan Wolkers and J. M. Meulenhoff bv, Amsterdam.
Der Autor, Maler und Bildhauer Jan Wolkers (1925–2007) ist einer der wichtigsten niederländischen Schriftsteller und Künstler der Nachkriegszeit.
Mit Turks Fruit gelingt Jan Wolkers 1969 der internationale Durchbruch als Schriftsteller.
Die Kritik betont die stilistische Nähe zur amerikanischen Beat-Literatur: Wolkers schreibt offen und freizügig über Einsamkeit, Leidenschaft, Haß, Verfall, Tod und Sexualität, bedient sich einer klaren, bildhaften Sprache und schöpft dabei zumeist aus dem wahren (eigenen) Leben.
Inhalt
Chicorée im Rasiertopf
Die Flügel des Hermes
Eine Pelzjacke in Bleu
Someday Sweetheart
Der Racheapfel
Requiem für einen toten Spatz
Der Überraschungsautomat
Marxistische Gartenzwerge
Peel me a grape
Eine traumatisierte Maus
Miss Wespentaille
Die anatomische Grundstellung
Die Hexenzentrale
Cäsar und Brigitte Bardot
Sicherheitsstreichhölzer
Die Verwünschungsnägel
Nice Dolls & Judaspuppen
Fuck me I’m desperate
Rosa Turbinata
Das Wetter ist genauso schlecht wie die Menschen
Zur Entstehungsgeschichte von Turks fruit von Onno Blom
Beinhart und richtig im Takt
Nachwort von Arnon Grünberg
Für Olga Stabulas
RASTAPOPOULOS: Ich, schlecht? Jawohl, ich bin die Schlechtigkeit in Person! Das bin ich. Ich möchte den sehen, der das bestreiten könnte!
CARREIDAS: Verzeihung. Aber die Schlechtigkeit in Person bin ich! Außerdem bin ich viel reicher als Sie!
RASTAPOPOULOS: Möglich, aber ich habe meine drei Brüder und meine zwei Schwestern ruiniert, nachdem ich meine Eltern ins Armenhaus gebracht hatte. Was sagen Sie jetzt?
CARREIDAS: Das ist gar nichts! Ich, ich habe meine Großmutter so gequält, daß sie vor Kummer gestorben ist!
RASTAPOPOULOS: Jetzt hab ich’s aber satt! Geben Sie endlich zu, daß ich schlechter bin als Sie?
CARREIDAS: Niemals! Niemals, verstehen Sie? Lieber sterbe ich!
Zitiert nach: Hergé, Tim und Struppi – Flug 714 nach Sydney, Carlsen Comics, 1999. Deutsch von Ilse und Gilbert Strasmann.
Jan Wolkers Ehrenmitglied Pop-Music
CHICORÉE IM RASIERTOPF
Mein Leben war voll abgeschmiert, nachdem sie mich verlassen hatte. Ich arbeitete nicht mehr, ich aß nicht mehr. Ich lag den ganzen Tag in meinem versifften Bett und holte mir einen runter, Fotos und Nacktaufnahmen von ihr direkt vorm Gesicht. Und auf die Dauer glaubte ich beim Wichsen wirklich zu sehen, daß sie mit ihren stark getuschten Wimpern blinzelte, daß ihre Lippen voll wurden und sich feucht vorwölbten, und ich meinte ihre Schreie zu hören, wenn sie kam. Heftig wie am Anfang, als sie noch nicht gelernt hatte, den Genuß für sich und mich zu behalten, sie wollte ihn in die ganze Welt hinausschreien – so daß eine Nachbarin sie mal gefragt hatte: »Was stellt er eigentlich mit dir an?« Und ein Nachbar zu mir sagte: »Hört sich an, als hättet ihr einen Wurf junger Hunde in der Wohnung.« Ich las ihre Briefe wieder und schrieb Sätze daraus an die Wand: Als ich dich verlassen hatte, mußte ich in eine Apotheke rennen und blutstillende Watte kaufen, die war nötig, damit mein Herz in Schwung blieb. Und: Gestern abend konnte man hier in der Stadt das Heu riechen. Ich sehne mich so nach dir. Während ich dir schreibe, macht meine Möse Saugbewegungen wie ein Babymund. Ich zermarterte mir das Hirn, um zu verstehen, was bloß schiefgelaufen war, warum sie mich wegen eines solchen Scheißkerls, einem Klinkenputzer, so einem hochaufgeschossenen Typ mit Hohlkreuz verlassen hatte. Meine Kopfhaut schmerzte schon vom Denken und Grübeln. Ich fand keine Antwort, ich kapierte es einfach nicht. Wie hatte sie sich so vergiften lassen können. Von dem fiesen Aas, das sich ihre Mutter nennt. Und dann holte ich mir wieder einen runter vor diesem Nacktfoto – eine Rückenansicht. Sie hat sich leicht aufgerichtet, so daß ihre Pobacken schwer nach unten hängen. Und ich schrie, scheiß, verdammt, scheiß für mich, dann leck ich dich ab. Aber nach vierzehn Tagen reichte es mir, und ich stand auf. Abgemagert und verdreckt. In der Küche fand ich in einer Bratpfanne auf dem Gasherd das letzte, was sie bei mir zubereitet hatte: zwei Frikadellen. Sie lagen in einem Daunenbett aus Schimmel, und als ich sie durchs Klo spülte, war mir nach Heulen und Lachen zugleich zumute, weil ich an die Frikadelle denken mußte, die sie, als Schülerin in einem Internat, an die staatliche Nahrungsmittelkontrolle geschickt hatte. Ich ging unter die Dusche und scheuerte meinen Körper wund mit dem Gerippe einer Seegurke, um das ihre roten Haare wie Nylongarn gewickelt waren. Und ich zog meine besten Klamotten an und betrachtete mich aufmerksam im Spiegel. Mit meinem mageren Gesicht, den wilden Locken, der schwarzen Röhrenhose und der schwarzen Lederjacke fand ich mich einfach umwerfend. Und ich flüsterte mir in vollem Ernst zu, denn lachen konnte ich nicht darüber: »Glück im Unglück.« Ich reagierte so wie der Jude in dem Witz, der von einem Freund ertappt wird, als er am Tag der Beerdigung seiner Frau aus einem Bordell kommt und sagt: »Was weiß ich denn, was ich tue in meinem Schmerz.« Ich legte ein Mädchen nach dem anderen flach. Schleppte sie ab in meine Höhle, riß ihnen die Kleider vom Leib und rammelte mich halb tot. Bevor ich sie vor die Tür setzte, bekamen sie noch schnell was zu trinken. Manchmal waren es drei am Tag. Hängetitten wie Breisäcke, mit Nippeln zum Saugen. Kleine verschrumpelte Brüste, zu jämmerlich zum Streicheln. Dann eben den Pullover nicht ausziehen. Schamhaarbüschel, hart wie Seegras, weich wie Pelz. Trockene Mösen mit Warzen innen. Eklig an den Fingern, aber angenehm am Schwanz. Mösen, die ich nicht zu sehen bekam, weil eine Hand vorgehalten wurde. Mösen, weich und feucht wie Puddingteilchen. Dralle Mädchen mit Hüften wie Käselaibe, Rotterdamer Akzent und voll rabiat, die meinen Schwanz umklammerten wie den Griff eines Drillbohrers. Die nach dem Sex gleich das Geschirr spülen, den Fußboden putzen und das Klo schrubben wollten. Schniefende Mädchen, die sich mit ihren nassen Näschen an meiner behaarten Brust ausheulten, weil sie mit fünfzehn von ihrem Vater vergewaltigt worden waren. Die Indonesierin, die sich anstellte, als sei sie noch Jungfrau, und in ihrem runden, singenden Akzent halb benommen rief: »Was machst du mit mir?« »Ich spreize deine Schenkel und steck meinen Schwanz in dich rein, und ich werde dich bumsen, bis ich deinen süßen Atem nicht mehr rieche. Los, her mit deinen klebrigen Lippen. Häng die Zunge raus, dann freß ich sie.« Die scheußlichen Kopfschmerzen beim Aufwachen, wenn wieder eine Monatsbinde unters Kopfende meiner Matratze gestopft worden war. Das Blut schwarzbraun wie Ahornsirup. Die Filzläuse, die sie dir mitbrachten wie graue Hautschuppen und die Grüße vieler Freunde aus fernen Ländern. Und ich schrieb all diese kurzlebigen Begegnungen in ein Tagebuch. Oft klebte ich eine Haarsträhne und gelegentlich Schamhaare dazu, wenn ich sie so weit hatte bringen können. Und wie ich sie verführt hatte und sie manchmal mich. Was sie gesagt hatten, und was ich gesagt hatte. Für eine Frau ist nun mal nichts attraktiver als ein Mann, der einer verflossenen Liebe nachweint. Aber nach ein paar Monaten kotzte es mich an. Ich kam wieder etwas zur Ruhe und vermietete ein Zimmer an zwei amerikanische Studentinnen, von denen ich die Finger ließ. Sie studierten Kunstgeschichte und hatten zwischen einer Reproduktion von Hans Memlings Lamm Gottes und dem unvermeidlichen Selbstporträt von dem Irren aus Arles mit dem Kopfverband Sprüche an die Wand gepinnt: THERE’S NOTHING SADDER THAN ASSOCIATIONS HELD TOGETHER BY NOTHING BUT THE GLUE OF POSTAGE STAMPS. Und: ONE WHO PUTS SALT IN THE SUGAR BOWL IS A MISANTHROPE. Jeden Freitag brachten sie vom Markt mickrige, in eine fettige Zeitung gewickelte Schollen mit, obwohl sie nicht katholisch waren. Zum Salzen legten sie sie einfach ins Spülbecken, das von meinem Schleimauswurf und meiner Pisse glitschig war und nach fauligem Salat stank. Sie waren zu blöd, um zu begreifen, daß sie den Fisch auf einen Teller hätten legen müssen. Darum sagte ich auch nichts, als ich sah, wie sie eines Tages in meinem alten Rasiertopf Chicorée auf dem Herd stehen hatten und die am Rand angepappte Seife mit den schwarzen Stoppeln darin langsam im kochenden Gemüse wegschmolz. Es hatte doch keinen Sinn. In Amerika schmeckte sowieso alles nach Seife, hatten sie mir mal erzählt. Deshalb gingen sie mindestens viermal am Tag unter die Dusche, die direkt über der Toilette war, so daß ich sie planschen und kichern hörte, wenn ich gemütlich auf dem Klo saß und die Zeitung las. Und weil sie so lange auf dem Abfluß hockten, sickerte das Wasser durch die Risse nach unten. Zuerst waren die Wände nur feucht, aber ein paar Monate später zählte ich sieben verschiedene Schimmelarten. Und kurz darauf wuchsen kalkartige Warzen aus Wand und Decke, als pflanze sich die Scheidenflora der Mädchen durch den Fußboden hindurch fort wie eine wuchernde Koralle. Auch dazu sagte ich nichts, denn schließlich benutzte auch ich die Dusche. Jeden zweiten Tag, so war es abgemacht. Ich ging dann in Unterwäsche in ihr Zimmer. Sie saßen auf dem Sofa und steckten ihre amerikanischen Stupsnasen in ihre Bücher, buchstabierten laut die holländischen Wörter. Von den Katakomben bis Greco, diese Art Shit. Dann zog ich die Unterhose und das Unterhemd aus und legte sie als Häufchen auf den Boden. Ich hatte den Verdacht, daß sie mir noch schnell in den Arsch gucken wollten, bevor mein behaarter Körper in der Dusche verschwand. Und dann gleich wieder weiterlasen, über Giotto und Cimabue, oder andere alte Säcke. Wenn ich gut drauf war, steckte ich noch mal kurz den Kopf raus und sagte: »Rembrandt ist der größte Pfuscher des siebzehnten Jahrhunderts.« Sie erstarrten und wagten nicht, zu mir hinzusehen, weil sie nicht ahnten, was da aus der Tür ragte. Unter lautem Singen von The Stars And Stripes Forever drehte ich den Hahn auf. Unter dem lauwarmen Wasser hielt ich mein erigiertes Glied in der Hand und stellte mir vor, ich würde so in ihr Zimmer gehen, mich zwischen sie legen und mir von ihren begierigen Dollarhändchen eiskalt und hart einen runterholen lassen. Sie würden das Sperma auf meinem Bauch verstreichen und die abgelösten Marken von den Briefen aus Amerika (von Grace Anderson alias Miss Lonely Hearts oder Babe Sherman) draufkleben, mit Abbildungen der Freiheitsstatue, darüber im Halbkreis die Wörter IN GOD WE TRUST und am unteren Rand LIBERTY. Oder mit den Abbildungen eines ihrer alten historischen Knacker, einem alten zahnlosen Weib in Hellgrün oder sanftem Lila aus ihrer ruhmreichen Vergangenheit als Indianer-, Bison-, Neger- und Brudermörder. Aber dazu kam es nie. Allerdings beschwerten sie sich am Anfang darüber, daß ich nackt in die Dusche ging und nackt wieder herauskam. Ich antwortete ihnen nicht, ging hinunter, legte meinen Schwanz am Tischrand auf ein Stück Papier, zeichnete den Umriß nach, schrieb MY PENIS darüber und schob es bei ihnen unter der Tür durch. Sie haben den Wisch nicht zwischen ihre Reproduktionen und Sprüche an die Wand gepinnt, und im Mülleimer fand ich ihn auch nicht. Ich vermute also, eine der beiden hat ihn wie ein Kleinod in ihrem schmuddligen Schlüpfer versteckt und läuft bis zum heutigen Tag damit herum. Aber sie setzten einen jungen Amerikaner auf mich an, den sie in der Stadt kennengelernt hatten. Einen pummeligen mit Bürstenhaarschnitt, der aussah wie ein Teddybär, aber mit bösartigen, hellen Augen. Er kam in seiner Funktion als Diakon der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Vermutlich hatten sie ihm meine Zeichnung gezeigt, und er wollte seine Bekehrung damit beginnen, die Erektion auf Normalgröße zurückzubringen, so unter dem Motto »Mein Erlöser hängt am Kreuz«. Jedenfalls gab er mir gleich eine Visitenkarte mit dem farbigen Bildchen eines scheußlichen Gebäudes, das die Kuppel eines Tempels, die wie ein mißglücktes Ei aussah, bewachte. Den »Latter-day Saints«-Tempel bei Salt Lake City in Utah. Als er mir mit einer Predigt über Das Buch Mormon kommen wollte, sagte ich ihm, die Amerikaner seien überhaupt nicht religiös. Ihr ganzes Denken kreise nur um harte Dollars. Mormon sei die Abkürzung für More Money, das wisse er doch auch. Er schüttelte den Kopf und blieb gelassen. Schließlich kann man ja nicht gleich Napalmbomben werfen. Doch als er drei kleine Figuren aus der Tasche holte, sie wie Halmasteine auf den Tisch stellte und erklärte, das seien die heiligen Apostel Peter, John und James, konnte ich es mir nicht verkneifen, die Hose aufzuknöpfen, meinen Schwanz vorzuholen und zu sagen: »And this is the holy Habakkuk.« Kopfschüttelnd und mit leichtem Bedauern über das verlorene Absatzgebiet zog er ab. Die drei heiligen Apostel grapschte er vorher noch schnell wie Kleingeld vom Tisch und steckte sie ein. Und er ließ sich nie wieder blicken. Ihre anderen Freunde sah ich hingegen um so öfter. Bläßliche umherstrolchende amerikanische Studenten, ohne Dach überm Kopf und mit einem Stipendium, das fürs Leben nicht reichte und fürs Sterben zu viel war. So daß sie rastlos durch ein Niemandsland austauschbarer Mädchenzimmer streunten, in den tiefen Taschen ihrer abgewetzten Armeejacken Popcorn, Kaugummi und Roggenbrot. Von Stavanger bis Neapel. Als ich eines Morgens zur Dusche ging, waren es fünfzehn. Sie schliefen auf dem Boden, in graue Pferdedecken oder indianische Tücher gewikkelt, oder kauten lustlos auf einem Erdbeermarmeladenbrot herum. Ich ging zwischen ihnen durch wie durch eine Kolonie Seehunde. Vorsichtig, um nicht auf Schwänze oder Flossen zu treten. War einer mit einer Gitarre darunter, sangen sie den ganzen Nachmittag Volkslieder, die ähnlich klangen wie »Eine Seefahrt, die ist lustig« oder »Wem Gott will rechte Gunst erweisen«, nur eben auf amerikanisch. Manchmal so laut, daß die Nachbarn mich anriefen mit der Bitte, das Radio leiser zu stellen. Fragte ich die Mädchen, ob sie sich nicht mit einem der Jungs ein Verhältnis vorstellen könnten, hoffend, der Rest würde dann den Rückzug antreten, zogen sie ein mäklerisches Gesicht. Der eine sei »too hot to handle«, ein anderer kaue sein »chewing gum too loudly«. So schliefen sie also weiterhin auf dem harten Fußboden, fraßen sich durch und duschten. Aber die Stalaktiten an der Decke meiner Toilette wuchsen beängstigend, schließlich wurden sie mit Bakterien, Smegma und Schorf aus allen fünfzig Staaten von Amerika reichlich versorgt. Als sich die Mädchen zu allem Übel noch ein Dutzend Sittiche anschafften und sie im Zimmer herumfliegen ließen, so daß mir, wenn ich aus der Dusche kam, Vogelschiß und Federchen zwischen den Zehen klebten und ich mich vor Schmerzen krümmte, weil mir das Vogelfutter in die Fußsohlen piekste, war das Maß voll. Ich warf die Clochards von Uncle Sam raus, riß die Fenster auf und fegte die Wellensittiche mit dem Teppichklopfer auf die Straße hinaus, als spielte ich Federball. Die Mädchen, die blaß und heulend die Vögel aus den Sträuchern vor dem Haus mit ihren Tüllkopftüchern einfangen wollten, brüllte ich an, sie sollten sich zum Teufel scheren mit ihrem Popcorn und den Sweet potatoes. Das Zimmer sei fristlos gekündigt, damit die Mistvögel mit ihren Krummschnäbeln nicht alle vier Wände des Zimmers bis auf den blanken Putz abknabbern würden. Noch am selben Nachmittag sorgten sie für einiges Aufsehen in der Straße, als sie mit ihrem Hausrat auf einem Lastenfahrrad abzogen, im Schlepptau ungefähr zehn ihrer Jungs; alle trugen ein paar Wellensittiche in Keschern, die sie noch schnell im Anglerbedarf-Laden um die Ecke gekauft hatten. Und sie gaben mir sogar noch die Hand. Da fühlte ich mich dann doch ein bißchen mies. Es hätte mir eingeleuchtet, wenn sie mich vorwurfsvoll gefragt hätten, ob das nun der Dank für die Marshall-Hilfe sei. Oder mir den Spruch an den Kopf geworfen hätten, den sie in der verwohnten Bude an der Wand hatten hängen lassen: ONE WHO PUTS SALT IN THE SUGAR BOWL IS A MISANTHROPE.
DIE FLÜGEL DES HERMES
Ich wußte, daß die Unterseite des niedrigen Sessels, in dem er immer saß, eine Miniaturberglandschaft aus getrockneten Popeln war. Er pulte sie mit dem kleinen Finger aus der Nase, rollte sie zu Kügelchen, die er Hügelchen nannte, und drückte sie sorgfältig unter den Sessel. Das war eine der ersten Marotten, die sie mir von ihrem Vater erzählte, den sie sehr liebte. Ihre Mutter habe sich zu Tode geschämt. Denn die Putzfrau hatte es beim Saubermachen entdeckt. Sie dachte zuerst, daß es Holzleim oder Harz war, und versuchte, das Zeug mit den Fingernägeln abzukratzen. Aber selbst mit dem Brotmesser sprangen nur ein paar Schuppen ab. Also ließen sie die grünlichgelben Reliefs so, wie sie waren, weil ja doch noch Berge dazukommen würden. Man konnte es ihm nicht abgewöhnen. Er war die Gutmütigkeit in Person, aber wenn es um seine Popel ging, war er bockig wie ein Kind. Beim Essen legte er auch immer die Salatblätter zusammen, bevor er sie in den Mund steckte, weil sonst die Läuse wegliefen. Und wenn der Radetzkymarsch im Radio kam, sang er im Takt: Titten Arsch, Titten Arsch, Titten Arsch, Arsch, Arsch, Titten Arsch, Titten Arsch, Titten Arsch, Arsch, Arsch. Natürlich nur, wenn seine Frau nicht im Zimmer war. Aber am liebsten hörte er im Radio die Schlagersendung von und mit Peter de Boorder. Als Olga noch klein war, hatte sie sich einmal beim Essen auf den Tisch erbrochen und bitter geweint. Ihre Mutter war wütend vom Tisch aufgestanden, aber er hatte einen ihrer Teddybären genommen, ihn über die Kotze gehalten und dabei so bewegt, daß er sich immer wieder bückte, und gesagt: »Bärchen muß pucken. Bärchen muß pucken.« So lange, bis sie wieder lachte. Ich mochte diesen Mann sehr, wie er bei unseren Besuchen mit seinem rotfleckigen Gesicht und dem schwabbeligen Körper in den Sessel gequetscht dasaß. Kurzatmig, die dicken Arme auf den Lehnenwenn er nicht gerade mit seinen Popelhügelchen beschäftigt war. Obwohl er jedesmal sagte, die Amerikaner seien ein unzivilisiertes Volk, und immer wieder fragte: »Kennst du den Witz von den zwei Jungs, die nach Paris fuhren? Ha, die fuhren nicht.« Und jedesmal schüttelte er sich in seinem Sesselchen vor Lachen. Oder: »Wer leckt die Königin von hinten?« Und wenn du ihn quasi fragend ansahst, als hörtest du es zum erstenmal, sagte er: »Jeder, der eine Marke auf einen Brief klebt.« Und wieder wackelte er vor Lachen wie ein Pudding bei einem Bombenangriff. Er war viel zu dick. Er war schon jahrelang auf Diät, über die er sagte: »Fettarm macht fett.« Wenn wir für ein paar Tage bei ihren Eltern waren, umsorgte ihn seine Frau mit äußerster Liebenswürdigkeit. Nur ein Kartöffelchen und ein Löffelchen Soße von ganz unten. Wegen seiner Leber. Denn er wurde verdammt noch mal jede Woche gelber. Doch als Olga und ich einmal eher vom Tisch aufgestanden waren, weil wir ins Kino wollten, und ich noch mal kurz zurückging, um meine Zigaretten zu holen, hatte sie ihm einen Berg Kartoffeln auf den Teller geschaufelt und war gerade dabei, etliche Kellen Soße darüberzugießen. Sie sah mich feindselig und schuldbewußt an. Ich hatte sie beim beharrlichen Morden ertappt. Olga habe ich nichts gesagt. Sie hätte sich nur Sorgen gemacht, und ändern konnte sie es ohnehin nicht. Niemand hätte seine Frau davon abhalten können, ihm sein Fett zu geben. Ich haßte diese Frau. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil sie mich als den Freund ihrer Tochter immer mütterlich an sich drücken wollte, und ich so jedesmal spüren mußte, daß man ihr eine krebsbefallene Brust abgenommen hatte. Der steife Büstenhalter ohne Inhalt. Weil sie bekunden wollte, daß auch sie noch zählte, so daß man alle naselang im Badezimmer so eine in Zeitungspapier gewickelte Blutmaus auf einer Packung Monatsbinden fand. Sie kam auch immer in unser Schlafzimmer. Um uns das Frühstück zu bringen. Ein wabbeliges weichgekochtes Ei und Zwieback. Und dann blieb sie etwas doppeldeutig und elend lange im Zimmer, so daß ich, wenn ich wieder allein mit Olga im Schwefelgeruch des fachkundig geköpften Eies lag, Tagträume von ihr hatte. Daß sie uns die Bettdecke wegziehen, meinen Schwanz in ihre Tochter stecken und beim Griff an meinen Sack sagen würde: »Die Eier halte ich gut fest.« Dann würde sie ihre eine Brust mit einem eichelgroßen Nippel dran aus dem Morgenrock schütteln und Olga in den Mund stoßen. Und aus Rache, weil dieses Miststück damals schon Olga gegen mich aufhetzte, hätte ich im Badezimmer gern ihre Zahnprothese um meinen Schwanz gelegt und ins Waschbecken gewichst. Sie hatte ihren Mann im Krankenhaus kennengelernt. Er war Patient, sie die Krankenschwester. Beim Waschen, Steißbein einreiben, Fiebermessen. Sie hatte seine Eier schon gesehen, bevor er sie auch nur geküßt hatte. Er unförmig, gütig und wohlhabend. Sie hübsch, arm, gierig, und noch mit zwei Brüsten. Eine berechnende Frau, die für ihren Hund, einen Whippet, heimlich Plazentas aus dem Krankenhaus mitnahm, und dem sie beim Gassigehen, wenn er sein Geschäft gemacht hatte, das Hinterteil mit Klopapier abwischte. Vor ihren Kolleginnen machte sie Witze über ihren dicken Patienten, und die sagten zu ihr: »Du wirst dein Spottobjekt noch heiraten.« Was sie für sich längst entschieden hatte. Sie knuddelte und verwöhnte ihn dermaßen, daß sie ihn buchstäblich vom Krankenbett in den Ehehafen manövrierte. Innerhalb kurzer Zeit mästete sie ihn so, daß er ihr nicht mehr zur Last fiel und sich kaum noch bewegen konnte und nur noch imstande war, tief versunken in seinem großen amerikanischen Schlitten von seinem Haus in die Firma zu fahren, einem Großhandel für Haushaltswaren, die er nach dem Tod seines Vaters »Hermes« genannt hatte. Da seine Frau im Krieg ein heimliches Verhältnis mit einem deutschen Offizier gehabt hatte, war er sehr günstig an eine enorme Partie Messer gekommen, auf denen er natürlich sitzenblieb, weil die klobige Form und der Stempel die Herkunft verrieten. Zehn Jahre nach dem Krieg verteilte er sie noch als Werbegeschenke an seine Kunden. Kam er nach einem keuchend hinter seinem Schreibtisch verbrachten Arbeitstag nach Hause, war sie oft nicht da. Dann ging er ziellos durchs Haus und rief nach ihr wie ein dickes, krankes Kind. Wenn Olga aus der Schule kam, erwartete sie eine Atmosphäre von Kummer, Verzweiflung und Mißtrauen. Denn er wußte längst, daß seine Frau bei den Freundinnen, mit denen sie angeblich Tee trinken ging, ihre Kleider meist nicht anbehielt. Und so kam es, daß ein Hausfreund, den Olga auf Wunsch ihrer Mutter Onkel nennen mußte, am Strand zu ihr sagte, als sie dreizehn war: »Schau, wir haben den gleichen kleinen Zeh. Du bist mein Kind.« Schockiert und bestürzt dachte sie dauernd daran. Noch Jahre später. Nachdem ihr Vater sich erst einmal an die Affären seiner Frau gewöhnt und in das Unabänderliche gefügt hatte, fand er es sogar ganz angenehm. »Sie ist eine hübsche Frau«, sagte er. »Und ich bin halt ein Albino, ich kann schlecht sehen. Aber ich kann eine Stecknadel fallen hören.« Manchmal jedoch rächte er sich auf eine gutmütige Art. Wenn er das Telefon abnahm und es wieder ein Musiker oder Schauspieler für sie war. Und wenn sie auf ihren rosa Plüschpantoffeln, den Kopf voller Lockenwickler, angelaufen kam, sagte er noch schnell in den Hörer, bevor er ihn weiterreichte: »Here is cauliflower speaking.« Und einmal gab er Olga liebevoll einen Klaps auf den Hintern und meinte: »Du solltest aufpassen, ich lese gerade in der Zeitung, daß die kurvenreiche Blondine aus der Mode kommt.« Ihre Mutter warf ihr damals einen eifersüchtigen Blick zu, als wolle sie Olga die Jugend stehlen. Und mich machte es richtig geil. Die kurvenreiche Blondine. Ich lotste Olga in den Flur, schob sie vor mir her in die Toilette und vögelte sie im Stehen. Als sie kam, mußte ich die Spülung betätigen, sonst hätte sie das ganze Haus zusammengeschrien. Aber plötzlich ging es mit ihm zu Ende. Eines Morgens sagte er, er fühle sich körperlich wie ein Abtropfsieb. Er ging wieder ins Bett und kam aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Als wir ankamen, war er schon weit weg. Und so wie es mit den beiden angefangen hatte, endete es auch: Sie war die Krankenschwester eines dicken Patienten. Abends stellte sie alle Blumen aus seinem Zimmer auf den Flur, so daß es wie im Krankenhaus war. Sie lief ständig umher und schlug mit grimmiger Miene und lockerem Handgelenk das Thermometer herunter, wobei ich mich fragte, wo sie es ihm hinsteckte. Er war damals schon ein Haufen Matsch, und die Nässe sickerte durch die Matratze, so daß das Haus mit Eau de Cologne besprenkelt wurde, um den ekelhaften Fäulnisgeruch zu vertreiben. Olga zupfte den ganzen Tag nervös an einem kleinen Taschentuch herum, ihre Wangen waren geschwollen, das Weiß ihrer großen braunen Augen blutunterlaufen. Abends im Bett lag sie schlaff und seufzend in meinen Armen, nasse Haarsträhnen klebten ihr im Gesicht. Aber er ließ sich herrlich vögeln, dieser willenlose, apathische Körper. Und ich hätte sie fast dazu verführt, das Pessar nicht einzusetzen, denn nirgends ist es so sinnvoll, ein Kind zu machen, wie im Haus eines Sterbenden. Nachts wachte sie immer wimmernd auf und rüttelte mich wach. Dann versuchte ich sie zu trösten. Und dann erzählte sie mir, von Heulkrämpfen geschüttelt, sie habe wieder von dem Pferd geträumt. Das war eine Geschichte aus dem Krieg, die ihnen ein Bekannter erzählt hatte, der zur Zwangsarbeit in Deutschland gewesen war. Als die Russen vorrückten und die Deutschen vor ihnen flohen, hatte es ihn nach Berlin verschlagen. In einen verlassenen Außenbezirk. Die Bewohner hatten nichts Eßbares zurückgelassen. Zu Hunderten saßen sie wie Ratten in der Falle in einer Straße voller Schutt, durch die die Granaten flogen. Auf einmal lief ein Pferd über die Straße. Sie hörten seine klappernden Hufe auf dem Pflaster. Alle drängten sich an die kaputten Fensterscheiben und blickten sprachlos auf das Tier, das verängstigt durch die Trümmer und den Schutt trabte. Plötzlich wurde eine Tür aufgerissen, ein Mann rannte nach draußen, umklammerte den Pferdehals und versuchte, das Tier mitzuziehen. Aber das Pferd bäumte sich auf und stürzte, mit dem Mann obendrauf. Und sofort tauchte ein zweiter Mann aus einem der Häuser auf. Und zu zweit schnitten sie ein Stück Fleisch aus dem Hinterteil des Pferdes, dessen gellende Schreie das Dröhnen der Geschütze übertönte. Und immer wieder rannte jemand aus einem Haus, warf sich auf das Pferd und lief mit einem zuckenden, blutigen Stück Fleisch davon. Es hatte bestimmt eine Stunde gedauert, bis das Wimmern aufhörte. Und nur noch Haut, Gedärm, Knochen und der Kopf des Pferdes mit dem offenen Maul voll gelber Zähne in einer riesigen Blutlache lagen. Nachdem ich Olga getröstet hatte und das Pferd nun in meinem Kopf herumgeisterte, sagte sie: »Meine Mutter ist eine Hexe.« Sie schlug sich sofort auf den Mund, als ob ihre eigenen Worte sie erschreckten. Als ich sie ein Jahr später daran erinnerte, nachdem ihre Mutter zu ihr gesagt hatte, ihre verheirateten Freundinnen würden sie als hübsche Witwe meiden, leugnete sie, es je gesagt zu haben. Ein paar Tage danach starb ihr Vater. Wir durften noch einmal zu ihm, ich nach ihr, weil angeheiratet doch nie ganz dazugehört. Sein Gesicht war eine unförmige gelbe Masse, und in den wäßrigen Wülsten seiner ins Kissen gesunkenen Hängewangen zeigten sich violette Adern, die sich im Gewebe rot verästelten. Er sah mich nicht an, aber als ich mich neben ihn setzte, wußte er anscheinend doch, daß ich es war. Jedenfalls sagte er mit einer merkwürdig hohen Stimme: »Du nimmst meine rote Olga doch mit.« Ich machte mich auf eine sentimentale Geschichte gefaßt. Daß ich gut auf seine Tochter aufpassen solle, weil sie sein Augapfel sei. Aber das ersparte er mir. Er sagte, und ich glaube, er versuchte zu lächeln: »Kennst du den Witz von den zwei Jungs, die nach Paris fuhren.« Er wartete eine ganze Weile. Dann sagte er mühsam: »Ha, die fuhren nicht.« Und er wiederholte es noch einmal, kaum hörbar. Dann wurde er bewußtlos. Zwei Stunden später starb er, ohne das Bewußtsein wiedererlangt zu haben. Und sofort verwandelte sich das Haus in einen hysterischen Hexenkessel. Ständig stürmte seine Frau in sein Zimmer, und wir hörten sie vor Reue und Schuldgefühlen flennen. Sie führte lange Gespräche mit ihm und fragte ihn immer wieder dasselbe. Und dann kam sie wieder schluchzend zu uns, fiel mir um den Hals und sagte, nun sei ich das Oberhaupt der Familie. Ich solle die Bildhauerei aufgeben, damit könne ich ja nicht mal trockenes Brot verdienen, und müsse Direktor von »Hermes« werden. Der Schreck fuhr mir in die Glieder, denn ich sah mich schon lebenslang die klobigen deutschen Wehrmachtsmesser als Werbegeschenke verteilen. Als er in Velsen, dem Supermarkt des Todes, eingeäschert wurde, stritt sie sich noch mit der Direktion, die nicht die Ouvertüre zu von Reznicek spielen wollte, das sei nicht feierlich genug. Dem Verstorbenen wäre der Radetzkymarsch bestimmt lieber gewesen, aber darum zu bitten hat sie sich wohl verkniffen, weil sie natürlich wußte, daß keiner von seinen Angehörigen diesen Marsch hören konnte, ohne dabei an sein Geschmetter zu denken. Und so sackte der Sarg doch noch mit einer Fuge von Bach durch das Podest nach unten. Und ich dachte, statt der Kränze mit den Blumen und Schleifen hätte der Sessel mit seinen Popeln mit dem Sarg zum Ofen hinabgesenkt werden müssen. Denn der war sein ein und alles. Als wir einige Monate später ihre Mutter besuchten, die schwer zugange war, alles in Ordnung zu bringen, um in den Wintersport zu fahren, war der Sessel verschwunden. Und keiner wußte, wo er geblieben war.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!