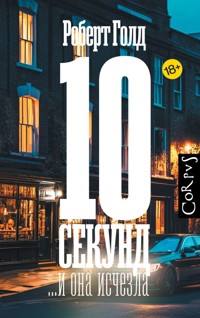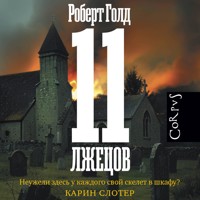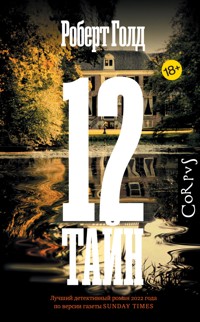9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ben Harper
- Sprache: Deutsch
In dieser Kleinstadt hat jeder ein Geheimnis ...
Eine idyllische Kleinstadt. Ein grausames Verbrechen. Ein Mörder, der zu allem bereit ist.
Ben Harpers Leben änderte sich für immer, als sein älterer Bruder scheinbar grundlos von zwei Klassenkameradinnen getötet wurde. Der kaltblütige Mord schockierte damals die Welt und katapultierte Bens Familie und ihre idyllische englische Heimatstadt Haddley ins Rampenlicht der Medien. Zwanzig Jahre später ist Ben einer der besten Journalisten des Landes und lebt wieder in Haddley. Als ein Mordfall neue Hinweise zum Tod seines Bruders liefert, beschließt Ben, zusammen mit der Polizistin Dani Cash der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Doch je mehr er in die Ermittlungen eintaucht, desto verdächtiger werden diejenigen, die ihm am nächsten stehen …
Die Thriller-Entdeckung für alle Leser*innen von Harlan Coben und Claire Douglas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Ben Harpers Leben änderte sich für immer, als sein älterer Bruder scheinbar grundlos von zwei Klassenkameradinnen getötet wurde. Der kaltblütige Mord schockierte damals die Welt und katapultierte Bens Familie und ihre idyllische englische Heimatstadt Haddley ins Rampenlicht der Medien. Zwanzig Jahre später ist Ben einer der besten Journalisten des Landes und lebt wieder in Haddley. Als ein Mordfall neue Hinweise zum Tod seines Bruders liefert, beschließt Ben, zusammen mit der Polizistin Dani Cash der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Doch je mehr er in die Ermittlungen eintaucht, desto verdächtiger werden diejenigen, die ihm am nächsten stehen …
Mehr Informationen zu Robert Gold finden Sie am Ende des Buches.
Robert Gold
Twelve Secrets
Niemand sagt die Wahrheit
Thriller
Aus dem Englischen von Ivana Marinovic
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die englische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel
»Twelve Secrets« bei Sphere, Hachette UK, London, UK.
Deutsche Erstveröffentlichung Dezember 2023
Copyright © der Originalausgabe 2021 by Robert Gold,
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH, München
Covermotiv: FinePic®, München
Redaktion: Ralf Reiter
LK · Herstellung: ik
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30329-7V005
www.goldmann-verlag.de
Für meinen Dad – den wahren Michael Noel.
Eins
»Meine eigene Vergangenheit möchte ich nie wieder durchleben.«
Kapitel 1
Die Besprechungseinladung von Madeline kam am späten Vormittag in meinen Posteingang geflattert. Sie hatte keinen Betreff, aber ich wusste sofort, worum es ging. Wenn Madeline eines ist, dann hartnäckig.
Den Nachmittag habe ich seither damit zugebracht, Zeit totzuschlagen. Den Gedanken, was Vernünftiges zu arbeiten, musste ich ziemlich schnell aufgeben, da ich unfähig war, mich auf irgendwas zu konzentrieren. Innerhalb der letzten Dreiviertelstunde drei Becher Kaffee zu trinken, hat auch nicht gerade geholfen. Und so habe ich vornehmlich den endlosen Schwall von Promi-News auf unserer 24-Stunden-Nachrichten-Webseite gelesen.
»Die königliche Familie hat sich einen neuen fuchsroten Labradoodle zugelegt«, sage ich zu Min, die mir gegenüber im Großraumbüro unserer Redaktion sitzt. »Ich wette mit dir, dass sie ihn Harry nennen.«
Min hebt bloß eine Augenbraue. Ich habe die letzte Stunde mehrfach versucht, sie in ein Gespräch zu verwickeln, obwohl ich weiß, dass sie eine Deadline hat.
»Sorry«, forme ich stumm und wende mich wieder meinem Bildschirm zu. Noch ein Hollywood-Pärchen hat seine Verlobung verkündet. Und ein Premier-League-Fußballer hat den Schädel seines Teamkollegen gegen einen Umkleidespind geknallt. Nett.
Ein Reminder, den ich nicht benötige, ploppt in meinem Terminkalender auf. Ich schaue zu Madelines Goldfischglas-Büro und sehe, wie sie wild gestikulierend auf zwei Marketingleiter einredet. Beide schrumpfen in ihrer Gegenwart zusammen. Mir selbst ist schon vor langer Zeit klar geworden, dass der einzige Weg, erfolgreich mit Madeline zusammenzuarbeiten, darin besteht, ihr die Stirn zu bieten. Es ist eine Lektion, die viele meiner Kollegen erst noch lernen müssen.
»Wirst du ehrlich zu ihr sein?«, fragt Min, als würde sie meine Gedanken lesen.
»Das versuche ich immer zu sein«, erwidere ich. Doch Madeline hat mir ihre eigene Entschlossenheit, an den Kern einer guten Story ranzukommen, eingeimpft. Und genau deswegen fürchte ich dieses Gespräch.
»Du bist ohnehin der Einzige, auf den sie überhaupt je hört.«
»Das Problem ist, dass es bei dieser Sache keinen Mittelweg gibt.«
Min verzieht mitfühlend das Gesicht, bevor sie ihre Kopfhörer aufsetzt. Ich blicke erneut durch den Raum und sehe die beiden Marketing-Typen verdruckst davonschleichen. Entschlossen klappe ich meinen Laptop zu und stehe auf.
Durch die offene Tür sehe ich Madeline in ihrem weißen Ledersessel sitzen, die Augen fest auf den Monitor vor sich gerichtet. Ohne aufzuschauen, ruft sie meinen Namen. »Ben, nur nicht trödeln.«
»Es gibt keinen Grund, sich deswegen gleich aufzuregen.« Ich betrete ihr Eckbüro, dessen deckenhohe Fenster einen unverstellten Blick auf die Tower Bridge gewähren. Hinter Madelines geschwungenem Glasschreibtisch hängen drei eindrucksvolle sonnengeflutete Fotografien, allesamt von Madeline selbst aufgenommen, wie sie mir schon zigmal erzählt hat. Die erste zeigt die Houses of Parliaments hier in London, die zweite das Weiße Haus in Washington und die dritte ihr eigenes Zuhause mit Blick auf den Richmond Park. Sie nennt sie »die drei Häuser globaler Macht«, und ich glaube, sie meint das nur halb im Scherz.
»Neunundzwanzig Komma vier Millionen«, sagt sie, den Blick immer noch nicht vom Monitor hebend. »Knapp drei Prozent runter – und diese beiden Clowns wollen mir erzählen, ich müsse mir keine Sorgen machen. Wir liegen keine zwei Millionen User vor der Mail Online. Ich habe nicht vor, unsere Erstplatzierung unter meiner Obhut zu verlieren.«
Sie erwartet keine Antwort, und ich gebe ihr auch keine. Stattdessen gehe ich um den riesigen Konferenztisch herum und setze mich ihr gegenüber.
»Außerdem rege ich mich gar nicht auf«, fügt sie hinzu. »Ich weiß, dass das hier eine schwierige Zeit für dich ist, Ben. Der Todestag deiner Mutter rückt näher, und wir alle werden in Gedanken bei dir sein.«
Ihre Stimme ist aalglatt. Sie hat das hier einstudiert, doch ich habe nicht vor, mich einlullen zu lassen.
»Deine Mutter wäre so stolz auf das, was du erreicht hast. Uns allen hat es vor zehn Jahren das Herz gebrochen. Wenn sie dich heute nur sehen könnte. Einer der besten True-Crime-Reporter des Landes. Es war ein ziemlich langer Weg, Ben, ein wahrer Triumph über diese Tragödie. Es ist an dir, die Geschichte zu erzählen.«
»Egal, wie oft wir das hier diskutieren«, erwidere ich, »die Antwort lautet immer noch Nein.«
»Ben!«, ruft sie aus. »Du hast mir noch nicht mal bis zum Schluss zugehört.«
»Ich weiß, worauf du aus bist. Aber das bin nicht ich. Ich schreibe investigative Storys, keine rührseligen Dramen.«
»Ich bin hier doch nicht auf reißerische Schnulzen aus. Es wäre schlicht die Wahrheit – emotional, bewegend, ungeschminkt, eine Erlösung. Die wahre Geschichte, erzählt von dem Mann, den alle in diesem Land so schätzen.«
»Tja, ich bin nicht daran interessiert.«
»Aber Millionen von Menschen sind es, Ben.« Madelines Stimme hat nun den Tonfall angenommen, den sie anschlägt, wenn sie entschlossen ist, ihren Willen zu bekommen – jedes Wort präzise und mit Nachdruck. »Du unterschätzt, wie sehr du den Leuten am Herzen liegst. Was Nick widerfahren ist und dann der Tod deiner Mutter … alle erinnern sich. Die Leute wissen, wer du bist, und glauben, dass sie eine echte Verbindung mit dir haben.« Sie steht auf, kommt um ihren Schreibtisch herum zu mir und hockt sich auf die Tischkante. »Ich sage ja nicht, dass ein paar von ihnen nicht ein wenig durchgeknallt sind – aber ob es dir nun gefällt oder nicht, sie bilden sich ein, dass sie deine Trauer mit dir geteilt haben. Sie wollen dich unterstützen – auch aus tiefer Dankbarkeit dafür, dass es nicht ihnen selbst widerfahren ist. Und sie wollen lesen, was du in deinen eigenen Worten darüber zu schreiben hast, und zwar in unserem weltweiten Exklusivbericht.«
Direktheit ist nichts, wovor Madeline je zurückschreckt. Diese Fähigkeit, schonungslos und ohne Umschweife zum Punkt zu kommen, ist es, die sie zu einer so großartigen Journalistin macht.
Ich schüttle bloß den Kopf. »Madeline, du weißt, was ich über diesen Artikel denke. Ich habe dir gesagt, dass ich ihn nicht schreiben werde. Und das wird sich nicht ändern.«
»Ben, wir beide wissen, dass du schreiben wirst. Egal, wie schmerzhaft – die Story ist zu gut, um es nicht zu tun.«
»Wenn ich diesen Artikel schreibe, werden nächstes Jahr ständig Leute auf der Straße auf mich zukommen und mich fragen, wie es mir geht, und mir versichern, dass sie immer für mich beten.«
»Das klingt doch nicht allzu schlimm. Diese Menschen meinen es gut, selbst die etwas sonderbaren unter ihnen.«
»Es bleibt ein Nein, Madeline.«
»Ben.« Sie steht abrupt auf, durchquert das Büro, um die Tür zu schließen, und dreht sich dann wieder zu mir um. »Ich werde ganz offen sein. Unsere Zahlen befinden sich im freien Fall. Wir stehen mächtig unter Druck. Wir brauchen eine große Story.«
»Die Antwort ist immer noch Nein.«
Madeline selbst hat mich in ihrer unerbittlichen Jagd nach Lesern geschult. Nun jedoch ist mir schlagartig klar geworden, dass, wenn die Jagd sich der eigenen Tür nähert, die Perspektive sich komplett verschiebt.
»Niemand hat sich dem Erfolg unserer Seite so verschrieben wie ich«, fahre ich fort. »Meine Reportagen ziehen mehr Leser an als alle anderen Artikel. Und dann bleiben genau diese Leser, um den reißerischen Tratsch zu lesen, den du ›Nachrichten‹ nennst.«
Madelines Augen blitzen auf, und kurz glaube ich, dass wir hier fertig sind. Dann entspannen sich ihre Schultern.
»Du hast es selbst gesagt«, schiebe ich hinterher, »ich bin der beste Journalist, den du hast.«
»Eine Auszeichnung macht dich nicht zu meinem besten Journalisten.«
»Nein, denn es sind gleich zwei, und die einzigen Auszeichnungen, die diese Seite je gewonnen hat.«
»Wir sind nicht hier, um Auszeichnungen zu sammeln, sondern Leser«, entgegnet sie. »Und wir brauchen mehr von ihnen. Und zwar schnell.«
Ich spüre, wie ich die Geduld verliere. Ich mache einen tiefen Atemzug. Würde ich Madeline nicht kennen, fände ich es schwer zu glauben, dass sie mich ernsthaft zu dieser Sache drängen will. Da sie in der Nähe meines Zuhauses aufgewachsen ist, weiß sie aus erster Hand, wie traumatisch der Tod meines Bruders Nick war – nicht nur für meine Familie, sondern für die gesamte Gemeinde. Ich habe mich noch mal damit befasst und die Artikel gelesen, die sie damals dazu verfasste. Sie verstand die verheerende Wirkung des Geschehens auf unseren Heimatort.
Ich drehe mich auf dem Stuhl zu ihr herum, als sie von der Tür zum Fenster schreitet. »Ich werde es nicht tun, Madeline. Das musst du akzeptieren. Du wirst nie auch nur ansatzweise ahnen, wie es war – Nicks Gesicht auf sämtlichen Titelseiten … das von Mum, meins. Ich verspüre keinerlei Wunsch, das letzte Fitzelchen Privatleben, das ich für mich behalten konnte, auch noch zu veröffentlichen.«
Es ist nicht die Antwort, die sie hören will, und ich sehe den Ärger in ihr aufsteigen. Sie trommelt mit den Fingern auf der Tischplatte. Schmallippig lässt sie sich in ihrem Sessel nieder und beginnt, auf ihre Tastatur einzuhacken. Nachdem sie nichts mehr sagt, gehe ich davon aus, dass ich vorerst entlassen bin, und erhebe mich erleichtert, um zu gehen. Aber gerade als ich die Tür erreiche, ergreift sie wieder das Wort.
»Ben, bist du je auf den Gedanken gekommen, dass, wenn du die Geschichte nicht schreibst, jemand anderes es tun könnte?«
Ich halte inne, ohne mich umzudrehen.
»Und wenn sie das tun, werde ich nicht kontrollieren können, was sie womöglich schreiben.«
Kapitel 2
Um sechzehn Uhr machen wir Feierabend, und ich erkläre Min, dass ich dringend ein Bier brauche. Aus einem werden zwei, und sofort fühle ich mich wacklig auf den Beinen. Eigentlich habe ich vor zehn Jahren mit dem Trinken aufgehört, aber ich brauche gerade etwas, um die Wogen meiner Wut auf Madeline zu glätten. Auch wenn ich ihre Fähigkeit, als Erste an einer Story dran zu sein, bewundere, ist ihr unersättlicher Appetit auf Leser zuweilen nur schwer erträglich.
Die Nachricht von meiner Auseinandersetzung mit Madeline verbreitet sich in Windeseile im Team. Unser Grüppchen wächst, und als wir zu viele für das beengte Pub in der City sind, beschließen wir, Richtung Westen aufzubrechen, ganz raus aus der Londoner Innenstadt, zu unserem Lieblingsrestaurant, dem Mailer’s. Am Ufer der Themse, im beschaulichen St. Marnham gelegen, befindet sich das vom renommierten Koch East Mailer geführte Restaurant in einem umgebauten Lagerhaus. Ich war es, der den Laden in der Redaktion bekannt gemacht hat. Denn ich stamme von hier. Die meisten hatten sich noch nie so weit in den Westen von London gewagt, wo es nahezu dörflich zugeht, aber das unglaubliche Essen dort, in Kombination mit dem atemberaubenden Ausblick auf den Fluss, zog schon bald eine ganze Armee von Bekehrten an.
Selbst wenn sie nicht anwesend ist, hat Madeline die Angewohnheit, die Gespräche unseres Redaktionsteams zu dominieren. Beim Abendessen herrscht beinahe einstimmige Unterstützung für mich, und die meisten Kollegen sind gebührend empört, dass unsere Chefin mich dazu drängen will, den Artikel zu schreiben. Nur Min bleibt still, und ich kann ihr förmlich beim Nachdenken zusehen, während die übrigen von uns über Madelines Eifer, um jeden Preis Leser zu ködern, wettern. Schließlich, als sie den Rest der letzten Flasche zwischen unseren Gläsern aufteilt, fragt sie mich, ob Madeline nicht recht haben könnte. Oder zumindest teilweise. Ob der zehnte Todestag meiner Mutter vielleicht der Moment für mich sein könnte, um innezuhalten und die Gelegenheit zu nutzen, um wirklich zu verstehen, was passiert ist.
In meinem dunkelsten Moment habe ich Min meine Schuldgefühle anvertraut, mein Unvermögen, selbst nach all den Jahren zu begreifen, warum Mum getan hat, was sie getan hat. Alle am Tisch verstummen. Ich verspreche, dass ich darüber nachdenken werde. In Wahrheit weiß ich bereits, dass ich den Artikel niemals schreiben werde, und zwar aus all den Gründen, die ich Madeline genannt habe. Mein Job mag es mir ermöglichen, das Leben anderer zu erforschen, aber meine eigene Vergangenheit möchte ich nie wieder durchleben.
Als der Abend sich dem Ende zuneigt und das Team sich auf den Heimweg macht, gehen Min und ich zu der Bar aus gemauertem Backstein rüber, um uns einen Absacker zu genehmigen. Obwohl ich jetzt schon weiß, dass ich es morgen bitter bereuen werde, so viel getrunken zu haben, protestiere ich nur halbherzig, als Min mich damit überredet, dass ein Gläschen mehr auch keinen Unterschied mehr macht.
Als ich mich umblicke, lächelt der neben dem offenen Kaminfeuer sitzende Miteigentümer des Restaurants, Will Andrews, mir zu und fordert uns auf, uns zu ihm zu gesellen, wobei er dem Barkeeper ein Zeichen gibt, noch drei Whisky zu bringen. Vor über zwanzig Jahren war Will ein enger Schulfreund meines Bruders gewesen. Seit jeher darauf getrimmt, ein erfolgreicher Geschäftsmann in der Londoner City zu werden, hat Will vor ein paar Jahren mit seinem Partner, East Mailer, in dieses Restaurant investiert. Ich selbst kannte ihn früher gar nicht so gut, aber Will war meiner Mutter gegenüber unglaublich aufmerksam gewesen, hatte nie ihren Geburtstag vergessen und ihr zu Nicks Todestag immer Rosen geschickt.
Wir wechseln ein paar Höflichkeiten und bringen einander über unser jeweiliges Leben auf den neuesten Stand. Will erkundigt sich nach der Arbeit, und ich berichte von einer Reportage, die ich erst kürzlich rausgebracht habe, samt des langwierigen Prozesses, einen True-Crime-Podcast daraus zu machen. Dann erzähle ich ihm von dem heutigen Gespräch mit meiner Chefin.
»Während der Rest von uns parieren muss, ist Ben es gewohnt, seinen Willen zu bekommen«, bemerkt Min lachend. »Er ist eben ihr absoluter Liebling.«
»Nein, bin ich nicht«, widerspreche ich. »Na ja, vielleicht ein kleines bisschen.«
»Als ich dich das vorhin beim Abendessen gefragt habe, meinte ich damit nicht, dass du den Artikel unbedingt schreiben musst«, fährt sie fort, »und natürlich sollte das absolut deine Entscheidung sein, aber du kannst es nun mal nicht ausstehen, wenn du und Madeline Zoff habt.«
»Aber selbst Madeline wird doch Bens Standpunkt verstehen können«, wirft Will ein. »Das ist so eine persönliche Angelegenheit.«
»Da widerspreche ich dir nicht«, erwidert Min, »trotzdem denke ich, Ben sollte die Gelegenheit nutzen – nicht, um Madelines große Story zu schreiben, sondern um seine eigenen Nachforschungen anzustellen. Sosehr es mich auch wurmt, es zu sagen, aber er ist nun mal der Beste in der Branche.«
»Nur Ben kann wissen, was das Richtige für ihn ist«, entgegnet Will. »Ja, Clares Tod hat uns alle schwer getroffen. So wie davor der von Nick. Aber Ben hat es sein Leben zerrissen. Madeline muss das respektieren und anerkennen, dass er eine Ewigkeit damit verbracht hat, seinen Weg in die Normalität zurückzufinden. Irgendwann muss ihm doch gestattet sein, einen Schlussstrich zu ziehen.«
»Darf ich auch was dazu sagen?«, melde ich mich schmunzelnd, als wir kurz von East Mailer unterbrochen werden, der unsere Getränke bringt. Ich erhebe mich, um ihn zu begrüßen, und er verspricht, sich zu uns zu setzen, sobald die letzten Gäste fort sind.
»Kann ich dich mal was fragen?«, sagt Min, als wir unser Gespräch wiederaufnehmen.
Ich nicke.
»Wie würdest du an die Sache rangehen, wenn es sich um irgendeine andere Story handeln würde?«
»Es ist nicht irgendeine andere Story, darum geht es ja«, wirft Will ein. »Es ist Bens Story. Und überhaupt, ist es denn realistisch, nach all der Zeit was Neues herauszufinden?«
»Absolut … das tun wir bei unserem Job die ganze Zeit«, erwidert Min. »Ben, ich weiß doch, dass es schmerzhaft ist – schmerzhafter, als sich irgendwer von uns auch nur ansatzweise vorstellen kann –, aber ich weiß auch, dass in deinem Inneren ein Teil von dir ist, der eine Million Fragen hat, die er unbedingt stellen möchte.«
»Aber es geht nicht nur um mich«, sage ich und drehe das Whiskyglas langsam zwischen meinen Händen. »Ich glaube nicht, dass Mum gewollt hätte, dass ich das tue.«
Von Anfang an hatte meine Mutter mir beigebracht, dass die simpelsten Dinge einen gewaltigen Unterschied bewirken können. Für sie bedeutete das, mich so leben zu lassen wie jeden anderen Teenager: Fußball spielen, über Mädchen reden, heimlich Alkohol trinken oder hin und wieder eine Kippe rauchen. Sie behandelte das alles wie jede andere Mutter auch. Nicht ein einziges Mal rastete sie aus und versuchte, mich von etwas abzuhalten – ganz gleich, wie groß der Wunsch in ihr gewesen sein mochte. Niemals benutzte sie Nick als Ausrede. Wenn ich mal eine halbe oder auch eine Stunde zu spät nach Hause kam und ihr das manchmal bestimmt furchtbare Angst gemacht haben musste, zeigte sie es nie – keine Riesendramen, keine Überreaktionen. Nachdem sie starb, brauchte ich meine ganze Kraft und die Unterstützung meines engsten Umfelds, um mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Ich bin mir sicher, sie würde nicht wollen, dass ich alles über den Haufen werfe, um die Vergangenheit neu aufzuwühlen.
»Das verstehe ich, Ben, wirklich«, sagt Min behutsam, wobei sie etwas Wasser in ihren Whisky kippt, um ihn zu verdünnen, und sich dann wieder mir zuwendet. »Aber ich glaube, du hast nach wie vor Fragen zum Tod deiner Mutter, und das wird dich immer davon abhalten, ihn zu akzeptieren. Ich glaube, auch das hätte deine Mum nicht für dich gewollt. Daher sage ich, pack die Gelegenheit jetzt beim Schopf, um die Wahrheit herauszufinden.«
»Das ist womöglich nicht ganz das, worauf Madeline aus ist«, erwidere ich.
»Wann bitte hat dich das jemals aufgehalten?«
Ich muss unwillkürlich lächeln. »Was mir eigentlich stinkt, ist, wie die Leute sich immer ihr eigenes Bild zusammenfabuliert haben«, fahre ich fort. »Sie glauben, dass Mum so furchtbar unglücklich war, dass sie einfach nicht mehr damit zurechtkam, dass sie nichts mehr hatte, um weiterzuleben. Aber ich weiß, dass dem nicht so war. Trotz allem, was wir durchgemacht hatten, fand sie eine neue, positive Einstellung zum Leben. Ich kann das, was sie getan hat, bis heute nicht verstehen. Irgendwie muss da mehr dran sein.«
»Was denn zum Beispiel?«, erwidert Will behutsam, während East uns noch mal nachschenkt.
Ich halte inne. »Das kann ich unmöglich sagen.«
Als die letzten Gäste aufbrechen, setzt sich East zu uns an den Tisch, und unser Gespräch wendet sich dem Dorfleben zu. Das geplante Riesenrad für das Frühlingsfest sorgt für Unmut.
»Der Vorsitzende des Organisationskomitees droht, sein Amt niederzulegen«, berichtet East. »Und mein Angebot, das verdammte Ding zu bezahlen, kam nicht ganz so an, wie ich erwartet hatte. Einige Mitglieder warfen mir vor, das komplette Event an mich reißen zu wollen. Ich bin tödlich beleidigt.«
»Hör nicht auf ihn«, meint Will lachend. »Er liebt es. Und sie lieben ihn. Als er anbot, persönlich einen Stand mit mongolischem Barbecue zu bewirten, hätte man meinen können, er hätte angeboten, Wasser in Wein zu verwandeln!«
»Ja, am besten den ganzen Dorfteich!«, fügt East hinzu.
Bei dem Angebot eines letzten Absackers aufs Haus halte ich beide Hände hoch – ein Signal, dass ich mein Limit weit überschritten habe –, und Min entschuldigt sich, dass sie am nächsten Morgen früh in der Redaktion sein müsse. East ruft ihr ein Taxi, und ich beschließe, am Flussufer entlang ins benachbarte Haddley zu laufen, wo ich wohne. »Die frische Luft wird meinen Kopf freipusten«, sage ich, während East sich im Innenhof des Restaurants einen Joint anzündet.
»Will lässt mich mittlerweile nur noch draußen rauchen«, erklärt er, und während er einen tiefen Zug von seiner Tüte nimmt, stehen wir da und blicken den Rücklichtern von Mins Taxi nach, bis sie verschwinden. East zieht sich sein kariertes Kochbandana vom Kopf, wuschelt sich durch das schulterlange ergrauende Haar und bietet mir die Tüte an.
»Ich glaube nicht, dass das helfen wird.« Ich weiß jetzt schon, dass ich morgen früh die zwei letzten Gläser Glenmorangie bereuen werde.
»Hast wahrscheinlich recht.«
Wir verlassen den Hof und spazieren langsam zum Uferweg.
»Ben«, beginnt East, als die Lichter des Restaurants hinter uns verblassen, »ich kam nicht umhin, euch vorhin zuzuhören, und ich war mir echt nicht sicher, ob ich was sagen soll …«
»Mach nur.« Wir bleiben am Fluss stehen, wo die Straßenlaternen ihren gelben Schein über den Treidelpfad werfen.
»Ich kenne Madeline schon lange. Sie war Stammgast in meinem ersten Restaurant in Richmond, vor einer ganzen Ewigkeit. Sie kann sehr überzeugend sein. Lass dich von ihr nicht zu etwas überreden, das du nicht tun willst. Mein Ratschlag ist, mach so weiter, wie du es immer getan hast, und blicke in deinem Leben nach vorn. Nach hinten zu schauen, hat noch nie jemandem was gebracht.«
Kapitel 3
Als das Morgenlicht durch die Jalousien sickert, liege ich noch im Bett und habe keinen blassen Schimmer, wie viel Uhr es ist. Ich strecke den Arm aus, taste auf dem Nachttisch blind nach meinem Handy, und ein großes Glas Wasser ergießt sich über den Boden. Ich fürchte, wenn ich den Kopf hebe, fängt der Raum an, sich zu drehen, also rolle ich mich ganz langsam zur Seite und spähe hinüber. Ich kann den schalen Alkohol in meinem Mund schmecken.
Vor zehn Jahren hatte ich in ebendiesem Bett gelegen, während meine Mutter zum dritten und letzten Mal hochrief, ich solle gefälligst aufstehen. Ich befand mich in meinem zweiten Studienjahr an der Manchester University und war die Osterferien über zu Hause in London, wo ich bei einer Sportnachrichten-Webseite jobbte und meine Tage damit zubrachte, Artikel auf Fakten hin zu überprüfen. Ich hatte keine Woche gebraucht, um zu kapieren, dass Sportjournalisten ihren Arbeitstag nicht vor Mittag begannen, spät Feierabend machten und den Großteil ihrer Freizeit damit verbrachten, sich im Pub Fußballspiele auf Sky anzuschauen. Es war eine Routine, die ich nur zu gerne übernommen hatte, und als ich an jenem Morgen verkatert unter meiner Decke lag, hatte ich keine Eile, mich Mums frühmorgendlicher Fahrt zur Arbeit anzuschließen.
Auch jetzt, die Augen immer noch fest geschlossen, schallt Mums Stimme durch meinen Kopf – ihr Ärger über mich, ihr wachsender Frust angesichts meiner scheinbaren Gleichgültigkeit. Als sie zur Haustür hinausging, rief sie ein letztes Mal zu mir hoch. »Ben, hör auf, deine Tage im Bett zu verplempern. Steh auf, jetzt!« Dann hörte ich, wie sie sich ihre Tasche schnappte, bevor sie die Tür hinter sich zuknallte.
Dies waren die letzten Worte, die sie zu mir sprach.
An jenem Morgen verließ meine Mutter wie üblich das Haus kurz vor acht. Sie nahm den Weg quer über die grüne Wiese des Haddley Common, des einstigen Dorfangers, und dann weiter am Wald entlang, der von den Bahngleisen gesäumt wurde. Sie brauchte keine zehn Minuten zur Station St. Marnham, wobei sie dieselbe Strecke nahm wie jeden Tag. Normalerweise ging sie ganz bis ans Ende des Bahnsteigs, wo sie sich hinstellte und wartete, um hinten in den Zug einzusteigen – der einzige Waggon, wo sie sicher sein konnte, einen Sitzplatz für ihre zwanzigminütige Fahrt in die Londoner Innenstadt zu ergattern. Doch was sie an jenem Morgen tat, das weiß ich nur von dem, was die Polizei mir später erzählte.
Ich hatte mir gerade ein Frühstück sowie ein Sandwich für die Arbeit gemacht, stand an einem der Fenster im Erdgeschoss, trank meine Tasse Kaffee und überlegte aufzubrechen. Während ich gedankenverloren zu unserem älteren Nachbarn Mr Cranfield hinausblickte, der in seinem Garten herumwerkelte, hielt draußen ein Polizeiwagen.
Zwei Beamte stiegen aus und kamen den Gartenweg hoch. Sofort spürte ich, wie sich mein Magen verkrampfte. Als Kind hatte ich zu viele Polizisten in unserem Haus ein und aus gehen sehen, und das Gefühl der Furcht, das mit ihrem Kommen einherging, war nur zu vertraut. Nach Nicks Tod hatte ich mich, wenn ich Polizisten näher kommen sah, oft versteckt, wobei ich mich meist oben an der Treppe hinkauerte und angestrengt lauschte, während man Mum die neuesten Erkenntnisse übermittelte. Auf einmal fühlte ich mich wieder wie ein Kind. Nur dass es dieses Mal keinen Ort zum Verkriechen gab, sosehr ich es mir auch wünschte.
Als es an der Tür klingelte, stand ich bloß wie festgefroren am Fenster und sah zu, wie Mr Cranfield seine Spatengabel an die Hauswand lehnte. Dann stapfte er zur Haustür und setzte sich auf die Eingangsstufe, um seine Gummistiefel auszuziehen. Sorgfältig stellte er sie daneben ab, bevor er sich wieder erhob und im Haus verschwand.
Erst als es zum zweiten Mal klingelte, rührte ich mich. Langsam ging ich in den Flur und zögerte, bevor ich die Hand auf die Türklinke legte – in mir der verzweifelte Wunsch, mich an das Leben zu klammern, so wie es war. Ein Leben, das, wie ich bereits irgendwie ahnte, dabei war, mir zu entgleiten.
Es klingelte ein drittes Mal, und ich öffnete.
Draußen fegte ein stürmischer Wind über die weite Fläche des Angers, und die zwei Beamten vor der Türschwelle, ein Mann und eine Frau, hatten sich unbewusst aneinandergedrängt. Ich wartete nicht mal darauf, dass sie was sagten, sondern drehte mich um und ging über den Flur zurück in die Küche. Die Polizisten traten hinter mir ein, und ich hörte, wie sie die Tür schlossen. Der Mann fragte, ob ich Mr Benjamin Harper sei. Mit einem Anflug von Resignation rief ich nach hinten: »Ja!« Sie wussten doch genau, wer ich war.
In der Küche setzte ich mich an unseren alten Bauerntisch. Es war ein riesiges, massives Ding, das den Großteil des Raums einnahm. Nach Nick hatte er sich für Mum und mich viel zu groß angefühlt, aber mit den Jahren hatten wir gelernt, ihn in Beschlag zu nehmen. Als ich mich nun allein an den Tisch setzte, waren seine Ausmaße erdrückend.
Die Beamtin, die an der Küchentür stehen geblieben war, bat mich zu bestätigen, dass ich Clare Harpers Sohn sei. Ob noch jemand zu Hause sei, erkundigte sie sich. Ich schüttelte den Kopf. Ich sah ihrem Kollegen zu, wie er zögernd die Küche durchquerte, um sich dann gegen die Arbeitsplatte zu lehnen, wo mein Frühstücksgeschirr ungespült herumstand. Ich hatte vergessen, die Butter in den Kühlschrank zurückzustellen; sie glänzte schon da, wo sie angefangen hatte zu schmelzen. Außerdem ragte ein Messer oben aus einem Glas Marmite. Mum hätte sich darüber geärgert.
Die Polizistin zog einen Stuhl unter dem Tisch hervor und wandte sich mir zu. Ich hob den Kopf und sah sie zum ersten Mal richtig an. Das Mitgefühl, das ich in ihren Augen sah, war ein Blick, den ich zu hassen gelernt hatte.
Sie fragte mich abermals, ob Clare Harper meine Mutter sei, und ich sagte Ja, das sei sie. Ob sie in einem Büro an der Welbeck Street arbeite? Ich erinnere mich, wie ich lachte, ein unfreiwilliges, nervöses Lachen, bevor ich die Berührung ihrer Hand spürte. Ich drehte mich weg, nur um dem Blick ihres Kollegen zu begegnen, bevor er ihn rasch auf den Garten draußen richtete, wo die Frühlingssonne das Gras hatte in die Höhe schießen lassen. Mum hatte mir die ganze Woche in den Ohren gelegen, den Rasen zu mähen. Ich hatte gemeint, sie solle nicht ständig nörgeln.
Die Polizistin wollte wissen, ob meine Mutter üblicherweise den Zug von der Station St. Marnham nahm. Ich begann zu reden, erzählte ihr, dass sie jeden Morgen an derselben Stelle in den Zug stieg, dass sie ein Gewohnheitstier war, immer der gleichen Routine folgte, das Haus immer zur gleichen Zeit verließ und über den Anger spazierte, egal, ob es regnete oder schneite. Die Beamtin versuchte mich zu unterbrechen, aber ich hörte nicht auf zu reden. Mum arbeite als Projektmanagerin in einer Firma für Büroeinrichtungen, nehme sich immer ein Mittagessen von zu Hause mit, mache um zwölf Uhr dreißig eine Stunde lang Pause, brühe sich einen Kaffee auf, wenn sie morgens eintraf; mittlerweile müsse sie im Büro sein, und dort würden sie sie sicher antreffen können. Die Polizistin drückte meine Hand und sagte meinen Namen.
Eine Frau habe sich vor den Acht-Uhr-Zug Richtung Waterloo-Station geworfen.
Ich nickte, mit einem Mal still.
»Ben, wir glauben, dass es sich bei der Frau um Ihre Mutter handelt.«
Ich schaute zu ihrem Kollegen rüber, der mich nun ansah und langsam nickte, und ich ertappte mich dabei, wie ich ihn nachahmte. Ich hörte das Ticken der Küchentür an der Wand hinter uns. Plötzlich erschien es mir furchtbar laut.
»Es tut mir leid, Ben, sie war auf der Stelle tot«, sagte die Polizistin. Wir saßen schweigend da, bis sie fortfuhr: »Mir ist klar, dass das viel auf einmal ist, also wäre es wohl das Beste, wenn Sie ein Familienmitglied anrufen, damit jemand bei Ihnen ist.«
Ich sagte nichts darauf.
»Oder vielleicht einen engen Freund«, fügte sie mit einem Blick zu ihrem Kollegen hinzu.
Sie wartete darauf, dass ich antwortete, aber ich hatte nichts zu sagen. Ich wollte, dass sie gingen.
Es gebe gewisse Formalitäten zu erledigen, aber ich hörte sie nicht. Die Identifikation der Leiche sei erforderlich, aber es drang nicht zu mir durch, dass ich derjenige war, der sie identifizieren müsse. Ich war zwanzig Jahre alt.
»Gibt es irgendwen, den wir für Sie anrufen können?«, wiederholte sie. »Ich denke wirklich, Sie sollten jemanden bei sich haben.«
Aus irgendeinem Grund konnte ich bloß an Mr Cranfield mit der Spatengabel in seinem Garten denken.
»Ben?«
Ich zwang meine Aufmerksamkeit zurück zu den beiden Beamten und log. Ich sagte, ich würde meinen Vater anrufen. Ich hatte nicht mal seine Nummer.
Der Polizist schritt durch den Raum, legte die Hand auf meine Schulter und fragte, ob ich zurechtkommen würde. Ich wollte, dass die beiden aus meinem Haus verschwanden. Und ich war sicher, dass es ihm genauso ging.
Ich stand auf und ging langsam in den Flur. Sie folgten. Die Polizistin wollte sich vergewissern, dass ich jemanden anrufen würde.
Wieder versprach ich, dass ich das tun würde. Ich wollte nur, dass sie gingen.
Sie würden sich melden, sagten sie.
Ich nickte und bedankte mich. Ich wusste auch nicht, wofür.
Als sie die Tür öffneten, um zu gehen, pfiff der Wind durch den Flur. Es regnete mittlerweile heftig, und die beiden Beamten hasteten zu ihrem Wagen, wobei die Frau ihre Mütze festhalten musste. Ich schloss die Tür und blieb allein in dem leeren Flur stehen.
Kapitel 4
Dani Cash verließ das Schlafzimmer im Obergeschoss ihres Einfamilienhauses in Haddley, knipste das Licht an und ging über den kleinen Flur zum Gästezimmer hinten. Wie sie dieses Haus geliebt hatte, als sie es das erste Mal betreten hatte: die frisch tapezierten Wände, den willkommen heißenden Geruch der neuen Teppiche, das geschickt eingebaute Mobiliar, um alles an seinem Ort zu verstauen. Es war perfekt gewesen – ein Heim, wie sie es sich immer erträumt hatte. Es kümmerte sie nicht, dass es eine Meile von der Themse und dem angeblichen viktorianischen Charme der Anwesen von Haddley unten am Fluss entfernt war. Das hier würde ihr Heim sein. Sie hatte sich eingeredet, dass es ein unglaublich glücklicher Ort werden könnte.
Vier Monate später fühlte es sich an wie ein Gefängnis.
Sie stand in der Tür und sah das Kinderzimmer vor sich, das sie vorgehabt hatte einzurichten – Tiertapeten an den Wänden, ihre geliebten Pinguine auf den Jalousien. Machte sie sich selbst was vor, wenn sie hoffte, dass dieser Tag noch kommen könnte?
Jetzt war nicht der Moment, um darüber nachzudenken. Sie musste ihre Konzentration wieder auf die Arbeit richten.
Sie schaute zur Uniform, die sie am Vorabend so sorgfältig auf dem Gästebett ausgelegt hatte, und einen Augenblick lang zögerte sie. War sie bereit?
Sie musste es sein.
Es war ihr einziger Ausweg.
Sie griff nach der makellosen weißen Bluse, die Schulterklappen bereits befestigt. Geübt schlossen ihre Finger die Knöpfe und knoteten das Halstuch. Als sie sich bückte, um die Schnürsenkel zu binden, fiel ihr Blick auf ihr Spiegelbild. Gestern Abend noch war sie ganz stolz gewesen, als sie eine messerscharfe Bügelfalte in ihre schwarze Stoffhose gepresst hatte. Sie hatte dabei an ihren Vater gedacht, an die Jahre seines Dienstes, und gewusst, dass er diesen Stolz mit ihr geteilt hätte.
Ihr Jackett hing außen an der Kleiderschranktür. Sie riss die Plastikfolie der Reinigung runter, löste den obersten Knopf und schlüpfte hinein. Sie spürte, wie es lose um ihren Rücken und ihre Hüften schlackerte. Sie war nicht überrascht – ihr Appetit war in den letzten Wochen verschwunden. Sie nahm die Mütze vom Bett und schob so viele ihrer blonden Locken wie möglich darunter. Wie sie so vor dem Spiegel stand, erkannte sie sich einen Moment lang beinahe selbst nicht mehr.
Sie war wieder eine Polizistin.
Oben an der Treppe hielt sie inne und lauschte nach Lebenszeichen. Sie achtete darauf, die zweite Stufe auszulassen, die trotz der Versprechungen der Handwerker immer noch unter dem geringsten Gewicht knarzte, und schlich nach unten. Als sie die Wohnzimmertür erreichte, war diese geschlossen, und sie atmete leise auf.
Draußen vor der Haustür schloss Dani kurz die Augen, hob ihr Gesicht zum Himmel und tankte in den wärmenden Sonnenstrahlen Mut. Sie stand so noch einen Augenblick da, bevor sie vorwärtsschritt, fest entschlossen, die vergangenen fünf Monate hinter sich zu lassen.
Ihre fünf Jahre bei der Truppe hatten gezeigt, was für eine gute Polizistin sie sein konnte. Schon als Neuling, mit gerade mal einundzwanzig, hatte sie sofort Eindruck gemacht. Jack Cashs Tochter zu sein, bedeutete lediglich, dass man sie noch mehr auf die Probe stellte. Doch vom ersten Tag an hatte sie geliefert. Ruhig und mit schneller Auffassungsgabe war sie unter ihren Ausbildern eine klare Favoritin gewesen. Vor sechs Monaten war darüber gesprochen worden, sie zum Detective Sergeant zu befördern.
Dani wischte den Gedanken beiseite. Sie war damals eine gute Polizistin gewesen, und das würde sie heute auch sein.
Auf halber Strecke den Haddley Hill runter blieb sie an der Ampel stehen. Der Verkehr nahm bereits zu, und Kinder trotteten zur Haddley Grammar School. Sie lächelte zwei Teenagermädchen zu, die neben ihr an der Kreuzung warteten, und ließ den Blick Richtung Themse schweifen. Sie sah zu, wie der frühmorgendliche River Bus unter der Brücke hindurchschipperte und die Pendler in die Londoner City beförderte.
Die Explosion kam aus dem Nichts. Die Mädchen kreischten, und Dani sprang so abrupt nach hinten, dass ihr dabei die Mütze vom Kopf flog. Sie tastete am Straßenrand herum, war jedoch fast blind vor Panik. Wo waren die Mädchen? Sie durfte nicht zulassen, dass ihnen was passierte. Schnell kam sie wieder auf die Füße, doch ihre Sicht verschwamm. Dann spürte sie eine Hand auf ihrem Arm.
»Alles in Ordnung, Miss?«, fragte eines der Mädchen und reichte Dani ihre Mütze.
»Dumme Jungs!«, schrie die andere, bevor sie in Lachen ausbrach. »Ihr seid wie die Kinder, echt!«
Dani sah sich um und stellte fest, dass das Leben um sie herum weiterging. Auf der gegenüberliegenden Seite erblickte sie die drei Missetäter, bevor diese in den Haddley Hill Park rannten und verschwanden.
»Die spielen ständig mit Böllern rum«, erklärte das Mädchen, das Dani die Mütze gereicht hatte. »Sie halten sich für echte Männer, dabei sind sie nichts weiter als dumme kleine Jungs!« Den letzten Kommentar brüllte sie aus Leibeskräften über die Straße.
»Mir geht’s gut, danke schön«, sagte Dani und sah, wie die Ampel umschaltete, während sie noch stehen blieb, um ihre Mütze zurechtzurücken. Die Mädchen überquerten die Straße und verschwanden ebenfalls im Park. Bevor Dani sich’s versah, rollte der Verkehr schon wieder los, und sie musste erneut den Knopf an der Ampel drücken.
Während sie den Hügel Richtung Hauptstraße hinunterging, staute sich der Verkehr immer mehr. Der Bus nach Wandsworth blockierte die Hauptkreuzung. Lautes Hupen ertönte, woraufhin Dani sich zu einem entnervten Fahrer umdrehte, um seine köchelnde Wut mit einem Blick zu ersticken. Ein Lieferant parkte im Halteverbot, und nachdem Dani ihn ermahnt hatte weiterzufahren, ging auch sie weiter, während die Kolonne hinter ihr sich in Bewegung setzte.
Als sie sich der Polizeistation Haddley näherte, wurden ihre Schritte langsamer. Von der anderen Straßenseite aus sah sie, wie zwei Constables das Gebäude betraten, dann eine ältere Frau, die sich auf ihren Gehstock stützte. Ein ranghöherer Officer, der gerade die Dienststelle verließ, hielt der Dame die Tür auf, bevor ein weiterer Beamter ins Innere folgte. Dani kannte keinen der beiden Constables, und die anderen erschienen ihr seltsam unvertraut, wie Leute aus einem anderen Leben, die sie nur vage gekannt hatte. War sie so lange fort gewesen? Ihr Beschluss, sich die letzten fünf Monate von der Wache fernzuhalten, war ein bewusster gewesen. Sie hatte sich zwar mit ein, zwei der jüngeren Kollegen auf ein Gläschen getroffen, aber dafür entschieden, mit dem Rest des Teams keinen Kontakt zu halten. Das bereute sie jetzt. Wenn sie nur ein paarmal angerufen hätte, wäre es ihr heute vielleicht leichter gefallen, hätte es das Eis gebrochen.
Nach einem weiteren Moment wandte sie sich von der Polizeistation ab und ging weiter. Als sie die Haddley Bridge erreichte, warf sie einen Blick auf ihre Armbanduhr. Sie hatte noch dreißig Minuten bis zum Schichtbeginn. Sie würde über den Fluss spazieren, den Ausblick von der Brücke genießen und dann zur Wache zurückkehren. Bis dahin wäre sie bereit.
Von der Brücke aus blickte sie den Fluss hinauf zu den Bootshäusern von Haddley, wo bereits reges Treiben herrschte. Dahinter erstreckten sich das Grün des Haddley Common und dann der Wald bis nach St. Marnham. In die andere Richtung ragte auf der nördlichen Uferseite ein verglaster Gebäudekomplex empor. Es handelte sich um Luxusappartements, und unter ihnen befand sich ein Feinkost-Supermarkt voller Biogemüse und erlesener Weine. Die perfekte Lage, um zahlungskräftige Pendler abzugreifen, die beim Nachhausekommen auf der Jagd nach einem unkomplizierten Abendessen waren.
Und der perfekte Ort für einen bewaffneten Überfall letztes Halloween.
Die Jungs waren ihr wie Schüler erschienen, als sie mit ihren Monstermasken an ihr vorbeirannten. Dani hatte ihnen kaum Beachtung geschenkt, in Gedanken bereits bei der Flasche Wein, die sie sich nach einer langen Schicht genehmigen wollte.
Sie wiederum hatten Dani nicht bemerkt, als sie ihnen hineingefolgt war.
Sie hatte immer noch ihre Polizeiuniform angehabt.
Als die Typen sie schließlich sahen, verfielen sie in Panik.
Das Aufblitzen eines Messers. Dann noch eins.
Das Kreischen von Kunden.
Plötzlich gab es Geiseln … eine Klinge, die in ihren Rücken gedrückt wurde.
In ihrem Kopf konnte Dani immer noch das Schrillen von Sirenen hören – so wie sie es die letzten Monate immer wieder gehört hatte. Hätte sie anders handeln sollen?
Sie rief sich das Gesicht ihres Vaters in Erinnerung, das Kräuseln um seine Augen, wenn er lächelte. »Du darfst nie an dir zweifeln, Dani«, sagte er oft. »Du kannst alles sein, was du willst.« Sie drehte sich abrupt um und kehrte über die Brücke zurück zur Polizeistation. Ohne in ihrem Tempo innezuhalten, stieg sie die drei Stufen vor dem Gebäude hoch. Rasch schritt sie durch die Tür, entschlossen, sich von Neuem zu beweisen.
Kapitel 5
Das Licht, das in mein Zimmer strömt, ist nun beinahe unerträglich hell. Ich stütze mich auf und greife nach meinem Handy, wische über das Display. Die Uhr verrät mir, dass ich zu spät bin. Ich werde Madeline schreiben, ich würde den Vormittag mit den Recherchen für meine nächsten Artikel verbringen. Und überhaupt, da Donnerstag ist, wird die Hälfte des Teams in Gedanken ohnehin schon beim Wochenende sein.
Ich betrachte den Raum. Meine Klamotten sind auf dem Boden verstreut, mein leeres Portemonnaie neben die Armbanduhr geworfen, die Mum mir zum achtzehnten Geburtstag geschenkt hat. Mein Kopf dreht sich immer noch, und so lasse ich mich wieder aufs Kissen fallen und starre zur Decke hoch. Tränen machen sich brennend bemerkbar, und ich presse mir die Finger in die Augenwinkel. Nach ein paar tiefen Atemzügen schlage ich die Bettdecke zurück, und da höre ich das Rauschen von Wasser aus meinem Badezimmer.
Sekunden später geht die Badtür auf, und Mrs Cranfield kommt in mein Zimmer gewuselt. Ich würde es zwar nie wagen, Mrs Cranfield meine Teilzeit-Haushälterin zu nennen, zumal ich ihr nie auch nur einen Penny gezahlt habe, aber sie leistet hervorragende Arbeit, indem sie mir hilft, mein Haus in Ordnung zu halten. Sie und ihr Mann sind zwei jener bemerkenswerten Menschen, die mir nach Mums Tod geholfen haben, wieder auf die Beine zu kommen. Für mich sind sie mehr so was wie Ersatzmutter und -vater geworden. Ich würde nur ungern ohne sie leben, auch wenn sie, wie alle Eltern, zuweilen ein klitzekleines bisschen nerven können.
»Du bist ja wach«, bemerkt Mrs Cranfield. »Das Bad ist ein einziger Saustall.«
»Echt?«, erwidere ich und taste hektisch nach der Bettdecke, um meine Blöße zu bedecken.
»Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte.« Sie durchquert energisch das Zimmer, wobei sie meine Shorts aufhebt und sie aufs Bett wirft. »Du musst dich noch mal übergeben haben, als du nach Haus kamst. Ich werde später wiederkommen, um ordentlich drüberzuwischen.«
»Noch mal …?«, frage ich zaghaft.
»Nachdem du auf dem Heimweg in unseren Vorgarten gekotzt hast. George ist gerade dabei, die Klematis mit dem Schlauch abzuspritzen.«
»Oje, das tut mir echt leid«, erwidere ich beschämt, während ich gleichzeitig versuche, an meine Shorts ranzukommen.
»Im Ernst, Ben, dieses Klo ist fürchterlich dreckig. Ich will gar nicht dran denken, wann du es das letzte Mal richtig geputzt hast.«
Irgendwie gelingt es mir, unter der Decke in die Shorts zu schlüpfen, bevor ich mich im Bett aufsetze. »Jetzt bin ich ja wach, Mrs C, ich denke also …«
Sie zieht die Jalousien hoch, ohne mir zuzuhören. »Ich werde hier aufräumen, wenn du unter die Dusche springst. Unten steht schon ein Frühstück.«
Bei Mrs Cranfield ist jeglicher Widerstand zwecklos.
»Du siehst vielleicht aus!«, kommentiert sie, als ich aufstehe, und ich merke, dass ich die Shorts verkehrt herum anhabe. »Wenn man sonst nie trinkt, erwischt es einen viel schlimmer. Du hast eben nicht an deiner Trinkfestigkeit gearbeitet, so wie mein George.«
Ich eile ins Badezimmer und schließe die Tür.
»Und überhaupt, was würde deine Mum dazu sagen?«, ruft sie mir nach.
Der heiße Dampf der Dusche hilft nicht gerade, meinen Kopf zu klären, und als ich ins Schlafzimmer zurückkehre, wummert er weiter. Mrs Cranfield hat das Bett abgezogen und die Klamotten vom Boden aufgelesen. Das Fenster wurde aufgerissen und lässt die Außenwelt herein. Ich schnappe mir ein T-Shirt aus dem Schrank und ziehe es über, während ich zum Fenster gehe. Die junge Frühlingssonne hat neues Leben auf den Haddley Common gebracht; Narzissen sprenkeln die Wiese, und Kirschblüten bedecken die Bäume. Ein Blätterdach hat sich über dem Weg gebildet, der von der Straße, wo alle zehn Minuten der Bus hält, abgeht und über den Anger in den dunklen, schattigen Wald führt.
An der Straßenecke kann ich Mr Cranfield die Blumen in seinem Garten hegen sehen, genau wie damals vor zehn Jahren. Er war in Altersteilzeit, seit ich denken kann, und hat sich in den letzten zwölf Monaten schließlich ganz aus dem Brillenfachgeschäft zurückgezogen, das er fast zwanzig Jahre geführt hatte. In der Freizeit versuchen wir, alle paar Wochen ein Spiel des Richmond Rugby Club unterzubringen. Ich hatte zwar nie den Eindruck, dass er ein großer Fan dieses Sports ist, aber wir fingen vor Jahren damit an, als mein bester Freund Michael Knowles es in den A-Kader von Richmond schaffte. Er war da zwar nur eine Saison, bevor er nach Bath zog, um dort in der Premiership-Liga zu spielen, aber Mr C und ich blieben unseren Lokalhelden treu. Ich glaube, was Mr C heutzutage am meisten Freude bei unseren Ausflügen ins Stadion macht, ist, mich über die Artikel auf unserer News-Seite auszuquetschen, da er immer einen Insiderblick in die neuesten politischen Skandale will. Auch wenn er während der Spiele praktisch nicht aufhört zu reden, genieße ich die Zeit mit ihm.
Ich schaue ihm zu, wie er zu dem Gemüsebeet hinübergeht, das er seitlich vom Haus angelegt hat. Da es das letzte in der Straße ist, verfügen die Cranfields über ein zusätzliches Stückchen Land, das Mr C seit dem Tag ihres Einzugs sorgfältig pflegt. Wie er seine Spatengabel hebt, der Griff mit Schnur umwickelt, sieht er genauso aus wie an jenem Morgen vor nun fast zehn Jahren. Vielleicht hat er heute ein paar Pfund mehr auf den Rippen, und vielleicht ist sein graues Haar etwas schütterer, aber ansonsten könnte ich gerade auch die Szene von damals beobachten.
Ich höre Mrs Cranfield in der Küche herumklappern. An jenem Morgen, nachdem die Polizei das Haus verlassen hatte und ich allein im Flur stand, kam Mrs Cranfield durch die Hintertür ins Haus. Sie durchquerte die Küche und setzte sich neben mich auf die Treppe. Sie hielt mich in ihren Armen, während ich schluchzte. Ich bezweifle, dass ich ohne sie den Tag überstanden hätte.
Ich gehe nach unten in die Küche, wo ich vom Duft nach frisch aufgebrühtem Kaffee und brutzelndem Speck begrüßt werde.
»So siehst du schon anständiger aus«, sagt Mrs Cranfield beifällig. »Was war denn der Grund, dass du gestern Abend so über die Stränge geschlagen bist?«
»Die Arbeit«, antworte ich und greife nach der Kaffeekanne. »Ich hatte Zoff in der Redaktion. Dummerweise meinte ich, ich bräuchte einen Drink, um runterzukommen.«
»Ich tippe mal, das hat es nur schlimmer gemacht. Hat Alkohol so an sich.« Mrs Cranfield reicht mir ein Specksandwich, bevor sie sich unbeholfen auf einen der Barhocker hievt, die Mums Landhausstühle ersetzt haben. »Ich werde nie verstehen, warum du diese Dinger gekauft hast«, brummt sie und klammert sich haltsuchend an der Kücheninsel fest. Sie sieht, dass ich ein Grinsen unterdrücke, und bricht in Lachen aus. »Meine Figur ist eben nicht geschaffen für so moderne Küchentrends.«
»Also ich finde ja, Sie sehen toll aus.«
»Charmeur«, erwidert sie schnaubend.
Es war Mrs Cranfield, die mich die letzten Jahre dazu ermuntert hat, das Haus zu meinem Heim zu machen. Nach Mums Tod kehrte ich nach Manchester zurück, gab das Trinken auf und schaffte einen ordentlichen Uniabschluss. Das Jahr darauf reiste ich durch die Welt. Mein alter Schulfreund Michael nahm den Flieger, um sich mir ein paar Wochen anzuschließen, als ich gerade in den USA war, und wir verbrachten Mardi Gras in New Orleans. Ich hatte damals seit dem Tod meiner Mutter keinen Tropfen mehr angerührt, und mitzukriegen, wie Michael durch eine Glastrennwand am Hotelpool lief und zwei Wochen im Louisiana University Hospital verbrachte, bestätigte mich nur in den Gefahren exzessiven Alkoholkonsums.
Als ich nach England zurückkehrte, bekam ich direkt meinen ersten Job – er war von Haddley aus günstig gelegen, und mir wurde klar, dass es an der Zeit war, nach Hause zurückzukehren. Am Anfang war es schwierig, da ich mir eingeredet hatte, ich könnte die Hauptstraße von Haddley nicht entlangspazieren, ohne erkannt zu werden, aber mit der Zeit bemerkte ich, dass die meisten Menschen eher wohlmeinend als böswillig waren.
»Mit wem hast du dich denn gezofft?«
»Rate mal.«
Mrs C schmunzelt. Sie hat schon so viele Geschichten von meiner turbulenten Beziehung mit meiner Chefin gehört.
»Madeline will, dass ich zum zehnten Todestag einen Artikel über Mum schreibe«, erkläre ich. »Ich habe Nein gesagt«, schiebe ich rasch hinterher, als Mrs Cranfield schon den Mund öffnet, um was einzuwenden.
»Diese Frau verfügt über kein Fünkchen Moral.« Sie schnalzt missbilligend mit der Zunge. »Von dir zu verlangen, das alles noch mal durchzumachen … Als ob das irgendwem helfen würde. Ihr Verhalten ist schlicht inakzeptabel.«
Lächelnd nehme ich einen Schluck von meinem Kaffee. »Sie finden also, ich sollte hart bleiben?«
Mrs C hebt eine Augenbraue. »Jetzt erzähl mir nicht, du hättest darüber nachgedacht.«
»Min meinte, es könnte mir helfen, meine letzten Fragen zu den Akten zu legen.«
»Min ist ein liebes Mädchen, aber im Ernst …«
»Ich frage mich immer noch, was passiert wäre, wenn ich nicht so verkatert gewesen wäre, Mrs C … Wenn ich doch nur mit ihr gesprochen hätte, bevor sie ging, oder ihr gefolgt wäre. Vielleicht wäre alles anders ausgegangen.«
»Ben, das hatten wir doch schon. Es war nicht deine Schuld. Du darfst dir niemals die Verantwortung dafür geben«, flüstert Mrs Cranfield, klettert von ihrem Hocker und drückt meinen Arm. Sie lässt den Kopf sinken, geht zur Spüle und fängt an, energisch die Pfanne zu schrubben.
»Sie werden sich noch die Hände verbrühen«, sage ich angesichts des Dampfes, der aus dem Wasser steigt, aber Mrs C schrubbt unbeirrt weiter. Ich gehe zu ihr rüber und drehe das Wasser ab. »Sauberer wird die Pfanne nicht – diese Flecken sind eingebrannt fürs Leben.«
Sie trocknet sich die Hände an einem Geschirrtuch ab und mustert mich einen Moment. »Dann erzähl mir mal von deinem Abend gestern«, sagt sie. »Min ist dabei gewesen?«
»Min und noch ein paar andere Kollegen.«
»Min ist nur eine Kollegin?«
»Kollegin beziehungsweise gute Freundin, mehr nicht.«
»Und sind die anderen Kollegen auch gute Freunde? Oder gilt das nur für Min?«
»Genug!«, sage ich lachend, kehre zum Küchentresen zurück und quetsche noch einen Klecks Ketchup auf mein Specksandwich.
»Na schön, dann stelle ich eben keine Fragen mehr.« Mrs C hebt in gespielter Kapitulation die Hände. »Hast du auch genug Ketchup drauf?«, fragt sie neckend, als ich die Flasche noch mal zusammendrücke. »Das erste Mal, als du mit mir und George zu Mittag gegessen hast, hast du dich geweigert, irgendwas zu essen, was nicht in Ketchup ertränkt war.«
»Ich war zehn!«
»Manche Dinge ändern sich nie.«
An jenem Tag sollte Mum zu ihrem ersten Vorstellungsgespräch, da sie beschlossen hatte, wieder arbeiten zu gehen. Ich hatte wegen einer Lehrerfortbildung nur Vormittagsunterricht, und Mr und Mrs Cranfield sprangen bereitwillig ein, um derweil auf das Kind aufzupassen. Mum, die in der Zwickmühle steckte, nahm das Angebot der neuen Nachbarn, die erst zwei Wochen zuvor in die Straße gezogen waren, dankbar an. Da Mrs Cranfield mit Auspacken und dem Einrichten des neuen Heims beschäftigt war, nahm Mr Cranfield mich zum Fluss mit runter, um mir die Grundlagen des Süßwasserangelns beizubringen. Kaum hatte er die Dose mit Lebendködern geöffnet und ich die Maden darin zappeln gesehen, wurde es schnell zu meiner ersten und letzten Angelerfahrung.
»Sie war so glücklich, wieder arbeiten zu können«, sagt Mrs C, und auch ich erinnere mich an Mums Freude, als zwei Wochen später der Brief mit der Stellenzusage eintraf. »Alles, was sie wollte, war, für dich zu sorgen.« Mrs C hält inne. »Und mir war sie eine so gute Freundin …«, da ist ein Zittern in ihrer Stimme, »… aber jetzt stehst du für mich an erster Stelle – um deinetwillen und deiner Mum willen.« Mrs C spült ihre Tasse unter dem Wasserhahn aus, bevor sie hinzufügt: »Komm doch Sonntag zum Mittagessen. Und bring eine Kollegin mit, wenn du magst.«
Ich lache, und als sie sich zum Gehen wendet, drücke ich sie in einer Umarmung an mich. »Danke schön.«
»Ach was«, erwidert Mrs C. »Dafür bin ich doch da.« Und mit einem kurzen Wink spaziert sie durch die Küchentür und über den schmalen Weg zu ihrem Haus zurück.
Ich gieße mir einen Kaffee ein, bevor ich die Terrassentüren aufschiebe, die zu meinem kleinen Garten hinausführen. Ich setze mich auf die Stufe in die frische Frühlingssonne, entsperre mein Handydisplay und klicke unsere neue App an. In der Promirubrik heißt es, dass eine minderjährige Adelstochter dabei gesehen wurde, wie sie angetrunken mit einem Kerl aus einem Nachtclub getorkelt kam, der definitiv kein Duke von irgendwas ist. Der Aufmacher auf der Hauptseite berichtet vom Unglück dreier Personen, die im Zentrum von Nottingham von einem umgestürzten Baukran erschlagen wurden; dicht gefolgt von einem Artikel über eine Frau, die in einem Vorort von Leeds tot in ihrer Einzimmerwohnung aufgefunden wurde. Ich scrolle mich durch die Einzelheiten. Die Polizei verweigert zu diesem Zeitpunkt weitere Auskünfte, kann jedoch nicht ausräumen, dass sie unter ungewöhnlichen Umständen starb. Jeder halbwegs anständige Journalist weiß, was das bedeutet: dass die Frau aller Wahrscheinlichkeit nach ermordet wurde, die Behörden es jedoch nicht öffentlich bestätigen wollen.
Ich klicke zurück und wische mich durch die Schlagzeilen weiter nach unten, halte jedoch abrupt inne, als mir plötzlich die Augen meiner Mutter entgegenblicken.
INERINNERUNGANCLAREHARPER – ZEHNJAHREDANACH
Zwei Wochen vor dem Todestag meiner Mutter kündigt Madeline einen Artikel an, der erst noch geschrieben werden muss. Ihre Dreistigkeit verblüfft mich immer wieder aufs Neue.
Ich starre auf mein Handy. Das Foto meiner Mutter ist mir nur allzu bekannt. Aufgenommen an einem kühlen Sommerabend im Jahr, bevor sie starb: das Licht hinter ihr verblassend, in ihren liebsten Pulli gekuschelt, an der Themse sitzend. An jenem Abend war ich in Haddley unterwegs gewesen und ging gerade am Fluss entlang nach Hause, als ich sie da allein am Ufer erblickte, während die wässrige Sonne hinter dem Wald versank. Ohne dass sie es bemerkte, fing ich den Anblick mit meinem Handy ein – das Bild einer Frau im Einklang mit der Welt. Danach saßen wir gemeinsam da und unterhielten uns über einen Kurztrip nach Bordeaux, den sie gerade erst mit zwei engen Freundinnen unternommen hatte; sie erzählte, wie sie jeden Tag unterschiedliche Winzereien besichtigt und bis spät in die Nacht Wein trinkend auf der Terrasse gesessen hatten. Das Foto gab den neu gefundenen Frieden wieder, den diese Reise ihr geschenkt hatte. Als sie starb, war es dieses Bild, das ich zur Veröffentlichung für die Presse auswählte.
Unter dem Foto befindet sich eine Reihe von Links zu thematisch verknüpften Artikeln. Einer führt zu einer Reportage von vor zig Jahren, die für eine Frauen mit Courage-Reihe geschrieben wurde. Ich lese den Bericht von Neuem – eine Hommage an Frauen mit großer innerer Würde und Kraft.
Als ich mich durch den Text scrolle, bleibe ich an einem Foto von meinem Bruder Nick mit seinem besten Freund, Simon Woakes, hängen. Es ist ein Bild, das zum Synonym wurde für Nicks und Simons Geschichte – ein berüchtigtes Bild, das es weltweit zu trauriger Berühmtheit brachte. An der Seitenlinie des Richmond Rugby Club, in den Mannschaftstrikots ihrer Schule und mit einem Siegerlächeln im Gesicht, stehen sie da, Nick und Simon. Neben ihnen, die Arme um sie geschlungen, zwei Klassenkameradinnen.
Die beiden vierzehnjährigen Mädchen, von denen die Jungs nur Wochen später bestialisch ermordet werden sollten.
Kapitel 6
Ich drückte mich an unserem Gartentor herum und wartete, dass Nick heimkam, wobei ich die zwei Mädchen beobachtete, die sich träge auf dem versengten Gras des Haddley Common fläzten. Die Ankunft des Busses brachte Leben in sie, und rasch rappelten sie sich auf, als die Nummer 29 auch schon am Bordstein hielt. Nick und Simon, die Rucksäcke geschultert, stiegen aus. Ich spähte über unsere Gartenmauer und sah, dass ein kurzer Wortwechsel folgte.
Dann tänzelte das erste Mädchen davon, das Haar in der späten Nachmittagssonne herumwirbelnd. Sie streckte beide Hände aus, um die ihrer Freundin zu nehmen, und zog sie mit sich; zu zweit sausten sie über das weite offene Feld auf den dichten Wald zu, der Haddley vom Nachbardorf St. Marnham trennte. Ich konnte sie über den Anger hinweg kreischen hören, während sie sich immer wieder im Kreis drehten.
Einen Moment lang schienen Nick und Simon zu zögern, aber dann sah ich, wie sie ihre Schritte beschleunigten, um die Mädchen einzuholen. Neugierig überquerte ich die Straße vor unserem Haus und betrat die ausgedörrte Wiese. Das Gras war trocken und knisterte. Ich spürte die sengende Hitze auf mich niederbrennen; es war einer dieser zähen Sommerferientage, die einfach nicht zu Ende gehen wollten. Die Gestalten von Nick und Simon vor mir verschwammen im Sonnenlicht. Ich achtete darauf, Abstand zu halten, musste jedoch schon bald rennen, um sie nicht aus den Augen zu verlieren. Wie jeder Achtjährige mit Forscherdrang war ich erpicht darauf, herauszufinden, wohin sie unterwegs waren.
Atemlos erreichte ich den zugewucherten Eingang zum Wald; ich sog tief die trockene Luft ein, bevor ich die Schultern krümmte und mich gebückt hineinbegab. Sofort spürte ich, wie die Hitze verflog, da das Kronendach der Bäume die Sonnenstrahlen aussperrte.
Rasch hastete ich weiter, spürte ein kleines Rinnsal aus Schweiß mein Rückgrat hinabsickern.
Im Wald herrschte Stille, die Äste der Bäume harrten reglos, da nicht die leiseste Brise ging. Das einzige Geräusch kam vom Rascheln des welken Laubs unter meinen Füßen. Ich lauschte nach irgendeinem Laut, der mich auf meiner Suche hätte leiten können, doch gerade da ratterte ein Zug über die Gleise, die oberhalb des Waldes verliefen.
Ich wartete.
Dann lauschte ich erneut. Ich hörte bloß meinen eigenen Atem … bis ein ferner Ruf durch die Bäume hallte. Nick wäre stinksauer, würde er mich erwischen, aber ich eilte auf Zehenspitzen weiter, wobei ich mich geduckt zwischen den wild wuchernden Sträuchern hielt. Ich steuerte die kleine Senke tief im Wald an, wo mein Bruder und seine Kumpels sich oft versteckten.
Der schmale Pfad wand sich vor mir her, und ich schob mich durchs Unterholz, bis ich endlich die Lichtung erreichte. Kurz war ich geblendet von dem Sonnenlicht, das durch die Lücke im Blätterdach fiel, und stolperte seitwärts. Mein Nacken brannte unter der gleißenden Hitze.
Die Senke war leer.
Ich schlurfte über den Boden, kickte Zigarettenstummel weg, wirbelte Staub auf. Ohne eine Spur von meinem Bruder, dafür mit zunehmendem Durst, beschloss ich, mich auf den Heimweg zu machen.
Ein fernes Lachen schallte durch den Wald.
Dann noch eins.
Dann ein Freudenschrei.
Sofort wusste ich, wo sie waren – eine kleine Anhöhe am anderen Ende des Waldes in der Nähe von St. Marnham. Nicks Geheimplatz. Um mich ungesehen anzupirschen, musste ich an der zugewucherten Böschung über den Bahngleisen entlangkraxeln. Als ich mich durch die Disteln schob, verhakte sich ein Stachel in meiner Armbeuge. Ich zog ihn raus und betrachtete die dünne Linie aus Blut, die an meinem Unterarm entlangrann und in meine Handfläche sickerte. Ich biss mir auf die Lippen, um den Schmerz zu unterdrücken.
Als ich endlich vor dem riesigen Erdhügel stand, kehrte wieder Stille in dem luftleeren Wald ein. Ich begann mit meinem Aufstieg, krabbelte den Hang hoch, wobei meine Füße auf dem staubigen Untergrund wegrutschten. Unfähig, Halt zu finden, spürte ich, wie ich abwärts glitt, bis ich eine abgestorbene Wurzel zu greifen bekam und mich wieder hochzerrte. Als ich den Gipfel endlich erreichte, klopfte ich meine Klamotten ab und blickte dann auf mein Lieblingsfußballshirt hinab – es war voller trockener Erde und Blut.
Langsam schlich ich vorwärts.
Ein …
… zwei …
… drei zögernde Schritte.
Dann blieb ich stehen.
Ich hielt den Atem an.
Auf der anderen Seite des Hügels lagen Nick und Simon. Nackt. Ihre Arme ausgestreckt, ihre Fußsohlen zu mir zeigend.
Verwirrt schlich ich weiter vorwärts.
Meine Schreie zerrissen die Stille.
Kapitel 7
Die Kollegin am Empfang lächelte ihr zu, und Dani musste sich ermahnen zu atmen, als sie an ihr vorbei in die Damenumkleide ging. Es war kaum zu glauben, dass dieser Ort sich vor fünf Monaten wie ihr Zuhause angefühlt hatte. Als sie die Tür aufschob, hielt sie kurz inne, um einen Blick auf das Schwarze Brett zu werfen – freie Startplätze beim Richmond-Halbmarathon, Pilates-Kurse, Tai Chi, die anstehende Party zum 21. Geburtstag eines Auszubildenden. Dani hatte zu ihrem 21. eine ganz ähnliche Einladung an das Brett gehängt. Sie war erst zwei Wochen davor in der Truppe aufgenommen worden und war zur Feier mit zig neuen Freunden unten am Fluss gewesen.
Als sie zu ihrem Spind ging, fragte Dani sich, wie viele Kollegen heute noch abends was mit ihr unternehmen würden. Als sie nach ihrem Vorhängeschloss griff, war ihr Kopf plötzlich leer. Sie probierte eine Zahlenkombination, dann eine zweite und schließlich die dritte – Mats Geburtstag. Dass sie den vergessen hatte, machte es nur noch schlimmer.