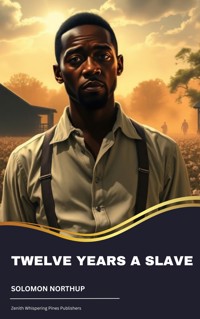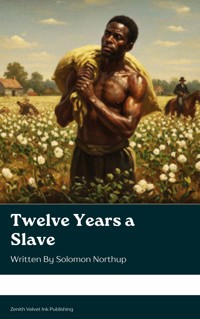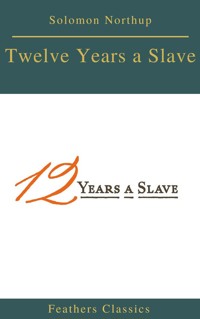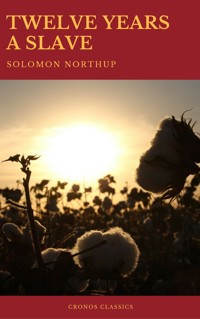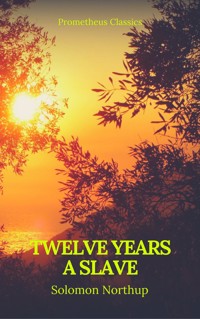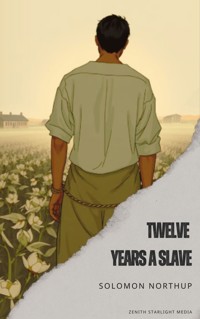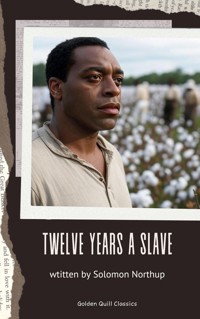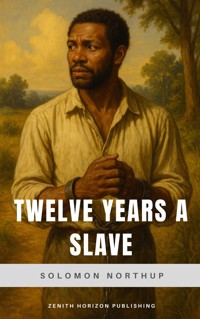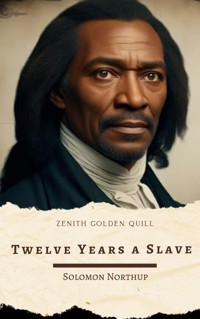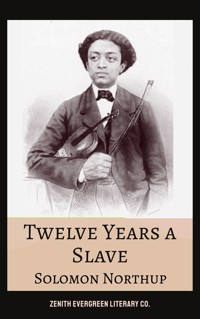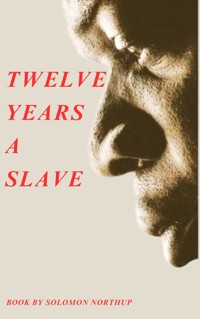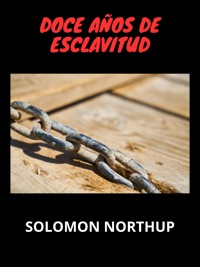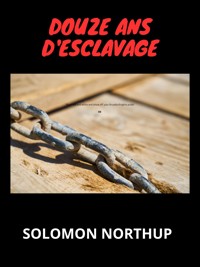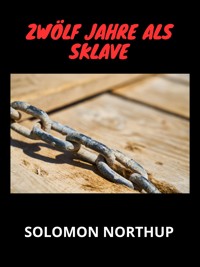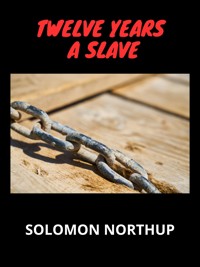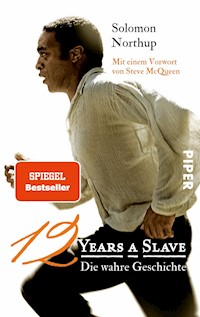
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Solomon Northup lebte als freier Bürger, bis er von Sklavenhändlern verschleppt und an einen Plantagenbesitzer in Louisiana verkauft wurde. Zwölf Jahre erlitt er grausamste Gefangenschaft, bevor er seine Freiheit zurückgewann und zu seiner Familie heimkehrte. Seine Memoiren von 1853 sind nicht nur wertvolles historisches Testament, sondern auch berührendes Zeugnis eines mutigen und unnachgiebigen Mannes. John Ridleys Drehbuch basiert auf seinem wahren Bericht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Johannes Sabinski und Alexander Weber
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-492-96708-2
Deutschsprachige Ausgabe: © 2014 Piper Verlag GmbH, München Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Twelve Years a Slave« Vorwort: © Steve McQueen, 2013, und Bianca Stigter, 2014 Szenenfotos: TOBIS Film Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagmotiv: © 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Vorwort
Ein Buch über den Mut
Steve McQueen
Dreieinhalb Jahre bevor die Produktion von Twelve Years a Slave endete, war ich verloren. Ich wusste damals, ich wollte eine Geschichte über Sklaverei erzählen – doch wo beginnen?
Mir schwebte ein Protagonist vor, mit dem sich jeder Zuschauer identifizieren kann, ein freier Mann, der gefangen genommen und gegen seinen Willen festgehalten wird. Monatelang versuchte ich eine Geschichte um diesen Anfang zu schreiben, ohne großen Erfolg – bis meine Partnerin Bianca Stigter, eine Historikerin, mir vorschlug, dass ich mir wahre Berichte über Sklaverei anschaue. Nur Tage nach Beginn unserer Recherche hatte Bianca Twelve Years a Slave entdeckt.
»Ich glaube, ich habe es gefunden«, sagte sie. Was für eine Untertreibung. Das Buch verschlug uns den Atem: der epische Umfang, die Details, das Abenteuer, der Horror und die Menschlichkeit. Das Buch liest sich wie ein Drehbuch, bereit, gefilmt zu werden. Ich konnte kaum glauben, dass ich noch nie von diesem Buch gehört hatte. Es schien uns ebenso bedeutend wie Das Tagebuch der Anne Frank, nur dass es fast hundert Jahre früher veröffentlicht worden war.
Und nicht nur ich kannte das Buch nicht. Keiner der Menschen, mit denen ich sprach, hatte von Twelve Years a Slave oder von Solomon Northup gehört. Das war erstaunlich! Eine solch wichtige Geschichte, erzählt mit dermaßen viel Herz und Schönheit, musste mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Ich hoffe, mein Film kann einen Teil dazu beitragen, diesem wichtigen Buch über den Mut eine größere Bekanntheit zu verschaffen.
Solomons Tapferkeit und Leben verdienen nichts weniger.
Steve McQueen,
Amsterdam, 2013
Wie ich Solomon Northups Twelve Years a Slave fand
Bianca Stigter
Als ich Brad Pitt nach der Premiere von Twelve Years a Slave in Toronto traf, drängte er mich dazu, etwas zu tun, wozu ich keine Ermutigung brauche: »Lies weiter.« Ich lese viel – Belletristik und Sachbücher, Romane und historische Berichte, Bücher über Kunst und Bücher über Lernen. Ich habe immer gelesen – als Kind, als Historikerin und als Journalistin. Einer meiner liebsten Schriftsteller ist der Römer Plinius der Ältere. Er schrieb seine Naturalis Historia zu einer Zeit, in der alles Wissen in ein Buch passte. Ein weiterer ist der surreale, französische Dichter Francis Ponge, der in seinem Prosagedicht Die Seife zeigte, dass man nicht alles wissen kann, nicht einmal über ein Stück Seife. Doch selten las ich ein Buch, das einen solch nachhaltigen Effekt auf mich hatte wie Solomon Northups Bericht seiner jahrelangen Gefangenschaft als Sklave in Amerikas tiefem Süden.
Im Internet stolperte ich darüber. Die Ausgabe war nicht besonders ansprechend – sie hatte einen beigefarbenen Einband mit einem einfachen Cover. Als das Buch bei mir eintraf, schaute ich es mir ohne große Erwartungen an. Doch das änderte sich schon nach wenigen Seiten. Es war, als würde ich Homers Odyssee lesen, doch gleichzeitig auch wie Dan Browns The Da Vinci Code – Sakrileg; die Geschichte war so fesselnd, dass ich nicht aufhören konnte zu lesen. Ich las im Gehen, beim Kochen, während ich die Kinder zu Bett brachte – und vor allem las ich mit Unglauben. Wie hatte so etwas geschehen können?
Ich rannte die steilen Stufen in unserem Haus in Amsterdam hoch und fand Steve in seinem Zimmer (er nennt es nicht gerne sein Studio), umringt von Büchern und Kinderspielzeug. Wie immer war er am Telefon, doch als er meine geweiteten Augen und geröteten Wangen sah, legte er sofort auf. »Du musst dieses Buch lesen«, sagte ich und sprach dabei in Großbuchstaben.
»Ich glaube, ich habe es gefunden. Du kannst aufhören zu suchen. Alles ist hier drin.« Steve wollte mir das Buch aus der Hand nehmen. »Du kannst es haben, wenn ich fertig bin.«
Ich hatte Twelve Years a Slave zusammen mit einigen anderen Büchern über Sklaverei im Internet bestellt, um Steve mit seinen Recherchen zu helfen. Das war im Winter 2009 gewesen. Steve hatte gerade Hunger, seinen ersten Spielfilm, abgedreht und arbeitete an seiner zweiten Produktion, Shame. Er hatte bereits begonnen, über sein nächstes Projekt nachzudenken, einen Film über Sklaverei. Sklaverei ist ein Thema, das – soweit es Filme angeht – fast nicht stattfindet. Wenn das Kino die einzige Quelle wäre, um etwas über unsere Vergangenheit zu erfahren, dann wäre Sklaverei nur eine unbedeutende Erscheinung, etwas, das weniger Bedeutung hatte als, sagen wir, der Tod von Prinzessin Diana. Es wurden mehr Filme über den römischen Sklaven Spartakus gedreht als über alle amerikanischen Sklaven zusammen. Selbst Filme über Sklaverei wie Lincoln zeigen kaum ein Abbild der Zustände und haben selten einen Sklaven als Protagonisten.
Wir leben in Amsterdam – ich bin hier geboren und Steve zog in den Neunzigerjahren hierher –, der Hauptstadt der Niederlande, einem Land, das sich stark an dem transatlantischen Sklavenhandel beteiligt und als eines der letzten die Sklaverei in seinen amerikanischen Kolonien abgeschafft hat. Bis zum vergangenen Jahr war kein einziger niederländischer Film über dieses Thema produziert worden. Im Zentrum von Amsterdam ist Sklaverei nur für diejenigen sichtbar, die wissen, dass einige der opulenten Kanalhäuser des goldenen Zeitalters von Sklavenbesitzern erbaut worden sind, die ihr Vermögen in den Westindischen Inseln gemacht haben.
Steve hatte sich bereits überlegt, seinen nächsten Film um einen freien amerikanischen Mann spielen zu lassen, der entführt und versklavt wird und mit dem sich jeder Zuschauer identifizieren konnte. Doch er war festgefahren. Ich hatte ihm vorgeschlagen, dass er nach wahren Berichten über Sklaverei suchen solle, denn die Vergangenheit ist eine gewaltige Fundgrube. Die Geschichte hält so viele erstaunliche Gegebenheiten bereit, da muss man vielleicht keine erfinden.
An diesem Abend in seinem Zimmer bat mich Steve, ihm die bisherige Geschichte von Solomon Northup zu erzählen. Sie beginnt im Jahre 1841 im Staat New York, wo Northup als freier Bürger mit seiner Familie lebt, bis er verschleppt, nach Süden verschifft, auf einem Sklavenmarkt in New Orleans verkauft und auf verschiedenen Plantagen versklavt wird, bevor er 1853 seine Freiheit zurückerlangen kann. In jedem Kapitel berichtet Northup mit unglaublichem Detailreichtum von unfassbaren Ereignissen, sodass man meinen könnte, Zeitreisen seien doch möglich. Auf einmal war ich dort, von Amsterdam nach Louisiana befördert, über einen Kontinent und zwei Jahrhunderte, um eine Hinrichtung zu bezeugen. Sein neuer Besitzer will Northup töten: »Na dann«, erkundigte sich einer von Tibeats Gesellen, »wo sollen wir den Nigger hängen?« Einer schlug einen Ast vor, der vom Stamm eines Pfirsichbaums abzweigte, nahe der Stelle, wo wir standen. Sein Kamerad hielt dagegen, er könnte brechen, und schlug einen anderen vor. Schließlich einigten sie sich auf den letzteren. Wir hatten dies schon vorher bei dem unglaublichen Roman Blindness von José Saramago gemacht, der später verfilmt worden war. Steve war zu der Zeit unterwegs gewesen und hatte das Buch zu Hause vergessen, also hatte ich angefangen zu lesen. Jeden Abend hatte er mich angerufen und sofort gefragt: »Was ist passiert?!« Dann hatte ich ihm nach und nach die Geschichte erzählt, so weit wie ich an dem jeweiligen Tag gekommen war. Mit Northups Memoiren versuchten wir das Gleiche, doch dieses Mal war es schwieriger. Neben der schnell voranschreitenden Handlung besteht die Eindringlichkeit des Buches in der Fülle an Beschreibungen und Charakterisierungen. Jede Figur hätte ihr eigenes Buch verdient.
Außerdem liest sich der Roman zeitweise wie eine Betriebsanweisung für eine Zucker- oder Baumwollplantage. Und trotz des Elends, das Northup erleiden musste, schafft er es sogar hin und wieder, lyrisch zu sein: Wenige Anblicke schmeicheln dem Auge mehr als ein weites Baumwollfeld in voller Blüte. Es bietet ein Bild von Reinheit ähnlich einer hellen Fläche jungfräulichen Neuschnees.
Wenn man sich einmal an den langsamen, etwas hochtrabenden Schreibstil des 19.Jahrhunderts gewöhnt hat, schafft Twelve Years a Slave es, Geschichte so zu visualisieren, wie es kaum ein anderes Buch vermag.
Seite um Seite erstaunte Northup mich mit jeder Drehung und Wendung seines Berichts. Als ich das Buch zuschlug, trocknete ich meine Tränen und riß Steve erneut vom Telefon weg. »Du musst kein Skript mehr schreiben«, sagte ich ihm. »Dieses Buch ist ein Skript.« Ich gab es ihm, und Steve begann zu lesen – und stimmte mir bald zu. Nach der Lektüre wurde die erstaunliche Geschichte von Solomon Northup zu seiner Leidenschaft.
Als ich drei Jahre später, im Sommer 2012, zum Filmset kam, einer Plantage in der Nähe von New Orleans, drehten sie gerade die Hinrichtungsszene. Es war unglaublich bewegend, den Aufwand zu sehen, der in die Nachbildung von Northups Bericht investiert wurde – so akribisch und doch so frei wie nötig. Im letzten Moment bat Steve einige der Kinderkomparsen, hinter dem am Ast baumelnden Northup durch das Gras zu laufen. Dieses Detail war so nicht im Buch, hätte es aber ebenso gut sein können. Es zeigt die Brutalität und Schonungslosigkeit der Sklaverei, die für Kinder zur bedeutungslosen Normalität geworden war. Sie kannten es nicht anders. Die Tatsache, dass Solomon Northup es anders erlebt hatte, macht ihn so einzigartig. Er ist der einzige Mensch, der jemals einen Bericht über Sklaverei aus beiden Perspektiven verfasst hat: der des freien Mannes und der des Sklaven.
Jedes Mal wenn ich den Film gesehen habe – ängstlich im Schneideraum in Amsterdam, Notizen machend auf dem Laptop zu Hause, nervös bei der ersten Probeaufführung in einem ausverkauften Kino in L.A., überwältigt bei der Premiere in Toronto und stolz bei der Vorstellung in London –, habe ich mir die gleiche Frage gestellt: wozu das alles? Wozu all diese Arbeit, wenn das Buch bereits existiert? Doch wir leben in einer Zeit der Bilder. Fotografie und Filme sind zu den wichtigsten Medien geworden, um uns selbst und unsere Umwelt wahrzunehmen. Wenn es nicht abgebildet ist, existiert es nicht. Heutzutage braucht man fast einen Film, um ein Buch zu lesen.
Twelve Years a Slave war seinerzeit ein Bestseller: Northup und sein Koautor David Wilson verkauften allein im Erscheinungsjahr 1853, ein Jahr nach Onkel Toms Hütte, 30 000Bücher. Nach dem Bürgerkrieg geriet das Buch langsam in Vergessenheit, bis zwei Historiker aus Louisiana, Sue Eakin und Joseph Logsdon, es in den Sechzigerjahren wiederentdeckten. Bei ihrer Arbeit an der Louisiana State University in Alexandria und der Universität von New Orleans konnten sie die erstaunliche Detailgenauigkeit von Northups Bericht recherchieren und das Buch 1968 wiederveröffentlichen. Danach wurde es zu einem Klassiker im Bücherregal – mehr verehrt als geliebt, mehr von Historikern gelesen als von der breiten Öffentlichkeit.
Steves Film hat Solomons Geschichte ein neues Leben gegeben. 2013 wurden mehr Exemplare des Buchs verkauft als in all den Jahren zuvor. Jede Seite dieses Buches lässt dich ausrufen: »Das kann nicht wahr sein! Menschen können einander nicht so etwas antun.« Doch das taten sie, und in manchen Gegenden der Welt tun sie es noch immer.
Dieser Film ist näher an der Buchvorlage, als es die meisten Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen, sein können. Der amerikanische Filmverleih Fox Searchlight Pictures hat eine Website erstellt, auf der Bilder von allen heute noch lebenden Nachfahren von Northup zu sehen sind. Es gibt kaum Text, nur Namen und Fotos. Ich frage mich, wie Solomon wohl ausgesehen hat. Uns liegen keine Fotografien von ihm vor. Im Film trägt er das expressive und würdige Gesicht von Chiwetel Ejiofor. Wäre es wohl möglich, basierend auf den Fotos seiner Nachfahren, mithilfe eines Computeralgorithmus ein Abbild von Northup zu erstellen? Vielleicht wäre es möglich. Doch wenn man darüber nachdenkt, ist es unsinnig. Schließlich sind wir jetzt alle Solomon.
Bianca Stigter,
Amsterdam, 2014
Twelve Years a Slave
Bericht des Solomon Northup,
New Yorker Bürger,
verschleppt in der Stadt Washington im Jahre 1841
und
errettet im Jahre 1853,
von einer Baumwollplantage nahe des Red River in Louisiana.
»Es ist ein einzigartiger Zufall, dass Solomon Northup auf eine Plantage am Red River verschleppt wurde – in dieselbe Gegend, wo Onkel Toms Gefangenschaft spielt –, und sein Bericht über diese Plantage und die Art des Lebens dort und einige Ereignisse, die er beschreibt, bilden eine verblüffende Parallele zu dieser Geschichte.«
Schlüssel zu Onkel Toms Hütte, S.174
Dieses Buch ist voller Respekt
Harriet Beecher Stowe
gewidmet,
deren Namen in der ganzen Welt mit der Großen Reform verbunden ist;
dieser Bericht ist ein weiterer Schlüssel zu Onkel Toms Hütte.
»So angeschmiert sind sie vom schlecht Bestehenden, und so zur Ehrfurcht des geneigt, was steinalt ist, was Abfolge von langer Observanz zu seinen Gunsten geltend macht, daß selbst die Dienstbarkeit, der Übel schlimmstes, weil von dem Sire auf den Sohn vererbt, wie ein Reliquienschrein bewahrt wird und bewacht. Darf das denn seyn, kann es denn Choc vernünftiger Erörterung standhalten, daß ein Mann gebaut, gemischt wie alle andern Menschen aus widerstreitenden Impulsen, in dem Lust und Narrheit sich so weitreichend verschränken wie in der Brust des Sklaven, der ihm dient, ein Absoluter Zwingherr sein sollt’, der sich brüstet, der einzge Freisass’ seines Lands zu sein?«
William Cowper
Vorwort des Herausgebers (1853)
Als der Herausgeber mit der Niederschrift der folgenden Erzählung begann, rechnete er nicht damit, dass sie den Umfang dieses Bandes erreichen würde. Um jedoch alle Tatsachen, die ihm berichtet wurden, zu präsentieren, erschien es notwendig, sie auf die vorliegende Länge auszuweiten.
Viele der auf den nachfolgenden Seiten dargelegten Behauptungen sind durch mannigfaltige Tatsachen verbürgt, andere beruhen gänzlich auf Solomons Aussagen. Dass dieser sich strikt an die Wahrheit gehalten hat, davon ist der Herausgeber, der die Möglichkeit gehabt hätte, Unstimmigkeiten in seinem Bericht jederzeit zu entlarven, zutiefst überzeugt. Stets hat er dieselbe Geschichte wiederholt, ohne auch nur im kleinsten Detail davon abzuweichen. Zudem hat er das Manuskript sorgfältig durchgesehen und überall dort, wo auch nur die unbedeutendste Ungenauigkeit vorlag, seine Änderungen diktiert.
Es war Solomons Glück, während seiner Gefangenschaft mehrere Besitzer gehabt zu haben. Die Behandlung, die ihm auf der Plantage von Pine Woods widerfuhr, zeigt, dass es unter den Sklavenhaltern ebenso menschliche wie auch grausame Männer gibt. Über manche von ihnen spricht er gar mit Gefühlen der Dankbarkeit – über andere im Geiste der Verbitterung. Es ist glaubhaft, dass die folgende Schilderung seiner Erlebnisse auf der Plantage von Bayou Boeuf ein wahrhaftiges Bild der Sklaverei zeichnet, mit all ihrem Licht und Schatten, so wie sie heutzutage dort existiert. Unbefangen und ohne jegliche Voreingenommenheit und Vorurteile war es das alleinige Ziel des Herausgebers, eine wahrheitsgetreue Schilderung des Lebens von Solomon Northup zu liefern, so wie er sie aus seinem Munde vernommen hat.
Diesem Zweck gerecht zu werden ist ihm, wie er glaubt, gelungen, ungeachtet der zahlreichen Fehler in Stil und Ausdruck, die das Dargelegte enthalten mag.
David Wilson
Whitehall, N.Y., Mai 1853
Bericht des Solomon Northup
Kapitel I
Als freier Mann geboren, der über dreißig Jahre lang die Segnungen der Freiheit in einem freien Staate genoss – und am Ende dieser Zeit verschleppt und in die Sklaverei verkauft, wo ich verblieb, bis ich im Januar 1853 nach einer Gefangenschaft von zwölf Jahren glücklicherweise errettet wurde –, wurde mir nahegelegt, dass eine Schilderung meines Lebens und Schicksals für die Öffentlichkeit nicht uninteressant sein könnte.
Seit meiner Rückkehr in die Freiheit ist mir nicht entgangen, dass das Thema der Sklaverei in sämtlichen Staaten des Nordens auf wachsendes Interesse stößt. Werke der Dichtung, die deren Eigenheiten in angenehmerem sowie im abstoßenderen Licht darstellen, finden in noch nie da gewesenem Maße Verbreitung und haben, wie ich es sehe, ein fruchtbares Klima für Kritik und Diskussionen geschaffen.
Ich kann über die Sklaverei nur in dem Maße sprechen, wie ich sie selbst beobachten konnte – sprich: in dem Maße, in dem ich sie selbst kennengelernt und am eigenen Leibe erfahren habe. Mein Ziel ist es, eine ehrliche und wahrhaftige Schilderung der Tatsachen zu geben, meine Lebensgeschichte ohne Übertreibungen darzulegen und anderen das Urteil darüber zu überlassen, ob die erfundenen Geschichten womöglich ein Bild noch grausameren Unrechts oder noch schlimmerer Knechtschaft zeichnen.
Soweit ich es zurückverfolgen kann, waren meine Vorfahren Sklaven in Rhode Island. Sie gehörten einer Familie mit dem Namen Northup an, von denen einer in den Staat New York zog, um sich in der Stadt Hoosic im Rensselaer County niederzulassen. Er nahm Mintus Northup mit sich, meinen Vater. Beim Tod dieses Gentlemans, der sich etwa vor fünfzig Jahren zugetragen haben muss, wurde meinem Vater aufgrund einer Verfügung in dessen Testament die Freiheit geschenkt.
Henry B. Northup, Esquire, aus Sandy Hill, ein angesehener Rechtsanwalt und der Mann, dem ich, wie es die Vorsehung wollte, meine heutige Freiheit und die Rückkehr zu Frau und Kindern verdanke, ist ein direkter Nachfahre der Familie, in deren Diensten meine Vorfahren einst standen und von der sie den Namen bekamen, den ich heute trage. Dieser Tatsache ist wohl auch das beharrliche Interesse geschuldet, das er meinem Schicksal entgegengebracht hat.
Irgendwann nach seiner Befreiung zog mein Vater in die Stadt Minerva in Essex County, New York, wo ich im Juli 1808 geboren wurde. Wie lang er an letzterem Ort verblieb, kann ich nicht genau sagen. Von dort zog es ihn nach Granville in Washington County, in die Nähe eines Ortes namens Slyborough, wo er einige Jahre lang auf dem Hof von Clark Northup arbeitete, einem weiteren Verwandten seines ehemaligen Besitzers; von dort wiederum zog er auf die Alden Farm in der Moss Street, die etwas nördlich des Dorfes Sandy Hill liegt, siedelte dann aber über zur Farm an der Straße von St. Edward nach Argyle, die heute Russell Pratt gehört, wo er bis zu seinem Tod am 22.November 1829 lebte. Er hinterließ eine Witwe und zwei Kinder – mich und meinen älteren Bruder Joseph. Letzterer lebt noch immer in Oswego County, unweit der Stadt gleichen Namens. Meine Mutter starb während meiner Gefangenschaft.
Obwohl er als Sklave geboren war und mit allen Nachteilen lebte, denen meine unglückliche Rasse unterworfen ist, war mein Vater ein für seinen Fleiß und seine Rechtschaffenheit bekannter Mann, was viele, die ihn kannten, bereitwillig bezeugen können. Sein gesamtes Leben verbrachte er mit der friedvollen Arbeit in der Landwirtschaft und suchte nie Anstellung in jenen niederen Tätigkeiten, die in besonderem Maße den Kindern Afrikas zugewiesen zu werden scheinen. Abgesehen davon, dass er uns eine Bildung zuteilwerden ließ, die die anderer Kinder unseres Standes bei Weitem übertraf, erwarb er durch seinen Eifer und seine Sparsamkeit genügend Eigentum, um sich für das Wahlrecht qualifizieren zu können. Es war seine Gewohnheit, uns Geschichten aus seiner Jugend zu erzählen; und obwohl er allzeit die wärmsten Gefühle der Güte, ja sogar der Zuneigung zu der Familie hegte, in deren Haus er einst Leibeigener war, begriff er dennoch das System der Sklaverei als das, was es war, und sprach mit großem Kummer von der Erniedrigung seiner Rasse. Er war bestrebt, in uns einen Sinn für Moral zu wecken, und lehrte uns, unser Vertrauen und unsere Zuversicht dem HERRN zu schenken, der die niedersten Geschöpfe ebenso schätzt wie die höchsten. Wie oft sind mir nicht seine väterlichen Ratschläge in den Sinn gekommen, während ich in einer Sklavenhütte in den entlegenen und krank machenden Gebieten Louisianas lag, mein Körper von den unverdienten Wunden schmerzte, die ein unmenschlicher Master mir beigebracht hatte, und ich mir nichts sehnlichster wünschte als das Grab, in dem mein Vater lag – auf dass es mich vor der Peitsche meines Peinigers schützen möge. Auf dem Friedhof von Sandy Hill bezeichnet ein bescheidener Stein den Ort, an dem er seine letzte Ruhestätte fand, nachdem er mit Würde die Aufgaben der niederen Sphäre gemeistert hatte, in der zu wandeln Gott ihm in diesem Leben aufgetragen hatte.
Bis zu dieser Zeit arbeitete ich überwiegend gemeinsam mit meinem Vater auf der Farm. Meine freien Stunden verbrachte ich meist entweder über meinen Büchern oder mit dem Geigenspiel – einem Vergnügen, das die große Leidenschaft meiner Jugend war. Zudem war es mir stets ein Quell des Trostes gewesen, das den einfachen Wesen, mit denen ich mein Los teilte, Vergnügen bereitete und meine Gedanken für viele Stunden vom schmerzvollen Nachsinnen über mein Schicksal ablenkte.
Am Weihnachtstag 1829 heiratete ich Anne Hampton, ein farbiges Mädchen, das damals in der Nähe unseres Wohnsitzes lebte. Getraut wurden wir in Fort Edward von Rechtsanwalt Timothy Eddy, Esquire, einem Friedensrichter und noch immer angesehenen Bürger der Stadt. Anne hatte schon lange in Sandy Hill gelebt, und zwar bei Mr.Baird, dem Inhaber der Golden Eagle Tavern, sowie in der Familie des Reverend Alexander Proudfit aus Salem. Dieser Gentleman hatte jahrelang der presbyterianischen Gemeinschaft in letzterem Ort vorgestanden und war weithin bekannt für seine Gelehrtheit und Frömmigkeit. Anne hält die außerordentliche Güte und den ausgezeichneten Rat dieses guten Mannes noch immer in dankbarem Andenken. Zwar vermag sie nicht die genaue Linie ihrer Herkunft zu ermitteln, doch mischt sich in ihren Adern das Blut dreier Rassen. Es ist schwer zu sagen, ob das rote, weiße oder schwarze überwiegt. Die Vereinigung aller in ihrer Herkunft jedoch hat ihr ein einzigartiges, aber überaus gefälliges Äußeres verliehen. Obgleich sie diesen in gewissem Maße ähnelt, kann man sie dennoch nicht als Quadroon bezeichnen – eine Klasse, zu der, wie ich zu erwähnen vergaß, auch meine Mutter zählte.
Ich war gerade der Minderjährigkeit entwachsen und hatte im Juli des Vorjahres das Alter von einundzwanzig Jahren erreicht. Des Rates und Beistandes meines Vaters beraubt und mit einer Ehefrau, die meiner Unterstützung bedurfte, entschied ich mich für ein Leben in Fleiß. Der Erschwernis meiner Hautfarbe und dem Bewusstsein meines niederen Standes zum Trotze gab ich mich süßen Träumen von einer guten Zukunft hin, in welcher der Besitz einer bescheidenen Behausung mit ein paar Morgen Land darum der Lohn meiner Arbeit sein und mir Glück und Geborgenheit bringen würde.
Von meiner Hochzeit bis zum heutigen Tage war meine Liebe zu meiner Frau stets aufrichtig und standfest; und nur diejenigen, die schon einmal die innige Zärtlichkeit empfunden haben, die ein Vater für seine Kinder hegt, können meine Zuneigung zu den unseren nachfühlen, die uns seitdem geschenkt wurden. Dies halte ich für angemessen und notwendig mitzuteilen, damit alle, die diese Zeilen lesen, die Schmerzlichkeit der Leiden, die zu ertragen ich verdammt war, begreifen mögen.
Sogleich nach unserer Hochzeit begannen wir als Hausbedienstete zu arbeiten – in dem alten gelben Haus, das damals am südlichen Ende des Dorfes von Fort Edward lag und das später zu einer moderne Villa umgebaut worden ist, in der heute Captain Lathrop wohnt. Heute nennt man es das Fort-Haus. In diesem Gebäude fanden nach der Neuordnung des Bezirks manchmal Gerichtsverhandlungen statt. Zudem war es im Jahr 1777 von Burgoyne besetzt worden, da es unweit des alten Forts am linken Ufer des Hudson liegt.
Während des Winters führte ich zusammen mit anderen Ausbesserungsarbeiten am Champlain-Kanal durch, in dem Abschnitt, dem William Van Nortwick vorstand. David McEachron hatte das direkte Kommando über die Männer, in deren Gesellschaft ich arbeitete. Als der Kanal im Frühjahr wieder eröffnet wurde, war ich in der Lage, mir von dem gesparten Lohn ein Paar Pferde zu kaufen, sowie einige andere Dinge, die man zur Flößerei benötigt.
Nachdem ich mehrere tüchtige Arbeiter angestellt hatte, nahm ich Aufträge an, große Flöße aus Baumstämmen vom Lake Champlain bis nach Troy zu bringen. Dyer Beckwith und ein Mr.Bartemy aus Whitehall begleiteten mich auf mehreren dieser Fahrten. Während der Saison erwarb ich eingehende Kenntnisse in der Kunst und den Geheimnissen der Flößerei – Kenntnisse, die es mir später ermöglichen sollten, einem achtbaren Herrn gute Dienste zu leisten und die einfältigen Holzfäller am Ufer des Bayou Boeuf in großes Erstaunen zu versetzen.
Eine meiner Reisen den Lake Champlain hinunter eröffnete mir die Möglichkeit eines Besuchs in Kanada. Als ich nach Montreal kam, besichtigte ich die dortige Kathedrale und andere Sehenswürdigkeiten der Stadt. Von dort aus setzte ich meine Reise fort, besuchte Kingston und andere Städte und verschaffte mir einiges Wissen über die dortigen Örtlichkeiten, was mir später ebenfalls zugutekommen sollte, wie sich gegen Ende meiner Erzählung zeigen wird.
Nachdem ich meine Dienste am Kanal zu meiner und der Zufriedenheit meines Auftraggebers erfüllt hatte und ich, da die Schifffahrt dort erneut unterbrochen war, nicht untätig sein wollte, nahm ich einen weiteren Auftrag an, der mich verpflichtete, für Medad Gunn eine große Menge Holz zu schlagen. Dieser Beschäftigung ging ich im Winter 1831/32 nach.
Mit der Rückkehr des Frühlings schmiedeten Anne und ich Pläne, eine benachbarte Farm zu übernehmen. Seit frühester Jugend war ich die Arbeit in der Landwirtschaft gewohnt – eine Tätigkeit, die meinen Vorlieben bestens entsprach. Dementsprechend pachteten wir einen Teil der alten Alden-Farm, auf der einst schon mein Vater gewohnt hatte. Mit einer Kuh, einem Schwein und einem Joch tüchtiger Ochsen, die ich kürzlich von Lewis Brown aus Hartford erworben hatte, sowie anderen persönlichen Habseligkeiten zogen wir in unser neues Heim nach Kingsbury. In diesem Jahr pflanzte ich fünfundzwanzig Morgen Mais, säte große Felder Hafer ein und begann die Landwirtschaft meinen Mitteln entsprechend im größtmöglichen Maße zu betreiben. Anne versah die häuslichen Pflichten mit äußerster Sorgfalt, während ich hart auf dem Feld arbeitete.
An diesem Ort lebten wir bis zum Jahr 1834. In den Wintermonaten buchte man mich regelmäßig zum Geigespielen. Wo immer junge Leute zum Tanz zusammenkamen war ich beinahe stets zugegen. Überall in den umliegenden Dörfern kannte und schätzte man meine Geige. Auch Anne hatte sich während ihrer Jahre in der Eagle Tavern den Ruf einer großartigen Köchin erworben. Ja, sie war fast schon eine Berühmtheit auf diesem Gebiet. In den Wochen, in denen das Gericht tagte, und bei öffentlichen Anlässen arbeitete sie hoch bezahlt in der Küche von Sherrill’s Coffee House.
Stets kehrten wir von diesen Aufführungen und Veranstaltungen mit reichlich Geld in den Taschen heim, sodass wir es mit Geigen, Kochen und Feldarbeit bald zu einem gewissen Wohlstand brachten und in der Tat ein glückliches und erfolgreiches Leben führten. Oh, wie gut wäre es uns wohl weiterhin ergangen, wären wir nur auf der Farm in Kingsbury geblieben! Doch die Zeit kam, wo der nächste Schritt in Richtung meines grausamen Schicksals erfolgen sollte.
Im März 1834 zogen wir um nach Saratoga Springs. Wir bewohnten ein Haus am nördlichen Ende der Washington Street, das sich im Besitz von Daniel O’Brien befand. Zu dieser Zeit betrieb Isaac Taylor am Nordende des Broadway eine große Pension namens Washington Hall. Er stellte mich ein, um eine Droschke für ihn zu fahren, was ich zwei Jahre lang tat. Danach arbeiteten Anne und ich während der Reisesaison im United States Hotel und anderen Gasthäusern des Ortes. In den Wintermonaten war ich auf meine Geige angewiesen, wenngleich ich auch beim Bau der Eisenbahnstrecke zwischen Troy und Saratoga viele mühselige Arbeitstage verbrachte.
In Saratoga pflegte ich die Waren, die ich für meine Familie benötigte, in den Geschäften von Mr.Cephas Parker und William Perry zu erwerben – Gentlemen, für die ich wegen der vielen Gefallen, die sie mir erwiesen, große Achtung empfand. Dies war auch der Grund, warum ich zwölf Jahre später den Brief, der in den Händen von Mr.Northup zum Instrument meiner glücklichen Erlösung werden sollte, an sie adressierte.
Während meiner Zeit im United States Hotel traf ich nicht selten Sklaven, die mit ihren Herren aus dem Süden gekommen waren. Sie schienen stets gut gekleidet und versorgt, ja sie führten offenbar ein bequemes Leben mit nur wenigen der alltäglichen Kümmernissen, mit denen sich unsereins plagte. Oftmals führten wir Gespräche über das Thema der Sklaverei. Denn fast alle von ihnen hegten trotz allem den geheimen Wunsch nach Freiheit. Einige bekundeten das glühende Verlangen zu fliehen und fragten mich nach der besten Methode, dies zu bewerkstelligen. Die Angst vor der Bestrafung jedoch, die sie bei ihrer Ergreifung und Rückführung mit Sicherheit erwarten würde, genügte in allen Fällen, um sie von diesem Wagnis abzuhalten. Als Mensch, der sein gesamtes Leben lang die freie Luft des Nordens geatmet hatte und wusste, dass er die gleichen Gefühle und Neigungen hegte, die auch in der Brust eines weißen Mannes heimisch sind, der sich ferner bewusst war, dass er über einen Verstand verfügte, der dem zumindest einiger Männer mit hellerer Haut ebenbürtig war, war ich zu unwissend, ja womöglich auch zu unabhängig, um mir vorzustellen, wie sich irgendjemand mit dem Leben in der elendigen Stellung eines Sklaven begnügen könnte. Es fiel mir schwer zu ergründen, was an den Gesetzen oder der Religion, die das Prinzip der Sklaverei aufrechterhielten oder auch nur anerkannten, rechtmäßig sein sollte. Und kein einziges Mal – das kann ich voller Stolz sagen – habe ich es versäumt, denen, die zu mir kamen, zu raten, auf ihre Gelegenheit zu warten und für ihre Freiheit zu kämpfen.
Ich lebte in Saratoga bis zum Frühling des Jahres 1841. Die hochgesteckten Erwartungen, die uns sieben Jahre zuvor aus unserem ruhigen Farmhaus am Ostufer des Hudsons fortgelockt hatten, hatten sich nicht erfüllt. Wenngleich wir stets unser Auskommen hatten, war uns kein rechter Erfolg beschieden. Die Gesellschaft und die Vereinigungen dieses weltberühmten Kurorts waren nicht für Menschen mit den einfachen Gepflogenheiten des Fleißes und der Sparsamkeit geschaffen, an die ich gewohnt war; im Gegenteil: Sie förderten an ihrer statt andere wie Trägheit und Verschwendung.
Damals hatten wir drei Kinder – Elizabeth, Margaret und Alonzo. Elizabeth, die Älteste, war zehn Jahre alt, Margaret zwei Jahre jünger, und der kleine Alonzo hatte gerade seinen fünften Geburtstag gefeiert. Sie erfüllten unser Haus mit Freude. Ihre jungen Stimmen waren Musik in unseren Ohren. Manch ein Luftschloss bauten meine Frau und ich für die unschuldigen Kleinen. Wenn ich nicht meiner Arbeit nachging, so spazierte ich stets mit ihnen, gekleidet in ihrem besten Sonntagsstaat, in den Straßen und Wäldern von Saratoga umher. Ihre Gegenwart bereitete mir Vergnügen, und ich schloss sie in meine Arme mit solch zarter und inniger Liebe, als wäre ihre getrübte Haut so weiß wie Schnee.
So weit enthält die Geschichte meines Lebens nichts auch nur im Geringsten Ungewöhnliches – nichts als die gewöhnlichen Hoffnungen, Leidenschaften und Mühen eines unbedeutenden schwarzen Mannes, der seinen bescheidenen Weg in dieser Welt machte. Doch nun hatte ich den Wendepunkt meines Daseins erreicht – die Schwelle zu unsäglichem Unrecht, zu Leid und Verzweiflung. Nun war ich im Schatten jener dunklen Wolke angelangt, in deren Finsternis ich bald verschwinden sollte, verborgen vor den Augen all meiner Lieben und für viele leidvolle Jahre dem süßen Licht der Freiheit beraubt.
Kapitel II
Eines Morgens gegen Ende März 1841, als gerade keine weitere Aufgabe meine Aufmerksamkeit beanspruchte, ging ich durch Saratoga Springs und überlegte, wo ich bis zum Anbruch der tätigen Jahreszeit Beschäftigung finden könnte. Wie so oft war Anne die rund zwanzig Meilen hinüber nach Sandy Hill gegangen, um während der Sitzungsperiode des Gerichts die Küche in Sherill’s Coffee House zu leiten. Ich glaube, dass Elizabeth sie begleitet hatte. Margaret und Alonzo waren bei ihrer Tante in Saratoga.
An der Ecke Congress Street und Broadway nahe der Schenke, die damals – und soviel ich weiß noch heute – von Mr.Moon betrieben wurde, begegneten mir zwei Gentlemen von ehrbarer Erscheinung, die mir beide gänzlich unbekannt waren. Mir ist, als habe einer meiner Bekannten, auch wenn ich mich beim besten Willen nicht entsinnen kann, wer es gewesen sein mag, mich ihnen mit der Bemerkung vorgestellt, ich sei ein ausgezeichneter Geigenspieler.
Jedenfalls begannen sie umgehend eine Unterhaltung über dieses Thema und erkundigten sich wiederholt nach meinen Fertigkeiten. Da meine Antworten allem Anschein nach zufriedenstellend waren, erboten sie sich, meine Dienste für einen kurzen Zeitraum in Anspruch zu nehmen, und äußerten zugleich, ich sei genau der Richtige für ihre Belange. Anschließend stellten sie sich mir als Merrill Brown und Abram Hamilton vor, wobei ich aus guten Gründen bezweifele, dass es sich dabei um ihre wahren Namen handelte. Ersterer war ein Mann von vielleicht vierzig Jahren, kleinem, fülligem Wuchs und einem Antlitz, das auf Scharfsinn und Intelligenz schließen ließ. Er trug einen schwarzen Gehrock und Hut und gab an, abwechselnd in Rochester oder Syracuse zu wohnen. Letzterer war ein junger Mann von heller Hautfarbe und mit ebensolchen Augen, der meinem Urteil nach die fünfundzwanzig noch nicht überschritten hatte. Er war groß gewachsen und schlank, gekleidet in einen tabakbraunen Mantel mit glänzendem Hut und elegant gemusterter Weste. Seine Kleidung war durchweg äußerst modisch. Sein Auftreten war etwas effeminiert, jedoch einnehmend, und er hatte etwas Unbeschwertes an sich, das seine Weltgewandtheit zeigte. Sie sagten mir, dass sie einer Zirkustruppe angehörten, die gerade in Washington gastiere, dass sie auf dem Weg dorthin zurück seien, nachdem sie einen Abstecher in den Norden gemacht hätten, um sich das Land anzuschauen, und dass sie ihre Reiseausgaben durch gelegentliche Schaustellungen bestritten. Zudem sprachen sie von ihren großen Schwierigkeiten, ihre Darbietungen mit musikalischer Begleitung zu versehen, und dass sie mir, sollte ich mich ihnen bis nach New York anschließen, einen Dollar täglich für meine Dienste zahlen würden und zusätzlich drei Dollar für jeden Abend, an dem ich bei ihren Vorstellungen aufspielte, nebst ausreichend Mitteln für meine Rückkehr von New York nach Saratoga.
Sogleich nahm ich das verlockende Angebot an, des verheißenen Lohnes wegen ebenso wie aus meinem Wunsch heraus, die Metropolis einmal zu besuchen. Sie wollten unbedingt sofort aufbrechen. Da ich nur von einer kurzen Abwesenheit ausging, hielt ich es nicht für nötig, Anne zu schreiben; vielmehr dachte ich, womöglich zur selben Zeit wie sie zurückzukehren. Also nahm ich einen Satz Wäsche zum Wechseln und meine Geige an mich und war fertig zur Abreise. Die Kutsche fuhr vor – mit geschlossenem Kasten und von einem Paar edler Brauner gezogen, gab sie ein vornehmes Bild ab. Ihr Gepäck bestand aus drei Truhen, die auf dem Traggestell festgezurrt waren. Ich kletterte auf den Kutschbock, während sie hinten ihre Plätze einnahmen, und fuhr auf der Straße nach Albany aus Saratoga heraus, stolz auf meine neue Stellung und so hochgestimmt wie man es im Leben nur sein kann.
Wir kamen durch Ballston, stießen auf die Ridge Road, wie sie nach meiner Erinnerung heißt, und folgten ihr geradenwegs nach Albany. Vor Einbruch der Dunkelheit trafen wir in dieser Stadt ein und stiegen in einem Hotel südlich des Museums ab. An jenem Abend hatte ich Gelegenheit, einer ihrer Vorstellungen beizuwohnen – der einzigen während der gesamten Zeit, die ich mit ihnen verbrachte. Hamilton war an der Tür postiert, ich bildete das Orchester, und Brown sorgte für die Unterhaltung. Sie bestand daraus, Bälle zu jonglieren, auf einem Seil zu tanzen, in einem Hut Pfannkuchen zu backen, unsichtbare Schweine zum Quieken zu bringen und derlei mehr Bauchrednertricks und Taschenspielereien. Das Publikum war ausgesprochen spärlich und zudem nicht gerade erlesen, und was Hamilton den Erlös nannte, war »ein bettelhaftes Gepränge von leeren Büchsen«.
Früh am nächsten Morgen setzten wir unsere Reise fort. In ihren Gesprächen überwog nun das Bestreben, unverzüglich zum Zirkus zurückzukehren. Sie reisten zügig, ohne noch einmal für eine Vorstellung haltzumachen, sodass wir zu gegebener Zeit New York erreichten und Unterkunft in einem Haus auf der Westside fanden, an einer Straße, die vom Broadway zum Fluss führte. Ich hielt meine Reise für beendet und rechnete damit, in einem, höchstens zwei Tagen wieder mit Freunden und Familie in Saratoga vereint zu sein. Brown und Hamilton jedoch drangen nun auf mich ein, sie weiter bis nach Washington zu begleiten. Sie behaupteten, der Zirkus werde nun, da es Sommer würde, gleich nach ihrer Ankunft gen Norden ziehen. Sie versprachen mir eine Stellung und guten Lohn, sollte ich bei ihnen bleiben. Ausführlich verbreiteten sie sich über den Gewinn, der sich für mich ergäbe, und stellten ihn derart vorteilhaft heraus, dass ich schließlich beschloss, das Angebot anzunehmen.
Am nächsten Morgen schlugen sie vor, dass, da wir in einen Sklavenstaat reisen würden, es ratsam sei, vorab in New York Freipapiere für mich zu beschaffen. Ein kluger Gedanke, der mir sofort einleuchtete, auch wenn er mir schwerlich selbst gekommen wäre, hätten sie ihn nicht ausgesprochen. Wir begaben uns umgehend zum Zollamt, wie ich dachte. Sie beglaubigten unter Eid Tatsachen, die mich als freien Mann auswiesen. Ein Schriftstück wurde aufgesetzt und uns mit der Anweisung ausgehändigt, es dem Amtsschreiber vorzulegen. Das taten wir, und nachdem der Beamte etwas hinzugefügt hatte, wofür ihm sechs Shilling gezahlt wurden, kehrten wir zum Zollamt zurück. Es gab noch weitere Formalitäten zu erledigen, ehe das Dokument ausgefertigt war, worauf ich dem Beamten zwei Dollar zahlte, die Papiere in meine Tasche steckte und mich mit meinen beiden Freunden zu unserem Hotel aufmachte. Ich muss zugeben, dass ich seinerzeit die Papiere für kaum der Kosten ihrer Erlangung wert befand – dass Gefahr für meine persönliche Sicherheit bestehen könnte, hatte ich nie auch nur im Entferntesten befürchtet. Ich weiß noch, wie der Beamte, an den wir verwiesen wurden, etwas in einem großen Buch notierte, das vermutlich jetzt noch in der Dienststelle aufbewahrt wird. Ein Nachweis der Einträge Ende März oder Anfang April 1841 wird zweifellos die Ungläubigen zufriedenstellen, zumindest was diese bestimmte Transaktion betrifft.
Den Beleg meiner Freiheit in meinem Besitz setzten wir am Tag nach unserer Ankunft in New York per Fähre nach Jersey City über und schlugen den Weg nach Philadelphia ein. Dort blieben wir eine Nacht und reisten frühmorgens weiter Richtung Baltimore. Zu gegebener Zeit erreichten wir diese Stadt und stiegen nahe dem Eisenbahndepot in einem Hotel ab, das entweder von einem Mr.Rathbone geführt oder Rathbone House genannt wurde. Auf dem ganzen Weg von New York schien der Wunsch meiner Begleiter, zum Zirkus zu stoßen, immer drängender zu werden. Wir ließen die Kutsche in Baltimore zurück, bestiegen den Zug und fuhren weiter nach Washington, wo wir bei Anbruch der Nacht eintrafen, am Vorabend der Beisetzung General Harrisons, und in Gadsby’s Hotel auf der Pennsylvania Avenue unterkamen.
Nach dem Abendessen riefen sie mich in ihre Räumlichkeiten und zahlten mir dreiundvierzig Dollar aus, mehr als mein Lohn betrug. Sie meinten, dieser großzügige Akt ergebe sich daraus, dass sie während unserer Reise von Saratoga weniger Vorstellungen gegeben hatten als versprochen. Überdies teilten sie mir mit, es sei zwar Absicht der Zirkustruppe gewesen, am folgenden Morgen Washington zu verlassen, man habe aber wegen der Beisetzung beschlossen, noch einen weiteren Tag zu bleiben. Dabei gaben sie sich, wie stets seit unserer ersten Begegnung, äußerst freundlich. Keine Gelegenheit wurde ausgelassen, Worte des Beifalls an mich zu richten, indes ich meinerseits ebenfalls sehr für sie eingenommen war. Ich schenkte ihnen mein vorbehaltloses Vertrauen und hätte mich leichten Herzens und nahezu unbedingt auf sie verlassen. Ihre häufigen Gespräche mit mir und ihr Gebaren mir gegenüber – ihr umsichtiger Vorschlag, mir Freipapiere zu besorgen, und hundert andere kleine Gesten, die nicht im Einzelnen berichtet werden müssen –, das alles wies sie als wahre Freunde aus, die aufrichtig um mein Wohlergehen bemüht waren. Ich wusste es nicht besser, aber sie zeigten sich rein von jener großen Niedertracht, der ich sie heute für schuldig halte. Ob sie Urheber meines Unglücks waren – raffinierte, unmenschliche Ungeheuer in Menschengestalt, die mich planvoll von Heimstatt, Familie und Freiheit des Goldes wegen fortlockten –, wer diese Zeilen liest, wird das ebenso bestimmt sagen können wie ich. Wenn sie unschuldig waren, muss mein jähes Verschwinden fürwahr unerklärlich für sie gewesen sein, doch wie sehr ich alle Begleitumstände im Geiste auch drehe und wende, gelingt es mir doch nie, so nachsichtig von ihnen zu denken.
Nachdem ich das Geld von ihnen erhalten hatte – wovon sie reichlich zu haben schienen –, rieten sie mir, die Nacht über die Straßen zu meiden, da ich mit den Gepflogenheiten der Stadt nicht vertraut war. Ich versprach, ihren Rat zu beherzigen, ließ beide zurück und wurde bald darauf von einem farbigen Bediensteten in eine ebenerdige Schlafkammer im hinteren Teil des Hotels geführt. Ich legte mich zur Ruhe, dachte an mein Zuhause, an Frau und Kinder und die große Entfernung zwischen uns, bis ich einschlief. Doch kein barmherziger Engel kam an meine Bettstatt und hieß mich fliehen – keine gnädige Stimme warnte mich in meinen Träumen vor den Prüfungen, die mir unmittelbar bevorstanden.
Am nächsten Tag gab es in Washington einen großen Trauerzug. Kanonendonner und Glockengeläut erfüllten die Luft, indes viele Häuser in Trauerflor gehüllt und die Straßen schwarz von Menschen waren. Als der Tag seinen Lauf nahm, trat die Prozession in Erscheinung, kam langsam die Avenue hinunter, Kutsche auf Kutsche in langer Reihe, der Abertausende zu Fuß folgten – alle im Takt schwermütiger Musik. Sie trugen den Leichnam Harrisons zu Grabe.
Seit dem frühen Morgen war ich ständig in Gesellschaft Hamiltons und Browns. Sie waren die Einzigen, die ich in Washington kannte. Wir standen beieinander, während der Trauerzug vorbeizog. Ich erinnere mich noch genau, wie das Fensterglas unter dem Knall der Kanonenschüsse, die an der Grabstätte abgefeuert wurden, barst und zu Boden klirrte. Wir gingen zum Kapitol und wandelten lange durch die Außenanlagen. Am Nachmittag schlenderten sie zum Haus des Präsidenten, behielten mich die ganze Zeit an ihrer Seite und wiesen mich auf allerlei Sehenswürdigkeiten hin. Bislang hatte ich vom Zirkus noch nichts gesehen. Freilich hatte ich in dem ganzen Trubel an jenem Tag auch kaum daran gedacht.
Im Lauf des Nachmittags kehrten meine Freunde mehrere Male in Saloons ein und bestellten Branntwein. Es war ihnen jedoch keinesfalls Gewohnheit, ihm übermäßig zuzusprechen, soweit ich sie kannte. Dabei schenkten sie jedes Mal, nachdem sie sich bedient hatten, ein weiteres Glas ein und reichten es mir. Allerdings wurde ich nicht betrunken, wie sich vielleicht aus dem anschließenden Geschehen folgern ließe. Gegen Abend und bald nach der Teilhabe an einem dieser Getränke wurde mir mit einem Mal ganz scheußlich zumute. Ich fühlte mich ausgesprochen krank. Ich bekam Kopfweh – ein dumpfer, lastender Schmerz und unsäglich unangenehm. Beim Abendessen hatte ich keinen Appetit; der Anblick und der Geschmack der Speisen ekelten mich an. Bei Einbruch der Nacht geleitete mich derselbe Bedienstete zu der Kammer, die ich die Nacht zuvor belegt hatte. Brown und Hamilton rieten mir zu Bettruhe, bekundeten liebenswürdig ihr Mitgefühl und drückten die Hoffnung aus, es möge mir am Morgen besser gehen. Ich streifte nur Jacke und Stiefel ab und warf mich aufs Bett. An Schlaf war nicht zu denken. Meine Kopfschmerzen wurden zusehends stärker, bis sie nahezu unerträglich waren. Nach kurzer Zeit wurde ich durstig. Meine Lippen waren ausgetrocknet. Ich konnte an nichts anderes denken als Wasser – an Seen und Flüsse, an Bäche, an denen ich zum Trinken Rast gemacht hatte, und an den tropfenden Eimer, wie er mit seinem kühlen, überfließenden Nektar vom Brunnengrund emporsteigt. Gegen Mitternacht, soweit ich das beurteilen konnte, stand ich auf, außerstande, solch quälenden Durst länger zu ertragen. Ich war fremd im Haus und kannte die Räumlichkeiten nicht. Außer mir schien niemand auf den Beinen zu sein. Aufs Geratewohl tastete ich herum, wo, weiß ich nicht, und fand schließlich den Weg zu einer Küche unten im Keller. Zwei oder drei farbige Bedienstete waren dort zugange, und eine Frau gab mir zwei Glas Wasser zu trinken. Es brachte vorübergehend Linderung, doch als ich meine Kammer wieder erreicht hatte, war dasselbe brennende Verlangen nach Wasser, derselbe peinigende Durst zurückgekehrt. Er war sogar noch quälender als zuvor wie auch die rasenden Kopfschmerzen, falls das überhaupt möglich war. Ich litt schlimme Not – die reinste Höllenqual! Ich schien dem Wahnsinn nahe! Die Erinnerung an jene Nacht grauenhaften Leidens wird mir noch bis ins Grab folgen.
Eine Stunde oder länger nach meiner Rückkehr aus der Küche wurde mir bewusst, dass jemand meine Kammer betrat. Es schienen mehrere zu sein – ein Gemenge unterschiedlicher Stimmen –, doch wie viele es waren und wer, kann ich nicht sagen. Ob Brown und Hamilton darunter waren, ist bloße Mutmaßung. Halbwegs deutlich entsinne ich mich nur, wie mir gesagt wurde, es gelte einen Arzt aufzusuchen und Medizin zu besorgen, und wie ich meine Stiefel anzog und ihnen ohne Hut und Mantel über einen langen Gang oder eine Gasse auf die offene Straße folgte. Sie verlief im rechten Winkel zur Pennsylvania Avenue. In einem Fenster gegenüber brannte ein Licht. Nach meinem Eindruck waren nun drei Personen bei mir, doch ist jener ganz und gar unbestimmt und vage wie die Erinnerung an einen Angsttraum. Dass ich auf das Licht zuging im Glauben, es fiele aus einer Arztpraxis, und es zurückzuweichen schien, während ich mich näherte, ist der letzte Funken Wahrnehmung, an den ich mich jetzt noch erinnere. Im nächsten Augenblick war ich bewusstlos. Wie lange ich in diesem Zustand blieb – ob nur jene Nacht oder viele Tage und Nächte –, weiß ich nicht; als ich aber wieder zu Sinnen kam, fand ich mich allein, in völliger Dunkelheit und in Ketten wieder.
Der Kopfschmerz hatte etwas nachgelassen, doch ich war noch immer sehr matt und benommen. Ich saß auf einer niedrigen Bank aus rohen Brettern und trug weder Hut noch Mantel. Ich trug Handschellen. Auch um die Fußknöchel hatte ich ein schweres Paar Fesseln. Das eine Ende einer Kette war an einem großen Ring im Fußboden angebracht, das andere an meinen Fußfesseln. Vergebens versuchte ich auf die Beine zu kommen. Aus solch schmerzhafter Trance zu erwachen kostete mich einige Zeit, ehe ich meine Gedanken sammeln konnte. Wo war ich? Was hatten diese Ketten zu bedeuten? Wo waren Brown und Hamilton? Was hatte ich getan, um Gefangenschaft in solch einem Verlies zu verdienen? Ich konnte es nicht begreifen. Eine Lücke von unbestimmter Dauer klaffte in meiner Erinnerung, als ich an diesem einsamen Ort erwachte, und kein noch so langes Grübeln konnte wieder aufrufen, was sich zuvor ereignet hatte. Angestrengt lauschte ich auf ein Anzeichen von Leben, irgendeinen Laut, doch nichts durchdrang die drückende Stille außer dem Klirren meiner Ketten, sobald ich mich bewegte. Ich sagte laut etwas und erschrak über den Klang meiner Stimme. Ich befühlte meine Taschen, soweit es meine Fesseln zuließen – weit genug allerdings, um festzustellen, dass ich nicht nur der Freiheit beraubt worden war; auch mein Geld und meine Papiere waren weg! Da kam mir erstmals eine Ahnung, anfangs ein dunkler und verworrener Gedanke, dass ich entführt worden sein könnte. Doch das, so dachte ich, war einfach nicht zu glauben.
Es musste irgendein Missverständnis gegeben haben – irgendeinen unglückseligen Fehler. Es konnte nicht sein, dass ein freier Bürger New Yorks, der keinem Menschen etwas zuleide getan, der kein Gesetz gebrochen hatte, derart unmenschlich behandelt wurde. Je länger ich jedoch meine Lage bedachte, umso mehr sah ich mich in meinem Argwohn bestätigt. Wahrlich ein trostloser Gedanke. Mir war, als kenne die gefühllose Menschheit weder Treue noch Erbarmen, und ich befahl mich dem Gott aller Unterdrückten, ließ den Kopf in meine gefesselten Hände sinken und weinte bitterlichste Tränen.
Kapitel III
Etwa drei Stunden vergingen, in denen ich weiter auf der niedrigen Bank saß und mich schmerzlichen Gedanken hingab. Nach einiger Zeit hörte ich das Krähen eines Hahnes, und bald darauf drang ein fernes Poltern wie von Kutschen, die durch die Straßen eilten, an meine Ohren, und ich wusste, dass es Tag war. Dennoch fiel kein Lichtstrahl in mein Gefängnis. Schließlich vernahm ich Schritte direkt über mir, als ob jemand auf und ab ging. Mir wurde klar, dass ich in einem unterirdischen Raum sein musste, und der feuchte, modrige Geruch bestätigte meine Vermutung. Das Rumoren über mir ging noch mindestens eine Stunde so weiter, bis ich endlich Schritte von außen auf mich zukommen hörte. Ein Schlüssel rasselte im Schloss, eine schwere Tür schwang auf, das Licht flutete herein, und zwei Männer traten ein und blieben vor mir stehen. Einer von ihnen war groß und kräftig, etwa vierzig Jahre alt, mit dunklem kastanienbraunem Haar, in dem schon etwas Grau schimmerte. Sein volles Gesicht war gerötet, und in seinen derben Zügen lagen nichts als Grausamkeit und Arglist. Er maß etwa fünf Fuß und zehn Zoll, war von untersetzter Gestalt und machte, wie ich offen sagen muss, insgesamt einen finsteren und abstoßenden Eindruck. Sein Name war James H. Burch, wie ich später erfuhr, ein stadtbekannter Sklavenhändler und damals oder später ein Geschäftspartner von Theophilus Freeman aus New Orleans. In seiner Begleitung befand sich ein schlichter Lakai namens Ebenezer Radburn, der lediglich die Aufgabe eines Gefängniswärters versah. Beide leben noch immer in Washington oder taten dies zumindest zu der Zeit noch, als ich auf meiner Rückreise aus der Sklaverei im letzten Januar durch diese Stadt kam.
Das Licht, das durch die geöffnete Tür hereinfiel, erlaubte mir einen Blick in den Raum, in dem ich eingesperrt war. Er maß rund zwölf Fuß im Quadrat, die Wände waren massiv gemauert. Der Boden bestand aus schweren Dielen. Es gab ein kleines Fenster, das mit Eisenstäben vergittert und dessen außen angebrachter Laden fest verschlossen war.
Eine eisenbeschlagene Tür führte in die benachbarte Zelle, die mehr einem Gewölbe glich und völlig fensterlos sowie ebenfalls ohne jegliche andere Lichtquelle war. Das Mobiliar des Raumes, in dem ich mich befand, bestand aus der Holzbank, auf der ich saß, und einem altmodischen verdreckten Kastenofen. Darüber hinaus gab es weder Bett, Decken noch irgendetwas anderes. Die Tür, durch die Burch und Radburn eingetreten waren, führte zunächst in einen schmalen Durchgang und dann eine Treppe hinauf in den Hof. Dieser war von einer zehn oder zwölf Fuß hohen Backsteinmauer umgeben, die hinter einem Gebäude von etwa derselben Breite stand. Der Hof erstreckte sich etwa dreißig Fuß hinter dem Haus. Auf einer Seite der Wand befand sich eine eisenbeschlagene Tür, die sich zu einem engen überdachten Durchgang öffnete, der sich an einer Seite des Hauses herumwand und auf die Straße führte. Das Verhängnis des farbigen Mannes, hinter dem sich diese Tür schloss, war besiegelt. Der obere Rand der Mauer hielt das eine Ende eines schrägen Daches, das somit eine Art offenen Verschlag bildete. Unter diesem Dach war so etwas wie ein runder Heuboden, wo die Sklaven, so sie dies wollten, nachts schlafen oder bei schlechtem Wetter Schutz vor den Elementen finden konnten. Der Ort glich in vielerlei Hinsicht dem Scheunenhof eines Bauern, abgesehen davon, dass er so konstruiert war, dass die Außenwelt das menschliche Vieh, das hier eingepfercht war, nie zu Gesicht bekommen konnte.
Ende der Leseprobe