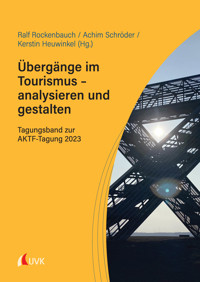
Übergänge im Tourismus – analysieren und gestalten E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UVK
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Übergänge positiv gestalten Übergänge im Tourismus sind allgegenwärtig, diese zu analysieren und zu gestalten ist unumgänglich. Mit diesem Thema beschäftigte sich deswegen auch 2023 die Jahrestagung des Arbeitskreises Tourismusforschung in der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) e. V. (AKTF). Dieses Buch enthält wertvolle Beiträge von Expert:innen aus Wissenschaft, Praxis und Politik. Es richtet sich an Forschende und Studierende der Tourismus-, Sozial- und Geowissenschaften. Er ist zudem für die Tourismuspraxis und -politik eine aufschlussreiche Lektüre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Rockenbauch / Achim Schröder / Kerstin Heuwinkel (Hg.)
Übergänge im Tourismus – analysieren und gestalten
Tagungsband zur AKTF-Tagung 2023 mit Beiträgen von Marcus Bauer, Julia E. Beelitz, Frauke Boltz, Lena Braitmayer, Anja Brittner-Widmann, Sarah Dornheim, Ina Dupret, Bernd Eisenstein, Jasmin Guerra, Kerstin Heuwinkel, Corinna Jürgens, Alexander Koch, Anne Köchling, Manon Krüger, Acácia Malhado, Ralf Rockenbauch, Knut Scherhag, Bettina Schmalfeld, Achim Schröder, Sabrina Seeler, Jessica Zenner
Prof. Dr. Ralf Rockenbauch, Prof. Dr. Achim Schröder und Prof. Dr. Kerstin Heuwinkel lehren und forschen an der htw saar in Saarbrücken.
Umschlagabbildung: © Achim Schröder
Gruppenbild: © Achim Schröder ∙ htw saar
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381132522
© UVK Verlag 2024‒ Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISBN 978-3-381-13251-5 (Print)
ISBN 978-3-381-13253-9 (ePub)
Inhalt
Die Teilnehmenden an der AKTF-Tagung 2023 in Saarbrücken.
Vorwort
„Einszweidrei, im Sauseschritt
Läuft die Zeit; wir laufen mit.“
Wilhelm Busch (1832–1908)
„Übergänge im Tourismus – analysieren und gestalten“ war das Thema der Jahrestagung des Arbeitskreises Tourismusforschung in der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) e. V. (AKTF). Die Tagung fand an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) vom 14. bis 16.6.2023 statt. Organisiert wurde die Tagung durch das Tourismuscluster der htw saar mit Unterstützung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Die Tourismus Zentrale Saarland hat die Veranstaltung ebenfalls gefördert.
Dieser Tagungsband entstand aus den Beiträgen der Tourismusexpertinnen und -experten, um Vertreterinnen und Vertretern aus der Wissenschaft, Praxis und Politik einen Überblick zur Vielfalt der Themen und Handlungsoptionen zu geben. Motiviert war die Themenwahl insbesondere durch die zahlreichen und allgegenwärtigen Übergänge im Tourismus:
Auf Reisen verlassen Menschen ihr gewohntes Umfeld, um sich vorübergehend an anderen Orten aufzuhalten. Auf der Suche nach Gegenalltag und Differenzerfahrung passieren sie räumliche, soziale, kulturelle und landschaftliche Grenzen und durchlaufen verschiedene Phasen der Customer Journey.
Die Betriebe entlang der touristischen Leistungskette stehen vor der Herausforderung, möglichst reibungslose Übergänge zwischen den ineinandergreifenden Prozessen der Servicekette zu garantieren. Produkte sowie Destinationen durchlaufen verschiedene Phasen des Produkt-Lebenszyklus und stehen immer vor der Frage, wie Übergänge zu gestalten sind.
Seitens der Nachfragenden führen Übergänge in den Lebensphasen zu Änderungen des Anspruchs- und Reiseverhaltens und erfordern entsprechende Reaktionen seitens der Anbietenden.
Die Digitale Transformation steht zudem für den Übergang von der analogen zur digitalen Welt mit sich ändernden Geschäftsmodellen und Prozessen. Zentrale Aufgaben hier sind die Gestaltung der technologischen Schnittstellen ebenso wie die Gestaltung des Übergangs von der Technik zum Menschen – und umgekehrt.
Aktuell sind der seitens der Arbeitgebenden beklagte Fachkräftemangel und selbstbewusste Forderungen nach Work-Life-Balance von Seiten der Nachwuchskräfte und Arbeitnehmenden deutliche Zeichen des Übergangs vom Anbieter- zum Nachfrager- (Arbeits-) Markt mit entsprechenden Konsequenzen für beide Seiten.
Materialien online
Details zur Tagung finden Sie auf dem Blog der htw saar unter 🔗 http://s.narr.digital/zkd50) und der Website des Arbeitskreises (🔗 http://s.narr.digital/r6by1).
Auf der Jahrestagung 2023 des AKTF wurden die Möglichkeiten, Konzepte und Grenzen für die Analyse und Gestaltung der vielfältigen Übergänge im Tourismus aufgezeigt und diskutiert.
Zentrale Fragestellungen der Beiträge waren:
Welche Übergänge gilt es im Tourismus zu analysieren?
Welche zentralen Herausforderungen ergeben sich aus den touristischen Übergängen?
Wie lassen sich Übergänge im Tourismus positiv gestalten?
Was lässt sich aus Übergängen der Vergangenheit für die touristische Zukunft lernen?
Die Ergebnisse wurden während der Tagung in den Themenbereichen Klimawandel, Mobilität, Transformation touristischer Räume, Mobilitätswende und Destinationsmanagement präsentiert.
In diesem Tagungsband werden die Erkenntnisse der qualitativen und quantitativen Forschung (Mengen- und Wertgrößen) zusammengefasst. Dadurch werden Entwicklungen verdeutlicht (Rückschau, Bestände, Vorschau), die eine weitergehende kritische Analyse ermöglichen und mit anwendungsorientierten Handlungsempfehlungen zu kombinieren sind. Ziel ist eine Intensivierung der Aspekte zum nachhaltigen Management im Tourismus unter Berücksichtigung der regionalen und internationalen Besonderheiten der touristischen Dienstleistungsunternehmen. Dabei werden auch aktuelle Trends wie Globalisierung, Digitalisierung, Entrepreneurship sowie Nachhaltigkeit in allen Belangen (ökonomisch, ökologisch, sozio-kulturell) berücksichtigt.
Letztlich führen unterschiedliche Formen von Innovation, Evolution, Disruption zu den notwendigen Anpassungen an die aktuellen Trends. Dabei gilt es die Chancen und Risiken sowie Nutzen und Kosten abzuwägen – mit interdisziplinären multioptionalen Ansätzen aus geografischer, sozialwissenschaftlicher und wirtschaftswissenschaftlicher Sicht.
Die Diversität der Beiträge der Autorinnen und Autoren findet sich thematisch, methodisch, sprachlich, redaktionell und formal in diesem Tagungsband wieder. Dies zeigt sich unter anderem auch in den unterschiedlichen Umsetzungen der genderneutralen Sprache, den unterschiedlichen Zitierweisen, optischen und inhaltlichen Gestaltungen, die von den Herausgebenden nicht geändert wurden, damit die Authentizität der Beiträge erhalten bleibt. Ebenso müssen die geäußerten Sichtweisen der Autorinnen und Autoren nicht zwangsläufig mit den Sichtweisen der Herausgebenden übereinstimmen. Letztlich geht es darum die Vielfalt der wissenschaftlichen Sichtweisen zu dokumentieren.
Das Tourismuscluster der htw saar und die Herausgebenden danken allen, die zum Erfolg der Tagung und dem Tagungsband beigetragen haben, insbesondere den Autorinnen und Autoren, dem UVK Verlag, der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der htw saar, der Tourismus Zentrale Saarland, dem AKTF sowie allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Vergnügen bei der Lektüre des Tagungsbandes, der weiteren wissenschaftlichen Diskussion, ihrem weiteren Werdegang und würden uns freuen, wenn sie weiterhin eine nachhaltige Entwicklung persönlich vorantreiben, denn …
„Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel.“
Charles Darwin (1809–1882)
Prof. Dr. Ralf Rockenbauch,
Prof. Dr. Achim Schröder,
Prof. Dr. Kerstin Heuwinkel
Community-based Tourism: Zugänge und Regulierungen
Schlagwörter | Community-based Tourism, Tourismussoziologie, Reiseleitung, Zugänge, Regeln
Abstract | Die Nutzung privater Räume im Tourismus hat eine lange Tradition. Neu ist eine durch ungleiche Machtverhältnisse ermöglichte Eroberung der letzten Sphären des Privaten. Unter dem Begriff des Community-based Tourism (CBT) werden u. a. Räume wie Kindergärten und Schulen oder auch Erlebnisse wie private Feiern zugänglich gemacht und in touristische Produkte überführt. Der Wunsch nach Authentizität und die vergleichsweise niedrigen Preise lassen die Nachfrage nach solchen Angeboten steigen. Ziel des Beitrags ist die exemplarische Analyse der Zugänge und Regulierungen touristischer Angebote im Kontext des Community-based Tourism.
1Übergänge im Tourismus
Die speziell für den Tourismus geschaffenen Strukturen, insbesondere in den Bereichen der Beherbergung, der Verpflegung, der Kultur-, Freizeit- und Sportaktivitäten, haben an Attraktivität eingebüßt oder werden von vielen Reisenden als Element des negativ besetzten Mainstream- resp. Massentourismus abgelehnt. Hinzu kommt der unter dem Begriff des Overtourism geführte Diskurs hinsichtlich des Zuviels an Tourist:innen in Destinationen (Goodwin, 2017; Kagermeier, 2021).
Als Konsequenz verändern sich in Kombination mit steigenden Reisendenzahlen die Angebotsstrukturen hin zu Angeboten im Privaten. Dazu zählen nicht nur klassische Formen wie Bed and Breakfast, Chambre d’hôtes oder auch Urlaub auf dem Bauernhof, die privatwirtschaftlich organisiert sind, sondern Homestays, Kochkurse in Privaträumen sowie die Besuche von Kindergärten und Schulen im Kontext von Führungen und Touren in Communities insbesondere im Globalen Süden. Die Angebote im Umfeld von Community-based Tourism (CBT) dringen noch weiter in das persönliche Umfeld vor und erobern die letzten Sphären des Privaten, weil sie auch ungefragt in Lebensbereiche eindringen. In Goffmans Modell der Bühnen werden nicht nur die Vorderbühnen, sondern auch die Hinterbühnen für das Publikum geöffnet (Goffman, 2003). Das Element der Freiwilligkeit und das Ideal der relativ ausgeglichene Machtbalancen (Elias, 1993) scheinen vor dem Hintergrund eines ökonomischen Ungleichgewichts gänzlich verloren zu gehen. Feministische Theorien (vgl. exemplarisch Cole, 2018 und Enloe, 2014) und Konzepte des Neo-Kolonialismus (vgl. exemplarisch Sharpley, 2018) decken geschichtlich und gesellschaftlich verankerte Beweggründe auf.
Der Wunsch nach Authentizität und die vergleichsweise niedrigen Preise lassen die Nachfrage nach solchen Angeboten mitten im echten Leben steigen. Enzensberger hat bereits 1958 den Übergang vom sight-seeing zum life-seeing beschrieben: „Wie die Leute, die man besucht, in Wirklichkeit leben, das wird als neuer Gegenstand touristischen Interesses eingesetzt“ (Enzensberger, 1958, S. 171). Als treibende Kraft sieht er „Überlegungen kluger Promotoren“ (ebd.), die geschickt zwischen fehlenden Angeboten und unbefriedigter Suche vermitteln. Unter Begriffen wie Responsible und Slow Tourism, wird die nachfrageseitige Verschiebung analysiert und die Nutzung authentischer Angebote erfolgt bezogen auf Destinationen und Reisende.
Etwas weniger berücksichtigt als die Angebotsseite ist bislang die Sicht der anderen Seite, sprich der Menschen, deren Leben betrachtet, miterlebt und zeitweise gelebt wird. Zwar finden sich frühe Modelle u. a. von Doxey (1975) und umfassende Konzepte wie Quality of Life (QOL) (Uysal et al., 2016). Allerdings bleiben diese in den Betrachtungen oft an der strukturellen Oberfläche oder fokussieren auf die Entwicklung und Überprüfung (psychologischer) Konstrukte. Auch hat sich die Qualität des life-seeings verändert. Wurden in den 1970er Jahren die Fischer in einem Hafen in Griechenland oder Italien beobachtet, sind es heute die Kindergartenkinder in Ländern wie Südafrika, Namibia und Botswana. Hinzu kommt, dass viele Angebote nicht reguliert sind und oft von Menschen angeboten werden, die nicht die erforderlichen Qualifikationen haben. Schließlich können sich im Gegensatz zu widerstandserprobten Katalan:innen die Einwohner:innen von Khayelitsha (Community in Kapstadt) aufgrund der strukturell schwächeren Position schlechter wehren. Diese wird verschärft durch fehlende Möglichkeiten der (medialen) Artikulation und politischen Einflussnahme. Ein zentraler Begriff ist in diesem Zusammenhang Empowerment (Heuwinkel, 2024, S. 63).
Der Aufbau des Beitrags ist wie folgt. Er beginnt mit einer kurzen Einführung in CBT. Dem folgt eine Analyse der Angebotsstruktur mit einem besonderen Fokus auf die Veranstaltenden von CBT-Touren. Ein Vergleich zwischen Kapstadt und Mumbai fokussiert auf die Definition von Regeln für das Eindringen in das private Umfeld sowie die Festsetzung von Grenzen. Der Beitrag schließt mit einem Ausblick auf mögliche Entwicklungen in europäischen Ländern.
Somit adressiert der Beitrag den Aspekt der Fluidität (Bauman, 2003) zwischen touristischen und privaten Sphären ausgehend von tourismussoziologischen Ansätzen (Heuwinkel, 2023), das dramaturgische Handeln und die Frage von Ungleichheiten und Machtbalancen.
2Community-based Tourism: Das Private als Attraktion
Community-based Tourism (CBT) ist kein klar abgegrenzter Begriff, sondern dient als ein Oberbegriff (umbrella term), der eine Vielzahl von touristischen Angeboten und Aktivitäten umfasst, die sich dadurch hervorheben, dass die Interessen der lokalen Bevölkerung berücksichtigt werden sollen. Damit verbunden sind die Annahmen, dass erstens CBT vorwiegend positive Effekte für die Bevölkerung hat und zweitens die Reisenden eine andere Art von Erlebnis und Interaktion suchen. Daraus resultierend findet oft eine Abgrenzung vom Pauschal- und Massentourismus statt (vgl. exemplarisch Lwoga, 2019). Die damit verbundene pauschale Abwertung des standardisierten und kommodifizierten Tourismus und die ebenfalls pauschale Aufwertung des CBT ist verkürzt (vgl. dazu Mundt, 2011). So wenig wie „der“ Massentourismus immer vor allem negative Auswirkungen hat, ist CBT automatisch gut für Bevölkerung, Umwelt und lokale Wirtschaft.
Eine Analyse der oft in der wissenschaftlichen Literatur zitierten Definitionen zeigt, dass die am häufigsten verwendeten Schlagworte Beteiligung oder Partizipation, Empowerment, Entwicklung und kollektive Vorteile für die lokale Gemeinschaft sind (Heuwinkel, 2024). Die zentrale Idee ist, dass Tourismus, der auf lokalen Begebenheiten und Ressourcen beruht und massive Auswirkungen auf diese und damit die Lebensgrundlagen der Bevölkerung (Community) hat, nicht nur das natürliche Umfeld schützen, sondern zum Nutzen der Community gestaltet sein sollte.
Murphy (1985) betonte die besondere und mehrfache Relevanz von Communities für den Tourismus. Sowohl Produkte und Dienstleistungen als auch das Image einer Destination hängen maßgeblich davon ab, wie die Einheimischen agieren und kooperieren. Mit Ausnahme von völlig abgeschotteten Resorts findet ein großer Teil touristischer Aktivitäten im öffentlichen Raum statt und nutzt öffentliche Infrastrukturen. In den Aufbau und Erhalt dieser Infrastrukturen fließen lokale Gelder und es kommt zu Begegnungen zwischen Einheimischen und Tourist:innen. Beispielsweise werden kulturelle und Sportveranstaltungen, Märkte, Parks und Friedhöfe von beiden Gruppen besucht. Schließlich sind die Einheimischen diejenigen, die mit den Folgen des Tourismus in der Destination leben müssen, während Tourist:innen bei Bedarf neue Ziele aufsuchen können. Das wesentliche Merkmal von CBT-Produkten und Dienstleistungen ist, dass die lokale Bevölkerung diese entwickelten und am Markt positionieren. Bei allen damit verbundenen Prozessen ist im Idealfall die gesamte Community involviert.
Ein Blick in praktische Umsetzungen von CBT zeigt eine Vielzahl von Ansätzen mit unterschiedlichem Erfolg (Goodwin, 2016; Heuwinkel, 2024). In vielen Fällen handelt es sich weniger um Community-based Tourism als um Tourism in Communities, sprich ein Besuch von Communities ist Teil der touristischen Dienstleistungskette. Die Übergänge zwischen den Formen sind fließend, bspw., wenn Menschen aus einer Community Führungen in dieser anbieten und ein Teil der Einnahmen direkt in die Community fließen. Es sollte von einer Skala ausgegangen werden, die von der Community als Objekt bis zur Community als Subjekt reicht.
In einer differenzierten Betrachtung muss untersucht werden, an welchen Aktivitäten die Community in welchem Maße beteiligt ist. Eine Herausforderung besteht darin, dass durch angebotsorientierte Trends, die eine steigende Nachfrage generieren einzelne Projekte ihren ursprünglichen Charakter verlieren, da Angebote von anderen Akteuren aufgegriffen und gemäß den Wünschen der Nachfragenden verändert werden. Daraus resultiert eine Einschränkung der ursprünglich intendierten Ziele bis hin zur Verletzung von Regeln und Grenzen.
Ein zentrales Element sind in diesem Kontext vermittelnde Strukturen, insbesondere menschliche Mittler:innen, die den Zugang zur Community gestalten und u. a. auf den Schutz derselben achten sollten.
3Mittler:innen, Zugänge und Regeln
Die Tourismusbranche verspricht eine Lösung vom Alltag, eine Gegenwelt mit Möglichkeiten, die ansonsten nicht gegeben sind. Die Tage oder Wochen des Urlaubs bedeuten Erholung, Glück, Luxus, Abenteuer und Freiheit. Im Zentrum steht das Ich oder auch die Familie und Gruppe, für die das Umfeld bestmöglich gestaltet wird. Vor diesem Hintergrund ist es offensichtlich, dass Regulierungen und Kontrollen nicht gerne gesehen oder so unauffällig wie möglich formuliert werden. Hinzu kommt, dass Urlaub als liminale Phase (Turner, 1989) beschrieben werden kann. Der Aufenthalt an einem ungewohnten Ort entspricht einer Umwandlungsphase mit vom Alltag abweichenden Normen, die in ein Verhalten münden können, das ansonsten nicht respektiert wird. Beispiele dafür sind der Konsum von Alkohol und anderen Drogen, Prostitution sowie respektloser Umgang mit Menschen und Natur.
Im Kontext der Debatte um Overtourismus wurden Forderungen nach Regulierungen des touristischen Handelns lauter und es werden frühe Ansätze aus den Bereichen des Responsible Tourism aufgegriffen. Zentrale Begriffe zur Regulierung touristischer Aktivitäten sind in der Umweltpolitik mit dem Beispiel der Schutzgebiete zu finden oder im Bereich des Destinationsmanagements unter dem Begriff der (gesellschaftlichen) Tragfähigkeit (Mundt, 2011). Auch wenn immer mehr Destination (Beispiele sind Amsterdam, Dubrovnik, Venedig) konkrete Regeln umsetzen, ist der Aspekt der Verhaltensregeln in der Interaktion mit Einheimischen wenig thematisiert oder auf besondere (religiöse) Orte und einzelne Handlungen beschränkt.
In den nächsten Abschnitten werden zunächst internationale und nationale Regelwerke für einen verantwortungsvollen Umgang vorgestellt und im Anschluss die Rolle von Tour Guides.
3.1Regeln und Selbstverpflichtungen
Der Global Code of Ethics for Tourism (Globale Ethikkodex für den Tourismus) (GCET) dient als grundlegender Bezugsrahmen für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Tourismus (UNWTO, 2001). Er umfasst Grundsätze, die den Hauptakteuren des Tourismus als Orientierung dienen sollen und richtet sich nicht nur an die Reisebranche, sondern auch an Regierungen, Organisationen und Reisende. Der Global Code soll dazu beitragen, die Vorteile des Sektors zu maximieren und gleichzeitig seine potenziell negativen Auswirkungen auf die Umwelt, das kulturelle Erbe und die Gesellschaft weltweit zu minimieren. Er wurde 1999 von der Generalversammlung der Welttourismusorganisation (UNWTO) angenommen und 2001 von den Vereinten Nationen anerkannt (UN Resolution A/RES/56/212). Die UNWTO wurde in Folge ausdrücklich dazu aufgefordert, die wirksame Umsetzung der Bestimmungen zu fördern. Ein Aspekt, der seitdem kritisch diskutiert wird, ist die fehlende Rechtsverbindlichkeit bedingt durch den Ansatz des freiwilligen Umsetzungsmechanismus. Dieser soll primär durch die Anerkennung der Rolle des World Committee on Tourism Ethics (Weltkomitees für Tourismusethik) (WCTE), an das sich die Beteiligten bei Fragen zur Anwendung und Auslegung des Dokuments wenden können, gestützt werden.
Ein zusätzlicher Rahmen sind die UN Sustainable Development Goals (SDGs) (UNESCO, 2015). Die UNWTO ist zuständig für die Förderung eines verantwortungsvollen, nachhaltigen und allgemein zugänglichen Tourismus, der auf die Erreichung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ausgerichtet ist.
Bereits 2019 und, nur durch die Pandemie unterbrochen, ab 2022 zeigt sich, dass die Freiwilligkeit der genannten Rahmenwerke für die systematische Umsetzung von Verhaltensregeln nicht ausreicht. Auch andere Branchen befinden sich im Übergang von einer freiwilligen Verpflichtung (insbesondere unter dem Begriff der Corporate Social Responsibility) hin zu einer verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung (vgl. ESG-Berichterstattung, Environmental, Social and Corporate Governance).
Das World Economic Forum (2023) formuliert, dass Regierungen auf allen Ebenen entschlossen mit politischen Maßnahmen reagieren müssen, um die touristische Nachfrage zu steuern. Es darf nicht wie bisher primär um finanziellen Gewinn gehen.
Eine große Herausforderung im Tourismus besteht in der Umsetzung der Maßnahmen und der Kontrolle der tatsächlich angebotenen Leistungen. Die von Unternehmen wie Hotels, Fluggesellschaften aber auch von Destinationsmanagementorganisationen formulierten Regeln müssen in der täglichen Interaktion zwischen Individuen umgesetzt werden.
3.2Tour Guides
Neben Reiseveranstaltern, Transport- und Beherbergungsunternehmen, nehmen Tour Guides (Reiseleiter:innen resp. Gästeführer:innen) eine wichtige Position innerhalb des Tourismus ein, da sie die Interaktion zwischen Reisenden und Einheimischen ermöglichen und gestalten (Scherle und Nonnenmann, 2008).
1985 führte Cohen eine Studie über die Bedeutung der Reiseleitung durch. Er beschrieb die geschichtliche Entwicklung sowie Veränderungen. Cohen vertrat die Ansicht, dass Tourist Guides sowohl als Mentor:innen, die beim geistigen Wachstum helfen, als auch als Pfadfinder:innen (Path Finder), die Gebiete auskundschaftet, gesehen werden können. Während die ursprünglichen Aufgaben eher instrumenteller Natur waren, wie z. B. das Leiten und das Führen von Menschen, sind die kommunikativen Aufgaben in den letzten Jahren wichtiger geworden. Von einer professionellen Reiseleitung wird erwartet, dass sie Tourist:innen unterhalten und mit ihnen interagieren. Die Rolle von Reiseleiter:innen wird als ein eigenständiges Produkt oder eine Dienstleistung innerhalb des umfassenderen touristischen Produkts bzw. als wesentlicher Bestandteil dieses Produkts betrachtet und die Einbeziehung von Reiseleiter:innen steigert den Wert des touristischen Erlebnisses. Entscheidend sind das Fachwissen, die Erfahrung, das Führungstalent und der Einfallsreichtum der Reiseleiter:in (Kruczek, 2013).
Reiseleiterin:innen haben verschiedene Rollen, die mit unterschiedlichen Aufgaben einhergehen. Zunächst übernehmen sie die Informations- und Wissensvermittlung ausgehend von Orts- und Sprachkenntnissen. Sie müssen seriös und aktuelle Informationen vermitteln, was eine kontinuierliche Weiterbildung erfordert. Die Rolle der Vermittler:in wird um Elemente der Ausbilder:in und Tutor:in ergänzt. Dieses umfasst die Förderung einer respektvollen Haltung gegenüber Natur, Kultur und Gesellschaft. Kultur und damit verbundene Werte sind anschaulich zu vermitteln. Unterschiedliche Profile der Reisenden erfordern den Einsatz verschiedener Methoden in der Vermittlung. Wichtige Größen sind Interessen, Erfahrungen, Bildungsniveau und Aufmerksamkeit. Die Sicherheit der Reisenden sowie die Unterstützung bei Problemen und Notfällen werden nicht explizit formuliert, müssen bei Bedarf aber abgedeckt sein. Der Umgang mit Beschwerden und Reklamationen ist eine weitere Aufgabe und steht in einem engen Zusammenhang mit den Erwartungen der Reisenden. Deswegen müssen Reiseleiter:innen wissen, mit welchen Annahmen Reisende in ein Land kommen und welche Stereotype und Vorurteile Grundlage für die Annahmen sind. Eine Herausforderung besteht darin, zwischen stereotypen Annahmen und der Realität zu vermitteln. Dieser Aspekt hat eine hohe Relevanz für CBT, da diese je nach Form eng mit Themen wie „Rückständigkeit“ resp. „Armut“ verbunden sind (Heuwinkel, 2024, S. 67 ff.).
Trotz der zuvor formulierten sowohl umfassenden als auch anspruchsvollen Tätigkeiten ist der Beruf Reiseleiter:in nicht in allen Ländern staatlich geregelt und somit auch nicht mit einer verbindlichen beruflichen Ausbildung verbunden. Ein Beispiel dafür ist Deutschland. Um dennoch die erforderliche Professionalisierung und Standardisierung zu garantieren, bieten in Deutschland sowohl der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft e. V. (BTW) als auch Industrie- und Handelskammern (IHK) in einigen Bundesländern Zertifikatskurse an.
Mehrere internationale Organisationen wie die World Federation of Tourist Guides Associations, (WFTGA) definieren Tour Guides als Personen, die Besucher:innen in der Sprache ihrer Wahl führen und das kulturelle und natürliche Erbe eines Gebietes erläutern, wobei diese Personen über gebietsspezifische Qualifikationen verfügen können. Solche Spezifikationen werden in der Regel von der zuständigen Behörde ausgestellt und/oder anerkannt.
4Fallstudien: Kapstadt und Mumbai
In diesem Kapitel werden anhand von zwei Fallstudien die Regeln für Tour Guides im Allgemeinen und speziell für Touren in Communities beschrieben.
4.1Tour Guides in Kapstadt: Grundlagen und Regelwerke
Wenig überraschend orientiert sich Tourismus in Südafrika an der Cape Town Declaration on Responsible Tourism (2002). Diese ist stark von den Arbeiten Krippendorfs (1984, 1987) und seiner Tourismuskritik beeinflusst. Südafrika war das erste Land, das sich in seiner nationalen Tourismusstrategie ausdrücklich zum verantwortungsvollen Tourismus bekannte. Das White Paper on Tourism mit dem Titel „The Development and Promotion of Tourism in South Africa“ (1996) definiert responsible tourism als verantwortungsvolle Aktivitäten gegenüber der Umwelt, den lokalen Gemeinden, den Besucher:innen und einer verantwortungsvollen Regierung. Dem Papier zufolge bietet der Tourismus viele Möglichkeiten, z. B. Beschäftigung, Entwicklung von Fähigkeiten, ländliche Entwicklung. Tourismus sollte die lokalen Gemeinschaften einbinden, damit sie davon profitieren können. Auf der anderen Seite sollte das Wohlbefinden und die Sicherheit der Besucher:innen gewährleistet sein.
The Institute of Professional Tourist Guides of Southern Africa (IPTGSA) greift die Cape Town Declaration auf und definiert eine Reiseleiter:in wie folgt: „Tourist Guides act as ambassadors of the country; they are the first to meet and welcome tourists and they are often the last ones to bid farewell to them when they leave the country.“
In Südafrika ist Tour Guide ein reglementierter Beruf, der durch nationale Gesetze und Richtlinien geordnet ist. Jede Person, die Tour Guide werden möchte, muss eine Ausbildung im Rahmen einer formalen Qualifikation absolvieren, die von der South African Qualifications Authority (SAQA) registriert wird. Wenn eine solche Person als kompetent erachtet wird, erhält sie ein Zertifikat, das von der Culture, Arts, Tourism Hospitality and Sports Sector Education and Training Authority (CATHSSETA) ausgestellt wird. Zusätzlich muss beim zuständigen Provincial Registrar eine Registrierung beantragt werden, um legal tätig zu sein. Dieses Verfahren ist im Tourismusgesetz (Tourism Act) von 2014 und in den Verordnungen über Tour Guides (Regulations in respect of Tourist Guides) von 1994 bzw. 2001 festgelegt.
Es liegen drei Hauptverordnungen vor, die den Sektor der Reiseleitung regeln: Tourism Act No. 3 (2014), Regulations of Tourist Guides (1994 resp. 2001), The Code of Conduct and Ethics (Verhaltenskodex und die Berufsethik).
Im Code of Conduct and Ethics wird auf das gewünschte Verhalten von Tour Guides im Umgang mit Reisenden eingegangen. Der Kodex besagt, dass eine professionelle Reiseleitung sich an die Grundsätze der südafrikanischen Verfassung halten muss und darüber hinaus die Vorschriften des Institute of Professional Tourist Guides of Southern Africa (IPTGSA) einhalten sollte.
Vorschriften des Institute of Professional Tourist Guides of Southern Africa
Die Reiseleitung ist motiviert, den Reisenden zu helfen und einen hervorragenden Service zu bieten. Darüber hinaus sorgt sie dafür, dass die Tourist:innen ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich verbringen.
Keine Tourist:in darf aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe, der ethnischen Zugehörigkeit, der Nationalität, einer Behinderung oder des Alters diskriminiert werden.
Die Reiseleitung hat sich unparteiisch und unvoreingenommen zu verhalten. Südafrika soll objektiv dargestellt werden.
Tour Guides sollten angemessen gekleidet und präsentabel, pünktlich, zuverlässig, ehrlich, gewissenhaft und taktvoll sein. Sie sind stets nüchtern und verantwortungsvolle Fahrer:innen.
Weiterhin wird eine Loyalität gegenüber der vertretenden Organisation oder dem Unternehmen erwartet.
Das Programm der Tour wird nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Der Umgang mit Konflikten erfolgt sensibel und verantwortungsbewusst. Verletzungen oder Todesfälle sind der nächstgelegenen Tourismusbehörde oder Polizeistation zu melden.
Falsche Informationen dürfen nicht verbreitet werden und Tour Guides sind immer sachkundig. Wenn sie nicht über die gewünschten Informationen verfügt, können sie sich an die nächstgelegene Fremdenverkehrsbehörde wenden.
Tour Guides sind nicht befugt, ohne ärztliche Konsultation Medikamente zu verabreichen. Sie werden unter keinen Umständen auf Trinkgeld bestehen. Für die Sicherheit der Tourist:innen ist stets Sorge zu tragen. Die Reiseleitung trägt ihre Registrierungskarte und das Namensschild.
Menschen, Kulturen und die Umwelt sind mit Respekt zu behandeln.
Bei einer Durchsicht der Punkte drängt sich an einigen Stellen die Frage auf, ob und wie die genannten Aspekte überprüft und bewertet werden können. Während das Tragen des Namensschildes trivial erscheint, ist die Forderung nach einer objektiven Darstellung vor dem Hintergrund sehr komplexer historischer, politischer und wirtschaftlicher Ereignisse eine Herausforderung.
Sehr deutlich zeigt sich, dass der Schutz, das Wohlergehen und die Zufriedenheit der Tourist:innen im Mittelpunkt stehen. Einheimische und die lokale Kultur werden nur kurz erwähnt.
4.2Tour Guides in Mumbai: Grundlagen und Regelwerke
Der Code of Conduct for Safe and Honourable Tourism (Verhaltenskodex für sicheren und ehrbaren Tourismus) hat das Ziel, sichere Tourismuspraktiken zu fördern, die internationalen Standards entsprechen und sowohl für Tourist:innen als auch für Einheimische in Indien gelten (Indian Ministry of Tourism, 2011). Das Hauptaugenmerk dieses Kodex liegt auf der Stärkung des wichtigen Aspekts Suraksha (Sicherheit), indem die Würde, die Sicherheit und der Schutz vor Ausbeutung aller am Tourismus beteiligten Personen gewährleistet werden. Die Leitlinien des Verhaltenskodex für den Tourismus konzentrieren sich auf mehrere Kernthemen. Eines der Hauptziele besteht darin, touristische Aktivitäten zu fördern und dabei die Grundrechte auf Würde, Sicherheit und Schutz vor Ausbeutung sowohl für Reisende als auch für Einheimische zu wahren. Dies gilt auch für Einzelpersonen und Gruppen, die in irgendeiner Weise vom Tourismus betroffen sind.





























