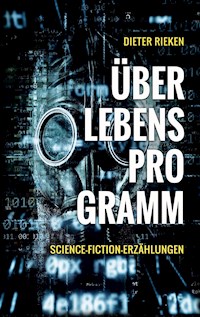
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In nicht allzu ferner Zukunft: Lisa Ressler arbeitet in einer Unterwasserstation, als auf der Oberfläche der Dritte Weltkrieg ausbricht. Grendel, der mitten in einer Eiswüste lebt, muss sich und seine Freundin gegen marodierende Banden verteidigen. Stefan, der in völliger Isolation aufwächst, will herausfinden, wie die Welt hinter den Mauern seines Gefängnisses aussieht. Richard Loewe kommt dem tragischen Schicksal der ersten außerirdischen Besucher auf die Spur. Miriam Hanna gerät auf einem Streifengang in der nächtlichen Großstadt in höchste Not. Fünf spannende, »klassische« Erzählungen über Männer und Frauen, die auf ihre Art versuchen, mit den Folgen menschengemachter Katastrophen fertig zu werden. »Stimmig charakterisierte Figuren« Sybille Schiller, Augsburger Allgemeine »Die Geschichten fesseln und begeistern schnell« Ralf Boldt, Andromeda Nachrichten
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autor
Dieter Rieken arbeitet als PR-Manager in der IT-Branche und schreibt in der Freizeit Science-Fiction-Erzählungen. Geboren und aufgewachsen in Norden, Ostfriesland, studierte er in Bamberg, Berlin und Kiew Germanistik und Slawistik, bevor er sich 1991 in Augsburg niederließ, wo er unter anderem als freier Journalist, Redakteur und Filmfestivalmacher tätig war. Er publizierte Gedichte und Kurzgeschichten in Anthologien sowie zahlreiche Artikel in Fachzeitschriften, Büchern und anderen Print- und Online-Medien. 2018 veröffentlichte er bei BoD das Buch Überlebensprogramm, eine Sammlung seiner besten Erzählungen, die Leser und Kritiker gleichermaßen begeisterte. 2020 erschien bei p.machinery das Buch Land unter, eine Mischung aus Zukunfts-, Kriminal- und Heimatroman.
INHALT
43 Meter
Schneekönig
Überlebensprogramm
Erstkontakt
Nachtschicht
Nachwort des Autors
43 METER
1
»Was fängst du mit deinem Leben an, wenn dir jemand deine Zukunft stiehlt?«
Lisa Resslers Tagebuch
In den mattschwarzen Konsolen der Instrumente tickte irgendwo eine Uhr. Ein echtes Relikt aus vergangenen Zeiten, dachte Lisa Ressler. Das rhythmische Geräusch des Sekundenzeigers machte sie noch nervöser, als sie ohnehin schon war.
Vor wenigen Minuten erst war Marc Roland, der junge Funker, mit der beunruhigenden Nachricht durch die Tür gestürmt: Krieg! Es sah jedoch so aus, als hätte diese Mitteilung Beller, die Kommandantin der OceanOrbiter, überhaupt nicht berührt.
Roland warf Ressler einen resignierten Blick zu. Er zuckte die Achseln und ging wieder in den Funkraum zurück.
Beller gab nun ein Knurren von sich und beugte ihren muskulösen Oberkörper ein wenig vor. Sie griff nach der schwarzen Dame und bedrohte damit Resslers Läufer von A5 aus. Anschließend ließ sie sich in den Sessel zurückfallen und senkte wieder den Blick.
Draußen auf der schmalen Stahltreppe waren Stimmen zu vernehmen. Eine davon gehörte Malraux, dem französischen Wissenschaftsminister, der für einige Tage Gast der Station war. Er und ein zweiter Mann näherten sich mit schweren Schritten der Tür.
Kurz darauf betrat der Regierungsvertreter in Begleitung eines Soldaten die Leitstelle des Habitats, die von der Besatzung nur »Turm« genannt wurde. Der untersetzte Mann baute sich schnaufend vor dem kleinen Spieltisch auf und stemmte die Fäuste in die Seiten.
»Ich habe gerade erfahren, was passiert ist. Wie können Sie noch so ruhig dasitzen!«, herrschte Malreaux die Kommandantin an.
Beller reagierte nicht auf den Vorwurf.
In diesem Augenblick kam Roland, das Headset um den Hals, zum zweiten Mal herein. Er ließ die Tür hinter sich offen, sodass alle die Übertragung mithören konnten.
Von vielerlei Störgeräuschen begleitet, spuckte der Lautsprecher die jüngsten Nachrichten in den kleinen Raum: Bombenangriffe auf russische Raketenbasen, Vergeltungsschläge gegen die NATO-Partner in Europa, Kriegserklärungen hier, allgemeine Mobilmachungen dort. Dazu unbestätigte Meldungen über die ersten Einschläge von Atomwaffen.
»Ich fürchte, da oben geht es jetzt richtig los«, bemerkte Roland mit heiserer Stimme. In dem gedämpften Licht glänzten Schweißtropfen auf seiner Oberlippe und an seinen Schläfen.
Beller starrte weiterhin scheinbar unberührt auf das Schachbrett. Ressler dagegen trafen die Neuigkeiten tief. Seit dem Streit der Großmächte um Waffenlieferungen und Truppenentsendungen in die Golfstaaten war die weltpolitische Lage äußerst angespannt gewesen. Einer Meldung von vorgestern zufolge hatte ein Manöver in den baltischen Staaten erstmals zu einer direkten bewaffneten Konfrontation geführt. Der Beschuss russischer Stellungen sei ein Irrtum gewesen, hatte es aus den USA geheißen. Aber auch die Beteuerungen des Präsidenten, wie üblich über die sozialen Medien verbreitet, hatten nicht verhindern können, dass am Vortag ein Gegenschlag von russischer Seite erfolgt war.
Seitdem waren unter der Besatzung der Station viele Vermutungen und Gerüchte kursiert, was als nächstes passieren würde. Jetzt stand fest: Da draußen begann der Krieg, vor dem sich die Menschheit seit Mitte des vorigen Jahrhunderts gefürchtet hatte. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis die Welt, wie sie sie kannten, nicht mehr existierte.
»Stellen Sie das leiser!« In Bellers Stimme schwang ein gereizter Unterton mit.
Vier Augenpaare richteten sich auf ihren kurz geschnittenen, grauen Haarschopf, bis sie aufsah und die Blicke bemerkte. Sie schien darin zu lesen, was hinter den Stirnen der anderen vorging.
Malraux rang nach Luft. Er konnte sich nicht länger zurückhalten. »Ich finde, wir sollten jetzt –«
»Das haben wir doch schon seit Wochen befürchtet«, äußerte sich die Kommandantin ruhig und schnitt dem Minister damit das Wort ab. »Oder etwa nicht?« Der Reihe nach sah sie die anderen an und senkte, da ihr keiner widersprach, erneut den Kopf.
»Wir können im Moment nichts anderes tun, als abzuwarten. Was mich betrifft: Ich hoffe, dass man uns übersieht«, fügte sie hinzu.
Ressler überlegte. Der Krieg würde wahrscheinlich kurz sein. Doch seine Folgen wären ohne Zweifel katastrophal. Sie rechnete mit der totalen Vernichtung. Selbst diejenigen, die den nuklearen Holocaust überleben sollten, erwarteten Hunger, Siechtum und Tod.
Für die Besatzung der OceanOrbiter dagegen gab es eine kleine Chance zu überleben. Die Unterwasserstation war vor rund sechs Jahren mit dem Anspruch errichtet worden, ein autarkes Habitat zu schaffen. Das war weitestgehend gelungen. Und die Inseln in der Nähe, von wo aus sie ihre Energie bezogen, lagen fernab jeder Zivilisation und hatten keinerlei strategische Bedeutung. Es kam also lediglich darauf an, dass sie sich hier unten, so gut es ging, auf die Folgen der atomaren Verwüstung vorbereiteten.
Und darüber sollten sie reden! Je eher desto besser.
»Müssen wir nicht irgendetwas unternehmen?«, wandte sie sich an die Kommandantin.
Aber Beller schien in Gedanken ganz woanders zu sein. Vielleicht hatte sie auch noch keine Antworten, dachte Ressler bei sich.
Der Soldat, der sich im Hintergrund gehalten hatte, setzte zum Sprechen an. Der Minister kam ihm jedoch zuvor. »Ich muss mich unverzüglich mit der Regierung in Verbindung setzen«, sagte er. Sein Tonfall war fast weinerlich.
Weil die Leiterin der OceanOrbiter immer noch keinerlei Reaktion zeigte, zuckte Roland erneut die Achseln. Damit gab er dem Politiker zu verstehen, dass er ihn ohne die Zustimmung seiner Vorgesetzten nicht in den Funkraum lassen würde.
»Wenn ich ein paar Vorschläge machen darf«, meldete sich der Soldat zu Wort.
Ressler hatte den älteren Mann als ruhig und besonnen kennen und schätzen gelernt. Er war ein guter Zuhörer und mischte sich für gewöhnlich nur dann in ein Gespräch ein, wenn er etwas Sinnvolles beizutragen hatte.
Darum wunderte sie sich auch nicht, dass Beller aufsah und sagte: »Reden Sie schon.«
»Es wäre gut, wenn wir die Leute, die noch draußen sind, hereinholen. Bis wir mehr wissen, sollte die Station abgeriegelt werden. Außerdem würde ich Funkstille empfehlen, damit uns niemand orten kann, zumindest vorübergehend. Falls uns jemand angreift, können wir uns zwar verteidigen, aber nicht sehr wirkungsvoll.«
Mit einer mürrischen Geste signalisierte Beller ihre Zustimmung. »Geben Sie das so weiter. Und Schluss mit den Formalitäten. Tun Sie einfach, was notwendig ist. Die Arbeiter wieder rein, alle Schotten dicht, und lassen Sie die Torpedostationen besetzen.«
Der Zeigefinger des Soldaten schnellte an die Stirn, und er eilte hinaus.
Roland ging nach nebenan und stellte den Nachrichtenkanal leiser. »Und was machen wir?« fragte er anschließend.
»Wie gesagt: abwarten«, antwortete Beller. »Für Sie heißt das: hinsetzen, zuhören, mitschreiben. Oder haben Sie noch weitere Vorschläge?«
»Das wird eine Panik geben«, bemerkte der Minister ernüchtert.
Zur allgemeinen Verwunderung fügte er sich jedoch in die Statistenrolle. Er folgte dem Uniformierten ohne ein weiteres Wort die Treppe hinab in die Aufenthaltsräume.
»Wir werden sehen«, meinte Beller nur.
Mit einem kurzen Nicken, das ihrer Spielpartnerin galt, wechselte sie vom Sessel zum Bürostuhl, setzte ein Headset auf und beugte sich über die Kontrollen.
Während Beller an den Monitoren die Abriegelung der Station überwachte, sah Ressler zu, wie sich der Funker im Nebenraum Notizen machte, um einen Überblick über den Verlauf des Krieges zu bekommen. Sie hätte sich gerne mit einem von beiden über ihre Situation unterhalten. Doch sie wollte sie nicht bei der Arbeit stören. Sie hätte auch nichts Konstruktives beizutragen gehabt. Sie war Biochemikerin und als solche im Augenblick völlig nutzlos.
Stattdessen versuchte sie, sich auf die Schachpartie zu konzentrieren. Sie hoffte, sich dadurch ablenken zu können.
»Die Arbeiter sind fast alle zurück. Feld fünf wird gerade geräumt. Sie wollen die Ernte noch mit reinbringen«, meldete Roland aus dem Nebenraum.
Ein Bauer würde genügen, entschied Ressler.
»Quatsch!«, blaffte Beller zurück. »Die sollen das Zeug lassen, wo es ist, und sich lieber beeilen!«
Die Kommandantin hatte den Bauernzug ihrer Spielpartnerin offenbar vorausgesehen. Denn mitten im Gespräch mit einem Untergebenen drehte sie sich zum Schachbrett um und machte ihren Konter.
Er war gut. Aber Ressler hatte ihn erwartet und brachte den weißen Läufer in eine strategisch bessere Position.
»Europa hat’s voll erwischt. Nur Spanien und Portugal scheinen noch nichts abbekommen zu haben«, rief Roland durch die Tür herüber. »Ich empfange Finnland«, folgte kurz darauf seine nächste Meldung: »Auch dort keine Einschläge. Allerdings macht ihnen die Strahlung Sorgen.«
»Überlassen Sie das Rumbrüllen mir«, fuhr Beller ihn an. »Passen Sie einfach auf, dass Sie nichts Wichtiges versäumen. Ich will später eine komplette Übersicht.«
»Hab’ schon verstanden, Chefin«, erwiderte Roland gekränkt. »Irgendwo wollen wir danach ja wohl noch leben können«, murmelte er missgelaunt vor sich hin. »Ich hab’ jedenfalls keine Lust, den Rest meiner Tage in dieser Blechdose zu verbringen.«
Ressler blätterte in einer Zeitschrift.
Nach einer knappen halben Stunde ließ sich die Kommandantin wieder in den Sessel gegenüber fallen. »So, das wäre erledigt«, sagte sie. Ihre Stimme klang erschöpft.
Die Biochemikerin hatte die Zeit genutzt, um über ihre Lage nachzudenken. »Sie haben doch sicher Pläne mit uns«, startete sie einen zweiten Versuch, der Leiterin des Habitats auf den Zahn zu fühlen.
»Worauf Sie einen lassen können«, bestätigte ihr Beller. »Es gibt sogar ziemlich klare Instruktionen. Liegen im Tresor. Interessante Lektüre übrigens. Da hat jemand weit vorausgedacht.«
»Und was genau heißt das?«
»Ich kann Ihnen im Moment nur so viel sagen: Unsere Zukunft ist bis auf weiteres vorherbestimmt.«
Die Kommandantin griff nach ihrem Läufer und schlug damit einen weißen Bauern.
Damit hatte Ressler nicht gerechnet.
»Es gibt also Instruktionen? Aber das ist doch absurd«, meinte die Biochemikerin. »Nehmen wir einmal an, wir kommen durch: Warum –«
»Kann gut sein, dass wir sogar die Einzigen sind, die diesen Krieg heil überstehen«, unterbrach Beller sie.
»Und warum dann nicht so, wie wir es für richtig halten? Verstehen Sie mich nicht falsch, aber wieso sollten wir die Anweisungen irgendeiner Behörde befolgen, die vermutlich gar nicht mehr existiert?«
»Ich versteh’ nicht, was Sie daran stört«, brummte Beller ungehalten.
»Die OceanOrbiter ist natürlich in erster Linie ein französisches Projekt. Das verstehe ich ja. Doch hier arbeiten Spezialisten aus ganz Europa – und sogar darüber hinaus«, fuhr Ressler unbeirrt fort. »Keiner könnte qualifiziertere Entscheidungen treffen als dieses Team. Vor allem können wir sie selber treffen. Ich meine: gemeinsam.«
»Warten Sie doch erst einmal ab, okay?«
»Gerne. Trotzdem ist das ist eine grundsätzliche Frage. Es sollte Ihnen klar sein, dass auch andere so denken werden wie ich.«
Die Kommandantin blickte auf. »Wenn das eine Warnung sein soll, können Sie sich die sonst wohin stecken!«, fuhr sie die Biochemikerin an. »Ich werde den Teufel tun, klare Instruktionen zu ignorieren! Abgesehen davon: Ich leite diese Station, und ich kenne meine Verantwortung der Besatzung gegenüber. Die Leute brauchen jetzt jemanden, der ihnen sagt, was zu tun ist.«
Ressler kannte Bellers Temperament. Darum nahm sie den Wutausbruch nicht allzu ernst.
»Ich denke, ›die Leute‹ brauchen vielmehr etwas, woran sie glauben können«, erwiderte sie. Vor allem, nachdem ihre Freunde, ihre Familie und alles, was ihnen wichtig war, ausgelöscht wurden, fügte sie in Gedanken hinzu.
Die Kommandantin schüttelte den Kopf. »Wie gesagt: Warten Sie’s ab. Die meisten sind jetzt wahrscheinlich eine Zeit lang im ›Betroffenheitsmodus‹. Da ist es mein Job, einen kühlen Kopf zu bewahren.«
Ihr Gespräch wurde unterbrochen, weil die ersten Techniker hereinkamen. Ressler erinnerte sich, dass Beller alle, die mit der Wartung der Stationssysteme beschäftigt waren, zusammengerufen hatte, »um sie über die anstehenden Aufgaben zu informieren«, wie sie sich ausgedrückt hatte.
Sie überlegte, ob sie gehen sollte. Ihr Platz war unten im Labor, ihre Aufgabe die Analyse von Seetangen und anderen Algen. Dazu kam, wenn auch in kleinerem Umfang, die Züchtung neuer Arten. Diese Arbeit entsprach ihrer Ausbildung und nicht zuletzt den persönlichen Ansprüchen, die sie an eine sinnvolle berufliche Tätigkeit stellte. Immerhin leistete sie damit einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Welternährungslage.
Mit dem Turm und der Leiterin der OceanOrbiter verband sie lediglich die Leidenschaft für das Schachspiel.
Fünf Männer und Frauen drängten sich jetzt in den kleinen Raum. Während sie auf die Anweisungen ihrer Vorgesetzten warteten, die wieder das Headset aufgesetzt hatte und ein dringendes Gespräch führte, machten aktuelle Informationen und neue Gerüchte die Runde.
Unter normalen Umständen hätte Ressler sich in der Gegenwart so vieler Menschen unwohl gefühlt. Im Augenblick jedoch kam sie sich in ihrer Mitte geborgen vor. Der Sessel bot ihr dabei das Minimum an Distanz, das sie gerne zu anderen hielt. Dazu kam die beruhigende Gewissheit, sich 43 Meter unter der Meeresoberfläche zu befinden, 43 Meter tiefer, als die Bomben fielen und die Strahlung drang.
»Sagen Sie den Labormäusen, sie sollen von ihren Becken ablassen und alle Versuche vorerst einstellen ... Ja, natürlich. Sagen Sie ihnen auch warum – und schnell!« Mit diesen Worten beendete Beller das Gespräch.
Nachdem sie das Headset abgenommen hatte, wandte sie sich dem technischen Stab der Station zu und bat sich Ruhe aus. Der Raum knisterte förmlich vor der Anspannung der versammelten Menschen.
Unbewusst lauschte die Biochemikerin dem Takt des Sekundenzeigers.
2
»Sollte ein Atomkrieg nicht eigentlich undenkbar sein? Ich war mir stets sicher, dass die etablierten Deeskalationsmechanismen den Einsatz nuklearer Waffen unmöglich machen würden. Waren diese Mechanismen nicht ausreichend gewesen? Oder hatte den Regierenden der Wille zu einer diplomatischen Lösung gefehlt? Hatten sie sich womöglich nicht genug Zeit genommen, ihre Konflikte anders zu regeln? Wie viele Minuten braucht es eigentlich, um den sicheren Weltuntergang zu verhindern?«
Lisa Resslers Tagebuch
Später an diesem Abend steckten Beller und Roland an der Wand über dem Spieltisch eine Weltkarte ab: schwarze Fähnchen für verwüstete Teile der Welt, rote für teilweise zerstörte und diejenigen, die unter starkem radioaktiven Niederschlag litten. Weiße Fähnchen erhielten die wenigen Länder mit geringer Strahlenbelastung. Leider waren diese fast ausnahmslos in konventionelle Kampfhandlungen verstrickt. Die Chance, dass man die vierunddreißigköpfige Besatzung der Unterwasserstation nach dem Krieg in irgendein Land evakuieren konnte, das verschont geblieben war, sank von Stunde zu Stunde.
Ihre Internetverbindung war bereits seit Stunden tot. Auch über Funk gab es Roland zufolge kaum noch verlässliche Meldungen. Eine von mehreren Seiten bestätigte Neuigkeit war, dass die Großmächte nur einen Teil ihrer Atomwaffen eingesetzt hatten. Doch diese Nachricht tat die Kommandantin mit dem berechtigten Einwand ab, dass zwischen »Kill« und »Overkill« ja wohl kein großer Unterschied bestand.
Während Roland weitere Informationen einzuholen versuchte, war Beller dazu verdammt, sich in Geduld zu fassen. Sie begann, mit einem Stift auf eine Metallkante zu schlagen, bis sie das Geräusch selbst nicht mehr ertrug.
Warten.
Ressler schaute aus den großen Fenstern der Leitstelle hinaus in das Wasser. Dank der Scheinwerfer, die jeden Abend für ein paar Stunden eingeschaltet wurden, reichte die Sicht bis zum beweglichen Dock neben Stauraum zwei. Ein verlassenes U-Mobil lag davor. Der Fahrer hatte es einfach stehengelassen.
Die sandige Fläche, die sich bis zu den Plantagen erstreckte, war wie ausgestorben. Nicht einmal ein Fisch ließ sich blicken.
Beller hatte für 22 Uhr eine kurze Ansprache an die Besatzung geplant. Gleich danach wollte sie sich mit den sechs französischen Marinesoldaten treffen, die auf der OceanOrbiter stationiert waren. Da das Gespräch vertraulichen Charakter hatte, bat sie ihre Schachpartnerin, den Turm zu verlassen.
Als Beller Punkt zehn das Headset wieder aufsetzte, erhob sich Ressler und ging. Die Stimme der Kommandantin, die durch das verzweigte Lautsprechersystem bis in das entfernteste Modul übertragen wurde, verfolgte sie auf ihrem Weg die Treppe hinunter, an den Unterkünften vorbei und in die Aufenthaltsräume.
Einige Köpfe drehten sich nach ihr um, als sie die Kantine betrat. Sie kannte nur etwa die Hälfte der Leute persönlich.
Heute hatten sich hier auch die Taucherinnen und Taucher eingefunden, die tagsüber auf den Algenplantagen arbeiteten und die zu dieser Zeit für gewöhnlich längst in ihren Kojen lagen.
Alle lauschten aufmerksam, was ihnen die Leiterin des Habitats mitzuteilen hatte.
Ressler blieb in der Tür stehen und gab vor, der Ansprache ebenfalls zuzuhören. Dabei beobachtete sie die Anwesenden unauffällig.
Männer saßen mit Männern an den Tischen und tranken Bier. Frauen hielten einander bei den Händen. Einige streichelten geistesabwesend den Arm ihres Partners, andere trösteten gute Freunde.
Sicher hatten sie alle Angehörige gehabt, da oben, irgendwo in Europa, dachte die Biochemikerin.
Nachdem die Kommandantin die Besatzung schonungslos über die Lage an der Oberfläche informiert hatte, sprach sie den Menschen zunächst ihr Beileid aus. Dann bemühte sie sich, sie aufzurichten, indem sie an ihren Zusammenhalt appellierte und ihre Stärke und Willenskraft beschwor.
Ressler konnte nur den Kopf schütteln. Ihre Spielpartnerin ließ so gut wie keine Durchhalteparole aus. Sie fand die Rede kalt und bürokratisch.
Anschließend kam Beller auf die Aufgaben und Ziele zu sprechen, die vor ihnen lagen. Doch dieser Teil der Ansprache, von dem sich die Biochemikerin endlich ein paar Details versprochen hatte, blieb vage.
Als die Kommandantin die Besatzung schließlich zu Solidarität und Disziplin aufrief, konnte Ressler die Rede nicht länger mitanhören und verließ die Kantine.
Sie lief den gekrümmten Gang hinab, der sie bis an das westliche Ende der OceanOrbiter führte. Dort traf sie auf eine Reihe von ovalen Stahlluken. Ohne lange zu überlegen, öffnete sie die zweite von hinten. Sie führte in einen der Geschützräume, die der Forschungsstation seitens der Regierung vor zwei Jahren aufgezwungen worden waren.
Beim Eintreten riss sie den Soldaten, der es sich auf einer kleinen Sitzbank bequem gemacht hatte, aus dessen Gedanken. Als der Mann die Besucherin erkannte, lächelte er ihr freundlich entgegen. Er hieß Thierry Tomas und war einer der Wenigen an Bord, zu denen Ressler privaten Kontakt pflegte.
»Ich hoffe, ich störe Sie nicht?«, erkundigte sie sich bei dem Soldaten.
Der winkte ab. »Im Gegenteil. Es ist bestimmt nicht gesund, wenn man mit trüben Gedanken in der Ecke liegt. Kommen Sie rein. Aber schließen Sie bitte das Schott.«
Sie zog die Luke hinter sich zu. Damit verstieß sie einmal mehr gegen Bellers ausdrücklichen Befehl, die Soldaten während des Dienstes an den Torpedorohren nicht zu behelligen. Doch das war ihr gleich. So »von oben herab«, wie die Alte sich heute aufgeführt hatte, sah sie den Besuch bei Tomas als eine Art stillen Protest an. Sollte man sie hier zusammen erwischen, würde es ihr eine Freude sein, diese Meinung auch offen zu vertreten.
Der Soldat war ein Mensch, der fast immer gute Laune hatte. Er war unkompliziert und verstand sich mit allen auf der Station, egal ob es sich um eine einfache Plantagenarbeiterin oder einen Wissenschaftler mit zwei Doktortiteln handelte – bis auf »die Alte«, wie er seine Vorgesetzte zu nennen pflegte, die er für »ziemlich gestört« hielt.
Von Tomas hatte Ressler das Wenige über Beller erfahren, das sie wusste. Die Personalakte der Kommandantin war keinem Besatzungsmitglied zugänglich. Dem Soldaten war jedoch zu Ohren gekommen, dass »die Alte« schon als Teenager damit angefangen hätte, in der Autowerkstatt ihres Vaters zu arbeiten. Später hätte sie neben der Arbeit die Abendschule besucht und ein Verwaltungsstudium absolviert. Was sie danach gemacht hatte, wusste niemand, ebenso wenig, wie sie an den Posten auf der OceanOrbiter gekommen war. Es gab jedoch allerlei Gerüchte, etwa dass sie – als zweite Frau überhaupt – bei der Fremdenlegion gedient und sich dort Verdienste erworben haben soll. Die Biochemikerin kannte eine ähnliche Geschichte, nämlich dass Beller in Deutschland jahrelang einen Boxclub betrieben habe. Aber auch das hielt sie für weit hergeholt.
Dass die Kommandantin nach Dienstschluss häufig in dem kleinen Fitnessraum der Unterwasserstation anzutreffen war, wo sie Stunde um Stunde den Sandsack traktierte, war dagegen eine Tatsache, die Ressler aus eigener Erfahrung bestätigen konnte.
Während sie sich mit Tomas über die weltpolitische Lage und ihre Situation auf der OceanOrbiter unterhielt, wurde das Licht heruntergedimmt, und die künstliche Nacht senkte sich über die Station. Heute gab sie den Bewohnern allerdings keinen Frieden. Denn die Menschen, die sich in die Unterkünfte zurückzogen, waren am Trauern und hatten Angst um ihre Zukunft.
Nachdem es auf den schmalen Gängen still geworden war, nutzte Ressler die Gelegenheit, noch einmal das Labor aufzusuchen. Kurz darauf kehrte sie mit zwei Sitzkissen und einer Flasche Pinot Noir in den Geschützraum zurück.
Sie machten es sich so bequem wie möglich und nippten an dem roten Burgunder, der selbst aus Tomas’ Plastikbechern hervorragend schmeckte.
Wie immer, wenn Ressler mit dem Soldaten zusammen war, konnte sie sich entspannen. Vor allem genoss sie es, in seiner Gegenwart sie selbst sein zu können.
Im Gegensatz zu einigen ihrer Kollegen hatte er noch nie mit ihr geflirtet. Das war ihr nur recht. Er hatte ganz offensichtlich keinerlei Interesse daran, mit ihr zu schlafen – so wenig wie sie mit ihm. Was ihn betraf, mochte das daran liegen, dass sie sechs Jahre älter war als er. Vielleicht fand er sie auch einfach nicht attraktiv. Ihr war das gleich. Hauptsache, sie konnten ungezwungen miteinander umgehen.
Tomas war nach Resslers Erfahrung kein Mensch, der viel über persönliche Dinge sprach – eine weitere Eigenschaft, die sie sehr an ihm schätzte. Umso erstaunter war sie, als der Soldat ihr in dieser Nacht zum ersten Mal von seiner Freundin erzählte. Sie war einunddreißig, zwei Jahre jünger als er, und Puertorikanerin. Er hatte sie in einem Café in Nantes kennengelernt.
»Seitdem verbringe ich jeden freien Tag mit ihr. Eigentlich wollten wir uns in drei Wochen wieder treffen. Aber das war vor diesem ganzen Mist, und jetzt erreiche ich sie nicht ... Macht mich ehrlich gesagt ziemlich fertig, nicht zu wissen, wie es ihr geht«, gestand er der Biochemikerin ein.
Ressler wusste darauf nichts zu sagen. Sie versuchte noch, sich darüber klar zu werden, ob sie schon dazu bereit war, sich dem Mann gegenüber noch mehr zu öffnen.
»Sie sind ein sonderbarer Mensch, Lisa«, meinte Tomas nach einiger Zeit. »Seit ich Sie kenne, sehe ich Sie immer nur alleine. Sie sind eine richtige Einzelgängerin. Okay, Sie haben mir erzählt, dass sie ab und zu in den Turm gehen, um mit der Alten Schach zu spielen ...«
Sie nickte verlegen.
»Aber was machen Sie sonst noch? Verkriechen sich in Ihrem Labor, beugen sich über die Reagenzgläser und lesen irgendetwas?«
»So ungefähr«, bestätigte Ressler ihm. »Oder ich sitze vor einem Torpedorohr und trinke Rotwein.«
Der Soldat grinste, wurde jedoch gleich wieder ernst. »Sie wissen, worauf ich hinaus will. Haben Sie denn keinen Ehemann oder Freund?«
Unwillkürlich verzog sie den Mund. Sie hob den Blick zu der Deckenleuchte, die ein angenehm schummriges Licht in den kleinen Raum warf. Was sollte sie ihm erzählen?, fragte sie sich. Vielleicht die Wahrheit? Dass sie lesbisch war? Dass sie schon einmal verheiratet gewesen war und ihre Frau sie verlassen hatte?
»Nein, da gibt es niemanden Bestimmten«, antwortete sie. »Wissen Sie, meine Eltern sind früh gestorben, und ich habe es deshalb nicht immer leicht gehabt. Ich habe meine Ausbildung sehr ernst genommen und später meine Arbeit auch. Über die Jahre bin ich ziemlich oft umgezogen. Jedenfalls hatte ich nie viel Zeit für Freunde ... oder für andere Frauen.« Das letzte Wort sprach sie, ohne es beabsichtigt zu haben, in einem abschätzigen Ton aus.
Egal, sagte sie sich. Jetzt war es heraus.
Es dauerte eine Weile, bis der Mann begriff, dass sie sich ihm gegenüber gerade geoutet hatte. »Tut mir leid, wenn ich Sie so unverschämt aushorche«, sagte er kleinlaut. »Thierry und seine dummen Fragen!«
Ressler winkte ab und entspannte sich wieder. Sie musterte das blutrote Tropfenmuster auf dem Grund ihres leeren Bechers.
»Was, glauben Sie, hat die Alte mit uns vor?«, wollte der Soldat wissen.
Sie freute sich über den schnellen Themawechsel. Über Bellers Absichten konnte sie Tomas allerdings auch nichts sagen.
So unterhielten sie sich noch eine Weile über die Ansprache der Stationsleiterin und spekulierten darüber, was in nächster Zeit wohl auf sie zukommen würde.
»Für uns Soldaten ändert sich sowieso nichts«, meinte Tomas. »Wir waren Beller schon vorher unterstellt, und wir werden auch weiterhin tun, was sie uns sagt.«
Was ihre Zukunft betraf, gaben sie sich beide betont optimistisch. Das Wichtigste an diesem Abend war, dass es jemanden gab, mit dem man reden konnte.
3
»Wozu sind wir noch hier? Das ist die zentrale Frage, die alle beschäftigt, die aber kaum jemand offen zu stellen wagt. Wir haben überlebt. Doch was wollen wir mit unserem Leben anfangen? Ich denke, dass die wenigsten darauf eine Antwort geben können. Unsicherheit und Ratlosigkeit überall. Nichts, das uns Halt gibt. Alles ist in Frage gestellt.«
Lisa Resslers Tagebuch
Die Lage an der Oberfläche verschärfte sich weiter, der Krieg tobte immer wütender. Selbst in einer so entlegenen Region der Welt wie der ihren waren erstmals leichte Erschütterungen des Meeresbodens messbar. Die Möglichkeit, dass es sich dabei um ein Seebeben handelte, schloss der Geologe der Unterwasserstation definitiv aus.
Die meisten Wissenschaftler, Techniker und Plantagenarbeiter waren schon jahrelang auf der OceanOrbiter tätig. Bei allen Umständen und Einschränkungen, die das Leben unter Wasser mit sich brachte, hatten sie ihren Job stets gemocht. Er hatte etwas Exotisches und Abenteuerliches, war gut bezahlt und bot auch sonst viele Vergünstigungen.
Wie in den folgenden Tagen deutlich wurde, hatte all das jedoch nur gegolten, solange ein Notausgang vorhanden gewesen war, der das Schild »Zur Oberfläche« trug. Von heute auf morgen existierte dieser Ausgang nicht mehr.
Auch wenn viele es nicht wahrhaben wollten, spürten alle, wie massiv sich ihre Situation verändert hatte. Selbst unter denjenigen, die an den drängendsten Aufgaben – der Versorgung mit Energie, Sauerstoff, Nahrung und Trinkwasser – arbeiteten, kam es vermehrt zu emotionalen Krisen. Zugleich nahm die Aggressivität besorgniserregend zu. Der geringste Anlass konnte schnell zu einem Streit führen.
Zweimal kam es in der Kantine zu einem Handgemenge.
Drei Nervenzusammenbrüche.
Ein Selbstmord.
Ressler ließ das, was um sie herum geschah, nicht unberührt. Doch sie konzentrierte sich auf ihre Arbeit, denn diese gab ihr Halt.





























