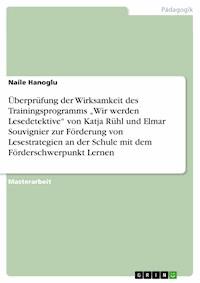
Überprüfung der Wirksamkeit des Trainingsprogramms „Wir werden Lesedetektive“ von Katja Rühl und Elmar Souvignier zur Förderung von Lesestrategien an der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen E-Book
Naile Hanoglu
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Pädagogik - Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Note: 1,7, Universität Koblenz-Landau (Campus Landau), Veranstaltung: Förderschwerpunkt Lernen, Sprache: Deutsch, Abstract: Bei dieser Untersuchung wurde die Fragestellung geklärt, wie wirksam die Lesestrategien durch das Unterrichtsprogramm bei der Stichprobe im Vergleich zur Kontrollgruppe gefördert werden. Die große Bedeutung der Lesefähigkeit in der Vergangenheit und heute wird zu Beginn dieser Arbeit dargestellt. Dabei werden die Begriffe Lesen und Lesekompetenz definiert. Danach werden die drei Schulleistungsstudien PISA, IGLU und DESI vorgestellt. Bei diesen drei Studien spielt der Begriff Lesekompetenz eine wichtige Rolle. Dabei wird auf die Kompetenzdebatte eingegangen. Außerdem werden Lesestrategien und –methoden beschrieben. Zum Abschluss des Theorieteils wird die Leseförderung vorgestellt. Bei der Untersuchung wurde das Trainingsprogramm „Wir werden Lesedetektive“ von Rühl und Souvignier mit der Experimentalgruppe aus der 6. Klasse an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen durchgeführt. Vor und nach der Durchführung des Programms wurde mit der gesamten Klasse der Leseverständnistest ELFE 1-6 durchgeführt. Dabei wurde der Rest der Klasse als Kontrollgruppe angesehen. Mit der Experimentalgruppe wurde vor der Durchführung des Trainingsprogramms eine Kurzform des Grundintelligenztests CFT 2 Skala 2 erarbeitet. Bei den Ergebnissen der Untersuchung wurde sichtbar, dass das Unterrichtsprogramm bei der Experimentalgruppe insgesamt beim Leseverständnis effektiv war. Vor allem zeigte sich bei den Ergebnissen, dass sich die Schüler/innen aus der Experimentalgruppe im Bereich Wortverstehen stark verbessert haben. Auch im Satzverstehen verbesserte sich die Experimentalgruppe, wohingegen bei der Kontrollgruppe im Laufe der Zeit ein negativer Effekt auftrat. Im Bereich Textverstehen haben sich beide Gruppen gleichmäßig verbessert. Der Effekt beim Text-verstehen ist nicht signifikant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Abbildungen:
1 Zusammenfassung/ Abstract
2 Einleitung
3 Theoretische Grundlegung
3.1 Lesen – Was ist das eigentlich?
3.1.1 Definition Lesen
3.1.2 Lesen im Unterricht
3.2 Geschichte des Lesens
3.2.1 Lesebezogene Bildungsnormen von B. Hurrelmann
3.3 Lesekompetenz
3.3.1 Definition Lesekompetenz
3.3.2 Was wird durch den Erwerb der Lesekompetenz gewonnen?
3.3.3 Wie entwickelt sich die Lesekompetenz?
3.4 Die Kompetenzdebatte in der aktuellen Bildungspolitik
3.4.1 Das Konzept von Lesekompetenz in der PISA-Studie 2000
3.4.2 Das Konzept von Lesekompetenz in der IGLU-Studie 2001
3.4.3 Das Konzept von Lesekompetenz in der DESI-Studie 2003/2004
3.5 Textverstehen
3.5.1 Sozio-kognitiver Ansatz von Ruddell und Unrau zum Textverstehen
3.6 Lesestrategien und –methoden
3.6.1 Die Lesestrategien
3.6.2 Die Lesemethoden
3.7 Ergebnisse aus der Leseforschung
3.8 Leseförderung und Förderung der Lesekompetenz
3.8.1 Was ist Leseförderung?
3.8.2 Leseförderung „nach PISA“
3.8.3 Systemische und systematische Leseförderung
4 Das Trainingsprogramm „Wir werden Lesedetektive“
4.1 Ziele und Aufbau des Trainingsprogramms
4.2 Durchführung der Maßnahme
4.3 Befunde zur Wirksamkeit
5 Fragestellung und Hypothesen der Arbeit
6 Methoden
6.1 Stichprobe
6.2 Durchführung der Untersuchung
6.3 Erhebungsinstrumente
6.4 Datenauswertung
7 Ergebnisse
7.1 Stichprobe
7.2 Leseverständnis vor Beginn des Trainings
7.3 Wirkung des Trainingsprogramms
8 Hypothesenüberprüfung
9 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick
10 Literaturverzeichnis
11 Anhang
Skizze des Klassensaals
Skizze des Nebenraums
Ergebnisse der Schüler/innen im Überblick
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Auszug aus dem Lehrplan für Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen - Fach: Deutsch (Klasse 1-4) Lernbereich: Schreiben- und Lesenlernen - Zugriff auf Schriftsprache beim Lesen
Abbildung 2: Auszug aus dem Lehrplan für die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen - Fach: Deutsch (Klasse 1-4) Lernbereich: Mit Texten und Medien umgehen
Abbildung 3: Auszug aus dem Lehrplan für Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen - Fach: Deutsch (Klasse 5-6) Lernbereich: Zugriff auf Schriftsprache beim Lesen
Abbildung 4: Auszug aus dem Lehrplan für Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen - Fach: Deutsch (Klasse 5-6) Lernbereich: Mit Texten und Medien umgehen
Abbildung 5: Auszug aus dem Lehrplan für Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen - Fach: Deutsch (Klasse 7-9) Lernbereich: Zugriff auf Schriftsprache beim Lesen
Abbildung 6: Beschreibung der typischen Anforderungen pro Kompetenzstufe und Subskala bei PISA
Abbildung 7: Modell des Leseaktes in IGLU 2003
Abbildung 8: Leseprozess bei DESI
Abbildung 9: Niveaustufen und Anforderungen im DESI-Modell von Lesekompetenz
Abbildung 10: Didaktisches Modell der Lesekompetenz von Rosebrock & Nix
Abbildung 11: Die systemischen Handlungsfelder von Leseförderung von Hurrelmann
Abbildung 12: Instruktionsaufgabe ELFE 1-6
Abbildung 14: Tafelbild Detektiv - Lesedetektiv
Abbildung 15: Arbeitsblatt Detektiv - Lesedetektiv
Abbildung 16: Arbeitsblatt Detektivmethode 1
Abbildung 17: Profildiagramm Leseverständnis (ELFE-Gesamtwert)
Abbildung 18: Profildiagramm Wortverstehen
Abbildung 19: Profildiagramm Satzverstehen
Abbildung 20: Profildiagramm Textverstehen
Abbildungen:
Tabelle 1: Das Unterrichtsprogramm "Wir werden Lesedetektive"
Tabelle 2: Übersicht über die an der Evaluation beteiligten Klassen
Tabelle 3: Übersicht über die Durchführung
Tabelle 4: Zusammensetzung der Kontrollgruppe (KG) und Experimentalgruppe (EG) nach Erstsprache
Tabelle 5: Zusammensetzung der Kontrollgruppe (KG) und Experimentalgruppe (EG) nach Geschlecht
Tabelle 6: T-Test zur Überprüfung unterschiedlicher Lernausgangslagen zwischen der Kontroll- und Experimentalgruppe hinsichtlich des Leseverständnisses
Tabelle 7: Deskriptive Statistiken des Leseverständnisses vor Trainingsbeginn nach Gruppenzuordnung
Tabelle 8: Deskriptive Statistiken für Pre- und Posttest bzgl. Leseverständnis (ELFE - Gesamtwert) nach der Kontrollgruppe (KG) und Experimentalgruppe (EG)
Tabelle 9: Leseverständnis (ELFE-Gesamtwert) Mauchly -Test auf Sphärizität
Tabelle 10: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung für das abhängige Variable Leseverständnis (ELFE - Gesamtwert)
Tabelle 11: Deskriptive Statistiken für Pre- und Posttest bzgl. Wortverstehen nach der Kontrollgruppe (KG) und Experimentalgruppe (EG)
Tabelle 12: Wortverstehen Mauchly-Test auf Sphärizität
Tabelle 13: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung für das abhängige Variable Wortverstehen
Tabelle 14: Deskriptive Statistiken für Pre- und Posttest bzgl. des Satzverstehens nach der Kontrollgruppe (KG) und Experimentalgruppe (EG)
Tabelle 15: Satzverstehen Mauchly - Test auf Sphärizität
Tabelle 16: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung für das abhängige Variable Satzverstehen
Tabelle 17: Deskriptive Statistiken für Pre- und Posttest bzgl. des Textverstehens nach der Kontrollgruppe (KG) und Experimentalgruppe (EG)
Tabelle 18: Textverstehen Mauchly - Test auf Sphärizität
Tabelle 19: Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung für das abhängige Variable Textverstehen
1 Zusammenfassung/ Abstract
Bei dieser Untersuchung wurde die Fragestellung geklärt, wie wirksam die Lesestrategien durch das Unterrichtsprogramm bei der Stichprobe im Vergleich zur Kontrollgruppe gefördert werden. Die große Bedeutung der Lesefähigkeit in der Vergangenheit und heute wird zu Beginn dieser Arbeit dargestellt. Dabei werden die Begriffe Lesen und Lesekompetenz definiert. Danach werden die drei Schulleistungsstudien PISA, IGLU und DESI vorgestellt. Bei diesen drei Studien spielt der Begriff Lesekompetenz eine wichtige Rolle. Dabei wird auf die Kompetenzdebatte eingegangen. Außerdem werden Lesestrategien und –methoden beschrieben. Zum Abschluss des Theorieteils wird die Leseförderung vorgestellt. Bei der Untersuchung wurde das Trainingsprogramm „Wir werden Lesedetektive“ von Rühl und Souvignier mit der Experimentalgruppe aus der 6. Klasse an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen durchgeführt. Vor und nach der Durchführung des Programms wurde mit der gesamten Klasse der Leseverständnistest ELFE 1-6 durchgeführt. Dabei wurde der Rest der Klasse als Kontrollgruppe angesehen. Mit der Experimentalgruppe wurde vor der Durchführung des Trainingsprogramms eine Kurzform des Grundintelligenztests CFT 2 Skala 2 erarbeitet. Bei den Ergebnissen der Untersuchung wurde sichtbar, dass das Unterrichtsprogramm bei der Experimentalgruppe insgesamt beim Leseverständnis effektiv war. Vor allem zeigte sich bei den Ergebnissen, dass sich die Schüler/innen aus der Experimentalgruppe im Bereich Wortverstehen stark verbessert haben. Auch im Satzverstehen verbesserte sich die Experimentalgruppe, wohingegen bei der Kontrollgruppe im Laufe der Zeit ein negativer Effekt auftrat. Im Bereich Textverstehen haben sich beide Gruppen gleichmäßig verbessert. Der Effekt beim Textverstehen ist nicht signifikant.
2 Einleitung
Von PISA wird die Lesefähigkeit wie folgt definiert:„Lesefähigkeit bedeutet, geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen, über sie zu reflektieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“.[1]
Lesen ist ein komplexer kognitiver Vorgang. Durch die Lesefähigkeit ist der Mensch in der Lage sich mithilfe von Schrift mit der Gesellschaft auszutauschen und zu verständigen. Das Lesen wird heute durch den Medienwandel stark beeinflusst. Der Computer hat die Leselandschaft um neue Textqualitäten und damit neue Leseanforderungen erweitert. Außerdem wurde die Lesegewohnheit der Menschen durch die Ausbreitung des Fernsehens stark beeinflusst. (vgl. Bretschi-Kaufmann, 2007, S.8f.)
Es werden unterschiedliche Nutzungsmotive von Printmedien genannt. Von Dehm et al. (vgl. Dehm, 2005 in Garbe/ Philipp/ Ohlsen, 2009, S.11) werden dazu folgende Motive zum Buchlesen genannt. Bücher werden gelesen, um Spaß zu haben, zur Entspannung, um Stoff zum Nachdenken zu haben, um etwas zu lesen, zur Ablenkung von Alltagssorgen und Alltagsstress uvm. (vgl. Garbe/ Holle/ Jesch, 2009, S.11f.)
Lesen ist die Entnahme von im Text enthaltenen Informationen und Bedeutungsinhalten. Beim Lesen werden die Informationen vom Schreiber enkodiert und später vom Leser wieder dekodiert. Darum sind Dekodierung und Enkodierung spiegelbildliche Prozesse. Lesen ist außerdem die aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten der Texte. Das Leseverstehen wird auf drei unterschiedlichen Ebenen erlernt. Auf der Wortebene wird das Leseverstehen von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Diese sind zum Beispiel der Wortschatz des Schülers/ der Schülerin, die Fähigkeit zur Dekodierung einzelner Wörter, die Erfassung der Wortbedeutung und das Wissen, wie diese Bedeutung durch den jeweiligen Kontext modifiziert wird. Wenn der Schüler/ die Schülerin in der Lage ist die Wortbedeutung auf der Basis des Kontexts zu interpretieren, hat er/sie eine Verbindung zur Satzebene hergestellt. Auf der Satzebene können die Schüler/innen die grammatikalische Struktur berücksichtigen. Auf der Textebene können sie die Informationen aus verschiedenen Sätzen miteinander in Beziehung setzen. Auf dieser Ebene sind metakognitive Fähigkeiten von großer Bedeutung. (vgl. Lenhard/ Schneider, 2005, S.13f.)
Dass das Lesenlernen nicht immer erfolgreich verläuft, wurde durch die Ergebnisse der Schulleistungsstudien, wie zum Beispiel die PISA-Studie im Jahre 2000 sichtbar. Aufgrund dieser Ergebnisse wurden die beunruhigenden Mängel der Schüler/innen im deutschen Bildungssystem bezüglich der Lesekompetenz sichtbar. Viele Schüler/innen haben mit dem Verstehen von gelesenen Texten große Schwierigkeiten. Sie können Texte flüssig lesen, sind aber nicht in der Lage wichtige Informationen zu identifizieren. Infolge der Ergebnisse aus den Schulleistungsstudien wurde der hohe Wert vom Lesen sichtbar. Außerdem wurde von den Schulleistungsstudien, wie beispielsweise der PISA-Studie, die Lesekompetenz definiert. Von der PISA-Studie wird Lesekompetenz als die „basale Kulturtechnik, die zur Lebensführung nötig ist“[2] beschrieben. Die Vermittlung der Lesekompetenz ist die Aufgabe der Schule. Darum hat das Lesen eine wichtige Stellung im Lehrplan der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen im Fach Deutsch. Für die Schüler/innen, die beim Verstehen von Texten Probleme haben, wird die Vermittlung von Lesestrategien empfohlen. Für den Unterricht wurden verschiedene Lesestrategieprogramme entwickelt. Einer dieser Lesestrategieprogramme ist „Wir werden Textdetektive“ von der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. A. Gold. Daraus wurde die Programmversion „Wir werden Lesedetektive“ von K. Rühl und E. Souvignier entwickelt. Diese Programmversion wurde bei dieser Untersuchung an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen eingesetzt. Dieses Programm wurde speziell für leistungsschwächere Schüler/innen entwickelt. Es kann in den Jahrgangsstufen fünf bis acht eingesetzt werden. Mithilfe des Unterrichtprogramms werden Lesestrategien vermittelt und eingeübt. Das Programm kann auch bei geringem Wortschatz und niedriger Lesegeschwindigkeit angewendet werden. Die einzige Voraussetzung für den Einsatz ist die Automatisierung von Buchstaben- und Worterkennung. Bei Erfolgserlebnissen mit den Lesestrategien werden die Schüler/innen motiviert diese auch später weiterhin einzusetzen. Die Lesestrategien sind in der weiteren Bildungslaufbahn wichtig und werden als Voraussetzung im Beruf angesehen. (vgl. Rühl/ Souvignier, 2006, S.5f.)
Die Untersuchung wurde an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit einer sechsten Klasse erprobt. Für die Untersuchung wird die Programmversion „Wir werden Lesedetektive“ mit fünf zufällig durch ein Losverfahren ausgewählte Schüler/innen aus der Klasse von 04.11.2014 bis 19.11.2014 erprobt. Dabei geht die Untersuchung der Frage nach, wie wirksam die Lesestrategien durch das Unterrichtsprogramm „Wir werden Lesedetektive“ bei der Stichprobe im Vergleich zur Kontrollgruppe gefördert werden.
Bevor ich die Untersuchung näher erläutere, werde ich zuerst auf die theoretische Grundlegung eingehen. Diese ist in mehrere Kapitel unterteilt. Zuerst gehe ich auf das Lesen ein. Dabei wird geklärt, was genau darunter verstanden wird. Dazu definiere ich den Begriff „Lesen“. Danach werde ich auf das Lesen im Unterricht eingehen. Dieses Unterkapitel enthält die Verankerung des Themas im Lehrplan der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen. In dem nächsten Unterkapitel gehe ich auf die Geschichte des Lesens ein. Außerdem schildere ich dazu die lesebezogenen Bildungsnormen von B. Hurrelmann detailliert. Im nächsten Unterkapitel werde ich die Lesekompetenzen veranschaulichen. Dabei werde ich die Fragen klären, was unter dem Begriff „Lesekompetenz“ verstanden wird, was durch den Erwerb der Lesekompetenz gewonnen wird und wie sich die Lesekompetenz entwickelt. Dazu passend gehe ich auf die Kompetenzdebatte in der aktuellen Bildungspolitik ein. Hierbei stelle ich die drei großen Schulleistungsstudien PISA, IGLU und DESI vor und erläutere die Ergebnisse. Des Weiteren beschreibe ich im folgenden Unterkapitel das Textverstehen ausführlich, da das Textverstehen als eine wichtige Komponente der Lesekompetenz von den Schulleistungsstudien, wie beispielsweise die PISA-Studie, aufgefasst wird. Danach erläutere ich das Unterkapitel Lesestrategien und –methoden. Hierbei definiere ich zuerst was man unter dem Begriff „Lesestrategie“ versteht. Außerdem werden die Schüler/innen ermittelt, bei denen die Vermittlung der Lesestrategien angebracht ist. Zusätzlich werde ich die einzelnen Lesestrategien und deren Vermittlung vorstellen. Weiter beschreibe ich kurz die Ergebnisse aus der Leseforschung. Am Ende des Kapitels schildere ich schließlich die Leseförderung und die Förderung der Lesekompetenz. Hierbei findet die Frage nach der Begriffsdefinition der Leseförderung ihre Antwort. Anschließend werde ich auf die Leseförderung nach dem „PISA-Schock“ eingehen. Zum Schluss stelle ich die zwei Modelle der Leseförderung – systemische und systematische Leseförderung – detailliert dar. Nach der theoretischen Grundlegung werde ich im nächsten Kapitel das Trainingsprogramm „Wir werden Lesedetektive“ von K. Rühl und E. Souvignier vorstellen. Dabei erläutere ich die Ziele und den Aufbau des Programms. Anschließend veranschauliche ich die Durchführung der Maßnahme und die Befunde zur Wirksamkeit. Im nächsten Kapitel werde ich die Fragestellung und die Hypothesen zur Untersuchung darstellen. Ebenfalls erläutere ich die Methoden der Untersuchung in einem gesonderten Kapitel. Hierzu gehört die Beschreibung der Stichprobe. Zusätzlich beschreibe ich die Durchführung der Untersuchung mit den Pre- und Posttests und des Unterrichtprogramms. Ebenfalls gehören die Erhebungsinstrumente (Grundintelligenztest CFT 2 Skala 2 und Leseverständnistest ELFE 1-6) zu diesem Kapitel. Zuletzt werde ich in diesem Kapitel die Datenauswertung schildern. Im nächsten Kapitel werde ich die Ergebnisse deskriptiv darstellen. Im anschließenden Kapitel werde ich die in dem vorangegangenen Kapitel aufgestellten Hypothesen auf ihre Richtigkeit überprüfen. Zuletzt werde ich die Ergebnisse diskutieren und ein Ausblick geben.
3 Theoretische Grundlegung
Bevor im Detail auf die Untersuchung eingegangen wird und die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt werden, wird die theoretische Grundlegung im folgenden Abschnitt genau betrachtet. Zuerst erfolgt die genaue Beschreibung des Begriffs „Lesen“. Danach folgt die Geschichte des Lesens. Dann werden die Lesekompetenzen näher erläutert. Dazu wird die Kompetenzdebatte in der aktuellen Bildungspolitik beschrieben. Anschließend wird das Textverstehen noch einmal getrennt von der Lesekompetenz betrachtet. Daraufhin folgt die Beschreibung der Lesestrategien und –methoden. Außerdem werden die Ergebnisse aus der Leseforschung in gekürzter Form dargestellt. Zum Schluss werden die Leseförderung und die Förderung der Lesekompetenz beschrieben und verschiedene Modelle zur Leseförderung werden vorgestellt.
3.1 Lesen – Was ist das eigentlich?
Lesen ist ein komplexer kognitiver Vorgang. Dass das Lesenlernen nicht immer erfolgreich verläuft, wird durch die Ergebnisse der PISA-Studien aus den Jahren 2000 und 2003 sichtbar. Auf die Ergebnisse der PISA-Studie und die darauffolgende Diskussion wird in einem späteren Abschnitt detailliert eingegangen. Durch die Lesefähigkeit erhält man die Zugehörigkeit zur Gesellschaft, da sich diese mithilfe von Schrift austauscht und verständigt. (vgl. Bretschi-Kaufmann, 2007, S.8)
Seit der Ausbreitung des Fernsehens können Kinder und Jugendliche Unterhaltung und spannende Geschichten nicht mehr nur von gedruckten Texten beziehen. Durch die Entwicklung der neuen Medien ist die Lesetätigkeit nicht mehr nur auf die gedruckten Texte bezogen. Das Lesen am Bildschirm oder auf dem Display gehört heute zum Alltag. (vgl. ebd. S.11f.)
3.1.1 Definition Lesen
Nach KAINZ ist Lesen „das verstehende Aufnehmen von schriftlich fixierten Sprachfügungen, somit die aufgrund der erworbenen Kenntnis der Schriftzeichen vollzogenen Tätigkeit des Sinnerfassens graphisch niedergelegte Gedankengänge.“[3]





























