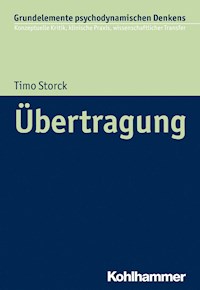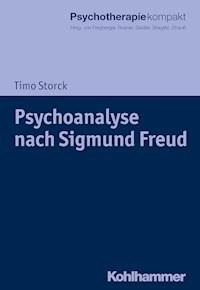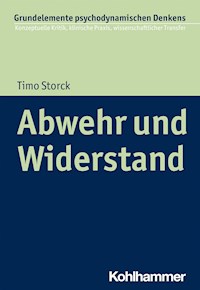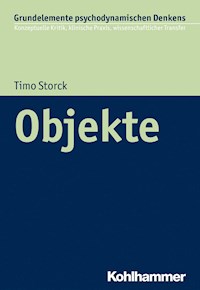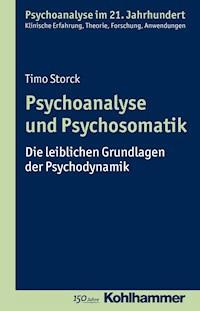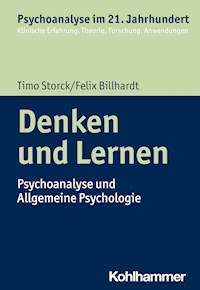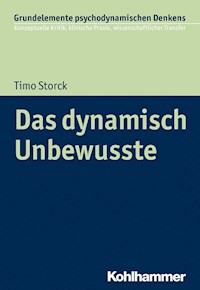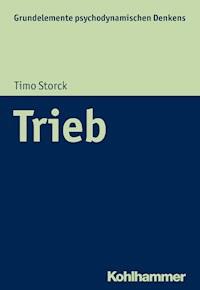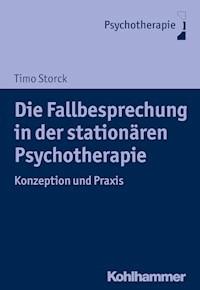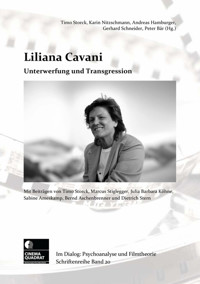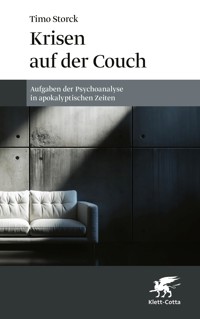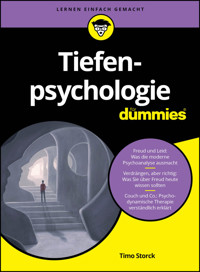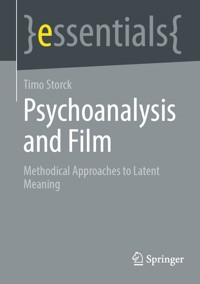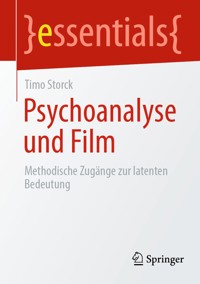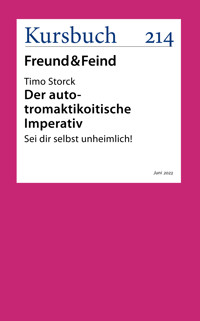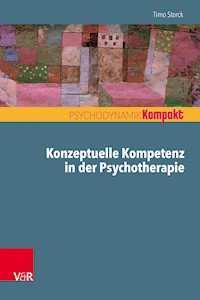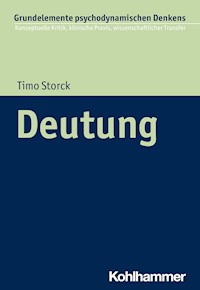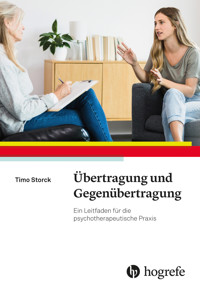
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bei zahlreichen psychischen Störungen spielen dysfunktionale verinnerlichte Beziehungserfahrungen eine wichtige Rolle und zeigen sich in der therapeutischen Beziehung. Die Konzepte von Übertragung und Gegenübertragung liefern die Möglichkeit, diese Prozesse genauer zu verstehen und für therapeutische Veränderungsprozesse nutzbar zu machen. Das Buch liefert einen praxisorientierten Überblick über psychotherapeutisches Arbeiten unter Einbezug von Übertragung und Gegenübertragung. Nach einer Einführung in die Grundgedanken der Konzepte von Übertragung und Gegenübertragung beschreibt der Band, wie sich bei unterschiedlichen psychischen Störungen verinnerlichte Beziehungserfahrungen in der therapeutischen Beziehung zeigen können. Der Band geht darauf ein, wie die Reflexion der Beziehungsmuster erfolgen kann, welche diagnostischen Instrumente für die Erfassung von Beziehungserfahrungen vorliegen, welche behandlungspraktischen Entscheidungen zu treffen sind und wo die Grenzen des beziehungsorientierten Vorgehens liegen. Klinische Entscheidungsprozesse werden zunächst auf drei Ebenen dargestellt – nämlich auf der Ebene des therapeutischen Beziehungsangebots, der Konzeptualisierung sowie der therapeutischen Interventionen –, bevor es um Variationen in der Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung bei unterschiedlichen Störungsbildern, Altersgruppen und psychotherapeutischen Settings sowie um Möglichkeiten der Kombination mit anderen psychotherapeutischen Ansätzen geht. Ein ausführliches Fallbeispiel und Ergebnisse der Psychotherapieforschung schließen den Band ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Timo Storck
Übertragung und Gegenübertragung
Ein Leitfaden für die psychotherapeutische Praxis
Prof. Dr. Timo Storck, geb. 1980. 2000–2005 Studium der Psychologie in Bremen. 2006–2008 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bremen. 2008–2011 Klinischer Psychologe im Ludwig-Noll-Krankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie sowie in der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum Kassel. 2009–2015 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel. 2010 Promotion. 2015 Habilitation. 2014–2016 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie an der Medizinischen Universität Wien. Seit 2015 Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin. 2023–2024 Fellow am Käte Hamburger Centre for Apocalyptic and Postapocalyptic Studies an der Universität Heidelberg.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten. All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com / SDI Productions
Satz: Sabine Rosenfeldt, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2025
© 2025 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3207-6; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3207-7)
ISBN 978-3-8017-3207-3
https://doi.org/10.1026/03207-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet umrandete Seitenzahlen (Beispiel: 1) und in einer Seitenliste, die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Übersicht
Cover
Titel
Über die Autor:innen
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
5Inhaltsverzeichnis
Übertragung und Gegenübertragung
1
Einführung
1.1
Zur Konzeptgeschichte von Übertragung und Gegenübertragung
1.2
Therapiemethoden jenseits der Verfahrensgrenzen
2
Theoretischer Bezugsrahmen
2.1
Die drei Ebenen der Beziehung in der Psychotherapie
2.2
Beziehungserleben und psychische Gesundheit
2.2.1
Beziehungsvorstellungen als „Bausteine“ der Persönlichkeit
2.2.2
Merkmale psychischer Gesundheit
2.2.3
Verinnerlichte Beziehungsmuster und psychische Störungen
2.3
Übertragung und Gegenübertragung
2.3.1
Übertragung und „Diagnostik“ impliziten Beziehungserlebens in der Therapiebeziehung
2.3.2
Strukturierung versus Offenheit
2.3.3
Bereitschaft zur Rollenübernahme
2.3.4
Ein dreistufiges Modell der Beziehungskompetenz
2.3.5
Eigenübertragung und Gegenübertragung
2.4
Beziehungskrisen und Brüche in der Arbeitsbeziehung
2.5
Typische Formen von Übertragung und Gegenübertragung bei unterschiedlichen psychischen Störungen
2.5.1
Übertragung bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung
2.5.2
Übertragung bei Borderline-Persönlichkeitsstörung
2.5.3
Übertragung bei Depression
2.5.4
Übertragung bei Zwangsstörungen und zwanghafter Persönlichkeit
2.5.5
Übertragung bei Somatischer Belastungsstörung
2.5.6
Übertragung bei anderen psychischen Störungen
2.5.7
Besonderheiten in der Übertragung und Gegenübertragung in der Psychotherapie mit älteren Menschen
2.6
Empirische Befunde zu Übertragung und Gegenübertragung
2.7
Kritische Würdigung der Konzepte
2.8
Folgerung: Die Therapiebeziehung als Ort der Reflexion und der Veränderung von internalisierten Beziehungsmustern
3
Indikation und Diagnostik
3.1
Zur Indikation für die Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung
3.1.1
Behandlungsmotivation
3.1.2
Die Ebene der psychischen Störung
3.1.3
Folgerung: Arbeit an der Veränderung, wie jemand sich selbst im Verhältnis zu anderen erlebt
3.2
Diagnostische Instrumente
3.2.1
Zentrales Beziehungskonfliktthema
3.2.2
Die Beziehungsachse der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik
3.2.3
Bezüge zu weiteren diagnostischen Instrumenten und Modellen
3.2.4
Diagnostische Zugänge zur Gegenübertragung
4
Therapeutisches Vorgehen
4.1
Therapeutisches Vorgehen in der Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung
4.2
Variationen der Methode
4.2.1
Therapeutisches Vorgehen bei unterschiedlichen psychischen Störungen
4.2.2
Therapeutisches Vorgehen in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen
4.2.3
Übertragung und Gegenübertragung in der stationären Psychotherapie
4.2.4
Übertragung und Gegenübertragung in der Gruppen- oder Paartherapie
4.3
Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung in manualisierten Therapien
4.3.1
Übertragungsfokussierte Psychotherapie
4.3.2
Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
4.3.3
Schematherapie
4.4
Umgang mit möglichen Problemen in der Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung: Kritische Würdigung der Methode
4.4.1
Differenzialindikation und Transparenz
4.4.2
Gefahr der Abhängigkeit bzw. Infantilisierung von Patient:innen
4.4.3
Verknüpfung mit anderen Therapiebausteinen und Bezug zu unterschiedlichen Veränderungstheorien
4.4.4
Differenzierbarkeit zwischen Eigenübertragung und Gegenübertragung
4.5
Beendigung der Therapie
5
Ergebnisse der Psychotherapieforschung
5.1
Übertragungsdeutungen
5.2
Einbezug der Gegenübertragung
5.3
Evidenz zur Übertragungsfokussierten Psychotherapie
6
Anwendungsbeispiel
6.1
Vorstellungsanlass und Symptomatik
6.2
Biografie
6.3
Diagnostik: Beziehungsdynamische Formulierung
6.4
Indikationsstellung für eine Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung
6.5
Therapieprozess I: Kurzzeittherapie zur Stabilisierung
6.6
Therapieprozess II: Durcharbeiten verinnerlichter Beziehungsmuster in einer Langzeittherapie
6.7
Therapieprozess III: Das Vorgehen in einer CBASP-Behandlung
6.7.1
Spezifische diagnostische Informationen
6.7.2
Liste der prägenden Bezugspersonen und Formulierung von Übertragungshypothesen
6.7.3
Interpersonelle Diskriminationsübung
6.7.4
Kontingente persönliche Reaktion
6.8
Fazit
Literatur
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Das ZBKT-Schema
Abbildung 2: Beispiel für ein zyklisch-maladaptives Muster
Abbildung 3: Schema der Beziehungsachse der OPD (in Anlehnung an Arbeitskreis OPD, 2024)
Abbildung 4: Auswertungsblatt Fallbeispiel (Arbeitskreis OPD, 2024, S. 102)
Abbildung 5: Leitende Themen des Beziehungserlebens bei Frau Bergner
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Überblick über dominante Übertragungen und Gegenübertragungen bei unterschiedlichen psychischen Störungen
Tabelle 2: Vier Formen der Gegenübertragung (nach Barreto & Matos, 2024)
Tabelle 3: ZBKT-Cluster (erstellt in Anlehnung an Körner et al., 2002)
Tabelle 4: Ausgewählte Items der Beziehungsitems-Checkliste (aus Arbeitskreis OPD, 2024, S. 318ff.)
Tabelle 5: Leitende therapeutische Aufgaben bei der Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung bei ausgewählten psychischen Störungen
Tabelle 6: Beispiele für Übertragungshypothesen in den vier Übertragungsbereichen
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
91 Einführung
Der Band verfolgt das Ziel, den Nutzen einer Arbeit mit denjenigen Mustern des Beziehungserlebens aufzuzeigen, die sich in der therapeutischen Beziehung zeigen. Dabei wird davon ausgegangen, dass es sich um Aktualisierungen internalisierter Muster handelt. Ihre Betrachtung in der therapeutischen Beziehung liefert die Möglichkeit, diese Muster zu reflektieren und zu verändern.
Allerdings soll nicht nur der Nutzen aufgezeigt werden, sondern es sollen auch konkrete Schritte benannt werden,
wie die Reflexion der Beziehungsmuster geschehen kann,
bei welchen Patient:innen sie erforderlich ist und bei welchen sie eine nebengeordnete Rolle spielt und
welche Evidenz es bislang für diese Art der Arbeit in der Psychotherapie gibt.
Wie noch genauer auszuführen ist, kann man die Beziehung zwischen Therapeut:in und Patient:in in der (ambulanten) Psychotherapie auf drei Ebenen betrachten (z. B. Gelso, 2014): Auf der Ebene der realen Beziehung, der Ebene der Arbeitsbeziehung und der Ebene der Übertragungs-Gegenübertragungs-Beziehung. Diese Unterscheidung ist wichtig: Nicht alles, was sich in der Therapiebeziehung zeigt, ist eine Wiederholung verinnerlichter Muster. Allerdings kann sich die Betrachtung von und die Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung lohnen, um insbesondere die noch nicht erkannten oder noch nicht verbalisierten Aspekte des Beziehungserlebens einzubeziehen.
Merke
In einer Betrachtung der therapeutischen Beziehung können drei Ebenen unterschieden werden: die reale Beziehung, die Arbeitsbeziehung und die Übertragungs-Gegenübertragungs-Beziehung.
Mit den Begriffen Übertragung und Gegenübertragung sind Konzepte berührt, die ihren Ursprung in der psychoanalytischen Theorie haben. Zwei Arbeitsdefinitionen können für die weitere Darstellung herangezogen werden:
Unter Übertragung versteht man die (vor allem) unbewusste Wiederholung internalisierter Beziehungsmuster in aktuellen Interaktionen mit anderen. In einer Psychotherapie kann dies gesondert betrachtet und vertieft werden.
10Unter Gegenübertragung versteht man die „Antwort“ (in Gefühlen, Vorstellungen, Fantasien) des Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin auf die Übertragungsprozesse des Patienten oder der Patientin. Davon konzeptuell zu unterscheiden ist die Eigenübertragung – damit sind eigene Übertragungsprozesse auf Therapeut:innen-Seite gemeint, die weitgehend unabhängig von dem Patienten oder der Patientin auftreten (siehe auch Berger et al., 2024).
Merke
Unter Übertragung versteht man die unbewusste Wiederholung verinnerlichter Beziehungsmuster. Die „Antwort“ darauf auf Therapeut:innen-Seite in einer Psychotherapie bezeichnet man als Gegenübertragung.
Prozesse von Übertragung und Gegenübertragung können zentrale Elemente in der psychotherapeutischen Arbeit darstellen, da die Frage, wie jemand sich in Beziehungen zu anderen erlebt, was er dabei fühlt und was er von anderen erwartet, eine große Rolle für die psychische Gesundheit und für das Auftreten psychischer Störungen spielen kann. Auch für therapeutische Prozesse konnte mittlerweile deutlich gezeigt werden, dass die bereits von Strotzka (1975) in einer bis heute oft herangezogenen Definition von Psychotherapie formulierte Annahme, für psychotherapeutische Veränderung sei „in der Regel eine tragfähige emotionale Beziehung“ nötig, einen entscheidenden Teil der Psychotherapie ausmacht. Dabei legt die Betrachtung einer förderlich gestalteten therapeutischen Beziehung konkret im klinischen Geschehen auch die Berücksichtigung der internalisierten Beziehungsmuster nahe.
Allerdings ist zu beachten, dass Prozesse von Übertragung und Gegenübertragung von unterschiedlich starkem Gewicht sind, nämlich in Abhängigkeit
vom Störungsbild,
von den Behandlungszielen und
von der spezifischen Indikation und Behandlungsmotivation.
Diese Ebenen sowie die Frage der behandlungstechnischen Einbettung der Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung gilt es im Weiteren genauer zu betrachten.
1.1 Zur Konzeptgeschichte von Übertragung und Gegenübertragung
An dieser Stelle soll ein knapper Überblick über die Geschichte des Konzepts von Übertragung und Gegenübertragung gegeben werden, der helfen soll, einige allgemeine Linien der möglichen Betrachtung zu unterstreichen (für eine ausführliche Darstellung siehe z. B. Gödde, 2016; Storck, 2020b; Parth et al., 2017).
11Freud entwickelte das Konzept der Übertragung in der Psychoanalyse in Auseinandersetzung mit seiner Traumtheorie (Freud, 1900, v. a. S. 568) sowie mit den Erfahrungen in Behandlungen. Dabei ist für ihn die Idee einer „Anheftung“ zentral: Was dem bewussten Erleben nicht zugänglich werden „darf“, weil es unangenehme Affekte hervorrufen würde, heftet sich an „harmlosere“ Vorstellungen an, sodass es über diesen Umweg, allerdings in „entstellter“ Form, doch bewusst werden kann. Diese „Anheftung“ von unbewussten Aspekten des Erlebens an bewusstseinsfähige Vorstellungen nennt Freud „Übertragung“.
Beispiel
So ist es beispielsweise für jemanden unerträglich, sich starken Ärger auf eine geliebte Person einzugestehen (z. B. den Vater), mit der Folge, dass dieser Ärger nicht bewusst erlebt werden kann. Da damit der Ärger aus der psychischen Welt nicht verschwunden ist, taucht er an anderer Stelle wieder auf, etwa in Form einer Übertragung auf eine andere Person (z. B. den Chef), wo er im subjektiven Erleben als weniger problematisch empfunden wird (z. B. weniger Schuldgefühle hervorruft).
Dies bezieht Freud (z. B. 1905) dann konkret auf das Beziehungsgeschehen in psychoanalytischen Behandlungen. Es komme dort „regelmäßig“ zur Übertragung von Vorstellungen, Affekten, Fantasien u. a. (heute würden wir zusammenfassend sagen: von internalisierten und dann generalisierten Beziehungsmustern) auf den Therapeuten oder die Therapeutin. So komme es zu „Neuauflagen, Nachbildungen“ (Freud, 1905, S. 279) von Beziehungen zu den frühen Bezugspersonen.
Freud erkennt zunehmend, dass die Übertragung nicht allein „das größte Hindernis“ für Behandlungen ist (eine Annahme, die er macht, weil die Arbeit dadurch komplizierter werde, dass sich heftige Gefühle auf den Behandler richten), sondern zugleich das „mächtigste[.] Hilfsmittel“ (Freud, 1905, S. 281). Denn auf diese Weise kann sich etwas in der Therapiebeziehung zeigen, das nicht verbalisiert werden kann, im Erleben von Patient:innen gleichwohl oft eine wichtige Rolle spielt. Dass dies in der Therapiebeziehung besonders deutlich wird, hat mit dem besonderen Setting einer Therapie zu tun: Hier kann gewissermaßen unter einem Brennglas betrachtet werden, was sich für einen Patienten oder eine Patientin auch in anderen Beziehungen zeigt, nämlich eine Aktualisierung internalisierter und generalisierter Beziehungsmuster. Die Therapiebeziehung ist dabei eine Art Spezialfall dessen, wie verinnerlichte Beziehungserfahrungen das aktuelle Erleben leiten – da dies in vielen Fällen gerade die „problematischen“, also mit unangenehmen Affekten oder negativen Erwartungen verbundenen Aspekte des Erlebens sind, wird der Vorgang einer Übertragung ein relevantes Feld für Psychotherapie.
Konzeptionen generalisierter Beziehungsmuster haben ferner eine Verbindung zum Konzept der Bindungsrepräsentation bzw. dem Bindungsstatus. Auch die Bin12dungsrepräsentation (sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent, desorganisiert) kann mit dem in Verbindung stehen, was sich in der therapeutischen Beziehung als eine Art von Aktualisierung zeigt und verändert werden kann (z. B. Tmej et al., 2018). Da sich die überwiegende Zahl der theoretischen und empirischen Arbeiten zur Übertragung aber nicht dezidiert auf das Konzept der Bindungsrepräsentation bezieht, wird es hier nur am Rand erwähnt.
Ebenso wie der Nutzen von Übertragungsprozessen in der Konzeptgeschichte erst erkannt werden musste, gilt dies auch für die Gegenübertragung. Gefühle und Fantasien aufseiten der Behandelnden (in der Frühzeit der Psychoanalyse meist Männer) gegenüber ihren Patient:innen galten als Störfaktor, der niederzuhalten wäre – im Gegensatz zu einer nüchtern-chirurgischen Betrachtung psychischer Probleme (z. B. Freud, 1910, S. 56 f.). Unter anderem die Betrachtung einiger ethischer Entgleisungen, unter denen C. G. Jungs sexuelle Beziehung zu seiner Patientin Sabina Spielrein die bekannteste ist, führte dazu, dass erst Schritt für Schritt Standards für die professionelle Selbsterfahrung angehender Psychoanalytiker:innen sowie andere ethische Richtlinien ausformuliert wurden.
Die 1950er Jahre sind besonders relevant für die Konzeptualisierung der Gegenübertragung und der Arbeit als behandlungstechnisches Vorgehen. Vor allem Arbeiten der deutsch-britischen Analytikerin Paula Heimann (1950/1996) sind hier maßgebend dafür anzunehmen, dass die Reflexion eigener Gefühle und Fantasien aufseiten der Psychotherapeut:in, verstanden als eine Antwort auf die Übertragung, einen Zugang liefert und eine wichtige Grundlage für ein nicht abstrakt bleibendes Verstehen des Erlebens von Patient:innen darstellt.
Merke
Das Auftreten von Gegenübertragungen wird als eine Zugangsmöglichkeit zum Erleben und Gestalten von Beziehungen aufseiten von Patient:innen verstanden.
Joseph spricht ferner von der „Übertragung als Gesamtsituation“ (Klein, 1952, S. 437; Joseph, 1985): Unterschiedliche Aspekte einer (analytisch-)therapeutischen Stunde können darauf befragt werden, was darin aus verinnerlichten Beziehungsmustern wiederkehrt – selbst noch der Bericht eines Traum, in dem „die Landschaft abgestorben oder verödet war, es gab da kein Leben, nichts Grünes …“ kann danach auch Ausdruck dafür sein, wie „lebendig“ jemand Beziehungen zu anderen erlebt oder wie hoffnungslos es sich anfühlen kann, in keinen fruchtbaren Kontakt zu kommen.
Einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Konzepte von Übertragung und Gegenübertragung stellen Arbeiten dazu dar, dass Übertragungsprozesse innerhalb einer Behandlung wechselhaft sein oder „fragmentiert“ nur einige Aspekte des Erlebens der Beziehung zu anderen zeigen können. Im Freud’schen 13Denken wirken Übertragungsprozesse noch deutlich „geordneter“: Eine Beziehung ersetzt eine andere. Insbesondere bei schwereren psychischen Erkrankungen, z. B. psychotischen Störungen oder Persönlichkeitsstörungen, zeigt sich aber ein viel instabileres Bild der Übertragung. Bei Psychosen ist das Beziehungserleben „flüchtig“, eine stabile Wiederholung bestimmter Erfahrungen oder Erwartungen wird z. B. aufgrund der instabilen Ich-Grenzen kaum möglich (Storck & Stegemann, 2021). Bei Persönlichkeitsstörungen kommt es oft zu den z. B. von Kernberg (z. B. 1978/1995) beschriebenen Übertragungen von Teil-Objekt-Vorstellungen. Darauf wird noch in Kapitel 4.3.1 eingegangen.
Merke
Bei schweren psychischen Störungen sind Übertragungen häufig wechselhaft und/oder treten in fragmentierter Form auf. Stabile Muster sind seltener zu finden.
In jüngster Zeit setzen sich konzeptuelle Überlegungen zu Übertragung und Gegenübertragung zum einen fort in der Annahme einer Ko-Kreation, also der gemeinsam gestalteten Beziehung in der Psychotherapie. Hier spielt insbesondere die Arbeit mit Brüchen in der Arbeitsbeziehung und mit Krisen eine wichtige Rolle (Safran & Muran, 2000). Wie noch zu zeigen sein wird, geht es immer um das Verhältnis zwischen Arbeitsbeziehung, realer Beziehung und Übertragungs-Gegenübertragungs-Prozessen. Beim Arbeiten mit Beziehungskrisen in der Therapie geht es gerade nicht darum, einzig der Übertragung das Auftreten von Affekten in der Behandlungsbeziehung zuzuschreiben, sondern für das gemeinsam im Moment oder Prozess der Therapiestunde Gestaltete Verantwortung zu übernehmen.
Merke
Die Betrachtung von Krisen und Brüchen in der therapeutischen Beziehung und der Umgang damit kann als eine schulenübergreifende Kompetenz aufgefasst werden, in die auch die Konzeption von Übertragung und Gegenübertragung eingehen kann.
Ferner finden sich Überlegungen zur Gegenübertragung oder zum emotionalen Erleben auf Therapeut:innen-Seite in der Betrachtung der Rolle von Selbstenthüllungen und „immediacy“ (also der unmittelbaren Antwort) in einer Psychotherapie (ein Überblick findet sich bei Hill et al., 2019; Farber et al., 2023). Hier wird untersucht, welche Art des Zur-Verfügung-Stellens des eigenen Erlebens durch den Psychotherapeuten oder die Psychotherapeutin für den Therapieerfolg nützlich ist.
Aus der Konzeptgeschichte lassen sich zwei Perspektiven für die zeitgenössische Psychotherapie benennen:
14Die Betrachtung von Übertragung und Gegenübertragung muss nicht auf die analytisch begründeten Verfahren beschränkt bleiben.
In der Betrachtung dessen, was sich in der therapeutischen Beziehung zeigt, gibt es unterschiedliche Gewichtungen des Verhältnisses aus „realer“ Beziehung, Arbeitsbeziehung und Übertragungs-Gegenübertragungs-Dynamiken.
1.2 Therapiemethoden jenseits der Verfahrensgrenzen
Die Konzepte Übertragung und Gegenübertragung sind in der psychoanalytischen Theorie verwurzelt (Gabbard, 2001, 2006). Sie stehen mit anderen Konzepten im Zusammenhang, so etwa: dynamisch Unbewusstes, Objektrepräsentanz, psychischer Konflikt, Abwehr u. a. (ein Überblick findet sich bei Storck, 2018). In diesem Band geht es darum, wie der Grundgedanke einer Aktualisierung verinnerlichter Beziehungserfahrungen in der therapeutischen Situation genutzt werden kann, um besser einzuordnen, was in einer Psychotherapie passiert, und dies für erfolgreiche Behandlungsprozesse zu nutzen. Eine detaillierte Rekonstruktion der Konzepte ist dagegen nicht das Ziel der vorliegenden Auseinandersetzung; trotzdem wird es an einigen Stellen Berührungspunkte zu anderen psychoanalytischen Konzepten, aber auch zu Überlegungen anderer therapeutischer Richtungen geben.
Damit ist eine weitere wichtige Frage berührt, zu der hier eine Positionierung erforderlich ist, nämlich die Frage der Verfahrensorientierung. Theorien der Psychotherapie setzen sich aus unterschiedlichen Bestandteilen zusammen, in der Regel sind das:
eine (allgemeine und spezielle) Störungstheorie,
eine Veränderungstheorie und
eine Zusammenstellung der Forschungsbefunde.
Zugleich kann man eines feststellen: Psychische Störungen und damit einhergehende klinische Phänomene im Behandlungszimmer sind nicht „verfahrensspezifisch“. Patient:innen suchen eine Psychotherapie auf, weil sie an etwas leiden, und meist nur zweitrangig (wenn überhaupt), weil sie sich für psychotherapeutische Richtungen interessieren. Es lohnt sich also, darauf zu blicken, welches Verständnis und welchen behandlungstechnischen Umgang man in der Psychotherapie damit finden kann. Darin folgt die Darstellung im Buch der Kompetenzorientierung in der Psychotherapie. Hier ist entscheidend, was im klinischen Handeln erforderlich ist, um erfolgreiche Psychotherapien durchzuführen. Ausgehend von der als spezifische psychodynamische Kompetenz beschriebenen Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung (vgl. CORE-Kriterien; Lemma et al., 2008) kann diskutiert werden, wie sich Modelle und Methoden schulenübergreifend formulieren lassen.
15Fiedler (2018) legt einen vergleichenden Überblick über die Bedeutung der therapeutischen Beziehung in unterschiedlichen Verfahren vor. Breuer-Radbruch und Pilz (2017) diskutieren denselben Behandlungsfall unter psychodynamischer und kognitiv-behavioraler Perspektive unter besonderer Betrachtung von Übertragung und Gegenübertragung. Kiesler (2001) erkundet die Gegenübertragung im Verfahrensvergleich, Cartwright (2011) diskutiert die Bedeutung von Übertragung und Gegenübertragung in der Verhaltenstherapie und auch Gelso und Bhatia (2012) sprechen sich diesbezüglich für ein „crossing theoretical lines“ aus.
Im Mittelpunkt dieses Buches stehen folgende Fragen:
Was kennzeichnet das Arbeiten mit Übertragung und Gegenübertragung in der Psychotherapie?
Welches sind spezifische Indikatoren, die anzeigen, wann die Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung nützlich (oder gar erforderlich) ist?
Welche klinischen Entscheidungsprozesse lassen sich identifizieren?
Kapitel 2 gibt zunächst einen Überblick über die Theorie von Übertragung und Gegenübertragung. Dabei wird es um die Rolle von Beziehungserfahrungen und deren Verinnerlichung gehen sowie darum, welche Zusammenhänge es unter dieser Perspektive zu psychischer Gesundheit und Krankheit gibt. Am Ende des Kapitels wird die These vertreten, dass sich die Therapiebeziehung als Ort der Reflexion und der Veränderung internalisierter Beziehungsmuster auffassen lässt.
Im sich daran anschließenden Kapitel 3 geht es zunächst um die Frage, wann die Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung indiziert ist, und weiterhin um diagnostische Instrumente, die eine genaue Erfassung internalisierter Beziehungsmuster erlauben und so der Behandlungsplanung zugutekommen.
In Kapitel 4 geht es um die Behandlungsdurchführung und Interventionen. Es wird gezeigt, auf welchen klinischen Entscheidungsprozessen das Vorgehen beruht, wobei zwischen der Ebene des therapeutischen Beziehungsangebots, der Ebene des Konzeptualisierens und der Ebene der Intervention unterschieden wird. Außerdem wird das behandlungstechnische Vorgehen bei unterschiedlichen Störungen, bei unterschiedlichen Altersgruppen und in unterschiedlichen therapeutischen Settings vergleichend dargestellt. Es wird auf Manualisierungen sowie die mögliche Verknüpfung mit verschiedenen therapeutischen Ansätzen eingegangen. Abschließend werden mögliche Schwierigkeiten erörtert.
Kapitel 5 referiert Befunde zur empirischen Evidenz, bevor abschließend in Kapitel 6 ein ausführliches Anwendungsbeispiel beschrieben wird.
162 Theoretischer Bezugsrahmen
Mittlerweile kann es als Konsens angesehen werden, dass die therapeutische Beziehung und ihre Gestaltung im Behandlungsprozess als ein wichtiges Element erfolgreicher Psychotherapien gilt. Neben vielen Einflussfaktoren aus der Geschichte der Psychotherapie kann man hier den Stellenwert nennen, den die Beziehung im kontextuellen Modell der Psychotherapie erhält (Wampold et al., 2018), oder auf die Ergebnisse zur Wirksamkeit der „faciliative interpersonal skills“ hinweisen (Anderson et al., 2009). Eine zusammenfassende Darstellung der verschiedenen Aspekte einer hilfreichen Therapiebeziehung findet sich bei Norcross und Lambert (2019) sowie Norcross und Wampold (2019).
2.1 Die drei Ebenen der Beziehung in der Psychotherapie
Auf einer konzeptuellen Ebene werden, wie bereits erwähnt, drei Ebenen der Beziehung zwischen Therapeut:in und Patient:in unterschieden (Gelso & Hayes, 1998):
die „reale“ (oder „echte“) Beziehung (z. B. Gelso, 2014),
die Arbeitsbeziehung (Flückiger et al., 2018),
die Übertragungs-Gegenübertragungs-Beziehung.
Die reale Beziehung. Erstens geht es darum, dass zwei Menschen einander begegnen: samt ihrem Erscheinungsbild, ihren soziodemografischen Merkmalen und ihrer individuellen Eigenschaften (einschließlich der „Tagesform“ usw.). So hat es vermutlich oftmals einen Einfluss, ob ein Therapeut 30 Jahre oder 70 Jahre alt ist, ob eine Patientin von Beruf Künstlerin ist oder beide Beteiligten nicht Deutsch als ihre Muttersprache haben. Die psychotherapeutische Beziehung hat viel mit „Passung“ zu tun, also damit, wie beide Beteiligten sich aufeinander „einschwingen“ können oder eben nicht. Auf dieser Ebene der Beziehung geht es darum, einander wertschätzend, freundlich und authentisch zu begegnen. Es sollte nicht außen vor gelassen werden, dass Psychotherapie immer auch in der Erfahrung der Beziehung besteht, wie sie zwischen genau diesen beiden Menschen ist.
17Die Arbeitsbeziehung. Zweitens geht es darum, dass sich hier zwei Menschen in einer bestimmten Rollenzuweisung und mit einem bestimmten Auftrag begegnen. Wenn auch die Beziehung „auf Augenhöhe“ (statt bevormundend o. Ä.) stattfindet, ist sie doch nicht symmetrisch. Vielmehr kommt ein Patient oder eine Patientin mit einem psychischen Leiden zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin, der oder die professionell dazu befähigt ist, durch den Einsatz geeigneter Methoden und Techniken etwas am Leiden zu mindern. Auf der Ebene der Arbeitsbeziehung (oder des Arbeitsbündnisses) ist also von Bedeutung, dass man sich gemeinsam über den therapeutischen Auftrag, die konkreten Behandlungsziele und den Weg dorthin verständigt.