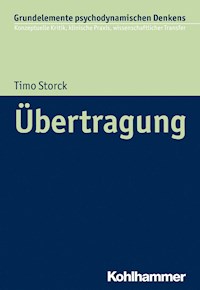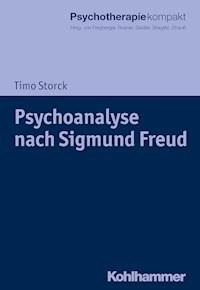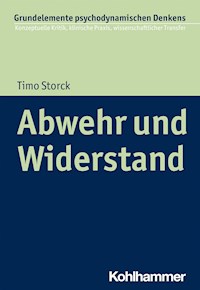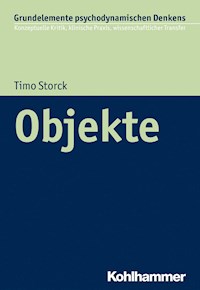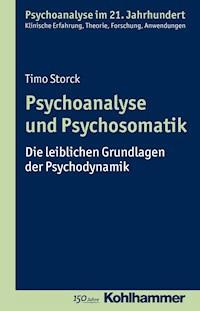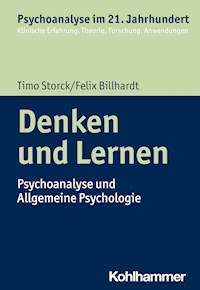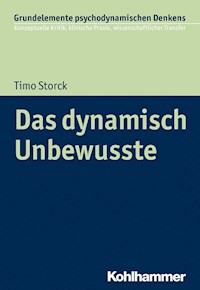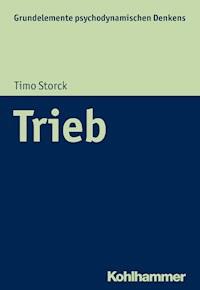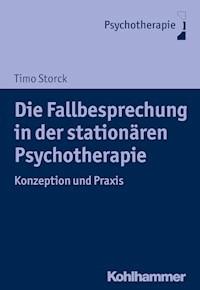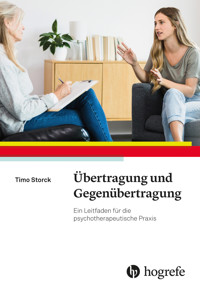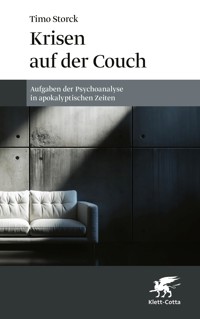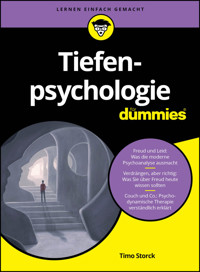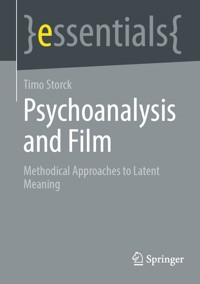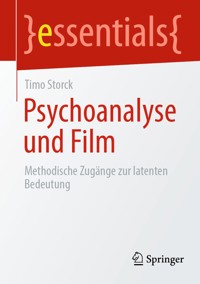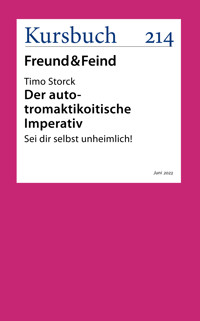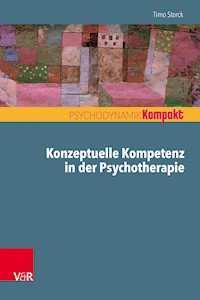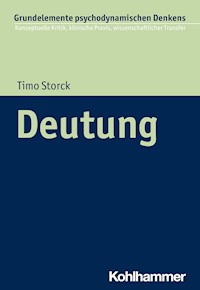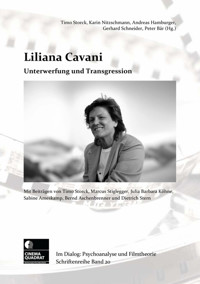
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der 20. Band der Buchreihe "Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie" widmet sich dem Werk von Liliana Cavani. Die Beiträge aus dem 21. Mannheimer Filmseminar, verfasst von Filmwissenschaftlern, Psychoanalytikern und Psychotherapeuten, untersuchen ihre filmischen Erkundungen von Religion, (Post-) Faschismus, Gewalt, Sexualität und Moral. In jedem Beitrag wird ein Film näher beleuchtet, darunter Der Nachtportier, Jenseits von Gut und Böse und Die Haut. Die Analysen untersuchen Cavanis emotional und ästhetisch kraftvolle Filmsprache und decken die komplexen psychologischen und gesellschaftlichen Dynamiken auf, die ihre ambivalenten Figuren und theatralisch stilisierten Szenen kommunizieren. Liliana Cavani – Unterwerfung und Transgression bietet wertvolle Einblicke für Filmwissenschaftler, Psychoanalytiker und Cineasten, die die tiefgehenden Verbindungen zwischen Cavanis Filmen und psychoanalytischem Denken erforschen möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Schriftenreihe Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie basiert auf den gleichnamigen Mannheimer Filmseminaren im Cinema Quadrat. PsychoanalytikerInnen und FilmwissenschaftlerInnen widmen sich in den Bänden jeweils einem herausragenden Regisseur und beleuchten die Themen, Motive und Strukturen der Filme und des Gesamtwerks unter der Oberfläche der filmischen Erzählungen.
Bisher in der Reihe erschienen:
Band 1 Peter Bär, Gerhard Schneider (Hg.): Alfred Hitchcock. 2003.
Band 2 Gerhard Schneider, Peter Bär (Hg.): Roman Polanski. 2004.
Band 3 Peter Bär, Gerhard Schneider (Hg.): Luis Bunuel. 2005.
Band 4 Gerhard Schneider, Peter Bär (Hg.): Ingmar Bergman. 2006.
Band 5 Peter Bär, Gerhard Schneider (Hg.): Pedro Almodóvar. 2007.
Band 6 Gerhard Schneider, Peter Bär (Hg.): David Lynch. 2009.
Band 7 Peter Bär, Gerhard Schneider (Hg.): Michelangelo Antonioni. 2011.
Die Bände 3 bis 7 sind über die Webseite www.cinema-quadrat.de und über den Bücherdienst psychosozial (www.psychosozial-verlag.de) erhältlich.
Die folgenden Bände bzw. Neuauflagen sind im Psychosozial-Verlag erschienen:
Band 1 Peter Bär, Gerhard Schneider (Hg.): Alfred Hitchcock. 2003 [Neuauflage 2018].
Band 2 Gerhard Schneider, Peter Bär (Hg.): Roman Polanski. 2004 [Neuauflage 2018].
Band 8 Gerhard Schneider, Peter Bär (Hg.): Pier Paolo Pasolini. 2012.
Band 9 Peter Bär, Gerhard Schneider (Hg.): Darren Aronofsky. 2012.
Band 10 Gerhard Schneider, Peter Bär (Hg.): David Cronenberg. 2013.
Band 11 Peter Bär, Gerhard Schneider (Hg.): Die Coen-Brüder. 2014.
Band 12 Gerhard Schneider, Peter Bär (Hg.): Michael Haneke. 2016.
Band 13 Peter Bär, Gerhard Schneider (Hg.): Martin Scorsese. 2017.
Band 14 Gerhard Schneider, Peter Bär, Andreas Hamburger, Karin Nitzschmann, Timo Storck (Hg.): Akira Kurosawa. 2018.
Band 15 Timo Storck, Andreas Hamburger, Karin Nitzschmann, Gerhard Schneider, Peter Bär (Hg.): François Ozon. 2019.
Band 16 Karin Nitzschmann, Andreas Hamburger, Gerhard Schneider, Peter Bär, Timo Storck (Hg.): Sofia Coppola. 2019.
Band 17Andreas Hamburger, Gerhard Schneider, Peter Bär, Timo Storck, Karin Nitzschmann (Hg.): Jean-Luc Godard. 2020.
Band 18Gerhard Schneider, Peter Bär, Timo Storck, Karin Nitzschmann, Andreas Hamburger (Hg.): Claire Denis. 2023.
Die folgenden Bände sind bei Cinema Quadrat, Mannheim erschienen:
Band 19Peter Bär, Timo Storck, Karin Nitzschmann, Andreas Hamburger, Gerhard Schneider (Hg.): Federico Fellini. 2024.
Organisation und Gestaltung ab Band 19: Friederike Bassenge
Band 20
Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie
Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie
Schriftenreihe Band 20
Timo Storck, Karin Nitzschmann, Andreas Hamburger,Gerhard Schneider, Peter Bär (Hg.)
Liliana Cavani
Unterwerfung und Transgression
Beiträgeaus dem20.MannheimerFilmseminar
12.- 14.Januar 2024
imCinemaQuadrat,Mannheim
Herausgeber:
Cinema Quadrat e. V., Mannheim
Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie Heidelberg-Mannheim
Psychoanalytisches Institut Heidelberg-Karlsruhe der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung
Heidelberger Institut für Tiefenpsychologie
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Originalausgabe
© 2024 Cinema Quadrat, Mannheims kommunales Kino, K1, 2, 68159 Mannheim
www.cinema-quadrat.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlagabbildungen:
8 mm Kodak film reel (Coyau, 2013). Bildquelle: Coyau, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/8_mm_Kodak_safety_film_reel_06.jpg
Liliana Cavani (Gorup de Besanez, 1993). Bildquelle: Gorup de Besanez, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PERX0146_04.jpg
Umschlagabbildungen transformiert durch Friederike Bassenge.
Umschlaggestaltung und Innenlayout nach Entwürfen von Friederike Bassenge.
ISBN 978-3-384-37365-6 (Print)
ISBN 978-3-384-37366-3 (E-Book)
Inhalt
Die Dokumentation der Triebschicksale als Leitthema in den Filmen Liliana CavanisTimo Storck7
Visionäre im Abseits der GesellschaftDas Kino von Liliana CavaniMarcus Stiglegger13
Sexuelle Gewalt, psychisches Trauma und masochistische Spiele in Cavanis Il portiere di notte(IT 1974)Julia Barbara Köhne35
Das relative und das absolute JenseitsÜberschreitung und Nachlass in Liliana Cavanis Jenseits von Gut und Böse (1977)Timo Storck61
Körperliche KriegsschauplätzeDerangierte Fleischlichkeit und Kritik an Gewaltpolitiken in Liliana Cavanis La pelle (IT/F 1981)Julia Barbara Köhne73
Obsessive Liebe in Zeiten des nationalsozialistischen FührerkultesZum Film Interior Berlinese [Leidenschaften] von Liliana Cavani (1985)Sabine Ameskamp105
»I’m a Creation.«Zum Medienwechsel der Moral in Ripley’s GameBernd Aschenbrenner119
Die substanzielle Bedeutung von Musik in einigen Filmen Liliana CavanisDietrich Stern133
Die Dokumentation der Triebschicksale als Leitthema in den Filmen Liliana Cavanis
Einleitung und Überblick
Timo Storck
Man kann Liliana Cavani, geboren 1933 in Carpi, über ihr filmisches Werk hinweg als eine Dokumentarfilmerin bezeichnen. Doch auch wenn ihr beruflicher Werdegang von genau dieser Tätigkeit ihren Ausgang nimmt, so ist es zur Begründung dieser Aussage doch erforderlich zu klären, was genau sie in ihren Spielfilmen dokumentiert und wie sie es tut.
In den Filmen Cavanis fällt ins Auge (eine Metapher, die durchaus treffend ist für ihren filmischen Stil!), dass sie sich immer wieder bei historischen Stoffen bedient, auch in der Bezugnahme auf geschichtliche Figuren, von Franz von Assisi bis Friedrich Nietzsche. Es geht um Vorlagen aus Drama (Sophokles‘ Antigone), philosophischer Abhandlung (Nietzsches Jenseits von Gut und Böse) oder Roman (Highsmiths Ripley’s Game), aber immer wieder geht es auch um den Faschismus in Deutschland oder Italien oder um religiöse Figuren.
In gewissem Sinn dokumentiert Cavani also, sie macht filmisch auf etwas aufmerksam, das von klarer, oft überwältigender Realität ist. Dabei ist ein wiederkehrendes Thema die Untersuchung derjenigen Gewalt der Gesellschaft, auch der Gewalt der Moral, die auf ihre Figuren wirkt. Doch sie dokumentiert nicht im Sinne eines genauen, objektiven Quellenstudiums, sondern sie dokumentiert das Triebhafte, die Triebschicksale, im Lichte geschichtlicher Ereignisse und Prozesse und deren Wirkungen auf ihre Figuren. Was fordert die herkömmliche Moral, welche Überschreitungen werden zugleich provoziert? Wie ist eine Auflehnung unter Bedingungen möglich, die ein Individuum oder ein Kollektiv auf überwältigende Weise ohnmächtig machen?
Das Triebhafte ist bei Cavani dabei, ganz psychoanalytisch, eine zweischneidige Angelegenheit. Es ist nicht einfach nur das, was der Moral entgegensteht und befreit gehört. Vielmehr ist das Triebhafte zwar geprägt vom Freiheitlichen einer Gegenmoral oder eines Außermoralischen, aber zugleich Quelle von Gewalt und Destruktivität. Auch die ›Rollen‹ in der psychischen Ökonomie werden immer wieder umgekehrt: Wird dem Triebhaften Gewalt angetan oder ist es das Triebhafte selbst, das gewaltvoll ist? Ist Moral gewaltvoll oder der Gegenstand von Attacken?
Cavani dokumentiert, indem sie etwas hinzufügt: Stilisierung, Subjektivierung und nicht zuletzt Erotisierung, immer in der Verwobenheit von Macht und Ohnmacht, ausgeübter und erlittener Gewalt, lustvollem Begehren und Vernichtung. Manche Kritik hat übersehen, dass es Cavani nicht darum geht, Historiendramen zu erzählen. So zielt es beispielsweise am Kern von Der Nachtportier, ihrem Hauptwerk von 1974, vorbei, auf die Inakkuratheit eines burlesken Spiels mit Verführung und Vernichtung in Nazi-Konzentrationslagern hinzuweisen. Cavani will nicht historisch dokumentieren, sie will Triebschicksale dokumentieren – ohne sich dabei bloß in Innerlichkeiten zu verlieren. Die moralischen Selbstpositionierungen der Figuren, die in ihren Filmen immer wieder zum Thema werden, fungieren als Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft.
Dabei sind es die Felder Religion und (Post-) Faschismus, denen sich Cavani wiederholt widmet und den Zuschauerinnen und Zuschauern dabei ihre filmisch-dokumentarischen Visionen auch insofern ›zumutet‹, als jenen die Einordnungen selbst überlassen werden. In den Filmen selbst finden sich ambivalent gezeichnete Figuren ›jenseits von Gut und Böse‹, stilisierte Szenen (in Schauspiel oder Ballett), die dadurch ihre Eindeutigkeit verlieren, jedoch bei weitem nicht ihre emotionale oder ästhetische Wucht.
Und noch mehr: Die Grenzüberschreitungen (von Gewalt, Sexualität, Moral) werden nicht in einem späteren Schritt wieder eingefangen und in eine ›geradegerückte‹ Moral eingeordnet, sondern bleiben ›auf der anderen Seite‹ oder eben, wie Stiglegger schreibt, im Abseits, ohne aus diesem wieder herauszutreten.
Übersicht über die Beiträge
In seiner Einleitung in das Werk Cavanis beschäftigt sich der Filmwissenschaftler Marcus Stiglegger mit übergeordneten Motiven. Zentral ist dabei Cavanis Weg ›aus dem Fernsehen ins Kino‹ und darin von der Auseinandersetzung u.a. mit dem Dritten Reich zu einer nicht nur dokumentarischen, sondern nun auch filmisch-narrativen Erkundung, in der sie in der Regel auf historische, nicht selten religiöse Persönlichkeiten als Figuren in ihren Filmen zurückgreift. Besonders zu nennen ist hier Franz von Assisi, der ein wiederkehrender Protagonist ist.
Stiglegger akzentuiert die »Visionäre im Abseits der Gesellschaft« in Cavanis Werk und damit auch die Gegenkultur und Rebellion, von der Auflehnung der Antigone-Figur in Die Kannibalen bis zu religiösen, politischen oder moralischen Auflehnungen in anderen Filmen. Wie die filmische Kritik immer wieder belegt, ist es auch Cavani selbst, die mit Konventionen bricht und so selbst als Visionärin auftritt.
Die ›Skandale‹ in Cavanis Werk, so Stiglegger am Beispiel von Der Nachtportier, bestehen nicht einfach nur im visuellen oder narrativen Tabubruch allein, sondern auch darin, dass insbesondere sexuelle Obsession oder moralische Grenzüberschreitung unkommentiert dargestellt wird. Es gibt keine Anleitung zur Einordnung des Gesehenen. Cavani wirft Licht auf »Schattenseiten«, etwa indem sie eine sadomasochistische Liebesbeziehung im Kontext eines Konzentrationslagers präsentiert, diese aber nicht bewertet. Dass sich sexuelle Obsessionen mit historischen Themen oder Figuren treffen, ist auch ein wichtiges Element der ›deutschen Trilogie‹. Auch im Hinblick auf Die Haut zeigt Stiglegger Cavanis Auseinandersetzung mit den nicht festgelegten oder eben überschrittenen Grenzen der Moral auf.
Stiglegger beschließt seine Werkschau in der Formulierung von neun zentralen Motiven im Werk Cavanis, darunter »das revoltierende Individuum im Abseits der Gesellschaft« oder »im Kampf mit restriktiven Institutionen«. Dabei spielt ein Blick auf Religion und Spiritualität eine Rolle, ebenso mit »Machtrelationen«, z.B. im (Post-) Faschismus oder in Klassenkonflikten. Dabei dient Gewalt als Kommunikationsform, und Tabubrüche und Immoralität werden, insbesondere bezogen auf Sexualität, sowohl zu erzählerischen Mitteln wie zum Gegenstand der filmischen Erzählung. Ebenfalls benennt Stiglegger zehn filmische Stilmittel, u.a. bezogen auf filmische Perspektive (Untersicht), Farbschemata (erdige Farben) oder das Bildformat selbst.
Die Kultur-, Film- und Medienwissenschaftlerin Julia Köhne widmet sich in einem Beitrag dem Film Der Nachtportier (1974) und nimmt zunächst eine Einordnung des Films im Hinblick auf vergleichbare filmisch-fiktionalisierende Darstellungen der Verbindung von NS-Vernichtungslagern und Sexualität/Erotik vor. In ihrer Interpretation setzt sie dann den Akzent auf die am Horizont auftauchende Frage, ob der Film einen Beitrag zum (nicht-fiktionalisierten) Traumadiskurs liefern kann.
Sie interpretiert die Handlungen und die filmische Darstellung der Protagonistin Lucia konsequent als Traumafolgen, ohne dabei in die Sackgasse zu geraten, die im Film gezeigten Szenen auf ihren Grad an historischem Realismus (Verbindung von Sexualität/Erotik und Gewalt/Vernichtung in KZ) befragen zu müssen. U.a. rekurriert sie dabei auf das Stockholm-Syndrom oder das aus psychoanalytischer Sicht von Sandor Ferenczi oder Anna Freud beschriebene Phänomen einer Identifizierung mit dem Aggressor (nicht zuletzt in Hinblick auf »Cross-Dressing« oder die Verwendung von Nazi-Symbolen), im Versuch, mit dem Ausgeliefertsein an eine absolute Machtposition umgehen zu können.
Im Wien der Erzählzeit des Films, die Szenen im Konzentrationslager werden in Rückblenden erzählt, findet Köhnes Interpretation zufolge eine Wiederholung von Lucias Trauma als wechselweise Rollenumkehr statt, und somit als Versuch eines Durcharbeitens oder zumindest des Entschärfens – ein »Reenactment der traumatisierenden Sex-Gewalt-Szenen«. Und doch, oder gerade deshalb, endet der Film im Tod der beiden Hauptfiguren. Köhnes Fazit lautet, dass der Film die unmittelbaren und dauerhaften Folgen von Extremtraumatisierungen auf Individuen und Kollektive zeigt.
Der Psychoanalytiker Timo Storck diskutiert in seinem Beitrag den Film Jenseits von Gut und Böse (1977). Die Dreiecksbeziehung zwischen Lou Andreas-Salomé, Friedrich (»Fritz«) Nietzsche und Paul Rée dient der Regisseurin seiner Auffassung nach zur Erörterung verschiedener Formen der Überschreitung: im Hinblick auf Moral, sexuelle Identität und Präferenz, Leben und Tod oder Gesundheit und Wahnsinn. Die Suche nach einer anderen Moral oder einem Leben in der Immoralität lässt sich unter der Perspektive eines »relativen Jenseits« und eines »absoluten Jenseits« diskutieren. Insbesondere die beiden zentralen Männerfiguren in Cavanis Film überschreiten zwar Grenzen, bleiben aber insofern einem relativen Jenseits verpflichtet, als es letztlich darin endet, auf der anderen Seite der selben Linie zu stehen: etwa tot statt lebendig zu sein oder wahnsinnig statt geistig gesund. Eine andere Art der Überschreitung ist in einem Weg ins Offene zu sehen, für den Lou steht: Für sie ist, anders als für die beiden Männer, der Weg ins 20. Jahrhundert möglich und damit die Figur eines absoluten Jenseits, das nicht nur das Andere des Diesseits ist. In diesem Sinn wird Lou u.a. zur Nachlassverwalterin von Fritz und, in geringem Umfang, von Paul.
Cavani nutzt dabei identifikatorische Blickpositionen, die den Zuschauer oder die Zuschauerin immer wieder dazu bringen, eine bestimmte Perspektive einnehmen zu müssen (die noch dazu oft in einer Überschreitung konkreter Schwellen oder von Intimität/Sexualität bestehen). Storck liest diese filmische Wirkung als eine stilistische Überschreitung dahingehend, sich mit dem Objekt zu identifizieren, das das Subjekt passiviert.
Julia Köhne betrachtet Cavanis Film Die Haut (1981) in erster Linie unter Gesichtspunkten der Körperlichkeit und Geschlechtlichkeit. Die Verfilmung der Romanvorlage Curzio Malapartes, der auch selbst als filmische Figur auftaucht, thematisiert die Lage in Neapel im Anschluss an die Befreiung durch US-amerikanische Streitkräfte im zweiten Weltkrieg. Diese ›Befreiung‹ wird aber in erster Linie unter dem Gesichtspunkt von Prostitution und Vergewaltigung betrachtet, welche sie mit sich gebracht hat.
Rund um die Haut diskutiert Köhne vor allem das, was die Haut umschließt, die Privatheit, Körperlichkeit und deren Grenzverletzungen visueller und physischer Art. Sexualität wird »derangiert«, Körper werden »demontiert«. Für Köhne ist dabei die von Kristeva entlehnte Figur des Abjektiven zentral. Insbesondere die Schlusszene des Films tritt heraus: Ein Mann gerät unter einen amerikanischen Panzer, von ihm bleibt gleichsam nur die Haut übrig, die in Bezug zur Fahne und damit der Frage nach Nationalismus und dem von der Haut/Fahne umschlossenen politischen Körper gesetzt wird.
Die Psychoanalytikerin Sabine Ameskamp diskutiert Leidenschaften (1985). Sie betrachtet den Film entlang der Linie der beziehungsdynamischen Folgen von Traumatisierungen im Sinne einer Umkehr einer machtlosen in eine Macht ausübenden Position – und dies ›im Kleinen‹ des mikrosozialen Gefüges der drei Protagonist:innen, aber auch ›im Großen‹ einer Thematisierung des Nationalsozialismus bzw. von Machtstrukturen. Ameskamp geht dabei zentral auch auf die Unterschiede zwischen der japanischen Romanvorlage (mit dem Titel Manji, was Swastika bedeutet) aus den späten 1920er Jahren und Cavanis Film ein. Sie arbeitet die von Cavani subtil in Szene gesetzten Machtdynamiken heraus und wie diese im Suizid(versuch) enden. Dieser ist auch als eine Demonstration der durch die Geisha Mitsuko ausgeübten (und genossenen) Macht zu sehen: Noch im vermeintlich von den drei Protagonist:innen geteilten Suizid übt sie die Handlungsmacht aus, die andere Frau nur zu betäuben.
Der Psychotherapeut und Medienwissenschaftler Bernd Aschenbrenner widmet sich in seiner Analyse dem Film Ripley’s Game (2002). Er bezieht sich auf die filmwissenschaftliche Seduktionstheorie Stigleggers im Sinne einer versteckten Verführung zum Medium Film. Auch Aschenbrenner diskutiert die Unterschiede zwischen der Romanvorlage Patricia Highsmiths und Cavanis Verfilmung im Sinne der Bedeutung des Medienwechsels und gelangt auf diesem Weg zur Diskussion eines brüchigen Moralbegriffs. Einmal mehr möchte Cavani, so Aschenbrenners These, Moral erschüttern und hinterfragen, indem sie hier einen Mörder, also jemanden mit fragwürdiger Moral, mit eigenen Vorstellungen eines guten Handelns porträtiert. Dazu rekurriert Aschenbrenner auf Derridas Diskussion der Kafka-Parabel Vor dem Gesetz und argumentiert, dass Highsmiths Roman den Moralbegriff dekonstruiere, indem etwas Monströses gezeigt werde, dass sich nicht in einer herkömmlichen Moral fassen lasse. In Cavanis Film, also in Form des Medienwechsels und unter der Perspektive der Seduktionstheorie, wird ein anderes Ende und, so Aschenbrenner, auch eine andere (moralische?) Gerichtsbarkeit gewählt: Der selbst zum Mörder gewordene Trevanny opfert sich, indem er sich vor Ripley wirft. Für Ripley ist dieser Akt, in der Logik seiner eigenen brüchigen Moral, unverständlich.
Der Musikwissenschaftler Dietrich Stern diskutiert einige Beispiele der Verwendung von Filmmusik durch Liliana Cavani. Dabei spielt beispielsweise der Beitrag von Kompositionen Ennio Morricones eine Rolle, in Galileo, Die Kannibalen oder Ripley’s Game. Morricones Musik wird dabei in ganz unterschiedlichen Kontexten und Funktionen eingesetzt: mal im Zusammenhang klerikaler Gesänge, mal als Rockmusik, mal als klassische Musik mit Cembalo, Streichern oder Bläsern (in Ripley’s Game auch konkret an die Musikalität des Protagonisten geknüpft). Neben Originalkompositionen findet sich bei Cavani aber auch der Einsatz bereits vorgefundener Musik, beispielsweise in Der Nachtportier in Gestalt der Verwendung des von Friedrich Holländer komponierten Liedes Wenn ich mir was wünschen dürfte, oder in Die Haut, wo neapolitanisches Liedgut eine wichtige Rolle spielt. Stern diskutiert jeweils die Wirkungen der Kompositionen auf andere filmische Elemente bzw. deren Wirkung auf die Musik.
Visionäre im Abseits der Gesellschaft
Das Kino von Liliana Cavani
Marcus Stiglegger
Das wilde Kino der 1970er Jahre
Die italienische Filmemacherin Liliana Cavani ist wie keine zweite einem sehr zeitspezifischen Filmdiskurs der frühen 1970er Jahre verbunden. In einer Zeit der gelockerten Zensur, des politischen Aktivismus und der sexuellen Revolution etablierte sich für einige Jahre ein Kino der bewussten Grenzüberschreitungen, ein buchstäblich wildes Kino, das bürgerliche Konventionen aufbrach, Genderdefinitionen prüfte und einen schonungslosen Blick auf die Mechanismen der Gewalt warf. Im italienischen Kino arbeiteten Regisseure wie Pier Paolo Pasolini, Lina Wertmüller, Luchino Visconti und Bernardo Bertolucci an diesem Projekt eines neuen Kinos, das den gesellschaftlichen und historischen Alpträumen des 20. Jahrhunderts Rechnung trug.
Liliana Cavani etablierte sich in diesem Diskurs als mutige ›Skandalregisseurin‹, deren Werke von Beginn an mit der Zensur in Konflikt gerieten. Im Zentrum ihrer Filme stehen Visionäre im Abseits der Gesellschaft, Menschen in der Revolte, um es mit Albert Camus zu formulieren: So interpretiert sie Franziskus, Galileo, Antigone, Nietzsche, Lou Salomé, Curzio Malaparte und viele andere, die man damals mit dem inzwischen unpopulären Begriff des ›Querdenkers‹ bezeichnet hätte. Ihre Perspektiven standen konträr zum Konsens der Gesellschaft und wurden folglich von den Instanzen der Macht unterdrückt: von Kirche, Justiz und Militär. Und es ist offensichtlich, dass sich Cavani bis heute mit dieser Haltung identifiziert.
Der folgende Beitrag betrachtet das umfassende und teilweise schwer verfügbare Gesamtwerk der Regisseurin und basiert auf zahlreichen früheren Studien zu ihrem Werk, die ich seit den 1990er Jahren veröffentlicht habe.
Vom Fernsehen auf die Leinwand
Die Italienerin Liliana Cavani wurde am 12. Januar 1936 nahe Modena / Carpi in der Region Emilia geboren. Nach dem Abitur studierte sie zunächst klassische Literatur an der Universität in Bologna, wo sie bereits ihre Filminteressen im dortigen Filmclub kultivieren konnte. Nach ihrer Promotion, dem Doktortitel in Linguistik, wechselte sie 1960 nach Rom und belegte den Regiekurs der Filmhochschule Centro Sperimentale di Cinematografica. Zwei Kurzfilme waren das fruchtbare Ergebnis ihrer dortigen Arbeit, beide Filme widmeten sich sozialen und interkulturellen Problemen: In Il contro notturno (1961) beschrieb sie die problematische Freundschaft zwischen einem Weißen und einem Afrikaner, in L’evento (1962) geht es um eine Touristengruppe, die »aus Spaß« einen jungen Italiener ermordet. Bald gelang es ihr, mit viel Glück einen Arbeitsplatz bei dem italienischen Fernsehsender RAI zu ergattern, wo sie zwischen 1962 und 1965 einige aufsehenerregende Dokumentationen drehte. Mit einigen Dokumentarfilmen, der monumentalen Storia del Terzo Reich (1963), Le donne della resistenza (1963) und Philippe Pétain – Processo a Vichy (1965), etablierte sie sich als Spezialistin für das Dritte Reich und den Nationalsozialismus. Als erklärte Marxistin blieb sie diesem Themenbereich lange treu. Philippe Pétain erhielt bei den Filmfestspielen in Venedig 1965 die Goldene Palme als beste Fernsehproduktion. In einen nachhaltigen Konflikt geriet sie aber noch im selben Jahr mit der fernsehinternen Zensur: Ihr vierstündiger Film La casa in Italia über Spekulationen auf dem italienischen Wohnungsmarkt schürfte offenbar zu tief in den Fakten. Erstmals wird hier Cavanis radikale Bereitschaft, auch problematische Positionen zu halten, deutlich. Sie ist eine unbequeme Filmemacherin, eine engagierte Querdenkerin. Und statt sich vom Fernsehen verbeamten zu lassen, schlug sie den Weg der Künstlerin ein.
Cavanis erster fiktiver Fernsehfilm, das marxistisch neu interpretierte Heiligendrama Francesco d’Assisi (1966), konnte ebenfalls erst nach heftigen Auseinandersetzungen gezeigt werden und läutete einen immer wiederkehrenden Kampf der Regisseurin gegen die Kunstzensur ein. Gemeinsam ist all ihren Werken ein tief verankertes Misstrauen in diktatorische staatliche und religiöse Instanzen.
»Als Atheistin hatte ich niemals auch nur den geringsten Wunsch, einen Film über das Leben eines Heiligen zu machen, bis ich das Buch eines französischen Protestanten las, der das Leben des heiligen Franz unter humanen und sozialen Aspekten studiert hatte. Zu meiner Überraschung spaltete der Film die Nation in zwei Lager, das ging bis zur empörten Anzeige vor dem Parlament mit der Begründung, ich hätte den meistverehrten Heiligen Italiens verunglimpft. Tatsächlich machte ich einen Film über den ersten Hippie in der Geschichte«,
sagte Liliana Cavani in einem zeitgenössischen Interview (zit. n. Phelix & Thissen 1983, S. 186). Eine so verwirrende wie radikale Neuinterpretation ausgerechnet dieses Stoffes wagte die Regisseurin 1989 mit der aufwendigen europäischen Koproduktion Francesco [Franziskus], der hier von Mickey Rourke, dem Kinorebellen der achtziger Jahre verkörpert wurde. Diesmal schilderte sie den Lebensweg des früheren Ritters und schließlich frustrierten Ordensgründers in zahlreichen Rückblenden aus Sicht ihm nahestehender Personen. Doch an Franziskus‘ Erleuchtung gibt es hier keinen Zweifel: Der Film strebt nach der spirituellen Ebene, die Liliana Cavani bereits 1974 mit dem buddhistischen Lehrstück Milarepa etabliert hatte.
Das Drama des Widerstandes
Ihr Historiendrama Galileo (1968), ebenso ursprünglich für das Fernsehen inszeniert, geriet zum antikatholischen Statement, das von kirchlicher Seite stark angefeindet wurde: Nach seiner Begegnung mit dem ›Ketzer‹ Giordano Bruno anno 1592 ist Galileo Galilei (Cyril Cusack) davon überzeugt, daß die Sonne, nicht die Erde, der Mittelpunkt des Universums ist. Für die Kirche ist seine Theorie erwartungsgemäß Ketzerei. Mit diesem Vorwurf wird Galileo, der seine Forschungen in Florenz fortführt, unmittelbar nach seiner Verhaftung konfrontiert. Den Höhepunkt des rabiaten kirchlichen Vorgehens bildet die Konfiszierung von Galileos Buch Die zwei Systeme der Welt, das von den Autoritäten unverstanden bleiben muss. Erst 1633 wird er vor einem Inquisitionsausschuss seine feierliche Abschwörung unterzeichnen (Abb. 1).
Abb. 1: Galileo (Medusa, 1:18:03) – Galileo vor der Inquisition
Cavanis nüchtern-polemisches Historienspiel berichtet von dem dramatischen Prozeß, den der Gelehrte gegen die Gebote einer konservativen und rückschrittlichen Kirche führte. Wie in Francesco d‘Assisi tritt der freidenkende Geist gegen die totalitäre Tyrannei an, ohne jedoch letztlich den Sieg davon zu tragen. In flirrenden Farben läßt sie die Würdenträger der Kirche sich durch ihre Ausführungen selbst bloßstellen. Cyril Cusacks Galileo muß sich zwischen der »Sklavenmoral« (ein Begriff von Friedrich Nietzsche) und der gefährlichen Freiheit des Denkens entscheiden, ein Dilemma, das auf zahlreiche Protagonisten aus Cavanis Filmen wartet. In Deutschland war Galileo zwar nur im DDR-Fernsehen zu sehen, aber Horst Manfred Adloff nutzte einige zentrale Sequenzen aus dem Film bereits 1970 für seinen semidokumentarischen Agitationsfilm Der Ketzer, in dem er »2000 Jahre Folterung, Mord und Unterdrückung im Namen der Kirche« anprangerte, wie es der Untertitel besagt. Der u.a. von Alexander Mitscherlich kommentierte Film wurde angesichts seiner drastischen Polemik scharf angegriffen, ergänzte sich aber offensichtlich mit Cavanis antiautoritärer politischer Botschaft.
Mit dem stilisierten, teilweise surrealen Politikon I cannibali [Die Kannibalen] (1969), das die Antigone-Tragödie des Sophokles in eine anonyme faschistische Diktatur projiziert, kamen auch sexuelle Obsessionen und ein intensiver Blick auf den unterdrückten und geschän-deten Körper ins Spiel. Ulrich Gregor merkt über Cavanis Filme jener Jahre an: »Mit I cannibali [...], L’ospite [...] und Milarepa [...] entwickelte Liliana Cavani den Stil eines verinnerlichten, meditativen Autorenfilms mit einer starken Vorliebe für mythologische Sujets.« (Gregor, 1983, S. 113). Die Filmemacherin versucht sich in diesem streng stilisierten Drama, das Ähnlichkeiten mit einigen politisierten Italowestern jener Jahre aufweist, an einer philosophischen Auseinandersetzung über den Konflikt zwischen Gut und Böse.
Abb. 2: I Cannibali – Die Toten verrotten auf der Straße (Minerva Pictures/Raro Video, 0:19:58)
Wo Galileo nach dem Dialog mit den Mächtigen suchte und an der Unmöglichkeit dieser Kommunikation scheiterte, hat sich der Jesus-ähnliche Protagonist Tiresia (Pierre Clementi) aus I cannibali bereits aus dem Dialog zurückgezogen: Er erstarrt in selbst auferlegtem Schweigen – einem Schweigen, das an Ingmar Bergmanns gleichnamigen Film »über das Schweigen Gottes« erinnert; das Schweigen angesichts des Grauens der Welt. Tiresias Anhängerin Antigone (Britt Ekland) bleibt ebenfalls stumm, nachdem sie sich für ihn entschieden hat, selbst als sie bedroht und gefoltert wird. Man zieht das Verhalten eines Hundes vor, statt mit den Wärtern zu sprechen. Wie Antigone, die Tochter des Ödipus, die ihren toten Bruder gegen den Willen des Tyrannen beerdigte, widersetzen sich die Rebellen dem Gesetz des totalitären Staates, demzufolge die Leichen auf der Straße verrotten sollen (Abb. 2). Tiresia und Antigone werden schließlich vom Staat ermordet, doch andere werden den Kampf gegen die Gewaltherrschaft weiterführen, werden die Toten letztlich begraben. Cavani montiert die theatralen Spielszenen mit realen Bildern der Achtundsechziger-Jugendrevolte zusammen und schafft so einen bitteren filmischen Essay im Stile Jean-Luc Godards oder Nagisa Oshimas (vor allem Shinjuku Dorobo Nikki [Tagebuch eines Diebes aus Shinjuku], 1969, sei hier erwähnt). I cannibali ist also ein Film, der die Auswüchse der Gewaltherrschaft dokumentiert. Liliana Cavani bringt das Thema in moderne Form, bedient sich der stilistischen Brüche des revolutionären Kinos dieser Aufbruchsära, etwa indem sie Techniscope-Breitwand mit schwarzweißem Doku-mentarmaterial konfrontierte, und dies qualifiziert die Regisseurin als ›junge Wilde‹ des italienischen Kinos. Die Musik stammt wiederum von Ennio Morricone, stieß hier jedoch auf massive Kritik: Wie bei einigen seiner Italowestern-Soundtracks integrierte er hier aufdringliche Slapstickelemente und komponierte zudem zwei Titelsongs, die Don Powell in balladeskem Pathos intonierte: Der Film »versagt nicht nur dabei, Emotionen zu erzeugen, sondern hat auch einen grauenvollen Soundtrack von Ennio Morricone – ein Schicksal, das wenige Filme teilen, die von diesem talentierten Komponisten untermalt wurden«, schreibt Peter Bondanella (1982, S. 348). I cannibali ist heute gesehen ein ebenso eigenwilliger wie gealterter Film, der als Symptom seiner Zeit betrachtet werden kann. Sein kommerzieller Misserfolg zwang die Regisseurin, erneut zum Fernsehen zurückzukehren. L’ospite (1971) war das experimentelle Ergebnis dieses Medienwechsels, in dem Cavani ihre dokumentarische Vergangenheit wiederbelebt: Sie drehte dieses Drama mit den Patientinnen einer psychiatrischen Frauenklinik und kombinierte wiederum dokumentarische mit inszenierten Sequenzen.
Der Nachtportier als Opus Magnum
Als Il portiere di notte [Der Nachtportier] 1974 in Italien uraufgeführt wurde, kam es erneut zum Skandal: Der Film wurde kurzfristig beschlagnahmt und erst nach einem aufsehenerregenden Streik der italienischen Filmindustrie – angeführt von Luchino Visconti und Bernardo Bertolucci – wieder freigegeben und zum Kunstwerk erklärt. Tatsächlich waren derartige Vorkommnisse im Italien jener Jahre wohl eher üblich. Die Kritik bezog sich u.a. darauf, daß dieses offensiv sexuelle Szenario auch noch von einer Frau inszeniert worden sei: »Der Film ist doppelt gefährlich, da er von einer Frau inszeniert wurde. Er zeigt, wie eine Frau die Initiative bei einem Sexualakt ergreift – und das in einer Weise, die jedem Bordell Ehre machen würde«, schrieb die staatliche Zensur. »Das beleidigt mich nicht nur als Regisseurin, sondern auch als Frau«, war Cavanis Antwort (Phelix & Thissen 1983, S. 186).
»Ich vermag nämlich nicht einzusehen, wieso der Zensor den Sexualakt nur gutheißt, wenn die Frau unter dem Mann liegt, während er es als unakzeptabel, vulgär und obszön ansieht, wenn der Mann unter der Frau liegt. Der Schriftsatz des Zensors ist schockierend: Er enthält Ausdrücke, die in der Tat vulgär sind, Ausdrücke, die weder ich noch einer meiner Kollegen je in den Mund nehmen würde.« (ebd.)
Die internationale Rezeption des Films gestaltete sich dagegen gemischt. Die Reduktion politischer Verhältnisse auf eine sadomasochistische Zweierbeziehung wurde meist als unvertretbar empfunden. In Deutschland, wo Portiere di notte erst zwei Jahre später startete, interpretierte die Kritik den Film meist als etwas missratene politische Parabel. Dass er in seiner Vielschichtigkeit und Doppelbödigkeit angemessen gewürdigt wurde, sollte noch einige Jahre dauern.
Das Hauptanliegen der Regisseurin ist es in Il portiere di notte zugleich, einen politischen Mikrokosmos zu entwerfen, wie auch den Mechanismus einer bedingungslosen Begierde einleuchtend zu gestalten. Im Wien des Jahres 1957 begegnet die ehemalige KZ-Gefangene Lucia (Charlotte Rampling) ihrem früheren Peiniger, dem SS-Veteranen Max (Dirk Bogarde) wieder (Abb. 3). Jeder Stufe der Begegnung zwischen Max und Lucia kommt drastischer als im Genre des Melodrams üblich der Charakter einer Schlüsselszene zu. Die Handlungen und Ereignisse bekommen zunehmend mythisierenden Charakter. Begierde hat hierbei stets den Anschein der Bedingungslosigkeit und letztlich der Auslieferung. Es erscheint folgerichtig, dass auch destruktive Akte als Liebesbeweise dienen, allen voran die spontane Trennung von ihrem Ehemann, als Lucia die Ausweglosigkeit ihres Verlangens erkennt. Nur eine Schmerzerfahrung scheint der Intensität ihrer Gefühle noch angemessen zu sein: Als Max zum ersten Mal ins Hotelzimmer eindringt, ohrfeigt er Lucia. Dem amour fou, der bedingungslosen, verrückten Liebe, die im europäischen Kino eine lange Tradition hat, folgend, kann der Weg der Liebenden nur in den gemeinsamen Liebestod führen, dem sie sich perfekt stilisiert (er in seiner schwarzen Ausgehuniform, sie in ihrem hellen Kinderkleid) hingeben. Dem Ort des Todes, einer einsamen Stahlbrücke im Morgengrauen, kommt hier deutlich der Charakter eines ganz bildlichen Übergangsritus zu. Cavani scheint suggerieren zu wollen, es gebe eine Welt für die Liebenden, nur ist es nicht die unsere. Auch entfernt sich die Kamera in diesem Moment deutlich vom Geschehen: Der Handlungsort wird bühnenhaft, die Protagonisten zu kleinen Figuren, die sich im Moment des Todes den Konturen der Umgebung anpassen. Die Liebenden sind zu kostümierten Chargen eines tragischen Stückes avanciert.
Abb. 3: Il Portiere di notte – das Wiedersehen (Criterion Collection, 0:05:28)
Das Eheverhältnis zwischen Lucia und ihrem Mann wird hingegen sehr distanziert gezeigt. Ihr Umgang hat bereits eine unleugbare Routine, innerhalb der Lucia nahezu die Rolle des kindlichen ›Luxusweibchens‹ hat, das im goldenen Käfig des Hotelzimmers an die Langeweile bereits gewöhnt ist. Fast gönnerhaft überredet ihr Mann Lucia, in Wien erst noch etwas »einkaufen zu gehen«, bevor sie ihm nach Frankfurt folge, ohne zu bemerken, was er damit einleitet. Die Notwendigkeit eines Befreiungsaktes aus diesem ›Ehegefängnis‹ wird nahe gelegt und schließlich zelebriert. Die Art und Weise dieser Befreiung durch erneute (bedingungslose) heterosexuelle Abhängigkeit und Auslieferung wird oft gegenteilig als endgültiger Schritt in die Passivität fehl gedeutet, da übersehen wird, wie bewusst und mit wie viel Kontrolle Lucia den Schritt geht. Letztlich ist es eher Max, der ein Leben lang als Sklave seiner Begierden verbrachte und dessen Handeln in der Tat von Zwanghaftigkeit geprägt ist.
Il portiere di notte entwirft die extreme Isolation des Paares als sinnliches Schlachtfeld der sexuellen Obsessionen: Der erwähnte Scherbenakt ist ebenfalls eine häufig zitierte Sequenz, die oft als Beleg für den sadomasochistischen Appeal des Films herangezogen wird. In einem übermütigen Necken schließt sich Lucia im Badezimmer ein. Max klopft barfüßig an die Tür. Die Frau wirft eine gläserne Parfumflasche auf den Boden, deren Splitter sich auf dem Boden verteilen, dann öffnet sie. Max läuft unmittelbar in die Scherben. Sein Gesicht spiegelt unvermittelten Schmerz und zugleich dessen zufriedene Duldung. Lucia streckt die Hand aus, um eine Scherbe aus der Ferse zu ziehen, Max verlagert überraschend sein Gewicht und tritt die Scherbe zugleich in seinen Fuß und ihre Hand. Sie lächeln sich an. Er breitet seine Arme zu einer großmütigen Geste. Die Dialektik von Henker und Opfer kehrt sich immer wieder um.
Abb. 4: Il Portiere di notte – Salomes Tanz (Criterion Collection, 1:13:28)