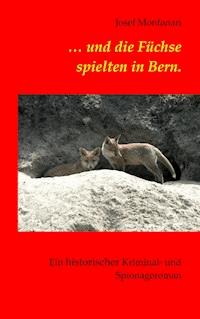
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die deutsche Botschaftsmitarbeiterin Antje Schudel wollte mit Ihrem Freund eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Dazu kam es nicht. Er wurde vermisst und viele Abklärungen wurden nötig. Antje wurde verdächtigt, selber etwas mit dem Verschwinden ihres Freundes zu tun gehabt zu haben. Ihr Freund war bei der britischen Botschaft beschäftigt. Zur Abklärung waren auch die politischen Behörden verpflichtet. Die Situation spitzte sich zu, als Antje durch eine undurchsichtige Organisation entführt und gefangen genommen wurde. Sie litt viel während dieser Zeit, wusste sich aber auch zu helfen. Ihr Freund wurde mit einer Waffenfabrik in Wallisellen in Verbindung gebracht. Dort wurden wichtige Kriegsanlagen projektiert, die für den Ausgang des Kriegs von großer Bedeutung waren. Die verfeindeten britischen und deutschen Geheimdienste interessierten sich daher sehr für diese Firma. Antje wurde immer mehr in kriminelle Machenschaften verwickelt, und auch die Berner Polizei musste sich mit dem Fall befassen. Der Roman ist sehr spannend geschrieben. Wer ihn in den Ferien, in den Bergen, oder am Meer liest, wird bestens unterhalten. Für einen geringen Preis erfährt er viel aus einer anderen Welt, einer anderen Zeit, einer anderen Kultur. Unseren Vorfahren ist es gelungen, das Land aus dem Krieg herauszuhalten. Sie konnten daher viele Kräfte für humanitäre Ziele einsetzen, in einer Zeit, wo Europa zerstört am Boden lag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dank
Der bekannte Fotograf und Kollege Peter Pfister aus Schaffhausen hat mir das Foto auf dem Titelblatt zur Verfügung gestellt. Peter hat das Foto 2006 selber aufgenommen. Er schrieb mir dazu: „Die Füchse gruben ihren Bau in einer steilen Viehweide in Buchthalen. Der Bauer (mein Vermieter) hatte keine Freude.“ Das Foto ist in seiner Art einzigartig. Es drückt mit tiefem Einfühlungsvermögen den Charakter und die List des eleganten Tieres aus.
Für die wichtigen Korrekturarbeiten des Manuskripts und die zahlreichen inhaltlichen Anmerkungen danke ich Kathrin Schmidig und meinem Sohn, Josef Matthias Montanari, welcher das Buchprojekt eng begleitete, vielfältige Gestaltungsarbeiten übernahm und das Buch zu einem Abschluss brachte.
Gerne danke ich auch meiner Frau Maya, meiner Tochter Liselotte und meinem Sohn Marcel für ihre Unterstützung und die Gespräche am Familientisch.
Thayngen, im Sommer 2018
Josef Montanari
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Impressum
Einführung
Die meisten Menschen erhoffen sich von Ihrem Beruf viel Befriedigung, hohe Anerkennung und einen guten Verdienst. Daneben vermittelt die berufliche Tätigkeit dem Einzelnen meist auch einen gut strukturierten Tagesablauf, der für ihn wichtig ist. Die Frauen erfüllen neben ihrer Arbeit häufig noch zusätzlich viele familiäre Aufgaben.
In Kriegszeiten wird der übliche Lebensentwurf stark gestört. Gewaltige Anforderungen und Erwartungen von aussen setzen die Leute unter einen zusätzlichen massiven Druck. Die Freizeit muss reduziert werden, und an Ferien ist gar nicht mehr zu denken. Nicht jeder kann die zusätzlichen Aufgaben pünktlich erfüllen und die Mehrarbeit bewältigen.
Im schlimmsten Fall zwingt ein plötzliches Ereignis, ein Schuss aus einer feindlichen Waffe, ein Bombenangriff oder eine persönliche Krise zur Verhaltensänderung und zu schwierigen Entscheidungen. Der Beruf oder der Wohnort muss plötzlich aufgegeben werden. Unter erschwerten Bedingungen findet man dann vielleicht anderswo wieder eine neue Herausforderung.
Kriegszeiten sind Krisenzeiten. Auch das Jahr 1943, wovon dieser Roman handelt, brachte viele persönliche Rückschläge und nur wenig Hoffnungen. Einzig die Sehnsucht nach mehr Freiheit und Selbstbestimmung blieb, denn sie ist im Innern des Menschen tief verwurzelt.
Wer, wie die Hauptfigur dieser Erzählung, Antje Schudel, in der noch unversehrten Schweiz von einem lieben Freund lange nichts mehr hörte, erlitt einen grossen Schaden. Denn sie hoffte auf dieser Insel der Unversehrtheit eine Zukunft mit ihm zu finden oder wenigstens in ein weniger gefährdetes Land ausreisen zu können.
Mit ihrem Arbeitskollegen wollte sie neue Wege finden. Zusammen schmiedeten sie Pläne in Interlaken an einem schönen Frühlingsabend. Doch dann musste sie von seiner ungewissen Abwesenheit erfahren, was sie stark erschütterte.
Ohne sich mit den Folgen und der Bedeutung des Verlustes genügend auseinanderzusetzen wurde sie in einen Strudel weiterer Ereignisse und grosser Herausforderungen gerissen. Man beschuldigte und verdächtigte sie sogar, selber am Verschwinden ihres Freundes mitbeteiligt gewesen zu sein.
Finstere Kräfte versuchten sie für ihre Zwecke auszunutzen und zu missbrauchen. Sie sollte eine Spionagerolle übernehmen, der sie gar nicht gewachsen war. Man verlangte von ihr, bei einer Ingenieurfirma Erkundigungen über heikle militärtechnische Waffen einzuziehen und Beziehungen zum Führungskader aufzubauen. Später hätten militärtechnische Pläne und besseres Know-how für den Einsatz von Panzern geliefert werden sollen.
Die Methoden zur Erreichung des Ziels wurden von den Geheimdiensten immer wieder geändert. Nur das Ziel, die Erreichung einer hohen Schlagkraft der Panzerverbände, blieb bei allen Parteien bestehen und hatte höchste Priorität.
In der neutralen Schweiz gab es für die Geheimdienste aller Nationen gute und ungestörte Kommunikationsorte und Austauschmöglichkeiten.
Viele Füchse waren daher in Bern und anderswo am Werk. Sie spielten nach ihren eigenen Regeln. Sie spendeten ihren Opfern grosse Anerkennung, sie drohten oder verkomplizierten die Situation. Zum Glück waren die besonders Schlauen nicht die Untätigsten.
Kapitel 1
Bern anfangs 1943
Es war Sonntagabend im Januar 1943. In Bern herrschte eine aufgeregte Stimmung. Am Bahnhof fiel die starke Durchmischung von zivilen mit militärischen Personen auf. Es kam zu vielen innigen Abschiedsszenen zwischen Personen, die daheim bleiben mussten, und denjenigen, die in den Militärdienst einzurücken hatten.
Für eine Familie war der Abschied vom Vater besonders schwer. Die Mutter wusste, was die nächsten Wochen für sie bringen würde. Sie hatte den Bauernbetrieb alleine zu führen. Nur ab und zu half ihr ein Knecht. Sie fühlte sich masslos überfordert mit all den Aufgaben, die sie zu erledigen hatte. Die Doppelbelastung Familie und Bauernbetrieb überschritt die Kräfte einer Person bei Weitem. Die Kinder weinten am Bahnsteig. Sie hätten dem Vater am liebsten zugerufen: „Bleib bei uns, fahr nicht fort, wir brauchen Dich!“
Der Vater wusste auch, was ihm die nächste Woche bringen wird. Ein Fussmarsch von 50 km mit Vollpackung stand auf dem Plan. Auf solchen Märschen bekam er regelmässig stark schmerzende Blasen am Fuss. Es war aber üblich, dass die Truppe auf solche Befindlichkeiten nicht stark einging. Ein Soldat konnte sich in einer solchen Lage zwar beim Sanitätsdienst melden. Dort wurde ihm provisorisch geholfen, er sollte sich aber auch auf die Härten eines vielleicht kommenden Kampfes vorbereiten und Schmerzen in Kauf nehmen. Unklar war für den Vater während der Abfahrt noch, ob er auch für eine Nachtwache vorgesehen sei. Dies hätte ein grosser Verzicht auf Schlaf bedeutet und wäre für ihn sehr kräfteraubend gewesen.
Der Zug setzte sich in Fahrt. Es blieb nur noch ein kurzes Winken. Die Familie war wieder für Wochen auf sich selber gestellt. Staatliche Hilfe gab es keine, und von der Nachbarschaft konnte die Familie nicht mit viel Hilfe rechnen. Jeder hatte, um durch zu kommen, zuerst für sich alleine zu sorgen.
Nahe beim Bahnhof Bern, nämlich auf dem Bundesplatz, gab es viele Schaulustige. Eine Gruppe junger Leute sang Lieder mit deutlich fremdem und politischem Inhalt. Dann versuchten sie auf Gebäuden rund um den Bundesplatz Hackenkreuzflaggen anzubringen. In Bern war sich niemand an fremde Flaggen auf Amtsgebäuden gewöhnt. Hackenkreuzflaggen am Bundesplatz waren eine riesige Provokation und nicht zu akzeptieren oder zu tolerieren. Diese Handlung veranlasste die herbeigerufene Polizei sofort einzugreifen. Ein Getöse von Sirenen war weit herum zu hören. Die Burschen wurden so verunsichert. Sie schmetterten aber trotzdem noch weitere Steine gegen Fenster des Bundeshauses. Die herbei geeilte zivile Bevölkerung war entsetzt.
Der Polizei gelang es, die Situation schnell in den Griff zu bekommen. Die jungen Leute wurden vom Platz weggeschickt. Die Journalisten, die von den Ereignissen hörten, wollten in ihren Zeitungen nicht darüber berichten. Sie folgten damit einer Empfehlung ihres Verbandes, dass solche Provokationen nicht weiterverbreitet werden sollten. Es sollte verhindert werden, dass auch in andern Städten Unruhen der gleichen Art ausbrechen könnten.
Europa im Krieg
Die grossen Nationen Europas standen mitten in kriegerischen Auseinandersetzungen. Die deutsche Armee überrannte am 1. September 1939 Polen. Sie gab vor, nur zurückzuschiessen. Panzer und Flugzeuge eröffneten aber einen brutalen Feldzug gegen ein ungenügend gerüstetes Volk. Die polnische Armee kämpfte mit Pferd und Wagen gegen deutsche Panzer. England war vertraglich mit Polen verbunden und konnte das entstandene Ungleichgewicht und die Bedrohung, die von Deutschland ausging, nicht mehr länger ertragen und erklärte den Krieg. Auch Frankreich erklärte am 3. September 1939 zusammen mit England Deutschland den Krieg.
Die deutsche Führung hoffte darauf, dass England seine Verpflichtungen nicht erfüllen werde und die kriegerischen Handlungen Deutschlands nochmals tolerieren würde, wie sie das schon einige Male bei Auseinandersetzungen mit andern Staaten Europas tat. Darin täuschten sich die Angreifer aber gewaltig. Denn nun war das Mass voll. Der Krieg wurde zur Fortsetzung der Politik mit andern Mittel, wie einst ein grosser deutscher militärischer Denker, namens Clausewitz, trefflich bemerkte.
In Friedenszeiten war das Militär jeweils der zivilen Regierung unterstellt. In Kriegszeiten dagegen griff es häufig in die Kompetenzen der zivilen Regierung ein und übernahm diese für eine gewisse Zeit selber. Selbst General Guisan verhandelte mit ausländischen Generälen, ohne den Bundesrat vorher zu informieren. Auch hohe Schweizer Offiziere führten Verhandlungen mit wichtigen ausländischen Stellen, ohne die politischen Behörden zu benachrichtigen. Sowohl der General als auch die Schweizer Offiziere handelten in übergeordnetem schweizerischen Interesse. Sie gingen dabei selber erhebliche persönliche Risiken ein.
In Deutschland war der Oberbefehlshaber des Militärs zugleich auch noch Kanzler, Chef der Regierung und Führer. Das Parlament trat, als Folge der Diktatur, nur noch sporadisch zusammen und wurde de facto ausgeschaltet. Es wurde zum Scheinparlament, denn Parteien im eigentlichen Sinne gab es keine mehr.
Nach Beginn des Krieges fielen grosse Mengen an Bomben auf englische Städte. Der Höhepunkt wurde zwischen Sommer 1940 bis Frühjahr 1941 erreicht. Es gelang den Deutschen aber nicht, den Krieg über die Lufthoheit Englands zu gewinnen. Churchill bemerkte in diesem Zusammenhang: „Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.“ Gemeint waren die englischen Piloten, die sich für die Bevölkerung voll einsetzten, grosse persönliche Risiken eingingen und sie retteten. Sie gingen bis zu den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit und häufig darüber hinaus. „Success is walking from failure to failure without loosing enthusiasm,” Churchill verwies damit auf einen bekannten, mühsamen Lernprozess.
Nur wer mehrere Niederlagen selber erlitten hat wird erfolgreich werden.
Das Leiden der englischen Bevölkerung und der Drang, es den Deutschen zurückzuzahlen wurden immer grösser. Frankreich konnte dem Sturm aus Osten nicht widerstehen und verlor einen grossen und bedeutenden Teil des eigenen Staatsgebietes. Frankreich kapitulierte am 21. Juni 1940. Später griffen die Deutschen, trotz Nichtangriffsvertrag mit Russland auch dieses grosse und weite Land an und brachten sich so selber allmählich in einen aufwendigen Zweifrontenkrieg.
Als Begründung für die deutsche Angriffswut galt ihr Drang, im Osten einen grösseren Lebensraum zu finden. Das Land litt aber unter der grossen Schmach des verlorenen ersten Weltkrieges. Es hatte riesige Summen an Reparationszahlungen zu leisten, was der Bevölkerung jede Zukunftschance verbaute. Dies empfanden die Deutschen als schwere Ungerechtigkeit und grosse Kränkung. Gewisse politische Parteien wehrten sich immer mehr gegen die erniedrigende Behandlung der Siegermächte, insbesondere gegen Frankreich.
Spätestens mit der Niederlage bei der Schlacht um Stalingrad Ende Januar und anfangs Februar 1943 wendete sich das Kriegsblatt. Das Kriegsglück der Deutschen nahm ab und ihre eigenen Städte wurden vermehrt Opfer englischer Flugangriffe.
Die Aufgaben der Botschaften
In Kriegszeiten sind die Botschaften stark gefordert. Sie sind häufig die einzige Verbindung zwischen den Landsleuten und deren Angehörigen in der Heimat.
Botschaften hatten politische und wirtschaftliche Interessen zu vertreten. Dazu verfügten sie über viele Kontakte und Beziehungen zu ihrem Gastland. Auch unter den Botschaften selber wurden viele Informationen ausgetauscht.
Von besonderer Bedeutung war die Visa-Abteilung. Dort wurde entschieden, wer ins Heimatland einreisen darf und wessen Gesuch abgewiesen oder weiter bearbeitet werden sollte. Hier wurden immer wieder neue Fragebogen entworfen, um die Bewerber noch genauer kennen zu lernen und die Plausibilität ihrer Antworten einzustufen. Es interessierte vor allem der Zweck der Reise. Hat der Bewerber wirtschaftliche, politische oder persönliche Gründe? Suchte er eine Arbeitsstelle oder will er selbständig werden? Konnte er für seinen Lebensunterhalt selber sorgen? Gab es politische Gründe ihn nicht hereinzulassen?
Die Botschaften waren sehr gut informiert, und die Grenzen ihrer Tätigkeiten waren nicht immer leicht fassbar. Was lag noch im legalen Bereich und was nicht mehr? Wann lag Spionage im eigentlichen Sinne vor und weshalb? Bei Überschreiten des legalen Rahmens drohte einer Botschaftsperson die Ausweisung aus dem Land seiner jetzigen Mission. Als Antwort wurde die gleiche Massnahme auch durch den betroffenen Staat ergriffen, selbst dann, wenn der einzelne Botschaftsmitarbeiter sich keine Verfehlungen zu Schulde hatte kommen lassen. Die offensichtliche Ungerechtigkeit wurde in Kauf genommen. Es handelte sich dann um eine sogenannte Retorsionsmassnahme. Bei dieser Massnahme spielte es keine Rolle, ob sie gerechtfertigt war oder nicht. Wichtig war nur, dass das Gleichgewicht der Massnahmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden konnten.
Ein unerwarteter Mord
John Hudson war alleine zu Hause. Er trank ein Glas Wein, was er sonst nur selten tat. Dann öffnete und las er die eingegangene Privatpost. Mit einem effizienten Kartensystem beantwortete er die erhaltenen Briefe in kürzester Zeit. Zur Verwunderung der Absender erhielten diese innerhalb eines oder zweier Tage bereits eine Antwort. Dazu verwendete er meist einen speziellen Füllfederhalter. Der Empfänger musste zwar eine handgeschriebene Antwort in Kauf nehmen. Angesichts der Geschwindigkeit der Antwort und des sehr freundlichen Stils nahm jedoch jeder Betroffene dies gerne entgegen.
Nachdem er die Post erledigt hatte, begann er mit den Vorbereitungsarbeiten für den Abend. John wollte für zwei Personen kochen. Dafür hatte er ein spezielles Stück Rindfleisch eingekauft. Dieses grillierte er. Für die Spaghetti verwendete er eine besondere Kräutermischung, und er holte einen feinen Bordeaux aus dem Keller.
Plötzlich klang die Hausglocke. John war noch nicht fertig mit all den Arbeiten für den Abend. Er erwartete eine Frau. Aber die Frau, mit der er abgemacht hatte, kam doch meist etwas zu spät und nur selten zu früh. Wer konnte das jetzt schon sein? Die eingekauften Blumen steckte er in die Vase. Er erwartete seine bekannte Freundin. Deshalb rief er: „Antje, bist Du es schon?“ Statt einer Antwort läutete es an der Hausglocke nochmals. John wurde sofort etwas misstrauisch, denn Antje bedrängte ihn nie. Sie war auch nie aufdringlich. War es wirklich seine Antje, die er mit besten Wünschen eingeladen hatte?
Trotz aller Bedenken ging John an die Tür und öffnete sie. „Sind Sie John Hudson?“ Verwundert, aber unvorbereitet antwortete John zögerlich: „Ja“.
„Ich bin ein Bekannter von Antje und möchte Sie kurz sprechen. Darf ich eintreten?“ fragte der Fremde. „Warum ist Antje nicht selber gekommen? Ist ihr etwas zugestossen?“ „Nein, aber ich muss Ihnen etwas erzählen. Darf ich also hereinkommen?“ Vorsichtig antwortete Hudson: „Ja, nun denn.“ Beide gingen Richtung Wohnzimmer und sprachen kein Wort. Der Fremde zog, anstatt zu reden, sofort sein Messer und stach es Hudson brutal von hinten durch die Rippen ins Herz. John stürzte sofort zu Boden. Der Stich schmerzte ihn. Er verlor die Kontrolle über seinen Körper. Der Angreifer nahm das Messer wieder zu sich und sah, dass John wegen des tiefen Stichs auf der Stelle starb. Danach flüchtete der Eindringling mit schnellen Schritten aus dem Haus. Draussen musste man das wegfahrende Auto gehört haben.
Der Mord an John Hudson war eine feige Tat. So etwas hatte niemand erwartet. Im Wohnquartier galt John Hudson als sehr zuvorkommend. Eigentlich konnte er keiner Fliege etwas antun.
Die Leute in der Umgebung, die von diesem Mord hörten, waren sehr bestürzt. Sie stellten sich verschiedene Fragen. Wer konnte nur ein Interesse an einer solchen Tat haben?
Sie geschah am Abend in seiner Wohnung und wurde von niemandem erwartet.
Hudson galt auf der Botschaft als sehr umgänglicher und zuvorkommender Typ. Seine Aufgaben erledigte er immer mit grosser Sorgfalt. Es gab nie Klagen wegen seines Verhaltens. Er fiel nicht auf und sein Privatleben war weitgehend unbekannt.
Seine gute Allgemeinbildung wussten alle zu schätzen. Er beherrschte nicht nur seine Muttersprache. Auch die deutsche Sprache war ihm geläufig. Von seiner langen Ausbildungszeit am renommierten Gymnasium in den Alpen profitierte er noch viele Jahre nach seinem Abschluss. Immer wieder waren seine Arbeitskollegen über sein Beziehungsnetz und von wem er eingeladen wurde erstaunt. Es wunderte sich daher auch niemand im Büro, wenn er manchmal am Telefon deutsch sprach. Auch französisch bereitete ihm keine Schwierigkeiten.
Abklärungen
Bei einem Mord werden von Amtes wegen diverse Untersuchungen durchgeführt, die normalerweise von der Polizei und der Staatsanwaltschaft vorgenommen werden. In diesem Falle wurde allerdings aus verschiedenen Gründen ein anderes Vorgehen gewählt.
Die zuständige Stelle beim Secret Service, Dep. II, sollte die Führung übernehmen. Sie wurde auf Befehl des britischen Premierministers einberufen. Absolute Diskretion war höchstes Gebot. Dies bedeutete, dass nur eine geringe Zahl von Personen Bescheid wissen durfte. Bei Erkenntnissen, die für das ganze Land wichtig waren oder gar den Gang der politischen und militärischen Ereignisse beeinflussen konnten, musste sofort der Premierminister benachrichtigt werden.
Vorerst deutete aber nichts auf eine solche Entwicklung hin. Das Dep. II beschaffte sich, wie in solchen Fällen üblich, alle Angaben über Lebenslauf und Gewohnheiten aus den Personalakten und führte verschiedene Befragungen durch.
Die Frage, ob auch die Schweizer Behörden eingeschaltet werden sollten, war schnell zu behandeln. Eigentlich war dies in einem fremden Land üblich. Die englische Untersuchungsgruppe wollte aber selber eine Hausdurchsuchung beim Beamten durchführen. Die Voraussetzungen, dass dies zu tun sei, waren gegeben und im Führungshandbuch, das jedem Botschafter zur Verfügung stand, geregelt.
Zwei Mitarbeiter der Botschaft schlossen daher die Wohnung in Bern auf. Sie besassen bereits ein Duplikat des Schlüssels, denn jeder Beamte musste nach seiner Versetzung einen Schlüssel abgeben. Ebenso hatte jeder Mitarbeiter einer Botschaft solchen indiskreten Abklärungen und Nachforschungen vor Antritt der Stelle schriftlich zuzustimmen. Ein Botschaftsmitarbeiter hatte auf seine Privatsphäre zu verzichten, wenn aussergewöhnliche Ereignisse eintrafen.
Die Durchsuchung der Wohnung führte zu keinen nennenswerten Aufschlüssen.
Immerhin wurde eine goldene Uhr sichergestellt. Sie war besonders wertvoll. Ein kleines Atelier in Biel hatte sie hergestellt. Normalerweise besass ein Mitarbeiter der Visa-Abteilung kein so teures Schmuckstück. Aus seinem Lohn konnte er sich das nicht leisten.
Ebenso fand man einige persönliche Briefe, die an John adressiert waren. Eigenartigerweise behielt er diese auf, obwohl er damit rechnen musste, dass sie eines Tages auch in falsche Hände gelangen könnten.
Weitere Ermittlungen und Erinnerungen
Für die Abklärungen wurde eine kleine Gruppe des Secret Service beauftragt. Sie untersuchte den Ort des Mordes genau. Die ganze Wohnung von John Hudson wurde unter die Lupe genommen, jede Schublade geprüft. Man wollte sich offensichtlich ein Bild machen, wie Hudson gelebt hatte und mit wem er Kontakt pflegte. Seine Lebensgewohnheiten interessierten und standen im Zentrum der Ermittlungen.
Es war ein Brief einer gewissen Antje Schudel, der besonders auffiel. Sie bedankte sich für den schönen Unterhaltungsabend im Kursaal Interlaken und die anregenden Gespräche, die John und sie führten. An diesem Abend wurde es offensichtlich sehr spät.
Sie entschieden sich nach der Aufführung noch etwas auf der Matte zu spazieren. „Mein lieber John, das war ein sehr gelungener Abend. Es hat mich sehr gefreut“, sagte Antje in vertraulichem Ton. „Ich teile Deine Meinung, Antje. Findest Du nicht auch, dass wir noch häufiger zusammen ausgehen könnten?“, fragte John. „Ich habe nichts dagegen. Nur, Du weisst ja, dass wir in ähnlicher Funktion arbeiten. Nur leider sind unsere Arbeitgeber zerstritten und gar im Krieg gegen einander. Zudem musst Du wissen, dass ich in meinem Alter eine seriöse Beziehung zu einem Mann aufbauen möchte“, fügte Antje hinzu. „Ich verstehe Deine Ansicht. Mir geht es ja ähnlich. Auch ich möchte mit einer Frau ein gemeinsames Leben aufbauen. Wir verstehen uns gut, Antje, und eine gemeinsame Perspektive könnten wir durchaus in Betracht ziehen“,





























