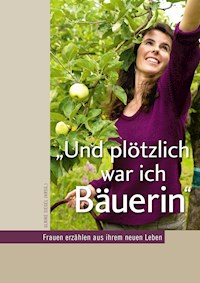
Und plötzlich war ich Bäuerin E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LV Buch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Viele Wege führen aufs Land!" In diesem Buch beschreiben 18 Frauen ihre Wege in die Landwirtschaft. Alle kommen sie aus Elternhäusern, die ihnen diesen Weg nicht vorgegeben hatten. Unterschiedliche Beweggründe haben sie dahin geführt. Einige haben aus Liebe zur Natur und den Tieren selbst einen landwirtschaftlichen Beruf erlernt oder ein Studium abgeschlossen, andere sind der Liebe wegen eher zufällig auf einem Bauernhof angekommen. "Mit ihren Geschichten zeichnen die Frauen viel fältige Bilder der heutigen Frauenrolle auf Bauernhöfen. Es wird deutlich, wie sich der gesellschaftliche Wertewandel in diesem Bereich auch auf die Landwirtschaft ausgewirkt hat."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frauen erzählen ihre Geschichte
„Und plötzlich war ich Bäuerin“
ULRIKE SIEGEL (HRSG.)
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Impressum
Viele Wege führen aufs Land!
Mit der Veröffentlichung der Bauerntöchter- und Bauernsöhne- Geschichten wurde das Themenfeld der bäuerlichen Herkunft ausführlich beleuchtet. Dadurch wurde offensichtlich das Interesse geweckt, auch etwas über den Blick „von außen“ zu erfahren. Und damit auch einmal Frauen zu Wort kommen zu lassen, die aus völlig anderen Lebenswelten kommend in der Landwirtschaft gelandet sind.
In diesem Buch beschreiben 18 Frauen ihre Wege in die Landwirtschaft. Alle kommen sie aus Elternhäusern, die ihnen diesen Weg nicht vorgegeben hatten. Unterschiedliche Beweggründe haben sie dahin geführt. Sie haben aus Liebe zur Natur und den Tieren selbst einen landwirtschaftlichen Beruf erlernt oder ein Studium abgeschlossen oder sind der Liebe wegen eher zufällig auf einem Bauernhof angekommen.
Da ist Nanna, in einer Hamburger Künstlerfamilie aufgewachsen, die sich in einem Wartesemester für das Tiermedizinstudium auf einem Milchviehbetrieb in die Kühe verliebte und blieb. Bettina aus Stuttgart, die nach der Schule ihren Traum verwirklichen wollte, einen kleinen Ökohof zu bewirtschaften und alles besser zu machen, was sie in der Schule über Landwirtschaft gelernt hatte. Da sind aber auch die Krankenschwestern Sigrun und Petra, die Bankerin Heike oder die Optikerin Gunda, die erst die große Liebe auf einen Hof geführt hat.
Sie schreiben von „Gefahrenwarnungen“ auf diesem Wege, eigenen Zweifeln und Anfechtungen, von Vorbehalten der Schwiegerfamilien, aber auch von liebevoller Aufnahme in die Großfamilie bis hin zur Unterstützung bei der weiteren außerbetrieblichen Berufstätigkeit. Es geht um das Einleben in ein bäuerliches Umfeld, die Mitarbeit in Hof, Stall und Feld und um die Schwierigkeiten, aber auch Chancen, dabei die eigene Rolle zu finden, zu definieren und diese auch zu leben.
Mit ihren Geschichten zeichnen die Frauen vielfältige Bilder der heutigen Frauenrolle auf Bauernhöfen. Es wird deutlich, wie sich der gesellschaftliche Wertewandel in diesem Bereich auch auf die Landwirtschaft ausgewirkt hat. Und wie Frauen in der Landwirtschaft ihren Traumberuf finden können, wenn sie die Eigenständigkeit des Berufes, das Arbeiten mit der Natur und die Verbindung von Beruf und Familie höher bewerten als die Abhängigkeiten vom Wetter und das Angebundensein mit dem Vieh. So wundert es auch nicht, dass keine einzige der Frauen ihren Weg aufs Land bereut!
Mein herzlicher Dank gilt den Autorinnen, die uns mit ihren Geschichten einen Einblick in ihre Lebenswelt gewähren. Für diesen Mut und die Offenheit gebührt ihnen großer Respekt.
Oktober 2010
Ulrike Siegel
Heike, Sparkassenfachwirtin, Niedersachsen
Das Gute an der Arbeit ist, dass sie nicht wegläuft
Was kann schöner sein? Ich sitze in meinem Gartenstuhl unter dem Apfelbaum nahe einem karmesinroten Rosenstrauch und schaue an einer Trauerweide vorbei auf den kleinen See. Über mir ein blassblauer Himmel mit vielen Schleierwolken, die langsam von der höhersteigenden Sonne davongeschoben werden. Menno-Heite und Helke spielen Ritter mit der Playmobilburg. Das gesamte Mittelalter wird wieder belebt, und selbst Janneke und Papa Menno erfahren durch das Brettspiel Agricola, wie es vor langer Zeit war, um das tägliche Brot zu kämpfen. Zwischendurch reden die vier jeweils über das Spiel der anderen und schaffen Problemlösungen.
Kinderbild
Und ich? Ja, ich genieße den lauen Wind an meinen Beinen, erfreue mich an dem Blick in die Natur und an der kleinen Distanz zu meiner Familie. Nun sind wir im Urlaub! Urlaub − dabei habe ich kurz vor meiner Hochzeit zu meiner Mama gesagt: „Wenn ich zu Menno auf den Hof gezogen bin, brauche ich nie wieder in Urlaub zu fahren, so schön werden wir es haben!“ Diesen Ausspruch habe ich vor ca. 19 Jahren getan. Und es ist tatsächlich so: Er gilt noch immer!
Wir sind zwar fast jedes Jahr unterwegs, aber wir fahren nie in Urlaub, sondern sind auf Reisen. Etwas Neues zu entdecken, zu schauen, was hinter der nächsten Kurve und dem Hügel auf uns wartet. Losgelöst vom Trott des normalen Alltags den Tag gestalten – wohlgemerkt selbst gestalten, keine Animation. Mit fremden Menschen in Kontakt treten und dann ihre Nähe spüren und spontan zu einem Glas Holundersaft eingeladen werden, einfach so. Und über das Leben diskutieren. Oder einem verträumten Bachlauf zu folgen, die Kiesel unter den Fußsohlen spüren, die sofort pieksen, weil man nichts gewöhnt ist oder weil man vielleicht manchmal die Bodenhaftung verloren hat. Das dahinfließende lebendige Wasser hat für uns alle einen besonderen Zauber. Und jeder genießt ihn auf seine Weise – die Kinder, die immer neue Möglichkeiten zum Spielen entdecken, Menno, der sich anstecken lässt vom Enthusiasmus, und ich, die Gelegenheit hat, sich dem Dahinfließen der Gedanken hinzugeben, sich vom Ballast zu befreien und in der Kühle die Seele baumeln zu lassen.
Spätestens wenn der Erste ruft: Ich habe Hunger! Hast du etwas Leckeres?, sind wir wieder in der Wirklichkeit angekommen. Trotzdem ist diese anders als auf dem Hof. Denn wenn mein Sohn hingebungsvoll in eine Scheibe dick abgeschnittenes Brot mit Leberwurst hineinbeißt oder Helke eine gebutterte Laugenstange verzehrt, ist dies das besondere Flair eines Picknicks. Natürlich ist bei einem Fünfpersonenurlaub das Budget eingeschränkt, denn zu Hause kostet der Betriebshelfer ja fast genauso viel wie unsere ganze Reise, doch das tut unserer Freude keinen Abbruch. Ich genieße es einfach, ein Glas roten Landwein zu trinken und ein Stück Ciabatta-brot in der Hand zu halten, vor unserem Zelt zu sitzen und der Natur zu lauschen, zu lesen oder mit meinem Mann Menno über Gott und die Welt zu reden. Das ist Freiheit!
Aber nicht nur auf Reisen, sondern gerade auch auf dem Hof gibt es diese Freiheit. Freiheit, die aus uns selber kommt, das sollen unsere Kinder lernen und dabei lebenstüchtig werden. „Gefühle macht man sich selbst“ – den Spruch, den ich selber vor langer Zeit geäußert habe, hält meine Mutter mir häufig vor, wenn ich mal wieder am Ende bin. Am Ende wovon? Weil ich wieder viel zu viel Arbeit habe? Weil mich Traditionen und Konventionen innerhalb der größeren Familie einengen? Das Schlimmste für mich ist, wenn mir gesellschaftliche Verpflichtungen aufgezwängt werden, weil es sich eben so gehört. Gerade dann möchte ich mich zurückziehen in meine Welt, angefüllt mit Träumen aus meinen Büchern. Doch wenn ich ehrlich bin, will ich kein vorgelebtes Leben, kein Leben aus zweiter Hand. Ich will mein Leben! Und genau darin besteht der Spagat, sich nicht desillusionieren zu lassen durch Wäsche, Hausputz, Elternabende, Melkzeiten und Generationenkonflikte, sondern sich die Neugier bewahren, im Alltäglichen das Besondere zu entdecken. Sei es ein Zitronenfalter, der seine Blüte auch im verkrauteten Beet findet, das Kälbchen, das am Sonntagmorgen gesund auf die Welt kommt und von seiner Mutter mit sanftem Muhen begrüßt wird, oder die ersten Schneeglöckchen, die meine Schwiegermutter mir herüberbringt. Für dieses Erkennen bedurfte es von meiner Seite einer langen Zeit des Wachstums.
Meine Eltern, beide Jahrgang 1940, erfuhren in der Kriegs- und kargen Nachkriegszeit ihre Prägung. Sicherheit und ein gutes Auskommen bestimmten ihren Werdegang. Als Grundschullehrerin und Diplom-Maschinenbauingenieur bauten sie sich ihr Heim in der Kleinstadt Leer. Beide Berufe waren durch Stipendien und Abendschulen hart erkämpft. Unabhängig zu sein, soweit dies im Angestelltenverhältnis möglich ist, war das große Streben. In diesem Sinne wurde ich auch von Anfang an angehalten, fleißig zu lernen, denn nur durch Wissen kann man etwas erreichen und wird anerkannt.
In beiden Familien meiner Eltern gab es zwar bäuerliche Freundschaften, aber der grundsätzliche Tenor war doch, dass viele Bauern einen großen Dünkel hatten. Nicht umsonst sprach man von den Polderfürsten, welche die Arbeitskraft der Erntehelfer ausnutzten, wenig zahlten und nur Akademiker gelten ließen. Glücklicherweise hat sich dies inzwischen geändert. Aber zur Jugendzeit meiner Eltern galt es noch. Trotzdem vermittelten sie mir die Landwirtschaft auch als große Freiheit. Oft waren wir im Hammrich unterwegs, oder Papa half aus lauter Vergnügen bei Freunden in der Heuernte. Wenn ich mitdurfte, war das immer ein großes Erlebnis. Am schönsten war das Abendessen: köstliche Bratkartoffeln, echte kuhwarme Milch, Rosinenbrot mit Schinken oder ein eigenes, gebratenes Hähnchen. Mittlerweile bereite ich dies alles selber zu und dennoch läuft mir bei den Erinnerungen an damals immer das Wasser im Munde zusammen.
Als ich mit 16 oder 17 Jahren ernsthafte Überlegungen anstrengte, welchen Beruf ich später ergreifen könnte, stand schon lange fest, dass ich Medizin studieren würde. Nun ergab es sich, dass ich die Ferien bei einer lieben Freundin meiner Mutter verbrachte, die einen schönen Milchviehbetrieb hatte. Dort lernte ich das Melken, das Füttern der Kälber, sogar Gülle durfte ich einmal fahren, das Abladen des Heus und Stapeln im Gulf und vor allen Dingen das gemütliche Beisammensein zum Essen um den Küchentisch. Dies sehr ausgeprägte Familienleben hat mir sehr gefallen, denn in dieser Form gab es das nicht bei uns zu Hause, schon berufsbedingt durch meinen Vater.
Nun geriet die Landwirtschaft immer stärker in meinen Fokus. Meinen sehr romantischen Gedanken an das Leben auf dem Land folgte alsbald die Ernüchterung. Das Hauptargument meiner Mutter war: „Kind, du machst dich abhängig von einem Mann, denn einen Hof können wir dir nicht geben!“ Wie ärgerlich, aber wahr! Außerdem wäre das Arbeitspensum beträchtlich, auch an Sonn- und Feier-tagen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Mein Bruder fand meine Idee einfach absurd und eine Verschwendung meines Potenzials.
Mamas Vorschlag, mir den Umgang mit Tieren und Natur als Hobby zu bewahren, wie Papa es auch tat durch Jagd und Hundeausbildung oder naturnahe Urlaube, hatte durchaus auch seine Berechtigung. Und letztendlich wollte ich ja auch Medizin studieren!
Doch daraus wurde gar nichts! Nicht mein Abitur, sondern mein starkes Heimweh führte mich zur hiesigen Sparkasse und zur Sparkassenfachwirtin. Manchmal läuft eben alles ganz anders – oder doch nicht?
Mit Begeisterung nahm ich 1987 meine Ausbildung in Angriff mit dem Hintergedanken: Vielleicht studierst du in drei Jahren doch noch. Aber der liebe Gott hatte anderes im Sinn. So lernte ich wohl vier Monate später Menno, meinen jetzigen Ehemann, kennen. Und dieser Menno war doch tatsächlich Bauer! Jetzt geriet ich in gewaltige Gewissenskonflikte, die von meinen Eltern auch kritisch hinter-fragt wurden, kannten sie doch mein Faible für die Landwirtschaft. Hatte ich mich in den Menschen Menno verliebt oder etwa in seinen bäuerlichen Hintergrund? Von zu Hause aus zu großem Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein erzogen, befand ich mich in einem echten Dilemma. Wir konnten nun schwerlich in die Stadt in eine Mietskaserne ziehen und Fließbandarbeit leisten, um festzustellen, wie es denn anders wäre. Auf jeden Fall begannen wir, Zukunftspläne zu schmieden, und standen 1991 vor dem Traualtar. Ich, als heulende Braut, mit der Bitte an den lieben Gott, die Hochzeit sofort zu beenden, wenn irgendetwas falsch wäre. Es passierte nichts!
Heute schaue ich auf 19 glückliche Ehejahre zurück. Wobei Glück relativ ist.
Unseren heutigen Biohof haben wir uns hart erarbeitet. Wir starteten mit dem Bau eines neuen Boxenlaufstalles und eines Wohnhauses. Meine Schwiegereltern wollten gerne auf dem alten Hof wohnen bleiben. Allerdings sollten die Generationen nicht mehr unter einem Dach leben. Meine Schwiegermutter pflegte damals ihre über 90-jährige Schwiegermutter und sie vertrat den Standpunkt: Früher zog man zusammen, aber das müsse heute ja wohl nicht mehr sein.
Der Hofzoo
Diese Einstellung fand ich einfach klasse! Und somit bauten wir auf der anderen Straßenseite. Eine schwere Erkrankung von Menno machte viele Pläne zunichte. Zunächst war ganz klar: Ich muss in meinem Beruf weiterarbeiten, damit wir uns nicht um unsere Exis-tenz sorgen müssten. Nach Mennos Genesung richteten wir uns dahingehend ein, dass ich in der Sparkasse arbeitete und Menno auf dem Hof. Wir mussten einige Zugeständnisse an seinen Rücken machen. Aber im Großen und Ganzen klappte es sehr gut.
1995 kam unsere älteste Tochter Janneke zur Welt – welche Freude! Trotzdem fing ich 18 Wochen nach der Geburt wieder Vollzeit in der Sparkasse an. Ich traute mich nicht, den dreijährigen Erziehungsurlaub anzutreten, hatte ich doch einen guten Arbeitsplatz und auch die politischen Rahmenbedingungen waren der Landwirtschaft nicht zuträglich. Also lieber auf Sicherheit bauen! In meiner Freizeit hatte ich doch genügend Möglichkeiten, auf dem Hof zu arbeiten!? Ich hatte überhaupt keine Zeit! 39 Wochenstunden Sparkasse plus Säugling plus Haushalt. Ich funktionierte einfach. Dann ein halbes Jahr später der Lichtblick. Mithilfe der neu eingesetzten Frauenbeauftragten wurde meine Stelle halbiert. Welch ein Luxus! Drei Jahre später wurde unser Sohn Menno-Heite geboren, und noch einmal fünf Jahre später bekamen wir unser jüngstes Töchterchen Helke. Nun blieb ich jeweils das erste Jahr zu Hause.
Rückblickend bin ich froh, dass ich mich durch diese Zeit durchgekämpft habe. Ich bin ein Grenzgänger gewesen! Nochmals würde ich das sicher nicht durchhalten: der chronische Schlafmangel, immer in Hetze, um pünktlich zum Stillen zu Hause zu sein, Haushalt, Garten. Gut, dass meine Schwiegermutter im Besonderen und meine Mutter, selbst noch berufstätig, mir zur Seite gestanden haben. Menno wurde zum Experten im Windelnzusammenlegen. Besuche wurden auf Sparflamme gehalten. Entweder stillte ich oder ich versuchte, früh zu schlafen. Heute frage ich mich manchmal, wie haben wir das bloß alles geschafft. Die Lösung ist ganz einfach: Menno und ich sind es gemeinsam angegangen! Wenn Menno in der traditionellen Rolle des Landwirts oder des Mannes an sich stecken geblieben wäre, gäbe es uns heute in dieser Form Familie mit unseren fünf Personen nicht! Und ich wäre vom Leben sicher sehr enttäuscht. Weil wir beide unkonventionell agieren und jeweils im Feld des anderen arbeiten können, finden wir für unseren großen Gemüsegarten, Haushalt, Kinder und Hof immer wieder Lösungen. Trotzdem gibt es natürlich auch bei uns eine Arbeitsteilung, und die ist ganz klassisch: Menno regiert hinten und ich vorne. Das ist für die Arbeitsabläufe einfach wichtig. Außerdem muss ein ständiger Austausch stattfinden, denn dadurch erfährt man etwas voneinander und sonst gingen die Gemeinsamkeiten verloren.
Vor vier Jahren haben wir beschlossen, endlich unseren Traum vom ökologischen Landbau zu verwirklichen. Zwei Jahre Umstellung liegen nun schon eineinhalb Jahre zurück. Es gab viele, sehr anstrengende Tage, an denen wir angezweifelt wurden. Aber Menno und ich glaubten an die Richtigkeit unseres Tuns. Unsere Kinder waren und sind begeistert, und das schweißt noch viel mehr zusammen. Nun sind wir also wieder auf einem neuen Weg mit unserem Biohof Lüntjenüst. Mit dieser Umstellung, die natürlich auch ökonomische Aspekte beinhaltet, ist aber die Wandlung weg vom Konsumdenken schlechthin zur Nachhaltigkeit einhergegangen. Ethische Werte, die für uns schon immer einen großen Stellenwert hatten, treten noch mehr in den Vordergrund. Den Fragen: Wo kommt etwas her? – Wie wird produziert?, kommen zentrale Bedeutungen zu. Ich habe längst aufgehört, nach Billigangeboten Ausschau zu halten. Vielfach leben wir nach dem Motto: Weniger ist mehr! Das bedeutet letztlich, dass wir zum Beispiel versuchen, auf Produkte der Massentierhaltung zu verzichten. Es bedeutet für mich aber auch einen Spagat beim Einkauf: Das eine will ich, das andere kann ich! Gelernt habe ich in den letzten Jahren, dass ich andere nicht missionieren muss, sondern ich muss vorleben. Hier komme ich jetzt an den Punkt, mich mit meinem erlernten Beruf auseinanderzusetzen. Zurzeit passt vor allem der verkäuferische Aspekt nicht mehr in mein Denkschema. Nun gab es vor einigen Monaten den Anstoß von Menno, der mich direkt fragte, ob ich mir vorstellen könnte, ganz auf dem Hof zu arbeiten. Meine Schwiegereltern haben schon ein hohes Rentenalter erreicht und ziehen sich immer mehr zurück. Obwohl Menno immer geplant hat, einen Einmannbetrieb zu führen, lässt sich dies aus gesundheitlichen Gründen nicht realisieren. Wird mein ewig gehegter Jugendtraum noch wahr? Was gibt es alles zu bedenken? Fragen über Fragen! Können Menno und ich überhaupt so eng zusammenarbeiten? Wir können! Nach Monaten intensivster Überlegung habe ich nun Stellung bezogen. Der Ruf der Verbraucher nach ökologisch angebauten Produkten bzw. Produkten der bäuerlichen Landwirtschaft bleibt hoffentlich im Fokus der Politik. Ich bereite zunächst nur vorübergehend meinen Ausstieg aus dem Angestelltendasein mit allen gebotenen Sicherheiten vor. Auch unsere häuslichen Abläufe ändern sich. Zum Beispiel planen die beiden großen Kinder ihr Frühstück weitestgehend allein: von Zwiebackmilch bis Spiegelei mit Schinken. Und sie sind stolz, wie selbstständig sie alles können, während ich erst die letzte Viertelstunde vor der Abfahrt zur Schule aus dem Stall komme, um noch kurz mit ihnen zu plaudern. Schön, dass unsere Erziehung zur Selbstständigkeit schon Früchte trägt. Unsere kleine Helke braucht natürlich noch mehr Unterstützung. Denn bei uns heißt es immer: zuerst die Familie. Ich werde trotz Mehrarbeit auf dem Hof viel freier sein. Denn nun kann ich innerhalb unseres Hofalltages meine Arbeit selber planen. Für meinen großen Wunsch nach Selbstversorgung wird mehr Zeit sein, vor allem ruhigere Zeit. Aber auch meine Hobbytiere, die Mohairziegen, deren Wolle ich verarbeite, mein Fjordpferd und das Pony, die Gänse, die Katzen, der Hund und bald auch die Hühner profitieren von meiner Gelassenheit, die mir im Urlaub von den Kindern bestätigt wird. Natürlich sind wir mehr angebunden als andere, aber so empfinde ich es nicht. Ich erfreue mich am Sonnenaufgang beim Küheholen. Es ist einfach schön, beim Vormittagskaffee kleine Zicklein auf den Pferden herumhüpfen zu sehen. Mittags essen wir im Garten und Libellen und Schmetterlinge umschwirren uns. Nachmittags aalen sich die Katzen in der Sonne und abends kehrt alles zur Ruhe. Im Herbst und Winter gibt es ein prasselndes Kaminfeuer und gute Musik und leckeren selbst gemachten Punsch und eigene Kekse. Menno spielt mit den Kindern und ich lese ein gutes Buch oder stricke oder spinne.
Die intensive Nähe zur Natur lässt mein Herz weit werden, und ich bin dankbar, dass ich so viel Lebensglück erfahren darf. „Wenn du die Ruhe nicht in dir selbst findest, ist es zwecklos, sie anderswo zu suchen“, sagt Friedrich Nietzsche. Meine Familie und der Hof sowie das weite Land sind mein Kraftzentrum. Nirgends möchte ich lieber sein. Das Phänomen unserer Gesellschaft, keine Zeit zu haben, macht auch vor mir nicht halt, dann muss ich Prioritäten setzen. Das Gute an der Arbeit ist, dass sie nicht wegläuft. Mennos Omas Ausspruch war immer, wenn man keine Lust hat, muss man sich welche machen und dann mit dem Herzen dabei sein. Wie recht sie hatte! Und wenn alles doch einmal überhand nimmt, beflügelt mich ein Wort von Astrid Lindgren: „… und manchmal muss man einfach nur dasitzen und gucken!“
Dani, Agraringenieurin, Baden-Württemberg
Das Ergebnis von vielen Zufällen
Ich bin geboren und aufgewachsen in der DDR. Der heutige Landesname Sachsen war damals nicht präsent in den Köpfen, wir wohnten im Bezirk Dresden. Meine Kindheit in einem dörflich geprägten Randbezirk einer mittelgroßen Kreisstadt erlebte ich als wunderschön: wohlbehütet, unbekümmert, voller Abenteuer im Kreis befreundeter Nachbarskinder, ohne große Pflichten seitens meiner Eltern. Unsere Familienverhältnisse empfand ich als Kind ideal. Meine Mutter war meine liebste Vertraute, mein Vater mein Idol und Beschützer, der einfach alles konnte. Mit meinem drei Jahre älteren Bruder teilte ich mir ein Zimmer, es gab die üblichen Streitereien, aber so ein großer Bruder bot auch Vorteile. Im gleichen Mietshaus hatte noch meine Oma mütterlicherseits eine kleine Wohnung im Dachgeschoss, sie war also auch ständig präsent und gehörte immer mit zur Familie. Davon dass wir finanziell nicht sonderlich gut ausgestattet waren, spürte ich nichts: Meine Welt war in Ordnung. Und das kleine bisschen Luxus kam ab und an von der Westverwandtschaft in Form von Paketen mit abgelegter Kleidung, die mich davor bewahrte, eine „Ost-Jeans“ tragen zu müssen.
Bei der Einschulung
Wir waren insofern nicht die typische Durchschnittsfamilie, da meine Mutter sich bewusst gegen die allgemein übliche Vollzeit-berufstätigkeit für Frauen entschieden hatte, zumindest solange wir Kinder klein waren. Aufgewachsen in der Nachkriegszeit als einzige Tochter einer alleinstehenden Flüchtlingsfrau war für sie das häufige Alleinsein schon als Kleinkind wohl eine schlimme Erfahrung. Ihren eigenen größten Kindheitswunsch, eine richtige Familie, wollte sie ihren Kindern unbedingt erfüllen. Auch ihr späterer Wiedereinstieg ins Berufsleben bestand aus Arbeit, die sie größtenteils von zu Hause aus erledigen konnte. Ich wusste das damals wahrscheinlich nicht richtig zu schätzen. Im Gegenteil, wie oft habe ich mir gewünscht, einmal „Schlüsselkind“ zu sein wie viele meiner Schulkameraden, dass eben niemand zu Hause ist, wenn ich aus der Schule komme. Auch mein Vater verhielt sich nicht systemkonform, er machte sich 1974 mit einem kleinen Handwerksbetrieb selbstständig. Vater war und ist ein Einzelgänger und Querdenker, der in den steifen Strukturen eines sozialistischen Betriebes ständig aneckte. Die Selbstständigkeit war kein Zuckerschlecken für meine Eltern und nur mit besonderen Auflagen überhaupt erlaubt, aber mein Vater konnte doch sein eigener Herr sein. Und mich erfüllte dieser Sonderstatus als eine der wenigen Möglichkeiten von Anders-sein durchaus mit Stolz. Mein Elternhaus war immer gegen den Staat eingestellt, ich habe wie viele andere von klein auf gelernt zu unterscheiden, was ich zu Hause und in der Öffentlichkeit sagen darf. Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar ist dies für uns früher ganz normal gewesen.
Landwirtschaft spielte zunächst keinerlei Rolle in meinem Leben. Meine Eltern hatten beide nichts mit Landwirtschaft zu tun. Ich war halt sehr naturverbunden und tierlieb, dies wurde mir auch so vorgelebt. Ein verletzter Spatz, eine kranke Katze – sowohl mein Vater als auch meine Mutter konnten kein Tier leiden sehen. Sie setzten alles daran, ihm zu helfen. Die allerersten Kontakte zur „Landwirtschaft“ überhaupt hatte ich in unserem Schrebergarten, und sie bestanden aus Unkrautjäten, eine schreckliche, endlos scheinende Arbeit.
Als ich 13 Jahre alt war, zog meine Familie aufs Dorf und ich wechselte die Schule. Das Leben im Dorf wurde in vielfältiger Weise geprägt von den LPG (Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften) bzw. in unserem Fall GPG (Gärtnerischen Produktionsgenossenschaften): landwirtschaftlichen Großbetrieben, in denen viele Dorfbewohner arbeiteten, nicht nur im Stall oder auf dem Feld, sondern auch als Handwerker, Mechaniker, Bauarbeiter, Küchenkräfte, Buchhalter, Büroangestellte, … So fand die „Praktische Arbeit“, ein Unterrichtsfach ab der achten Klasse, für uns ebenso in der örtlichen GPG statt. Alle 14 Tage ein halber Tag Mitarbeit in der Produktion, das bedeutete im Sommer Rüben hacken, Tomaten oder Blumenkohl ernten auf nicht enden wollenden Ackerreihen, im Winter Petersilie für den Verkauf bündeln, Berge von Kohlköpfen putzen in riesigen Lagerhallen mit Eisfüßen und bei penetrantem Gestank nach verfaultem Kohl. Zensuren gab es nach Erfüllung der Norm, die ich nie erreichte. Meine wichtigste Erkenntnis aus diesen Erfahrungen mit der praktischen Landwirtschaft war für mich: Niemals möchte ich mit so einer stupiden Arbeit, bei der man jedem Wetter ausgesetzt ist, mein Geld verdienen müssen.
Bei der Suche nach einem passenden Beruf für mich ließ ich mich mangels eigenen Wissens stark von den Ansichten meiner Eltern beeinflussen. Besonders meine Mutter hatte sehr konkrete Vorstellungen davon, was für ihre Tochter geeignet wäre oder – besser noch – was gar nicht in Frage käme. Zu Letzterem zählten u. a. Bauwesen, Maschinenbau und Landwirtschaft. Ihr vorgefertigtes Bild, das sie mir überzeugend von diesen Branchen vermittelte, war: dreckige, schwere Arbeit, raue Umgangssitten, wo Frauen selbst in der „Führungsebene“ einen schweren Stand haben.
Aufgrund meiner Vorliebe für Fremdsprachen wollte ich schließlich Dolmetscherin werden. Sicher verbarg sich dahinter auch die Hoffnung, mit diesem Beruf der Enge dieses Staates entfliehen zu können, etwas von der Welt zu sehen. Das Gefühl von Eingesperrtsein bestimmte aus der Erinnerung heraus meine Jugend. Was meine politische Gesinnung anging, hatte ich in der kirchlichen Jugendarbeit einen Platz gefunden, wo man Gleichgesinnte traf und der staatlich verordneten Langeweile und Verblödung entfliehen konnte. Aber das befreite mich nicht von der Wut und Verzweiflung, die ich empfand, wenn unsere Verwandtschaft aus Nürnberg nach ihren jährlichen Besuchen wieder nach Hause fuhr, wenn ich bei Reisen nach Berlin in greifbarer Nähe und doch unendlich weit weg die Hochhäuser der Gropiusstadt in Westberlin sah oder wenn ich mich mit meiner Brieffreundin aus Schwaben in Berlin traf und wir uns abends in der S-Bahn verabschiedeten, weil ich aussteigen musste, bevor die Bahn sich dem Grenzbahnhof näherte. Dies alles waren Boten aus einer Welt, die zwar nebenan lag, aber für mich unerreichbarer schien als der Mond. Noch heute spüre ich bei der Erinnerung daran diese Ohnmacht und ich muss mit den Tränen kämpfen. Andererseits bin ich im Nachhinein dankbar für diese negative Erfahrung. Ich bin überzeugt, niemand kann Freiheit so schätzen, wenn sie immer selbstverständlich dazugehörte.
Natürlich hätten wir wissen müssen, dass für den Beruf des Dolmetschers nicht nur sehr gute Sprachkenntnisse vorausgesetzt würden. Wir wussten es ja auch, aber es war mir einen Versuch wert und ich meldete mich für die Vorprüfung an, ohne die man sich gar nicht erst bewerben durfte. Bei diesem Test flog ich erwartungsgemäß durch. Es wurde mir nicht mitgeteilt, ob es an der wahrheitsgemäßen Beantwortung der Fragen des ersten Teils („Haben Sie Kontakte ins nichtsozialistische Weltsystem?“), an mangelnden Fremdsprachenkenntnissen oder an beidem lag.
Verschwenderische Fülle im Garten
Was nun? Ich konnte ausgezeichnete schulische Leistungen vorweisen, und das bewog meine Eltern, mir zu einer Bewerbung für ein Medizinstudium zu raten. Auch da wurde ich abgelehnt, die Studienplätze waren begrenzt und ich konnte außer meinen guten Noten nicht viele Aspekte in meinem Lebenslauf nachweisen, die mich als zukünftige Ärztin qualifizierten.
Mein Weg hin zur Landwirtschaft ist wahrhaftig kein Ruhmesblatt. Letztendlich bewarb ich mich im zweiten Durchgang für ein Landwirtschaftsstudium, weil wir über meine Mutter Kontakte zum Leiter eines Futtermitteluntersuchungslabors hatten, der sich wieder-um mit Leib und Seele der Landwirtschaft verschrieben hatte und mir eine rosige Zukunft in der Forschung ausmalte. Ich sollte zunächst Pflanzenproduktion studieren – das war nicht so gefragt, da bekam man problemlos einen Platz – und nach dem Grundstudium zur Pflanzenzüchtung wechseln. „Züchtung“ klang wohl auch für meine Eltern akzeptabel und so entschieden wir uns mangels Alternativen für diesen Weg. Einmal beim Studium angelangt, habe ich den Plan mit der Züchtung bald aufgegeben, der Stoff war selbst mir zu trocken und Statistik als eine der tragenden Säulen zählte nicht zu meinen Stärken.
Das für dieses Studium notwendige Vorpraktikumsjahr absolvierte ich in besagtem Futtermittellabor. Die Arbeit machte mir Spaß und ich traf dort zum Teil Menschen, die sich wirklich engagierten, die mitdachten und denen das Ergebnis ihrer Arbeit am Herzen lag. Zum ersten Mal erfuhr ich, dass acht Stunden tägliche Arbeit nicht nur Pflichterfüllung, sondern auch wichtig für das eigene Selbstverständnis sein können.
So interessant die Untersuchung der Qualität von Silage und Grünfutter auch war, sie bot wenig Einblick in Fragen des praktischen Ackerbaus. Also startete ich mein Studium mit wenig bis gar keinem Basiswissen über Landwirtschaft. Ich glaube, das ist einer der Gründe, weshalb ich den Lerneffekt meines Studiums als ungenügend einschätzen muss. Heute ist meine Meinung, dass ein solches Studium nur mit einer umfassenden praktischen Vorbildung Sinn macht. Fast alles Wissen und alle Fähigkeiten, die ich heute im Berufsalltag brauche, habe ich mir außerhalb des Studiums angeeignet. So fehlt mir heute auch jeder Respekt vor irgendwelchen Titeln – ich weiß, was hinter einem Dipl.-Ing. stehen kann.
Die während des Studiums absolvierten Praktika verlangten mir Dinge ab, die ich mir allein nie zugetraut hätte. Aber da wurde ich gar nicht gefragt, ich musste einfach Schlepper und Mähdrescher fahren. Es gab genügend Pleiten und Pannen, auf die ich lieber nicht näher eingehen will. Aber doch hat es mein Selbstvertrauen gestärkt, das ist für mich aus heutiger Sicht der größte Gewinn daraus. Und es zeigte sich, dass ich vor der realen Arbeitswelt nicht beschützt werden musste: Entweder war sie nicht so schlimm oder ich war nicht so zart besaitet, wie mir mein Elternhaus – sicher mit den besten Absichten – vermittelt hatte. Ich weiß, dass meine Eltern dann auch sehr stolz darauf waren, was ihre Tochter alles zuwege brachte.
Mitten in die Zeit meines Studiums fiel die Wende. Sah ich meine Zukunft vorher auf irgendeiner LPG als Brigadier, gern im Norden der DDR, war nun alles offen. Ich ergriff die Möglichkeit, für ein paar Wochen auf einem (für meine Verhältnisse) kleinen Bauernhof in Westdeutschland mitzuarbeiten, und stillte nach dem Studium mein Fernweh mit einem mehrmonatigen Auslandspraktikum. In beiden Fällen wurde ich erstmalig mit dem Gefühl von Stolz auf das selbst Geschaffene und Verantwortung für den eigenen Besitz konfrontiert. Das war mir vollkommen fremd, bei uns gehörte immer alles allen und somit keinem. Gleichzeitig entwickelte sich die Ahnung, dass mit Aufgabe der kollektiven Landwirtschaft – selbst wenn diese erzwungen war - doch auch Potenzial für effektiveres, zeitgemäßes Arbeiten verloren geht.
Während eines Kurses in Süddeutschland in den Semesterferien lernte ich meinen späteren Mann Dietmar kennen. Auch er war ein Quereinsteiger in die Landwirtschaft, der aber bereits in der Kindheit jede freie Minute auf einem benachbarten Bauernhof verbracht hatte und genau wusste, dass er später mal Landwirt werden wollte. Er hatte daher schon viel konkretere Vorstellungen von seinem beruflichen Werdegang als ich. Ich hatte mich mehr treiben lassen von äußeren Einflüssen, und die Entscheidung letztendlich für die praktische Landwirtschaft fällte ich ihm zuliebe. Nach meiner Rückkehr aus Australien kamen wir überein, dass eine Fernbeziehung auf Dauer für uns nicht in Frage kam, und daher bemühte ich mich um eine Arbeitsstelle in der Nähe des Studienortes meines Freundes, ohne darauf zu bestehen, dass diese meiner Ausbildung entsprach. Ein Lohnunternehmer, für den Dietmar schon längere Zeit neben dem Studium jobbte, bot mir eine Stelle als Maschinenführerin an. Seinen Mut bewundere ich heute noch und ich rechne es ihm hoch an, dass er mir so viel Vertrauen entgegenbrachte – ich selbst hätte es nicht gehabt. Und wie bei den Praktikumseinsätzen standen wieder Arbeiten an, die ich doch eigentlich gar nicht konnte. Ich lernte in kürzester Zeit, mit dem MB-Trac Straßenränder zu mulchen und freizuschneiden, mit dem Ungeheuer von Getreidemahl- und -mischanlage von Hof zu Hof zu ziehen, ansehnliche Zuckerrübenhaufen anzulegen und konnte auch meine Mähdruscherfahrungen zum Einsatz bringen. Nicht alles ging glatt, aber teilweise wurde ich sogar ausdrücklich gelobt von den Auftraggebern, die angesichts einer so jungen Frau auf den Maschinen wohl Schlimmeres erwartet hatten. Bald fühlte ich mich nicht mehr als „Ossi“ in der Fremde, und wenn ich doch daran erinnert wurde, war es kein negatives Gefühl. Nach einem Jahr wechselte ich in eine andere Firma in einer anderen, aber auch mit der Landwirtschaft verbundenen Branche. Die Stelle bot mehr Verantwortung und ich war vorrangig im Büro, aber auch praktisch tätig. Diese Mischung gefiel mir recht gut. Mir machte die Arbeit Spaß, da ich merkte, dass ich anerkannt werde und in der Lage bin, für mich selbst zu sorgen. Aber es war sicher nicht die Erfüllung meiner Träume. Mein Lebensziel sah ich auch nicht darin, möglichst viel zu arbeiten und alles andere hintanzustellen. Nein, meine Freizeit war mir wichtig, ich wollte reisen, mir etwas leisten, mein unabhängiges Leben genießen. In dieser Einstellung unterschied ich mich schon grundlegend von meinem Freund, mehr, als es mir damals vielleicht bewusst war.





























