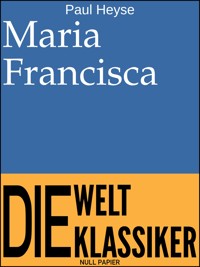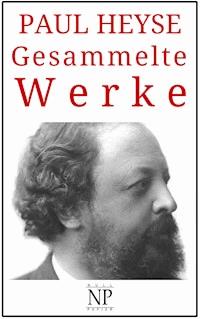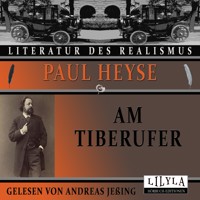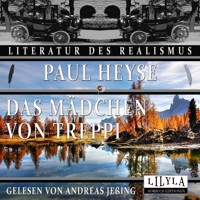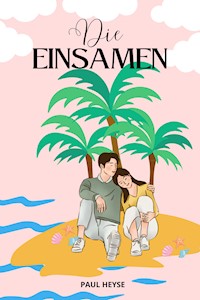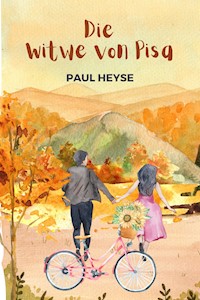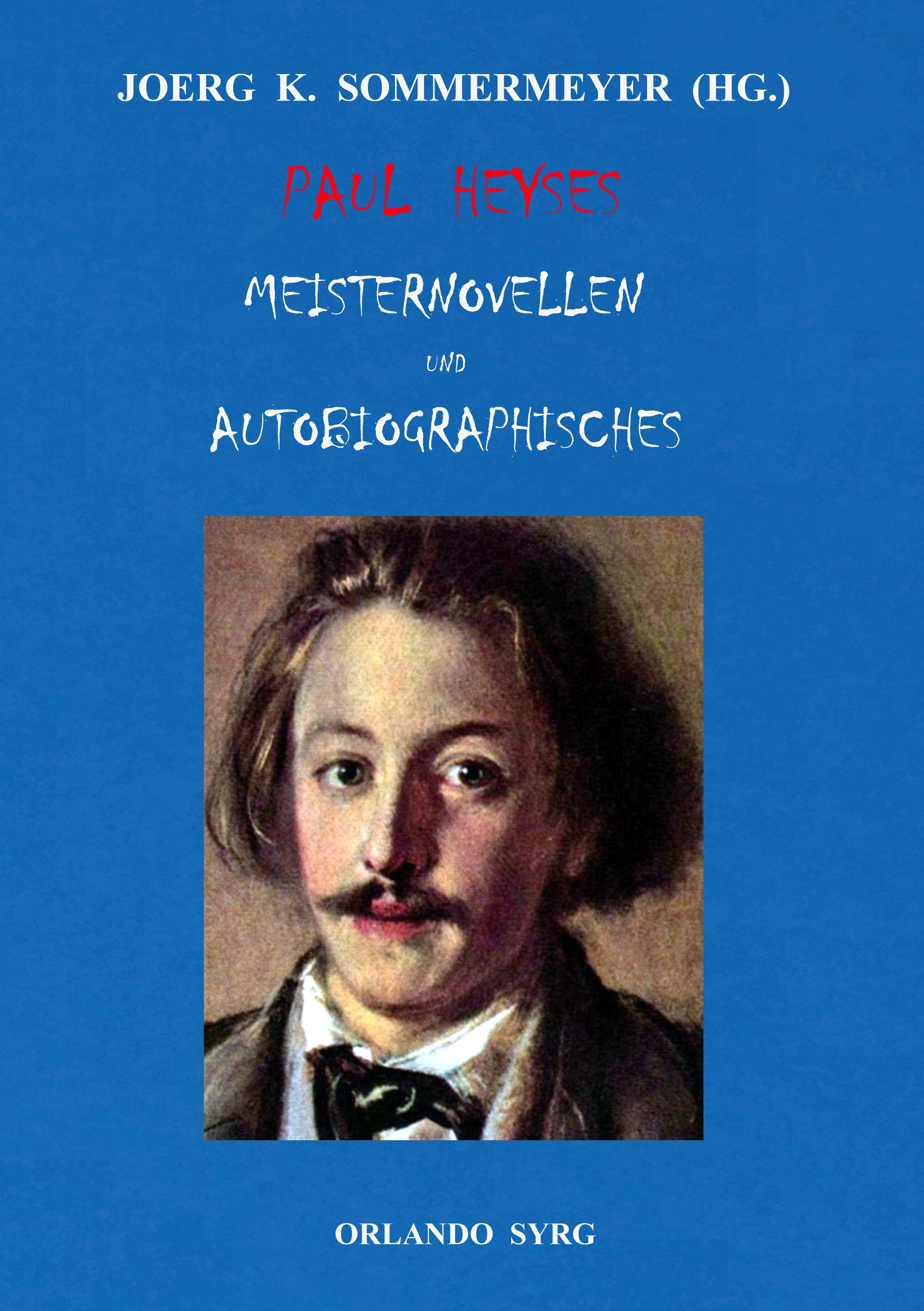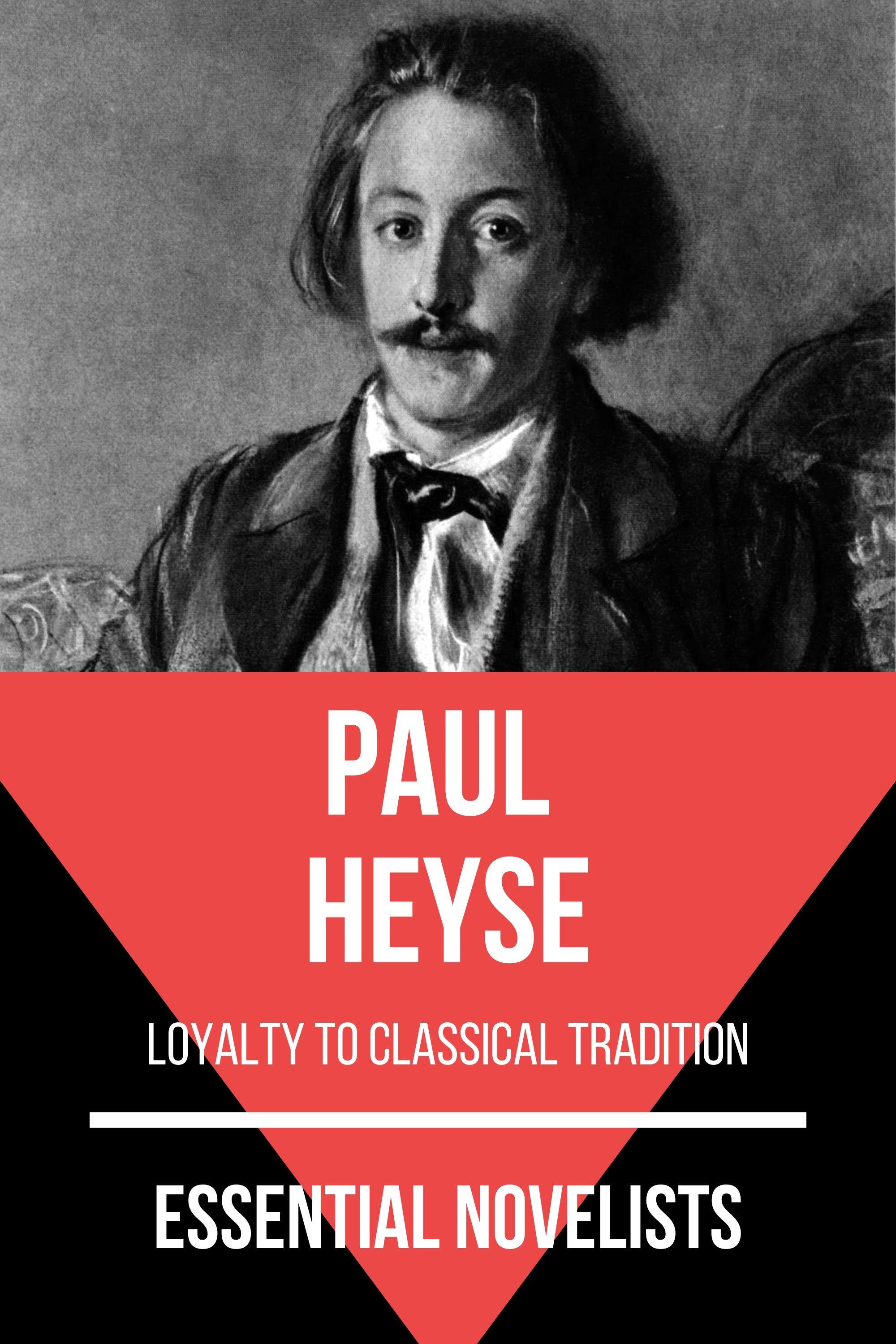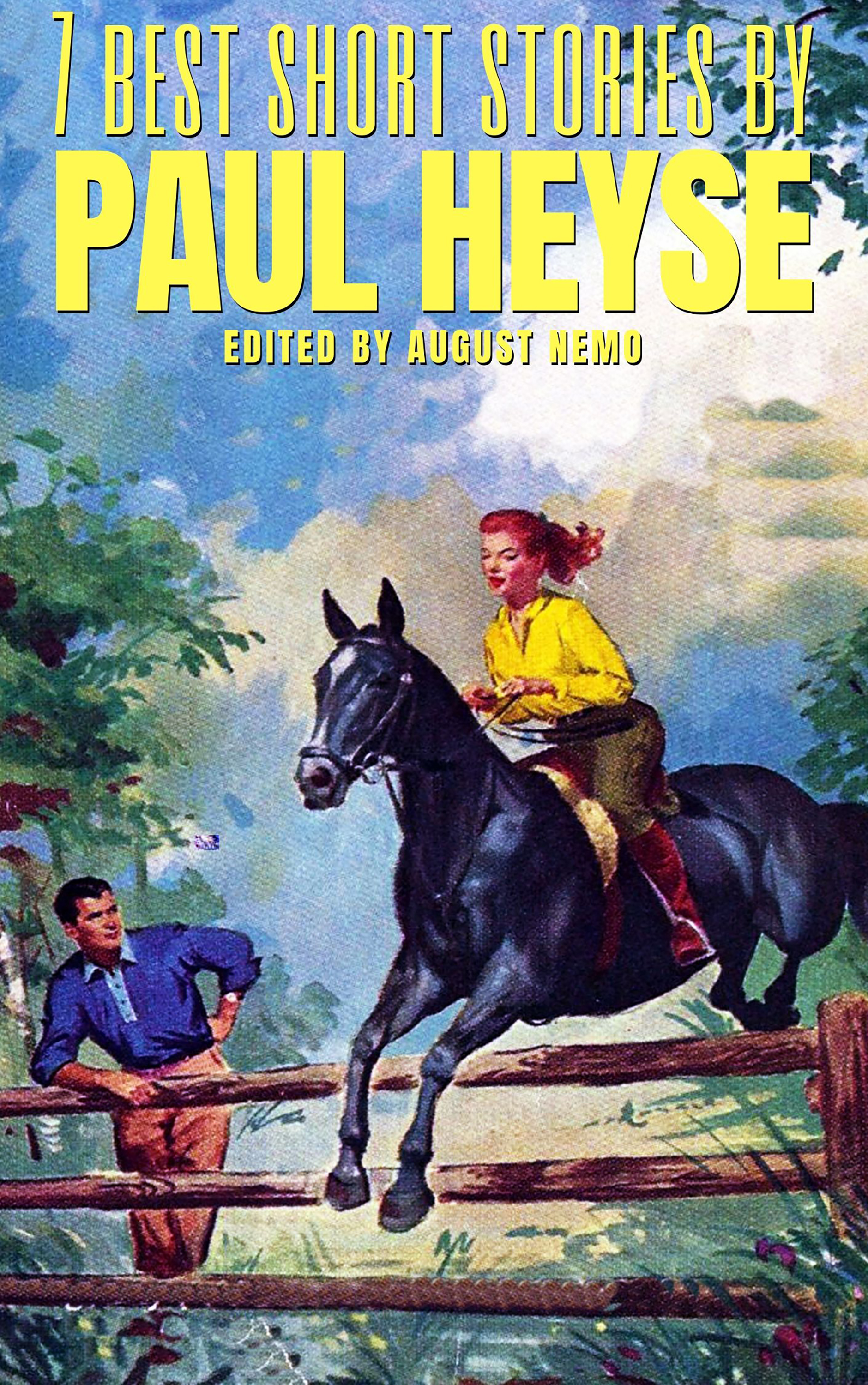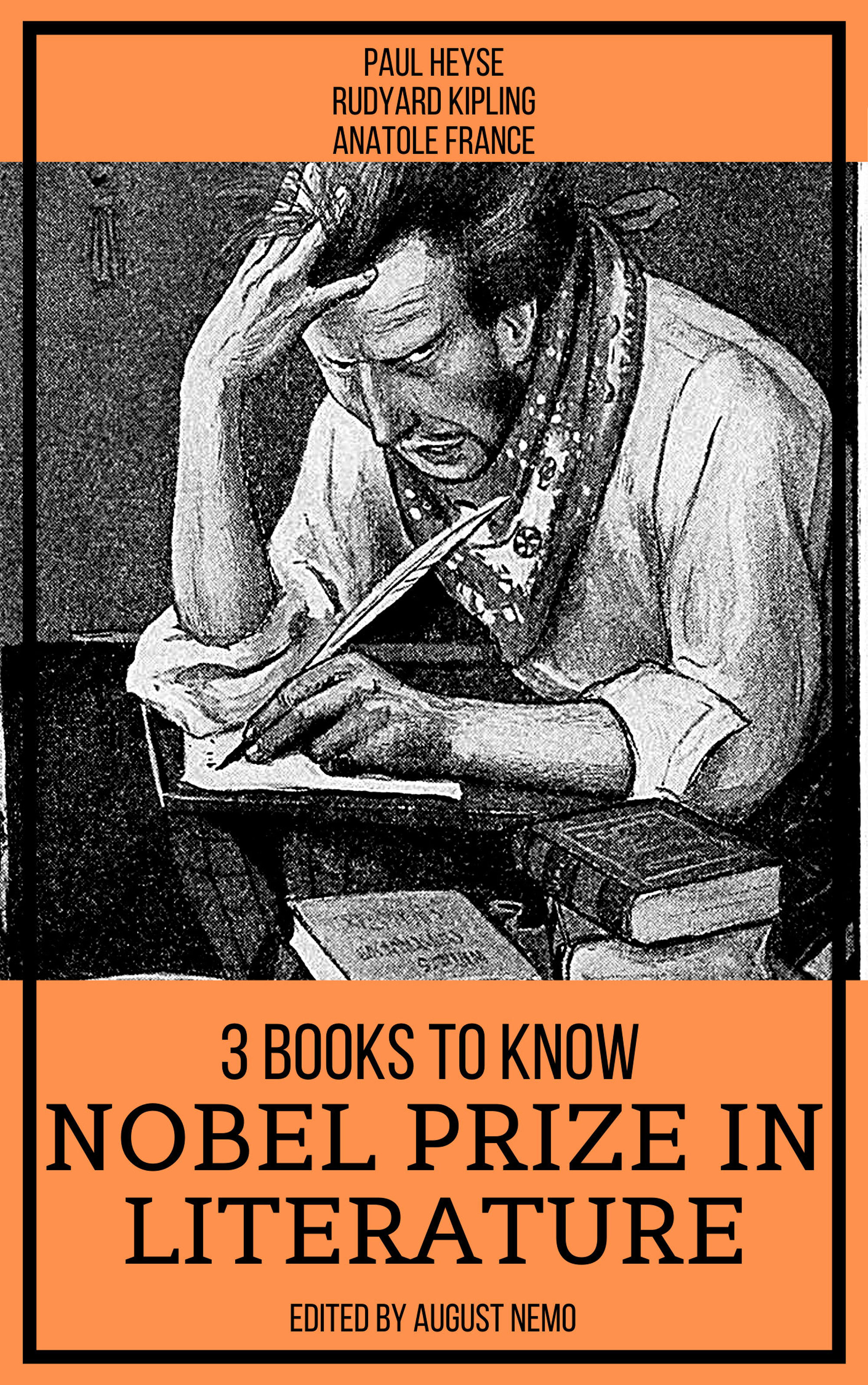Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Paul Johann Ludwig von Heyse (15.03.1830–02.04.1914) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Neben vielen Gedichten schuf er rund 180 Novellen, acht Romane und 68 Dramen. Heyse ist bekannt für die "Breite seiner Produktion". Der einflussreiche Münchner "Dichterfürst" unterhielt zahlreiche – nicht nur literarische – Freundschaften und war auch als Gastgeber über die Grenzen seiner Münchner Heimat hinaus berühmt. 1890 glaubte Theodor Fontane, dass Heyse seiner Ära den Namen "geben würde und ein Heysesches Zeitalter" dem Goethes folgen würde. Als erster deutscher Belletristikautor erhielt Heyse 1910 den Nobelpreis für Literatur. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Heyse
Unheilbar
Novelle
Paul Heyse
Unheilbar
Novelle
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962811-97-6
null-papier.de/newsletter
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Unheilbar
Meran, den 6. Oktober 186∗
Seit acht Tagen, die ich nun hier bin, keine Zeile geschrieben! Ich war zu erschöpft und aufgeregt von der langen Reise. Wenn ich mich niedersetzte und auf die weißen Blätter starrte, war mir’s, als blickte ich in eine Camera obscura. Alle Bilder, die mir unterwegs entgegen geflogen waren, tauchten ganz deutlich und farbig wieder auf und jagten sich wie im Fiebertraume, bis mir die Augen übergingen. Unterwegs fühlte ich auch mehr als ein Mal, dass mir die Tränen nahe waren; aber ich war nicht allein, und von den fremden Herren, die mitfuhren, bemitleidet und ausgefragt zu werden, hatte ich wahrlich keine Lust. Hier ist’s anders; ich bin einsam und frei; ich habe es schon erfahren, dass nur die Einsamen frei sein können. Warum schäme ich mich denn auch jetzt noch, zu weinen? Ist es denn nicht traurig genug, dass ich erst einen Blick in alle Schönheiten dieser Welt tun durfte, seit ich weiß, dass es ein Abschiedsblick ist? –
Es wäre wohl besser, ich verschlösse dieses Heft und ließe die Blätter leer. Womit kann ich sie füllen, als mit unfruchtbaren Klagen? Ich hatte es mir schön und tröstlich gedacht, alles niederzuschreiben, was mir in diesem letzten Winter, den ich noch zu leben habe, durch den Sinn gehen würde. Ich wollte meinem geliebten Bruder, meinem kleinen Ernst, der jetzt doch noch zu jung ist, um das Leben und den Tod zu verstehen, an diesem Hefte ein Vermächtnis hinterlassen, das ihm teuer wäre, wenn er später einmal nach seiner Schwester fragte und Niemand da wäre, der ihm antworten könnte. Aber ich sehe wohl, es war ein törichter Gedanke. Möchte man denn in der Erinnerung eines teuren Menschen fortleben unter dem Bilde der letzten Krankheit? Er soll mich lieber vergessen, als sich diese blassen Züge einprägen, die mich selber erschrecken, so oft ich in den Spiegel sehe.
Abends. Schwüle, bedeckte Luft.
Ich habe ein paar Stunden lang am Fenster gesessen. Man sieht da weit in das schöne Etschland hinaus, über die Stadtmauer, die Allee mit den breitästigen Pappeln, die auf dem Steindamme längs der rauschenden Passer stehen, in die Niederung hinein, wo die Herden zwischen den hundert kleinen Bächen weiden, bis zu den fernen Bergen. Die Luft war ganz still; ich konnte sogar einzelne Stimmen von den Spaziergängern auf der Wassermauer unterscheiden; oder schien mir’s nur so? Die Kinder meines Wirts, des Schneiders, sahen neugierig zur Tür herein, bis ich ihnen das Letzte von meiner Reise-Schokolade gab. Wie glücklich sie damit zur Mutter hinausliefen! Ich bin dann ganz heiter und still geworden und habe mir’s überlegt, dass ich Unrecht täte, mich vor meinen Selbstgesprächen zu fürchten. Mögen diese Blätter doch immerhin ein Testament sein – müssen sie darum schon Trauer tragen? Bin ich nicht von Hause, wo ich wie mit hundert Banden eingeschnürt war, mit herzhaftem Entschlusse fortgegangen, noch einmal des Lebens und der Freiheit froh zu werden, und sollte mir jetzt das Zeugnis geben, dass ich nicht verdiente, frei zu sein? Freilich, ich weiß, es ist ein kurzes Glück. Aber um so fester muss ich es halten und mir’s nicht durch Schwäche und Versinken in Selbstbemitleidung verkümmern. – –
Die Wirtin hat mir erzählt, dass heute früh ein Meraner Bürger in den besten Jahren, der nie eine Krankheit gehabt, plötzlich gestorben sei. Alle hätten ihm immer ein langes Leben zugetraut, und er selbst sich wohl auch. Bin ich nicht zu beneiden, wenn ich mich mit ihm vergleiche? Er wird eben auch, wie die meisten Menschen, in Mühe und Arbeit hingelebt und gedacht haben, die Zeit, um auszuruhen und sein bischen Leben auch zu genießen, werde endlich einmal kommen, wenn genug er geschafft und erworben hätte. Er hat sein Ziel nicht gekannt; ich kenne das meinige; das ist der Unterschied. Ist er nicht zu meinen Gunsten? Ist es nicht noch lange genug bis zum Frühling, und würde ich diese Gnadenfrist auskosten, wie ich jetzt tue, wenn ich sie nicht kennte? O es ist in Wahrheit eine Gnade, vom Tode nicht überrascht und überfallen zu werden, ihn langsam kommen zu sehen, dass man, Auge in Auge mit ihm, erst noch leben lernen kann! Ich kann es unserm Arzt, meinem lieben, väterlichen Freunde, nie genug danken, dass er mir die Wahrheit nicht verschwieg. Er hat dadurch das Wort, das er meiner sterbenden Mutter gab, mir immer ein Freund zu sein, reichlich eingelöst.
Die Nacht ist nun hereingebrochen; ich kann kaum mehr sehen, was ich schreibe. Habe ich mein Leben lang jemals einen so tiefen Frieden, um mich und in mir, genossen, wie hier in diesem schönen, blühenden, rebenbekränzten Vorhof des Grabes? Nur einen Hauch davon in deine gepresste, kummervolle Seele, mein armer Vater! Gute Nacht! Und gute Nacht, mein kleiner Ernst! Wer wird dich heute zu Bette gebracht und dich mit Märchen in Schlaf geplaudert haben?
Am 6. Nachmittags.
Meine Frau Meisterin hat heute, als sie mir das Essen brachte, mir eifrig zugeredet, nicht immer im Zimmer zu sitzen, es sei so schön auf der Wassermauer, man sehe da so viele Leute, ich müsse mich doch zerstreuen. Ich konnte der guten Seele nicht begreiflich machen, dass es mir lieber sei, mich zu sammeln, als mich zu zerstreuen, dass ich nach fremden Menschen gar kein Verlangen trüge.
Nur dass ich noch zu schwach und müde sei von der Reise und die zwei steilen Treppen mir beschwerlich fallen, hat ihr endlich eingeleuchtet.
Nun sitz’ ich wieder und schreibe. Die Stickerei habe ich weglegen müssen; sie greift mir jetzt die Brust an; auch das kleine Töchterchen des Wirtes, dem ich täglich Unterricht in Handarbeiten geben will, musste ich wieder wegschicken. Es liegt mir auch ein Zweifel im Sinn, der mich erst heute beim Aufwachen, da aber ganz heftig und heiß überlief, und mit dem ich erst ins Reine kommen muss.
Seltsam, dass er mir nicht früher begegnet ist. Ich war so völlig überzeugt, das Rechte zu tun. Ich wusste so deutlich, dass ich Niemand zu Hause fehlen würde, dass mein Vater jeden ungütigen Stiefmutterblick, der mir galt, schwer empfand, dass ich auch für Ernst überflüssig war, seit die Mutter darauf bestanden hat, ihn trotz seiner Jugend in die Pension zu tun, nur um ihn nicht mehr zu sehen und für ihn sorgen zu müssen. Der Vater weinte, als er mich zum letzten Mal an sich drückte. Aber es erleichterte ihm doch das Herz, mich fortreisen zu sehen. Er gönnt mir das Beste; und was kann er für mich tun? – Nun ist es mir dennoch auf einmal nahe getreten, ob ich nicht noch andere Pflichten zurückgelassen habe, ob ein Mensch, so lange er nicht ganz unfähig ist, die Hände in den Schoß legen und einen winterlangen Feierabend genießen darf? – Erst seit ich mich glücklich fühle, seit aller Staub und Druck des kahlen kleinstädtischen Alltagslebens von mir abgefallen ist, frag’ ich mich, welch ein Recht ich habe, glücklicher zu sein, als die Tausende, die dem Tode nicht ferner sind, als ich, und doch bis auf den letzten Blutstropfen kämpfen müssen! Und ich schließe hier einen selbstsüchtigen Waffenstillstand mit dem Feinde und feiere ein Fest, als hatte ich den größten Sieg davon getragen? –
Am 8. Oktober.
Die Antwort, die ich mir damals schuldig blieb, weil mein armer Kopf sich nicht Rats wusste, ist mir nun zu Teil geworden. Ich bin von meinem ersten Ausgange so zerbrochen und ausgelöscht nach Hause gekommen, als hätte ich einen harten Arbeitstag in Ketten hinter mir. Nein, ich tauge nur noch für das Gnadenbrot, und wenn es mir süßer schmeckt als Manchem, wird mir’s ja wohl kein Vorwurf sein. Ich bin auch genügsamer als Mancher.
Und wenn ich Niemand mehr nütze, wem falle ich denn zur Last? Mein kleines mütterliches Erbe, auch wenn ich es nicht angriffe, um es für Ernst aufzuheben, könnte es ihm die Pflicht ersparen, sich mit eigener Arbeit durchs Leben zu helfen? Es wird auch noch davon übrig bleiben, denn wie ich heute erfahren habe, ist der Rest meiner Kräfte armseliger, als ich dachte. Wer weiß, wie kurz mein Winter im Süden sein wird.
Ich werde nicht oft unter die Pappeln hinausgehen. Es war mir nicht wohl unter den armen, schleichenden, hüstelnden, geputzten Menschen, die mit ihren Traubenkörbchen am Arm herumschwankten und mit jeder Beere begierig einen Tropfen Hoffnung einsogen. Die aber, denen die Hoffnungslosigkeit auf dem Gesichte stand, fühlte ich mir noch fremder. Es mag wohltuend sein, mit Leidensgefährten zu verkehren. Aber wenn das gleiche Schicksal ungleiche Gesinnungen erzeugt, so trennt das, was vereinen sollte, und man fühlt den Abstand der Gemüter um so deutlicher. Keinen habe ich gesehen, dem ich mich getraut hätte von meiner festlichen und dankbaren Stimmung ein Wort zu sagen. Sie hätten mich für eine Überspannte, vom Fieber Verstörte, oder für eine Heuchlerin gehalten.
Und kann ich es ihnen übel nehmen? Es ist möglich, dass auch ich den Tod mehr fürchtete, wenn ich das Leben mehr liebte. Warum war das meine nicht liebenswürdiger?
Es können sich auch wohl nur Wenige vorstellen, in welch erhabener Größe und Stille diese Natur auf eine arme Seele wirkt, die zweiundzwanzig Jahre nicht den Fuß aus den Mauern einer kahlen, engen, spießbürgerlichen kleinen Stadt gesetzt hat. Man reist so viel heutzutage. Auch ich wäre wohl früher aus unserer traurigen Einöde herausgekommen, ohne die lange Krankheit der Mutter und dann, als sie gestorben war, meine Mutterpflichten gegen den Kleinen. Nun ist mir dieses wundervolle Tal schon wie ein Jenseits, ein wahrer Garten Gottes, und die ersten Atemzüge darin waren so berauschend, als trügen schon Flügel meine Seele über den Boden hin. Dass sie meinem Körper nicht besser halfen, als ich wieder die enge, steile Treppe hinaufschlich, war freilich schlimm. Aber ich habe ja auch unten nichts zu suchen. Jeder Blick aus dem Fenster ist schon wie ein Ausflug ins Paradies.
Meine Wirte sind sehr arm, der Mann arbeitet bis in die Nacht hinein, die Frau hat alle Hände voll mit den vielen Kindern zu tun, im Hause sieht es düster und unfreundlich aus. Wie ich zuerst mit dem Hotel-Diener, der mir diese Wohnung nachwies – wahrscheinlich weil er aus meinem einfachen Anzuge auf meine Kasse schloss – die langen, dunklen Gänge und trüben Höfe durchschritt und die baufällige Stiege hinaufkletterte, über die Flure, auf denen verstaubter Hausrat: alte Spinnräder, Bettstücke, Geschirr und Mais-Vorräte, bunt durch einander liegt und die Spinnen jahrelang ungestört ihre dichten Gewebe wirken, wurde mir die Brust zugeschnürt, und das Herz klopfte mir so stark, dass ich auf jeder dritten Stufe still stehen musste. Aber der erste Blick in mein niedriges Zimmerchen, und vollends aus dem Fenster, versöhnte mich rasch mit dem Gedanken, dass dieses meine letzte Wohnung auf Erden sein sollte. Der altmodische Schreib-Sekretär mit den Messinggriffen sieht ganz so aus, als wäre er ein Zwillingsbruder von jenem, der im Zimmer meiner lieben Mutter stand, und der Lehnstuhl ist gerade so braun und hoch und schwer, wie der ihre war. Ein paar schlechte Bilder, die mich störten, habe ich gleich weggenommen, und die der Eltern dafür hingehängt. Nun ist mir’s, als wäre ich schon jahrelang hier zu Hause.
In der Ecke, auf einer Konsole von schwarzem Holz, ist ein Kruzifix angebracht. Es gibt mir oft zu denken, obwohl ich nicht damit groß geworden bin. – –
Nun habe ich auch meine Bücher bekommen, die mir der Vater nachgeschickt hat, nun fehlt mir nichts mehr. Er hat auch dazu geschrieben, ganz wie ich’s erwartete. Den Zug, sich ins Unabänderliche zu fügen, ohne sich zu sperren, habe ich von ihm. Von Ernst sechs Zeilen, er ist höchst vergnügt in der Pension mit seinen neuen Kameraden. Von der Mutter auch einen Gruß; wenigstens steht er im Brief. Der Vater wird ihn wohl ohne zu fragen hinzugefügt haben.
Nun will ich nach Hause schreiben; wie viel lieber tät’ ich es, wenn ich wüsste, dass die Briefe nur in Vaters Hände kämen!
Am 10. Abends.
Was es doch für seltsame Menschen gibt! Vor einer Stunde, als ich lesend und an nichts Arges denkend am Fenster sitze und mich an der milden Abendluft erquicke – denn die Sonne geht schon um 5 Uhr hinter den hohen Marlinger Berg, und dann ist es noch viele Stunden sommerlich warm, und die örtlichen Berghäupter stehen noch lange im Lichte – klopft es an meiner Tür, was mich immer erschreckt, da es so selten geschieht, und eine kleine, korpulente, mir völlig unbekannte Dame tritt herein, die sich ganz unbefangen mir vorstellt und aufs Herzlichste ihr Verlangen, mich kennen zu lernen, an den Tag legt. Sie habe mich auf der Wassermauer, die ich seit jenem ersten Male noch nicht wieder betreten, gesehen und ein großes Tendre1 für mich gefasst, da ich offenbar sehr krank und so allein in der Welt zu stehen schiene, und sich gleich vorgenommen, das nächste Mal mich anzureden, in der Hoffnung, mir vielleicht in irgend etwas nützlich zu sein. »Denn wissen Sie, liebes Kind«, sagte sie, »ich selbst, wie Sie mich da sehen, bin nun neunundfünfzig Jahre alt, aber nie einen Tag lang krank gewesen, außer im Kindbett. Meine zwei Söhne und drei Töchter sind auch alle, Gott sei Dank, kerngesunde Menschen, alle schon versorgt und verheiratet. Nun aber habe ich von früh an eine wahre Passion gehabt, armen Menschen, die nicht so gut daran sind, wie ich, zu helfen, Kranke zu pflegen, Sterbenden die letzten Liebesdienste zu erweisen. Mein seliger Mann nannte mich immer die privilegierte Lebensretterin; denn eine bessere Wärterin können Sie sich nicht denken. Ich bin noch aus einer Generation, wo man gar nicht wusste, was Nerven sind; da verschlägt es mir gar nichts, zehn Nächte hinter einander kein Auge zuzutun; selbst Operationen kann ich mit ansehen, ohne jede Anwandlung von Schwäche. Eben jetzt habe ich eine Freundin hieher begleitet, die es schwerlich lange mehr machen wird. Wenn die Ärmste erlöst sein wird, habe ich noch mehr freie Zeit, als jetzt, wo sie mich auch schon immer mit Gewalt nötigt, sie allein zu lassen, um mir Bewegung zu machen. Sollten Sie also irgend eine Stütze, einen Rat, eine Hilfe bedürfen, mein liebes Kind, so wenden Sie sich an Niemand anders, als an mich, das müssen Sie mir gleich aufs Feierlichste versprechen. Dass ich im Übrigen nicht zugeben werde, dass Sie ihre Tage so wie bisher mutterseelenallein hinbringen, versteht sich von selbst. Ich werde oft kommen, ich mache keine Umstände mit meinen Freunden, und Sie müssen mir’s schon zu Gute halten, wenn ich Sie etwas tyrannisiere, es geschieht Alles zu Ihrem Besten. Denn auf Nervenleiden verstehe ich mich, wie der beste Arzt; die wollen Zerstreuung, Luft, Anregung. Apropos, wen von den hiesigen Ärzten haben Sie konsultiert?«
Ich erwiderte, dass ich mich an keinen Arzt gewendet hätte, es auch nicht Willens sei, da ich genau wisse, dass ich unheilbar sei. Als sie ungläubig den Kopf schüttelte, holte ich das Blatt Papier aus meiner Mappe, auf dem unser Arzt mir wie auf einer Landkarte aufgezeichnet hat, wie weit die Zerstörung in meiner Lunge schon um sich gegriffen habe. Sie betrachtete es ganz sachverständig. Liebes Kind, sagte sie, das ist Alles dummes Zeug; ich kenne die Ärzte, je mehr sie sagen, je weniger wissen sie. Ich möchte eine Wette machen, dass es ganz anders in Ihnen aussieht, als auf diesem Stück Papier.
Ich sagte ihr, dass ich ja alle Hoffnung habe, hierüber klar zu werden, wenn ich auch für die Wette danken müsse, da ich sie doch leider nicht bei lebendigem Leibe gewinnen könne. Sie hörte nur halb zu, wenn ich sprach, fuhr aber eifrig fort, mit einer so kraftvollen Stimme, dass sie mir durch Mark und Bein drang, mir alle möglichen Krankheits-Geschichten, die sie erlebt und die gegen die Unfehlbarkeit der Ärzte zeugen sollten, mit Details zu erzählen, von denen mir endlich wirklich übel ward. Ich hatte noch so viel Mut und Besinnung, sie um Schonung zu bitten. Da stand sie endlich auf, machte beim Abschiede eine Bewegung, als wenn sie mich küssen wollte, schien offenbar befremdet, als ich steif und förmlich ihr nur die Fingerspitzen gab, und rauschte mit stürmischer Eile und der Versicherung, bald wiederzukommen, zur Tür hinaus.
Ich musste eine halbe Stunde die Augen schließen und still mein Blut wieder ebben lassen, als sie fort war. Aber ein scharfer Geruch von Essig-Äther, der sie umgab und den sie mir als sehr nervenstillend angepriesen hatte, ist noch jetzt im Zimmer, und immer muss ich die kalt zutraulichen Augen und die resolute unbewegliche Miene der Menschenfreundlichkeit in dem großen runden Gesichte vor mir sehen, und nur der Gedanke, dass ich wenigstens heute vor einem neuen Überfall sicher bin, ist mir ein Trost. Aber um das Tête-à-tête mit meinem Schicksale, das mir diesen Ort so heimlich machte, bin ich gebracht; ich müsste denn noch deutlicher werden, was ich selbst im Falle einer Notwehr kaum übers Herz brächte.
Was ist doch der Anteil der Menschen! Die Wenigen, die uns lieben, tun uns, wenn wir leiden, mit ihrem Mitgefühl weh, weil wir sehen, dass wir sie traurig machen; die uns nicht lieben, können die uns mit irgend etwas wohl tun? »Nur Bettler wissen, wie Bettlern zu Mute ist«, habe ich einmal im Lessing gelesen. Aber können Bettler einander Almosen geben?
Am anderen Morgen.
Schlecht geschlafen! Ich bin des Gesprächs mit Menschen so entwöhnt, dass ich immer die harte, helle Stimme der barmherzigen Dame hören und mich im Traum aufs Heftigste mit ihr zanken musste, bis sie mir zuletzt sogar ihre blonde Haartour mit den drei dünnen Löckchen auf jeder Seite ins Gesicht warf, dass ich ganz entsetzt und in Schweiß gebadet aufwachte. Nun muss ich freilich darüber lachen. Was habe ich ihr für unhöfliche Dinge gesagt, unter Anderem sogar, dass ich ihr meine Lunge in Spiritus vermachen würde! Ist man doch ungezogen im Traume!
Nun bin ich eilig in die Kleider gefahren und habe die größte Angst, dass sie mich wieder überfallen möchte. Mein armes, friedliches, kleines Sterbewinkelchen, dass es mir so verstört werden musste, dass ich auch hier keine Ruhe haben soll! Ich muss wirklich ausgehen, um zu sehen, ob ich draußen irgendwo einen sicheren Versteck ausfindig machen kann.
Am Nachmittage.
Ich habe große Dinge hinter mir, einen hohen Berg, ein Abenteuer mit einem wilden Mann, einen berauschenden Trunk Natur und Einsamkeit. Obwohl ich nun so müde bin, dass ich den Arm jedes Mal, wenn ich die Feder eintauche, mit einem besonderen Anlaufe meines Willens aufheben muss, bin ich doch innerlich neu gestärkt und habe die schlechte Nacht verwunden und getraute mir jetzt, es mit einer ganzen Kaffee-Gesellschaft barmherziger Schwestern in blonden Haartouren aufzunehmen.
Wie schön mein Grab ist, wie wunderbare Sonnenstrahlen darauf herniederfließen, habe ich längst zu wissen gemeint, und erst heute sind mir die Schuppen recht von den Augen gefallen. Ich glaube im Ernst, was wir im Norden Sonnenschein nennen, ist nur eine Imitation, eine billigere Mischung von Licht und Luft, so eine Art Goldbronze im Vergleich mit dem echten, soliden, unbezahlbaren Golde, das hier verschwendet wird.